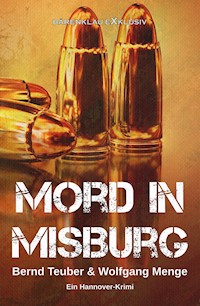3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Helga Wieberitz ist eine junge Frau, die sich gegen Geld mit Männern »vergnügt«, bis sie eines Nachts, nachdem sie mit einem Freier gegangen ist, spurlos verschwindet. Drei Monate später zieht die Küstenwache eine Frauenleiche aus dem Hafenbecken, die eindeutig ermordet wurde. Wer die Leiche ist, findet man rasch heraus, aber warum diese Frau sterben musste und wer für die Tat verantwortlich ist, war nicht so schnell zu beantworten. Kommissar Bohde leitet die Ermittlungen, die alles andere als einfach sind, denn vermeintliche Zeugen machen sehr widersprüchliche Aussagen, durch die sie in Verdacht geraten, selbst mit dem Mord in Zusammenhang zu stehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Wolfgang Menge
Die Tote im Hafenbecken
Ein Hamburg-Krimi
aus der Reihe »Im Netz des Verbrechens«
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Coverbild: © by Christian Dörge, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Weitere Romane von Wolfgang Menge sind ebenfalls erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung
Das Buch
Helga Wieberitz ist eine junge Frau, die sich gegen Geld mit Männern »vergnügt«, bis sie eines Nachts, nachdem sie mit einem Freier gegangen ist, spurlos verschwindet. Drei Monate später zieht die Küstenwache eine Frauenleiche aus dem Hafenbecken, die eindeutig ermordet wurde. Wer die Leiche ist, findet man rasch heraus, aber warum diese Frau sterben musste und wer für die Tat verantwortlich ist, war nicht so schnell zu beantworten. Kommissar Bohde leitet die Ermittlungen, die alles andere als einfach sind, denn vermeintliche Zeugen machen sehr widersprüchliche Aussagen, durch die sie in Verdacht geraten, selbst mit dem Mord in Zusammenhang zu stehen …
***
Der Autor Wolfgang Menge
Wolfgang Menge wurde 1924 in Berlin geboren. Er war Journalist und Drehbuchautor. Zwischen 1958 und 1968 schrieb er nahezu alle Drehbücher für die legendäre Fernseh-Krimiserie STAHLNETZ, die oft zu sogenannten »Straßenfegern« wurden. Einige davon wurden auch als Kriminalromane publiziert, wie dieser hier vorliegende.
Weiterhin schrieb er zahlreiche TATORT-Drehbücher. Aus seiner Feder stammt auch die satirische Familienserie EIN HERZ UND EINE SEELE mit Heinz Schubert als »Ekel« Alfred Tetzlaff in der Hauptrolle, welche deutsche Fernsehgeschichte schrieb. Er war bis ins hohe Alter tätig, bevor er 2012 in Berlin verstarb.
Die Edition Bärenklau legt einen Teil aus dem Nachlass des Autors neu auf und veröffentlicht seine Werke als eBook sowie als Printausgabe.
***
Diese Geschichte ist wahr. Sie hat sich so zugetragen, wie sie hier aufgezeichnet wurde.
Deshalb werden Sie auch keinen Detektiven von übermenschlichen Gaben begegnen, sondern Schritt für Schritt mit den Beamten der Mordkommission einer rheinischen Großstadt die Aufklärung eines Verbrechens verfolgen. Es ist nur aufgeschrieben worden, was die Ermittlungen der Beamten tatsächlich ergeben haben. Nur die Namen von Personen und Orten wurden geändert, um überlebende Zeugen und Unschuldige zu schützen.
Sie lesen kein Erzeugnis der Fantasie, sondern einen dramatischen Bericht von der Arbeit Ihrer Polizei.
Ihr Wolfgang Menge
1. Kapitel
Es war der 8. April. Seit dem frühen Morgen regnete es schon; in Hamburg, in Schleswig–Holstein, in Niedersachsen.
Es war abends, zwanzig nach sechs. Es war schon dunkel auf der Straße. Die Straßenbeleuchtung hatte sich gerade eingeschaltet.
Im Zimmer brannten zwei fünfundzwanzig Watt Birnen in der mit grüner Seide bespannten Deckenlampe und eine spärliche Nachttischlampe. Der Vorhang wurde in regelmäßigen Abständen sekundenlang von draußen angestrahlt; das war die Neonreklame vom Hippodrom, dem Hause gegenüber. Sie schien bis hierher in den zweiten Stock.
Auf dem Tisch stand ein halb geleertes Glas Bier, Butterreste, Brot, ein Taschenmesser. Nur die angebrochene Dose mit Ölsardinen stand zum Schutz der irgendwann einmal selbst gehäkelten Decke auf einer Untertasse. Alles andere hatte Helga einfach auf eine ausgebreitete Zeitung gestellt.
Das Bier war abgestanden, die Butter verschmiert, noch immer im Papier, in der sie gekauft worden war; in den Ölsardinen steckte ein Eierlöffel. Die Zeitung war voller Fettflecke.
Helga Wieberitz nahm das Glas, trank es leer, schüttelte sich. Sie war aufgestanden, um ihr Bett zu machen. Es war nicht ausgelüftet, sie legte die Decke auch ziemlich sorglos aufs Bett und strich sie nachlässig mit der rechten Hand glatt. Ich werde müde sein, wenn ich nach Hause komme, dachte sie, müde oder betrunken. Betrunken sogar bestimmt. Es schien, als lächle sie bei diesem Gedanken.
Aber sie sollte sich irren. Sie würde nicht müde sein, auch nicht betrunken. Um die Zeit, zu der sie sonst nach Hause kam, nach einer durchfeierten Nacht, um diese Zeit würde sie schon längst tot sein. Heute, am 8. April. Freilich konnte sie das nicht wissen. Kein Mensch konnte es wissen, jetzt, um zwanzig nach sechs. Nicht einmal dieser eine Mensch ahnte es, der Helga Wieberitz wenige Minuten vor Mitternacht umbringen würde. Nicht einmal dieser eine Mensch …
Es wäre auch höchst merkwürdig, wenn man so etwas im Voraus erfahren könnte. Es wäre in den meisten Fällen sogar gefährlich. Helga ahnte nichts, der Täter ahnte nichts. Schließlich ist es nicht üblich, dass man mit fünfundzwanzig schon stirbt. Älter war Helga nämlich nicht. Fünfundzwanzig Jahre, da fängt das Leben für viele erst an.
Vielleicht würden manche Menschen, die in der gleichen Stadt mit Helga lebten, in der gleichen Straße, im gleichen Haus etwa, Menschen, denen Helga irgendwann mal begegnet war, vielleicht würden manche von ihnen sagen, dass der Tod schon ganz gut für sie war. Schlimmer, einige von ihnen würden sagen, dass es für Helga noch besser gewesen wäre, wenn sie schon einige Jahre früher erlitten hätte, was ihr heute erst bevorstand, als Helgas Leben noch so verlief, wie man es von einem einundzwanzigjährigen Mädchen erwartet.
Damals, vor vier Jahren, heiratete Helgas Verlobter eine andere. Warum? Wir wissen es nicht. Der Verlobte sagte es uns nicht. Und Helga hatte selten darüber gesprochen. Die andere war nicht hübscher gewesen; auch hatte sie keinen reichen Vater – das hätte ja ein Grund sein können –, höchstens war diese andere etwas selbstbewusster als Helga. Nein, Helga konnte sich die Sache damals nicht erklären.
Aber seit diesem Tage, an dem ihr Verlobter – Albert hieß er übrigens – ihr eröffnete, dass er heiraten wolle, von diesem Tage an, schien Helga das Leben nichts mehr wert zu sein. Sie lebte dann auch so weiter, als habe sie nichts zu verlieren. Im Büro, in dem sie gearbeitet hatte, erschien sie nicht mehr. Sie schlief mit Männern, die sie kaum kannte. Sie begann zu trinken, bis sie abends nicht mehr nach Hause fand, solange sie nüchtern war.
Sie nahm sich ein anderes Zimmer, in St. Pauli, an der Großen Freiheit. So sparte sie sich die langen Fahrten in jenen Teil Hamburgs, wo man erst dann mit dem Tag anzufangen scheint, wenn die Lichter aufleuchten. Eines Abends wurde sie von einem Polizeibeamten aufgegriffen. Sie kam ins Krankenhaus, lernte dort andere Mädchen kennen, die aus dem Vergnügen ein Geschäft gemacht hatten, und als sie schließlich geheilt das Hospital verließ, trug sie einen neuen Ausweis in der Tasche, auf den sie nicht stolz zu sein brauchte. Mit diesem Ausweis musste sie zweimal in der Woche zum Arzt, der kontrollierte, ob sie in der Zwischenzeit gesund geblieben war.
Zuerst wollte sie in eine jener Straßen ziehen, deren Eingänge in Hamburg mit grau-gestrichenen Metallplatten verdeckt waren. Aber dann blieb es dabei, dass sie regelmäßig das gleiche Lokal besuchte, jeden Abend – die Tampico-Bar in der Großen Freiheit.
Hier fand sie genügend Kunden; Männer aus Chile, aus Burma, aus Norwegen, aus Australien, aus den Vereinigten Staaten, aus Japan. Wie es gerade kam. Hauptsache, sie konnten bezahlen. Helga verlangte, wenn die Wünsche im normalen Rahmen blieben, zehn Mark und konnte sich jeden Monat rund tausend Mark zurücklegen. Das Geld hatte sie auf dem Sparkonto einer Bank. Manchmal machte ihr das Leben sogar Spaß, dann wunderte sie sich, dass sie für eine Tätigkeit, die ihr so leichtfiel, noch obendrein Geld erhielt. Freilich ging der Spaß nie so weit, dass sie sich verliebt hätte.
An gewissen Tagen, zu bestimmten Stunden – besonders sonntags, wenn die Sonne ins Zimmer schien – hoffte sie auf einen, den sie heiraten könnte, dem sie Kinder schenken würde. Aber wenn mal so einer kam, dann merkte sie es nicht. Oder sie merkte es zu spät.
Helga warf ihren Morgenrock aufs Bett, ging an den Schrank, fischte sich, ohne lange zu suchen, ein Kleid heraus. Sie zog es noch nicht an, sondern stellte sich, so wie sie war, in Höschen, Strümpfen und bloßem Oberkörper ans Fenster. Sie schob den Vorhang beiseite und starrte eine Weile in den Regen hinaus, der ans Fenster schäumte.
Die Neonreklame von gegenüber warf nun in kurzen Abständen grelle Lichtbündel auf ihr Gesicht. Es war noch immer hübsch. Wer keinen Blick dafür hatte, würde sie noch immer für die Stenotypistin halten, die sie vor Jahren gewesen war. Die Haare dunkel, mit kurzen Locken, die in die Stirn frisiert waren, große Augen von einem etwas fahlen Blau, eine schmale, etwas zu kurze Nase, deren Spitze überdies noch ein wenig Vorstand. Vielleicht war sie um die Augen herum ein bisschen zu dunkel geschminkt. Doch im Licht der Tampico-Bar würde es nicht weiter auffallen. Außerdem finden selbst die so sicheren Teenager unserer Tage nichts dabei, die Umgebung ihrer Augen violett anzustreichen. Helga hatte an sich etwas von diesen jungen Mädchen. Und zum Schrecken anderer Prostituierter tauchte sie sogar in Jeans und Pullover, der Teenageruniform, in der Tampico-Bar auf.
Die Kolleginnen waren besonders ärgerlich, als sie merkten, dass manchen Männern dieser Aufzug eher gefiel als die üblichen Kleider mit unangenehmen Ausschnitten. Allerdings gab Helga solche Extravaganzen wieder auf, weil manche Männer sich eher betrogen fühlten. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass der kleine Spaß im Bett einer der zahllosen Pensionen außer der Zimmermiete noch Geld kosten sollte. Sie hatten Helga für eines der Mädchen gehalten, die ja auch tatsächlich, aus reinem Spaß an der Sache, in den Bars von St. Pauli ihre Abende verbringen – nicht nur in St. Pauli übrigens.
Helga ließ den Vorhang los, ging noch einmal an den Schrank, öffnete die zweite Tür und holte einen knallroten Büstenhalter heraus. Als man sie später fand, war dies übrigens das einzige Kleidungsstück, das sie noch am Leibe trug.
Als sie den Büstenhalter mühsam zugehakt hatte, umgedreht, die Arme durch die Träger gewunden, schlüpfte sie in das Kleid, holte die Handtasche vom Nachtschrank, steckte eine angebrochene Schachtel Zigaretten hinein, nahm Schirm und Regenmantel von einem Kleiderhaken neben dem Bett und schaute kurz auf das Bild von Albert, das noch immer auf dem Nachttisch stand, beachtete es aber nicht weiter.
Dann öffnete sie die Zimmertür vorsichtig, schloss sie genauso, zum letzten Mal in ihrem Leben.
Schnell wollte sie über den Korridor zur Haustür, aber die Wohnungsinhaberin, Frau Bertram, hatte schon hinter der angelehnten Küchentür auf sie gelauert.
Frau Bertram wollte gerade den Mund öffnen, um etwas zu sagen, da legte Helga schon los: »Es stinkt hier nach Weißkohl, Frau Bertram.«
»Wenn ich Weißkohl koche, kann es nicht nach gebratenen Enten duften.« Frau Bertrams Stimme klang scharf und dünn. Selbst wenn sie betete – was sie jedoch seit ihrem zwölften Lebensjahr niemals mehr getan hatte –, musste sie wirken wie ein Marktweib, das man gerade um einen Groschen betrogen hat.
»Ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, was wir heute für’n Tach haben, Fräulein?«
»Einen Regentag. Ist ja auch April«, erwiderte Helga kurz und wollte die Haustür öffnen.
»Heute haben wir den Achten, Fräulein Wieberitz.«
»Danke, ich hab’ selbst einen Kalender.«
»Dass Sie einen Kalender haben, glaub’ ich gern.« Frau Bertram schob plötzlich ihr Rattengesicht ganz dicht an Helgas Hals, sie war einen Kopf kleiner als Helga. »Aber haben Sie auch die Miete?«
»Sie haben noch immer Ihre Miete gekriegt, oder?«
»Nachdem ich Sie jeden Monat zwanzig Mal dran erinnern musste.«
»Ja, ich weiß, auf den Knien haben Sie vor mir gelegen. Überhaupt – hundertzwanzig Mark für diesen Stall …« Helga nahm ihre Handtasche hoch, öffnete sie und begann darin herumzukramen.
»Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja sofort ausziehen. Solche wie Sie finde ich jeden Tag!« Frau Bertram schob ihre Hände in die Schürzentasche und versuchte in Helgas Handtasche hineinzuschielen.
»Zu Hunderten, ja, ich weiß. Die stehen draußen schon Schlange. Weil das Zimmer so schön ist, die Wirtin so freundlich, die Miete so niedrig …«
»Außerdem ist das wohl meine Sorge! – Also, wenn Sie nicht bezahlen …«
Helga hatte einen Geldschein aus der Tasche genommen und gab ihn, zerknüllt, wie er war, Frau Bertram: »Ja, ja, ja. Hier sind erst mal fünfzig Mark. Den Rest kriegen Sie morgen. Oder übermorgen.«
»Besser ist morgen, Fräulein. Außerdem kriege ich noch eins zwanzig; die hab’ ich für Sie beim Briefträger ausgelegt.«
»Das haben Sie mir schon zehnmal vorgebetet.«
»Wenn Sie mir das Geld gegeben hätten, wär’ ich schon ruhig gewesen.«
»Ach, ist ja gut.« Helga schlug die Haustür hinter sich zu und ging langsam, etwas ärgerlich und müde die Treppen hinunter. Auf der Straße spannte sie den Schirm auf, blieb einen Moment noch im Hauseingang stehen, als wolle sie wieder umkehren, dann verschwand sie nebenan im Kolonialwarengeschäft.
Im Laden war niemand. Die Rollläden hatte der Krämer schon heruntergelassen, die Hauptbeleuchtung war ausgeschaltet. Helga sah sich um; da kam Krause, der Besitzer des Ladens, aus den hinteren Räumen: »Bisschen spät, was?«
»Ich will auch heute nichts mehr kaufen«, sagte Helga. »Das wird wohl noch erlaubt sein.«
»Was?«
»Ich meine, was zu bestellen.«
»Für morgen?«
»Ja, ich krieg’ Besuch.«
»Und was haben Sie sich gedacht?«
»’n bisschen was Besonderes.«
»Was Besonderes? Bei mir? Wir sind ja nun nicht in Harvestehude. Da kriegen Sie Kaviar und so. Aber …«
»Das will ich gar nicht. Irgendwas, was man eben nicht jeden Tag isst.«
»Meine Frau, die nimmt ja, wenn Besuch kommt, einfach immer Salami und ’n Stück Schweizer obendrauf und dann noch ’n Stück Senfgurke.«
»Na gut. Und dann noch was zu trinken.«
»Was bevorzugt denn der Herr. Vielleicht einen Mosel?«
»Es ist kein Herr. Meine Mutter …«
»Na, dann Likör?«
»Gut, also eine Flasche Likör, oder besser ’ne halbe. Denn ich trink’ das Zeugs doch nicht. Das ist dann alles.«
»Und rumschicken soll ich es wohl auch noch?«
»Allerdings. Aber nicht vor zwölf Uhr.«
»Ach ja, die Dame schläft ja bis zwölf.«
»Bis halb zwölf, mein Süßer.« Helga nickte nur und ging dann, während Herr Krause die Bestellung in ein schwarzes Vokabelheft eintrug.
2. Kapitel
Die Tampico-Bar ist ein Tanzlokal am Hamburger Hafen. Es gibt ein paar tausend dieser Sorte, in Hongkong, Bombay, Kobe oder Baltimore. Diese Bar steht in Hamburg, aber sie unterscheidet sich nur in Kleinigkeiten von ihren ausländischen Geschwistern, eigentlich nur in der Währung.
Hier ist nichts umsonst. Das erwartet auch niemand. Drei Mann spielen auf einem Podium, Studenten, die sich nebenbei Geld verdienen müssen. Wenn sie acht Stunden ihre altertümlichen Instrumente geschunden haben, kriegen sie kaum mehr Geld, als die Damen des Etablissements für eine Stunde Spaß erhalten. Ruhepausen gibt es nicht. Wenn die Studenten sich zurückziehen, donnert schon eine Musikbox los. An den Wänden, die vom Maurer gleich mitgemalt wurden, winden sich Damen in ernüchternder Nacktheit, von der der Wirt annimmt, dass sie Erotik ausstrahlt. Zu Unrecht.
Die männlichen Gäste wechseln hier täglich. Die weiblichen sind immer da, über Jahre hinweg. Sie sind deshalb auch keine Gäste, sie gehören zum Inventar.