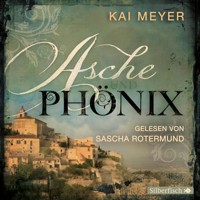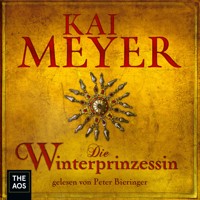12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geheimnisse des Graphischen Viertels
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Kai Meyer erschafft eine meisterhafte Melange aus Historie und bibliophiler Schauergeschichte Baltikum, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Tiefer Schnee und endlose Wälder schneiden ein Herrenhaus von der Welt ab. Hierher reist die junge Lektorin Paula Engel aus Leipzig, um das Manuskript des Schriftstellers Aschenbrand einzusehen. Paula und ihr Verlobter Jonathan begegnen einem faszinierenden Exzentriker, der ein dunkles Mysterium wahrt. Leipzig, 1933. Im legendären Graphischen Viertel rettet der von den Nazis entlassene Kommissar Cornelius Frey einem Mädchen das Leben. Bei ihrem Abschied flüstert sie »Sie weinen alle im Keller ohne Treppe«. In der nächsten Nacht liegt sie ermordet neben einem toten Polizisten. Auf der Spur des Mörders kämpft Cornelius sich zurück in seinen alten Beruf und stößt auf ein Netz aus Okkultisten und Verschwörern, Freimaurern und Fanatikern. In welcher Verbindung standen sie zu Paula und Jonathan, die vor zwanzig Jahren spurlos im Baltikum verschwanden? Kai Meyer erzählt erneut von den Geheimnissen des Graphischen Viertels, dem nebelverhangenen Herz der Bücherstadt Leipzig. Lesen Sie auch die anderen Teile der historischen Roman-Reihe»Die Geheimnisse des Graphischen Viertels«. Alle Teile sind unabhängig voneinander lesbar. - Die Bücher, der Junge und die Nacht - Die Bibliothek im Nebel »Atmosphärisch dicht geschrieben und mit vielen zeithistorischen Elementen gespickt, fesselt Kai Meyer mit einer hochspannenden Erzählung.« Passauer Neue Presse über Die Bibliothek im Nebel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kai Meyer
Das Haus der Bücher und Schatten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Baltikum, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Tiefer Schnee und endlose Wälder schneiden ein Herrenhaus von der Welt ab. Hierher reist die junge Lektorin Paula Engel aus Leipzig, um das Manuskript des Schriftstellers Aschenbrand einzusehen. Paula und ihr Verlobter Jonathan begegnen einem faszinierenden Exzentriker, der ein dunkles Mysterium wahrt.
Leipzig, 1933. Im legendären Graphischen Viertel rettet der von den Nazis entlassene Kommissar Cornelius Frey einem Mädchen das Leben. Bei ihrem Abschied flüstert sie »Sie weinen alle im Keller ohne Treppe«. In der nächsten Nacht liegt sie ermordet neben einem toten Polizisten. Auf der Spur des Mörders kämpft Cornelius sich zurück in seinen alten Beruf und stößt auf ein Netz aus Okkultisten und Verschwörern, Freimaurern und Fanatikern. In welcher Verbindung standen sie zu Paula und Jonathan, die vor zwanzig Jahren spurlos im Baltikum verschwanden?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Das Graphische Viertel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Das Graphische Viertel
Im frühen 20. Jahrhundert gab es in der alten Literaturstadt Leipzig über zweitausend Betriebe, die von der Herstellung und Verbreitung von Büchern lebten – Verlage, Druckereien, Buchbindereien, Schriftsetzereien und eine große Zahl Buchhandlungen und Antiquariate, zuweilen bis zu zweihundert.
Die meisten dieser Betriebe waren in einem Stadtteil östlich der historischen Innenstadt angesiedelt: dem Graphischen Viertel.
Eingehüllt in einen ewigen Nebel – in Wahrheit der Smog der Dampfmaschinen –, zusammengesetzt aus neugotischen Schmuckfassaden und ziegelbraunen Fabrikbauten, beschaulichen Buchläden und brutaler Zweckarchitektur, hat es einen solchen Ort nirgends auf der Welt ein zweites Mal gegeben.
Bei einem Luftangriff im Dezember 1943 wurde das Graphische Viertel fast vollständig zerstört.
1
1933
Die Stadt war ins Gespenstische entrückt.
Im Morgengrauen wanderte er durch die Nebelflüsse auf menschenleeren Straßen und las zwischen den Zeilen des Viertels. Vor seinem inneren Auge öffneten sich die Fassaden wie Buchdeckel, um in entlarvenden Kapiteln all die Wahrheiten zu enthüllen, die selbst Sterbenden nicht über die Lippen gekommen wären.
Er kannte diese Häuser, diese Plätze, das Graphische Viertel seit seiner Kindheit. Und er verwitterte mit ihnen, bekam die gleichen Furchen wie die Steingesichter der Statuen, den missbilligenden Blick der Mythenwesen, die von Torbögen und Dachgiebeln herab in die Gassen starrten.
Als er das Mädchen fand, das durch die Bücher sterben wollte, war er tief in Gedanken.
Die Einsamkeit ist ein Land voller Menschen, hatte jemand gesagt. Oder war ihm das selbst eingefallen? Die Vorstellung hatte etwas Verlockendes – ein Landstrich, in dem sich alle versammeln, die immer allein gewesen sind –, aber er machte sich nichts vor: Das Bild hatte nichts mit der Wirklichkeit gemein. Die Einsamkeit war hier, zwischen diesen Häusern, an der Grenze von Nacht und Morgen, und ihr Klang war der trostlose Schlag seiner Schritte auf dem nebelfeuchten Pflaster.
Er war zweiundvierzig, nicht allzu alt aus der Sicht des Zweiundvierzigjährigen, aber er hatte das Gefühl, als hätte er schon die Zielgerade erreicht. Immerhin aufrecht und mit einem Rest Würde. Nur dass es die Wut war, die ihn aufrecht hielt, und die Würde kostete ihn Tag für Tag mehr Kraft als das Leben selbst. Bis vor ein paar Monaten hatte er einen guten Beruf gehabt, einen, den er mochte und beherrschte, doch den hatten sie ihm genommen. Polizeikommissar. Ist man Anstreicher, kann man weiter Wände streichen, auch wenn sie einen vor die Tür setzen. Nimmt man einem Kommissar seinen Posten, bleibt nicht viel von ihm übrig.
Darum tat er nun etwas anderes: Er bewachte die Bücher. Seit ein paar Wochen war er Nachtwächter in der Deutschen Bücherei, einem Tempel der Literatur, mit Säulen und Sälen, mit wuchtigen Treppen und steinernen Friesen. Die Bibliothekare verwahrten dort jeden Titel, der draußen im Land geschrieben, gedruckt und vertrieben wurde. Die Deutsche Bücherei war nicht das schlagende Herz der Bücherstadt Leipzig, eher ihr Grabmal zu Lebzeiten, in dem Schweigen gefordert und bewahrt wurde; tagsüber in den Lesesälen und erst recht im Dunkeln, wenn Nachtwächter wie Cornelius Frey durch die Korridore und Hallen und übervollen Bücherlager zogen.
Gerade kam er von dort, nach Stunden in der Stille zwischen den Regalen. Er liebte auch die Ruhe hier draußen, die verlassenen Straßen und hallenden Gassen, und wenn er dabei über Einsamkeit nachdachte, dann färbte eher die Stimmung des dämmerigen Morgens auf sein Gemüt ab, als dass er selbst sich einsam fühlte. Er mochte das Alleinsein in diesen Stunden, denn nur um diese Zeit, kurz vor Beginn der Frühschicht in den Buchfabriken und ehe die Stadt ihre Träume abschüttelte, war für gewöhnlich weit und breit niemand zu hören, niemand zu sehen.
Das Mädchen stand auf der Brücke, auf der die Riebeckstraße die Gleise zum Eilenburger Bahnhof überquerte. Verloren hielt sie sich von außen an dem schmiedeeisernen Geländer fest, ganz in Schwarz, das Gesicht ins Leere gewandt, die Hände um den Handlauf hinter ihrem Rücken geklammert. Allzu tief war der Abgrund nicht. Den Sturz allein hätte sie wohl überlebt, mit gebrochenen Beinen und zerschmettertem Rückgrat, aber sie hatte etwas anderes vor.
Im Nebel, der den Bahnhof am Ende der Schienen verbarg, glommen die Lichter eines herankommenden Güterzuges, der wie jeden Tag die frisch gedruckten Bücher des Graphischen Viertels stadtauswärts trug, hinaus in die Buchhandlungen im ganzen Land. Das Mädchen schien abwarten zu wollen, bis der Zug fast heran war, um sich dann von hier oben aus davorzuwerfen. Sobald der schwarze Qualm der Lokomotive die gesamte Brücke einhüllte, würde es vorüber sein, begleitet vom Kreischen der Bremsen, die den Zug erst auf der anderen Seite zum Stehen brächten.
Cornelius rannte los und hoffte, dass der Lärm des heranrollenden Ungetüms seine Schritte übertönte. Selbst von Weitem konnte er die Anspannung erkennen, unter der das Mädchen stand, das Weiß ihrer Finger am Eisengeländer, die gespreizten, nach hinten gebogenen Arme, die hervorgetretenen Sehnen an ihrem Hals. Er meinte, sie hastig atmen zu hören, vielleicht, weil er schon andere in solchen Situationen erlebt hatte und wusste, wie ein Mensch klang, kurz bevor er starb.
Die Lichter des Zuges kamen näher, die Nebelwand wogte, und jeden Moment würde die Lokomotive daraus hervorbrechen, schnaubend und stinkend, mit Stahlgeschrei. Wind schlug ihm ins Gesicht. Das dunkle Haar des Mädchens wurde von den Schultern gehoben und flatterte wild in seine Richtung. Nur noch wenige Herzschläge, dann würde er danach greifen können, aber falls sie wirklich fiel, konnte er sie daran nicht festhalten. Er musste sie sicher zu fassen bekommen, am besten von hinten um den Brustkorb, und plötzlich hatte er entsetzliche Angst, dass sie ihn auf den letzten Schritten bemerken und sich fallen lassen würde, keine Handbreit von seinen Fingerspitzen entfernt.
Sie wirkte sehr zerbrechlich, wie sie so dastand und dem herandonnernden Tod entgegenblickte. Gleich würde Cornelius bei ihr sein, um sie zu packen und nach hinten über das Geländer zu ziehen.
Doch er hatte nicht mit der brutalen Gewalt des Windes gerechnet, die den Qualm aus dem Schlot der Lokomotive wie eine Riesenfaust aus dem Nebel in seine Richtung rammte. Er hatte das Mädchen noch nicht berührt, als die stinkende Schwärze über den Rand der Brücke quoll und sie beide einhüllte. Von einem Atemzug zum nächsten sah er nichts mehr, stieß blind beide Arme nach vorn und versuchte, etwas zu packen zu bekommen, irgendetwas, notfalls auch ihr Haar. Aber seine Finger griffen ins Leere, erst ein-, dann zweimal. Um ihn war es stockdunkel, er bekam kaum Luft in all dem Kohlegestank, und womöglich war sein eigener Schwung genug, um ihn gegen das Geländer und darüber hinwegzutragen.
Er ließ die Arme vor sich zuschnappen wie eine Zange. Sie schnitten durch den schwarzen Qualm, trafen auf Widerstand, schlossen sich um einen schmalen Oberkörper und klammerten sich daran fest, wobei ihm das Geländer zwischen ihnen den nötigen Halt gab. Sie schrie auf, nur ganz kurz und leise, und er spürte keinen Widerstand, kein Gestrampel, nur das rhythmische Beben der Brücke, während unter ihnen die Güterwaggons voller Bücher vorüberlärmten, zehn oder noch mehr, bis der Qualm endlich fort war und Cornelius wieder etwas sehen konnte, einen Wirbel im Haar an ihrem Hinterkopf, ihren Umriss, halb zerfasert im gelblichen Dunst des Graphischen Viertels.
Ohne ihren Protest abzuwarten, zog er sie nach hinten über die Brüstung, und dann standen sie nebeneinander, lehnten schwer atmend am rostigen Geländer und blickten über die Fahrbahn hinweg dem Zug nach, dessen Ende sich im Nebel davonschlängelte wie ein Lindwurm im Rauch einer brennenden Heide.
»Das war dumm«, sagte er, ohne sie anzusehen.
Ihr Atem überschlug sich, aber sie rührte sich nicht von der Stelle. »Sagt wer?«
»Der Idiot, der fast hinter Ihnen hergefallen wäre.«
Sie wandte ihm den Kopf zu. »Sie haben den Qualm unterschätzt.«
»Als hätten Sie sich darüber vorher Gedanken gemacht.«
»Hab ich. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier.«
Wut stieg in ihm auf. »Sie machen das öfters?«
»Heute wäre ich gesprungen. Vielleicht tu ich’s morgen.«
»Ach, geh’n Sie zum Teufel«, sagte er und wollte sie stehen lassen. Aber etwas hielt ihn davon ab. Es würden noch viele Züge kommen an diesem Tag, genug Züge für ein paar Dutzend Selbstmordversuche, doch sie hatte morgen gesagt. Vorerst mochte sie sicher sein, vor sich selbst und dem, was in ihren Gedanken spukte. Trotzdem ließ ihn die Sorge nicht los.
Aus der Nähe betrachtet, ohne den schwefeligen Nebelschleier zwischen ihnen, wirkte sie nicht mehr wie ein Kind, aber auch noch nicht allzu erwachsen.
»Wie alt sind Sie?«, fragte er.
»Neunzehn.«
»Sie sehen jünger aus.«
Sie hob die Schultern und machte etwas mit ihren Lippen, das wie eine alberne Schnute aussah. Das nahm er ihr übel, weil sie sich die Kindchennummer gefälligst für jemanden aufheben konnte, der anfälliger dafür war als er. Dabei war sie hübsch, auf eine zerzauste, abgelebte Weise, die ihn vor zwanzig Jahren erschreckt hätte, heute aber ein alltäglicher Anblick war. Sie musste als Kind die große Hungersnot während des Krieges miterlebt haben, dann die Verarmung während der Zwanziger und deren Nachbeben bis zum heutigen Tag. Wahrscheinlich gehörte sie nicht zu denen, die ihre Hoffnung in das neue Regime in Berlin setzten, denn wer Hoffnung hatte, warf sich nicht vor Züge. Jedenfalls nicht in Cornelius’ Regelbuch des Freitods, das auf einer Menge persönlicher Erfahrungen beruhte. Erfahrungen als Polizist, aber auch als jemand, der selbst schon am Abgrund gestanden hatte, unentschlossen wie sie, bis sein gesunder Menschenverstand und eine Musiklehrerin namens Felicie ihn überzeugt hatten, dass seine Selbstmordgedanken in erster Linie Selbstmitleid waren. Und aus Selbstmitleid zu sterben erschien ihm dann doch ziemlich lächerlich, nachdem er Gasangriffe auf Schlachtfeldern und den Siegeszug des Lindy Hop in den Tanzschuppen überstanden hatte.
»Ihr Name?«, fragte er.
»Ihr Name!«, ahmte sie ihn mit verstellter Stimme nach. »Was sind Sie? ’n Wachtmeister?«
»Nur ein Nachtwächter.«
»Natürlich. Man denkt, man erwischt die allerbeste Zeit, um ungestört zu sein, und prompt kommt ein verdammter Nachtwächter vorbei.« Sie seufzte. »Nichts für ungut.«
»Ich hab auch nicht wirklich erwartet, dass Sie mir dankbar sind.«
Sie schwieg einen Moment und ließ ihn dabei nicht aus den Augen. »Undine«, sagte sie dann.
»So heißen Sie?«
»Undine Malatesta.«
»Kein Mensch heißt so«, sagte er kopfschüttelnd. »Nicht in Leipzig.«
»Undine muss reichen. Und wie heißen Sie?«
Ihm lag eine sarkastische Bemerkung auf der Zunge, aber einer von ihnen musste ja den Erwachsenen geben, also sagte er die Wahrheit: »Cornelius Frey.«
»Cornelius«, sagte sie langsam. »Sie waren nicht immer Nachtwächter, oder? Was haben Sie verbrochen, dass man Sie rausgeschmissen hat?«
Er drehte sich zur Seite, lehnte aber weiterhin am Geländer. Seine Knie fühlten sich an wie Brei, und er wollte nicht, dass sie ihn schwanken sah. Offenbar hatte ihn die Sache mehr mitgenommen als sie. Vielleicht war er doch ganz gut aufgehoben in seinem neuen Leben, besser als bei der Polizei.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagte er. »Sie verraten mir, was Sie auf die Schnapsidee gebracht hat, sich von einer Lok über die Schienen schmieren zu lassen, und ich erzähle Ihnen, was immer Sie wissen wollen.«
»Ich hab mitangesehen, wie ein Mensch den Verstand verloren hat«, sagte sie, ohne zu zögern. »Und ich glaube, ich war schuld daran.«
Er dachte, dass es vielleicht um ihre Mutter oder ihren Vater ging. »Selbstmord aus schlechtem Gewissen? Sind Sie immer so pathetisch?«
»Jetzt ich«, entgegnete sie unbeirrt. »Warum sind Sie Nachtwächter geworden? Nicht freiwillig, stimmt’s?«
»Ich war wirklich mal Polizist. Kommissar. Im Februar hab ich den Mord an sechs Menschen im Naundörfchen untersucht, in einer Kaschemme namens Rote Lotte.«
Das Naundörfchen war ein überbevölkerter Stadtteil im Westen der Innenstadt, Leipzigs letztes Gassenlabyrinth aus dem Mittelalter, ein Irrgarten aus schimmelnden Bruchbuden und zweifelhaften Etablissements, begrenzt von Kanälen, die an den Fundamenten der uralten Häuser nagten. Nicht Cornelius’ übliches Einsatzgebiet, aber man konnte sich seine Morde nicht aussuchen.
»Gleich sechs Tote.« Ihr Atem beruhigte sich allmählich. »Alle Achtung.«
»Die Besitzerin der Kneipe und fünf Männer von der SA. Vorher hatten die Kerle dort alles kurz und klein geschlagen.«
»Autsch.«
»Man war der Meinung, ich hätte mich nicht genug ins Zeug gelegt, um die echten Mörder zu finden.«
»Wer waren denn die falschen?«
»In der Direktion wollten sie, dass ich Kommunisten verhafte, möglichst schnell und möglichst viele. Aber die das getan haben, waren keine Kommunisten.« Er hätte ihr erklären können, dass die Nationalsozialisten eine Menge Bars und Bordelle in den Großstädten unter ihre Kontrolle gebracht hatten, um dort blonde, blauäugige Frauen zur Erbauung der eigenen Leute zu beschäftigen. Das führte zu Revierkämpfen mit den angestammten Luden und Puffmüttern, manchmal auch zu Toten. Stattdessen sagte er: »Keiner wollte die Wahrheit hören. Also musste ich gehen. So ist das heutzutage.«
Sie runzelte die Stirn. »Klingt nach einem vorgeschobenen Grund. Sie haben bestimmt noch mehr Mist gebaut, geben Sie’s zu.«
»Sie stehen ja auch nicht nur hier auf der Brücke, weil irgendwer irre geworden ist, oder?«
Für einen Moment schien ihr Gesicht zu zerbrechen und in Scherben auf dem Pflaster zu zerschellen. In Windeseile hatte sie ihre Mimik wieder im Griff, doch er hatte es gesehen, ganz deutlich sogar. Eine Menge unverheilter Narben.
Kühl fragte sie: »Sind wir hier fertig für heute Nacht?«
»Sagen Sie es mir.«
»Mir ist die Lust auf Tod fürs Erste vergangen.«
Er verschränkte die Arme. »Leute, die Lust und Tod in einem Satz erwähnen, sind mir normalerweise suspekt.«
Das brachte sie kurz zum Lächeln. »Wenn Sie wüssten.«
Hätte er nicht über zwanzig Jahre lang Einblick erhalten in das Uhrwerk der Welt und alles, was sich darin verhaken konnte, hätte er sie für eine dieser naiven jungen Gören gehalten, von denen man in Büchern las: ein Fräulein in Nöten, das aus Liebeskummer schreckliche Fehler beging. Aber er wusste es besser. Naive junge Gören gab es nicht mehr, falls sie überhaupt je existiert hatten, und die hier war weiter davon entfernt als der Eilenburger Bahnhof von der Waterloo Station. Er sah es in ihren dunklen Augen, den schattenhaften Ringen darunter, und er hörte es an der Art, wie sie sprach. Nicht an den Worten – die gehörten nur zu der Rolle, die sie für ihn spielte –, sondern am Klang ihrer Stimme. Da war etwas Brüchiges, Versehrtes in ihrem Timbre, das gewiss keine Folge von Liebe war, wohl aber von Kummer.
Von Süden her näherten sich die Lichter eines Fahrzeugs, das erste seit einer Ewigkeit. Dass es keiner der Lastwagen war, die am ehesten so früh am Tag über Pflaster und Tramschienen holperten, konnte er bald erkennen, und dann sah er das Taxischild. Er winkte dem Fahrer zu.
»Sie fahren jetzt nach Hause«, sagte er zu dem Mädchen.
»Nach Hause«, wiederholte sie leise.
»Sie haben doch eins? Ein Zimmer, irgendwo?«
»Ja, ja.«
Er hätte sie gern an den Schultern gepackt und ihr einen kleinen Vortrag gehalten wie den Straßendieben, die das manchmal brauchten. Doch er sah ihr an, dass sie gerade anderes nötiger hatte als eine Predigt von einem wildfremden Mann, der sich anmaßte, ihr das Leben nicht nur zu retten, sondern womöglich sogar zu erklären. Sie hätte wahrscheinlich so was gesagt wie »Jetzt keine Klugscheißerei«, und insgeheim hätte er ihr recht geben müssen. Sie brauchte keine salbungsvollen Worte, nur ein warmes Bett und jemanden, der ihr eine heiße Brühe kochte. Und das konnte nicht er sein.
»Falls Sie noch mal Hilfe brauchen, dann wissen Sie, wo Sie mich finden«, sagte er.
»In der Nacht«, erwiderte sie. »Bei den Büchern.«
Das schwarze Taxi hielt an. Der Fahrer drückte eine Zigarette aus, am Armaturenbrett klemmte eine Packung Trommler. Cornelius kannte ihn, so wie fast alle Taxifahrer im Viertel. Der Mann hob grüßend die Hand, als er sah, wer da am Straßenrand stand. Kurzes Stirnrunzeln, während er überlegte, wie er Cornelius ansprechen sollte. »Der Herr Kommissar. Guten Morgen.«
Das Lächeln des Mädchens war so dünn wie die Nebelschwaden zwischen ihnen. »Sehen Sie?«, sagte sie leise. »Alles wird gut.«
»Sagen Sie ihm, wohin Sie wollen.«
»Ich hab kein Geld.«
Durchs Fenster steckte Cornelius dem Fahrer einen Schein zu. »Wohin sie will.«
»Selbstverständlich, der Herr, die Dame.«
Cornelius hielt ihr die Tür auf und wartete, dass sie einstieg. Sie tat es nach kurzem Zögern, nickte ihm im Vorbeigehen zu, roch dabei nach Ruß und Seife, und setzte sich auf die Rückbank. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, öffnete sie das Fenster einen Spaltbreit, suchte seinen Blick und bewegte tonlos die Lippen.
Er beugte sich vor. »Was haben Sie gesagt?«
Sie presste das Kinn gegen den Rand der Scheibe, bis es geisterhaft weiß war, und flüsterte etwas, das er nicht mehr vergessen sollte:
»Sie weinen alle im Keller ohne Treppe.«
Dann gab sie dem Fahrer einen Wink.
Cornelius machte einen Schritt zurück. Das Taxi setzte sich in Bewegung, rollte über die Brücke davon und verblasste im Nebel. Nachdem er sicher war, dass sie ihn nicht mehr sah, trat er ans Geländer, beugte sich darüber und erbrach sich hinab auf die Schienen.
Vom Bahnhof her näherte sich der nächste Bücherzug.
2
In der folgenden Nacht, um kurz vor eins, drehten Cornelius und sein Nachtwächterkollege Adams ihre zweite Runde durch die Hallen und Gänge der Deutschen Bücherei.
»Zwanzig Jahre«, sagte Adams, und er sagte es wohl auch zum zwanzigsten Mal, seit Cornelius ihn kannte. »Gerade mal zwanzig Jahre, und schon platzt der Kasten aus allen Nähten.«
Cornelius nickte stumm, um die Weisheit seines Begleiters nicht infrage zu stellen. Schweigende Zustimmung hatte sich als das beste Mittel erwiesen, um Adams’ Anfälle von eiferndem Furor zu verkürzen.
»Die haben das so geplant, weißt du?«, fuhr Adams fort. »Denen war vollkommen klar, dass die Bude schon bald zu klein sein würde für all die Bücher. Sag du mir, warum sie sie nicht gleich doppelt so groß gebaut haben. Platz ist doch genug.«
Damit zumindest hatte er recht. Die Deutsche Bücherei lag an der Straße des 18. Oktober, einer Gedenkallee, die das Völkerschlachtdenkmal mit dem Neuen Rathaus verband. Dass das letzte Stück dieser Achse ausgerechnet durch die Windmühlenstraße führte, vorbei an schillernden Nachtbars und Filmtheatern, hatte man zähneknirschend in Kauf genommen. Die Bücherei aber befand sich ein gutes Stück weiter draußen, nicht weit vom Denkmal entfernt, und rundum gab es genügend freie Flächen für all die Anbauten, die man von Anfang an eingeplant hatte. Der erste sollte im nächsten Jahr entstehen und Platz für Millionen weiterer Bücher schaffen. Cornelius erschien diese schrittweise Vergrößerung vernünftig, doch Adams war ein Anhänger einer Alles-und-sofort!-Theorie, die er als Lebensphilosophie verinnerlicht hatte.
»Zeitverschwendung«, rief er in den hallenden Korridor, »und Geldverschwendung! Hätten sie alles schon vor zwanzig Jahren gebaut, hätte das eine Menge Steuergeld gespart. Jeder weiß doch, dass die Preise steigen. Nichts auf der Welt wird plötzlich billiger, schon gar keine Großbaustelle.«
Adams, Mitte dreißig, war so groß wie Cornelius und kräftig wie ein Jahrmarktsboxer. Als ihm ein Engländer im letzten Kriegsjahr ein Bajonett durch beide Wangen gestoßen hatte, war er fast noch ein Kind gewesen. Fünfzehn Jahre später trug er die Narben mit dem lässigen Stolz eines Mannes, dem kein Messer mehr Angst einjagen konnte. Weil die Klinge wie durch ein Wunder seine Zunge verfehlt hatte, gab es nichts, das ihn daran hinderte, Nacht für Nacht einen Großteil der Konversation zu bestreiten.
Cornelius hätte es vorgezogen, die Rundgänge allein zu erledigen, aber sie hatten die Anweisung erhalten, sich nur noch paarweise auf den Weg zu machen. Als Cornelius Adams zum ersten Mal begegnet war, hätte er seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sein neuer Kollege im Leben noch kein Buch gelesen hatte. Darin jedoch hatte er sich getäuscht. Adams las sogar eine Menge, nichts allzu Tiefgründiges, aber doch so manches, das Cornelius ihm nicht zugetraut hatte. Einiges davon stand mittlerweile auf der Liste der unerwünschten Autoren, die vom Börsenverein des deutschen Buchhandels in speichelleckender Anbiederung an die neuen Machthaber verbreitet worden war. Adams ließ sich davon nicht beirren, lobte Remarque und Tucholsky, Meyrink und Lernet-Holenia. Er mochte die Statur eines Schlägers und ein Gesicht zum Fürchten haben, doch sein Herz schlug für die Literatur, und er wurde nicht müde, zu betonen, dass er der beste Wächter war, den die Deutsche Bücherei sich wünschen konnte.
Seltener sprach er über seine andere Arbeit, als Türsteher in den halbseidenen Etablissements rund um die Windmühlenstraße und in dunkleren Winkeln der Stadt. Nur ein-, zweimal hatte er erwähnt, dass er so gut wie nie das Tageslicht sah, weil er in den Nächten, die er nicht in der Bücherei verbrachte, vor den Eingängen von Bars und Nachtcafés stand. »Immerhin eine sichere Arbeit«, hatte er gesagt, »denn der Mann, der da das Sagen hat, ist ganz dicke mit den Nazis. Die feinen Herren saufen viel zu gern an seinen Theken und lassen es in den Separees krachen, als dass sie ihm ans Leder gingen. Falls die hier eines Tages doch noch alles abfackeln, dann verdien ich meine Kröten nur noch dort.«
Die großen Bücherverbrennungen vom 10. Mai waren gerade mal zwei Wochen her, und obwohl Leipzig weitestgehend davon verschont geblieben war, ließen sie Adams keine Ruhe. Cornelius machte sich seine eigenen Gedanken darüber, aber er hatte nicht vor, sie mit irgendwem zu teilen. Mit niemandem außer Felicie. Schon gar nicht mit dem plappernden Adams, der vielleicht eben doch ein Spitzel war, den Cornelius’ Erzfeind Schaller auf ihn angesetzt hatte.
»Das hier ist die Insel der Glückseligen«, verkündete Adams, während sie das Vestibül der ersten Etage durchquerten, um einen Blick in den Zeitschriftensaal zu werfen. Der Eingang wurde von zwei vergoldeten Eisengussreliefs flankiert. »Ich meine, nicht nur die Bücherei, sondern ganz Leipzig. Ist kein Zufall, dass hier bisher kaum Bücher verbrannt worden sind. Die ganze Stadt lebt von Büchern, hier hat man noch Respekt vor dem geschriebenen Wort, auch vor dem unbequemen.«
Ein paar Minuten später, auf der Treppe zum zweiten Stock, kam Adams auf das Thema zurück. »Das hier ist der letzte sichere Hafen für die Bücher, und wir sind seine Bewacher. Macht dich das nicht ein bisschen stolz?«
»Ein bisschen«, sagte Cornelius.
Adams breitete die Arme aus. »Nirgends sind sie geschützter als hier bei uns, und solange es das alles hier gibt, kann ihnen keiner was anhaben.« Nach kurzem Nachdenken fügte er hinzu: »Das heißt, solange das Radio nicht noch beliebter wird, denn dann liest bald eh keiner mehr ein Buch.«
Im nächsten Gang passierten sie eine verschlossene Tür, die Cornelius weit größere Sorgen machte als die Popularität des Radios. Hinter der hohen Eichentür wurde tagsüber eine neue Dienststelle eingerichtet. Ende Juni sollte die Deutsche Bücherei dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt werden, und hier oben räumten sie schon die Büros für Goebbels’ Kohorten ein. Die Porträts von Hitler und Hindenburg hatten bereits an den Wänden gehangen, ehe die Schreibtische heraufgeschleppt worden waren.
Cornelius quälte die ungute Vorahnung, dass bald jemand in seine Akte schauen und den Vermerk über seinen laschen Umgang mit Kommunisten im Naundörfchen-Fall finden würde. Spätestens im August würde er sich wohl eine neue Arbeit suchen müssen.
»Ich hab da was aufgeschnappt«, sagte Adams, dem Cornelius’ Blick zur künftigen Ministeriumsdienststelle nicht entgangen war. »Kann ich dich was fragen?«
»Kann ich’s denn verhindern?«
Adams grinste, wobei die beiden Narben auf seinen Wangen fast bis zu den Augen rutschten. »Du warst Polizist, schön und gut. Mir macht das nichts aus, wirklich nicht.«
»Da bin ich froh.«
»Die Jungs vom Wachdienst erzählen sich, dass du jederzeit wieder zurückgehen könntest. Ab in die Direktion, um Schurken zu jagen und so was. Dass du dich nur entschuldigen müsstest bei den hohen Tieren, bisschen auf den Knien rumrutschen und verdattert tun. So als tät’s dir leid, was immer du angestellt hast.«
Cornelius wünschte sich auf der Stelle fort von hier. »So einfach ist das nicht.«
»Einfach bestimmt nicht, aber auch nicht unmöglich. Die Polizei braucht gute Leute, gerade in solchen Zeiten. Überall gibt’s Geschrei und Ärger auf den Straßen.«
Vielleicht war Adams wirklich ein Spitzel, der ihn anschwärzen sollte. Schaller war das zuzutrauen, auch ein paar anderen Mitgliedern der Kommission, die Cornelius’ Rauswurf mit ihren Unterschriften besiegelt hatten. Und selbst wenn Adams nichts dergleichen war, einfach nur ein neugieriger Wachmann und Türsteher, mit überschaubarem Grips, aber dem Herz am rechten Fleck, dann würde er Cornelius nicht dazu bringen, etwas zu sagen, das ihn abermals kompromittierte. Sobald Goebbels’ Erbsenzähler ihn unter die Lupe nahmen, waren seine Tage in der Bücherei gezählt, und er würde das nicht von sich aus beschleunigen.
»Du willst nicht drüber reden, das ist in Ordnung«, sagte Adams, und zu Cornelius’ Überraschung fügte er hinzu: »Entschuldigung, ich wollte nicht in deiner schmutzigen Wäsche wühlen.«
Cornelius quittierte seinen guten Willen mit einem Nicken und hoffte, dass das Thema damit erledigt war.
»Es ist nur«, fuhr Adams nach ein paar Schritten fort, »dass ich nicht versteh, warum einer auf eine Beamtenlaufbahn verzichtet und stattdessen mit Kerlen wie mir für einen Hungerlohn Nachtschichten schiebt.«
»Ich mag die Nacht«, sagte Cornelius. »Hab ich schon immer.«
»Auch die schlechte Bezahlung?«
»Ich brauch nicht viel. Ich wohne zur Untermiete bei einem Buchhalter, fünfundachtzig Mark im Monat für das Zimmer, ein Frühstücksbrötchen und eine Tasse Kaffee am Morgen inklusive. Ich hab zwei Bücherregale, und die Matratze ist nicht allzu durchgelegen. Nur seine Zeitung lässt er mich nicht lesen. Nicht mal, wenn schon Flecken drauf sind.«
»Was für Flecken?«
»Marmelade. Eigelb. Flecken eben.«
Adams verzog anerkennend den Mund. »Jedenfalls kann dir keiner nachsagen, dass du auf großem Fuß lebst.«
In der Tat, Bestechlichkeit hatten sie ihm nicht anhängen können. Das war auch nicht nötig gewesen. Dabei hatte sogar sein direkter Vorgesetzter Rosendahl ein gutes Wort für ihn eingelegt. Nicht gut genug, womöglich, denn während Cornelius hatte gehen müssen, hatten sie Rosendahl kurzerhand zum Chef der Kriminalpolizei ernannt. Und somit lag Adams durchaus richtig: Heute besaß Rosendahl ausreichend Einfluss, um Cornelius eine erneute Anhörung zu verschaffen, eine Gelegenheit, seine Fehler vor der Kommission zu bereuen und diesem Scheißkerl Schaller so tief in den Arsch zu kriechen, bis der aus dem Mund blutete. Was immerhin eine erquickliche Vorstellung war.
»Fünfundachtzig Mark, ein Brötchen und ein Kaffee«, sagte Cornelius. »Mehr ist nicht nötig, um mit Ruhe durchs Leben zu kommen.«
»Und Ruhe ist dir wichtig?«
Er nickte. »Was übrigens auch für meine Rundgänge gilt.«
Adams war keine Leuchte, aber das verstand er. Mit leisem Lachen schlug er Cornelius auf die Schulter. »Frieden, mein Freund«, sagte er. »Kein böses Blut zwischen uns.«
Cornelius zwang sich zu einem Lächeln. »Kein Tropfen.«
»Was hältst du davon, wenn wir uns aufteilen?«, fragte Adams. »Ich geh zurück nach unten und seh dort nach dem Rechten, und du genießt hier oben die Stille.« Sein Grinsen wurde noch breiter. »Ich weiß schon, ich kann den Leuten auf den Zeiger gehen. Manchmal ist es schöner ohne mich.«
Damit drehte er sich um und ging. Cornelius blickte ihm mit einem Kopfschütteln nach, dann setzte er seinen Weg allein fort. Unterwegs blitzten Bilder und Laute von gestern in seiner Erinnerung auf, das tonlose Flüstern durchs Wagenfenster, das spukhafte Weiß ihrer Haut am Glas. Er dachte, dass es hier im Viertel so viele Keller gab – und Keller unter Kellern –, dass wohl einige ohne Treppe darunter sein mochten, auch wenn das kaum einen Sinn ergab. Und wer genau weinte dort unten? Er versuchte, den Gedanken abzuschütteln, und wusste zugleich, dass ihm das nur auf eine einzige Weise gelingen mochte, wenigstens für kurze Zeit.
Ein paar Minuten später streifte er durch die Magazinräume im Obergeschoss, blickte im Schein der Taschenlampe in all die schmalen Wege zwischen den Regalen, ließ sich vom Duft der Bücher führen, bog mal hier ab, mal dort, zog vergilbte Bände hervor, schlug sie an beliebigen Stellen auf und berührte vorsichtig das Papier. Gelegentlich las er einen Satz oder ganzen Abschnitt, egal, ob es sich um uralte Traktate oder moderne Romane handelte. Er genoss das Privileg, hier oben allein zu sein, und er konnte nur ahnen, wie viele sich wünschten, einmal an seiner Stelle zu sein, umgeben von nichts als Büchern und all den rätselhaften Schatten voller Geschichten.
Er mochte die Magazine lieber als den Rest des Gebäudes, nicht nur, weil hier der Großteil des Buchbestands aufbewahrt wurde, sondern weil die Erbauer hier auf Zweckmäßigkeit statt auf Prunk gesetzt hatten. Unten in den Gängen und Sälen wachten riesige Wandgemälde und Reliefs über die eingeschüchterten Besucher. Hier oben hingegen ging es nur um die Literatur. Er war im Graphischen Viertel aufgewachsen, in einem Hinterhaus an der Engelsdorfer Straße, und er hatte den Buchgeruch der Gegend mit dem Kohlenstaub der Dampfmaschinen eingeatmet. Dass er selbst kein Drucker, Typograph oder Buchbinder geworden war, hatte mit seinem Vater zu tun, der in den Druckereihallen die Maschinen gewartet hatte, ohne jede Liebe zum Buch, stets ölverschmiert, stets schlecht gelaunt, kein übler Mensch, aber irgendwann dermaßen dem Schnaps verfallen, dass es seinem Mörder leichtgefallen war, ihm für ein paar Mark nachts auf dem Nachhauseweg den Schädel einzuschlagen. Der Täter war bald gefunden worden, ein Säufer und Prolet, chronisch knapp bei Kasse, der niemandem wehtun wollte, solange er nüchtern war, aber nach ein paar Gläsern zum Ungeheuer wurde. Cornelius hatte erlebt, wie sehr es seiner Mutter geholfen hatte, den Mann vor Gericht zu sehen, und so hatte er beschlossen, für andere das Gleiche zu tun. Es war keine komplizierte, quälende Entscheidung gewesen. Die Bücher liefen ihm nicht weg, er las sie, wann immer er wollte, und schließlich konnte nicht jeder im Graphischen Viertel seinen Lebensunterhalt mit ihnen verdienen.
Und nun tat er es doch, indem er über sie wachte, ganz so wie Adams gesagt hatte. Vielleicht war das hier wirklich der letzte sichere Hafen, und wenn die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten weiter um sich griffen, mochte es nötig sein, mehr zu tun, als nur mit einer Taschenlampe durch kalte Korridore zu schlendern und hier oben so oft wie möglich nach dem Rechten zu sehen; auch um nicht zu vergessen, wie bedeutsam dieser Ort war und er selbst nun ein winziger Baustein in einer Festung der Wörter.
Irgendwann ließ er die Magazinräume hinter sich und stieg die breite Treppe wieder hinab, ins dritte, dann ins zweite Geschoss, und weil er keine Lust auf Adams’ Gerede hatte, kontrollierte er noch einmal den großen Korridor. Durch die Reihe der hohen Fenster konnte er hinaus in die Nacht blicken, zur Rückseite der Bücherei, auf den ummauerten Hof im Winkel zwischen Großem Lesesaal und Haupttrakt. Nur wenige Lampen schimmerten matt im Nebel, milchige Inseln aus Helligkeit inmitten des Dunkels. Darunter breiteten sich Lichtkreise am Boden aus wie schimmernde Pfützen, deren Ränder im Dunst zerfaserten.
Zwei Gestalten bewegten sich am Rand des Lichtscheins, Scherenschnitte hinter Nebelschwaden, beide in Mänteln, die eine klein und schmächtig, die andere über einen Kopf größer. Konturen aus Finsternis, die irgendwie ins Lampenlicht geraten waren, gesichtslose Silhouetten, heftig gestikulierend, vielleicht streitend. An einem belebteren Ort hätte Cornelius keinen zweiten Blick an sie verschwendet.
Die schmalere Gestalt war auf dem Weg über den Hof und die größere folgte ihr, holte auf, redete auf sie ein, streckte schließlich die Hand aus und griff zu.
Dort drüben bewegte sich noch jemand.
Ein dritter Schatten huschte für einen Herzschlag ins Licht und glitt wieder in die Dunkelheit, als wäre er den beiden versehentlich zu nahe gekommen, wie ein Aal, der die Oberfläche eines schwarzen Sees berührte, um sofort wieder abzutauchen.
Die Frau und der Mann – denn Cornelius war jetzt sicher, dass es sich um ein Paar handelte, das dort unten debattierte – hatten die dritte Gestalt nicht bemerkt. Vielleicht war sie auch gar nicht da gewesen, nur ein Fetzen von Dunkel im Nebelmeer, der Cornelius einen Streich gespielt hatte.
Metall blitzte zwischen den beiden auf.
Cornelius hob eine Hand und schlug damit flach gegen die kalte Fensterscheibe.
Der kurze Lichtschimmer war wieder fort, kehrte aber zurück, als der Mann die Frau an beiden Schultern packte. Ein kurzer, heller Schrei ertönte, und da warf Cornelius sich herum und rannte los, den Gang hinunter bis zur Treppe, dann die Stufen hinab, immer zwei, drei auf einmal.
Als er im Erdgeschoss ankam, peitschten draußen zwei Schüsse, gedämpft durch das dicke Mauerwerk.
Es war noch ein gutes Stück bis zum Hinterausgang. Ihm war, als streckten sich die Gänge vor ihm wie Spiegelbilder in Spiegelbildern, immerfort ins Endlose. Als er die Tür endlich erreichte, musste er den richtigen Schlüssel am Bund finde, da waren zu viele davon, alle fast gleich geformt und die Beschriftungen winzig. Schließlich fand er ihn, riss die Tür zum Hof auf und war überrascht, wie viel dichter der Nebel hier unten war, eine trübe Brühe, die vom Graphischen Viertel herüberwehte. Sie roch nach Kohle, vermischt mit Wasserdampf und all den Chemikalien, die zur Papierherstellung und Verleimung nötig waren. Cornelius atmete diese Luft von Geburt an, deshalb achtete er kaum darauf, war viel irritierter von der schlechten Sicht und den Sekunden, in denen er sich orientieren musste, um in die richtige Richtung zu laufen.
Er fand sie im Rund des Laternenscheins, wie hindrapiert, ein Stillleben in einem Rahmen aus Nacht. Der Mann lag auf dem Bauch, das Gesicht nach unten. In seinen letzten Augenblicken musste er versucht haben, sich umzudrehen; er hatte es nicht mehr geschafft. Blut lief unter seinem offenen Mantel hervor, nicht viel, aber sehr weit oben, was darauf schließen ließ, dass er in die Brust oder am Hals getroffen worden war.
Die zweite Leiche war das Mädchen von der Brücke.
Sie saß mit ausgestreckten Beinen da, der Oberkörper war nach vorn gesunken. Er konnte ihr Gesicht im Profil sehen und war sicher, dass sie es war. Eine Parabellumpistole lag unweit ihrer Hand, eine Kriegswaffe für den Nahkampf, die man eingerostet von obdachlosen Veteranen kaufen konnte oder auch fabrikneu von Männern, die mit Koffern voller Waffen kamen, wenn man nach genug Geld aussah.
Alles erweckte den Eindruck, als hätte Undine – falls das ihr wirklicher Name war – erst den Mann und dann sich selbst erschossen. Ein Loch über ihrer rechten Schläfe, das Haar rundum verklebt und dunkel, auch auf der anderen Seite, wo die Kugel wieder ausgetreten war. Ein Blutfaden aus ihrem Mundwinkel und am Hals hinab. Ein paar graue Spritzer auf ihrer linken Schulter.
Um ihren Hals lag eine Kette mit einem silbernen Medaillon. Das musste das metallische Schimmern gewesen sein, das Cornelius von oben gesehen hatte. Keine Klinge.
Er blickte aus dem Lichtfleck unter der Laterne hinaus in die Nacht, dorthin, wo er den Schemen gesehen hatte. Jetzt war da nichts mehr, nur Finsternis hinter Dunstschwaden. Jenseits des Büchereikomplexes erstreckte sich weites, offenes Gelände, potenzielles Bauland für die Anbauten. Falls wirklich noch jemand anderes hier gewesen war, hatte er sich längst dorthin abgesetzt, geschützt von der Nacht und der Nebelwand.
Cornelius ging neben dem Toten in die Hocke, zog den Ärmel der Nachtwächterkluft über die Finger und drehte den Körper vorsichtig an der Schulter auf die Seite. Ein Zischen drang aus dem Mund des Leichnams, als lauerte dort drinnen der Kopf einer Kobra. Der Rest eines letzten Atemzugs.
Hinter ihm näherten sich Schritte. Adams blieb stehen und sagte zur Abwechslung einmal gar nichts, atmete nur hörbar, fast stoßweise, so als hätte ihn selbst eine Kugel getroffen.
Cornelius sagte nicht Ich kenne dieses Mädchen, das behielt er für sich, und es wäre auch nicht die Wahrheit gewesen.
Stattdessen sagte er leise: »Ich kenne diesen Mann.«
Adams murmelte etwas von der Polizei, warf sich herum und rannte zurück zum Hintereingang.
»Ich kenne dich«, flüsterte Cornelius noch einmal in die Richtung des Toten. Und zu dem Mädchen sagte er leise: »Und wir beide sind uns zwar begegnet, aber ich hab keine Ahnung, wer du bist.«
3
In der Ecke des Kaffeehauses Felsche spielte ein elektrisches Klavier. Ein Tabulettkrämer mit Augenklappe ging von Marmortisch zu Marmortisch, deutete stumm auf die Ware vor seinem Bauch – irgendetwas Buntes für Kinder, Bauernhoftiere, Kaufladenobst –, ohne etwas anzupreisen oder zu verkaufen. Cornelius blickte dem Mann nach, bis er wieder am Ausgang war, während Felicie an ihrem Kaffee nippte und etwas über die Tauben sagte, die draußen auf dem Augustusplatz vor dem Einäugigen aufstoben.
Während Cornelius auf Felicie gewartet hatte, hatte er die Vögel beobachtet. Er hatte Tauben schon immer gemocht und verstand nicht, warum so viele Menschen nicht erkannten, wie schön sie waren. Als er klein gewesen war, hatte auf dem Dach des Hauses in der Engelsdorfer Straße ein Brieftaubenschlag gestanden. Manchmal hatte der Besitzer ihn von dort aus zusehen lassen, wenn die Vögel ihre Runden um die Rauchsäulen über dem Graphischen Viertel zogen, hektisch mit den Flügeln schlagend und doch als Schwarm majestätisch, in der Ferne ganz lautlos, dann wieder lärmend, wenn sie über Cornelius’ Kopf hinweggeflogen waren. Da war er acht, vielleicht zehn Jahre alt gewesen, sein Vater hatte noch gelebt, und seine Mutter hatte viel gelacht, anders als später, als sie selbst das schmalste Lächeln verlernt hatte.
Der Tabulettkrämer ignorierte das Geflatter auf dem Platz und wanderte mit seinem Bauchladen weiter Richtung Paulinerkirche.
»Cornelius?«
Sie saßen ein wenig abseits der anderen Gäste. Sie saßen immer abseits, wenn sich die Möglichkeit bot.
»Cornelius.«
Er schrak aus seinen Gedanken auf und sah den sorgenvollen Ausdruck in Felicies Augen. Ihr Gesicht sei zu herzförmig, sagte sie manchmal, darum ließ sie wie beiläufig ihre blonden Ringellocken über Ohren und Wangen fallen. Cornelius verstand nicht so recht, was gegen eine Herzform einzuwenden war, die doch in jedem Buch als Schönheitsideal gepriesen wurde. Er jedenfalls liebte ihr Gesicht und noch viel mehr ihr Herz und ganz sicher auch die Mischung aus beidem.
Jetzt aber konnte er nicht anders, als sich ganz auf ihren Blick zu konzentrieren, denn der war bohrend und würde schnell unbarmherzig werden, wenn Cornelius versuchte, seine Sorgen zu überspielen, um ihr damit nicht zur Last zu fallen.
»Raus mit der Sprache«, sagte sie. »Wie gefährlich war es wirklich?«
»Gar nicht gefährlich«, erwiderte er. »Alle waren schon tot, als ich dazukam.«
»Das arme Mädchen.«
»Noch steht immerhin im Raum, dass sie ihn getötet hat.«
»Dann wird sie ihre Gründe gehabt haben.«
»So kann man das auch sehen.«
»Warum sonst, bitte schön, sollte ein junges Mädchen einen Kriminalkommissar erschießen?«
Er senkte die Stimme, obwohl im Trubel des Cafés wohl niemand zuhörte. »Sie hat ihn nicht erschossen, da bin ich ganz sicher. Jemand wollte, dass es so aussieht. Aber sie war’s nicht.«
»Wie gut hast du diesen Zorner gekannt?«
»Zirner. Josef Zirner. Gut genug. Schwierige Type, aber kein schlechter Polizist.«
Felicie nickte ernst. »Also ein Arschloch.«
Er blickte zur Seite und sprach noch leiser. »Er hat jeden wissen lassen, welches Parteibuch in seiner Tasche steckt. Und manchmal neigte er zu Vorträgen, als stünde er auf der Bühne vor einem Aufmarsch der SA. Neue Weltordnung, das ganze Blabla.«
»Arschloch, sag ich doch.«
»Vielleicht sagst du’s lieber nicht ganz so laut.«
Sie musste lachen. »Rät mir der Mann, der nicht mal vor der Kommission den Mund halten konnte, um seine Arbeit zu behalten.«
»Gerade deshalb wär’s schön, wenn du deine behältst.«
Felicie unterrichtete Musik und Kunst an der Lessing-Schule in der Möbiusstraße. Nebenbei war sie zuständig für die Schulbücherei, wo seit einigen Wochen immer wieder Mitglieder des Kollegiums und Väter in braunen SA-Hemden auftauchten, um den Bestand zu inspizieren. Manchmal wurden ihr dann mit strengem Blick gewisse Exemplare herübergeschoben, die man hier künftig nicht mehr vorfinden wollte. Die ersten ein, zwei Male hatte sie sich gestritten, dann hatte der Direktor sie in sein Büro zitiert. Seitdem räumte sie die beanstandeten Bände in eine Kiste im Abstellraum und schimpfte, dass sie wohl bald eine zweite und dritte darauf stapeln müsste.
Eine Wahl blieb ihr nicht. Seit April wurden überall missliebige Lehrer aus dem Schuldienst entlassen. Allein in der Hauptstadt waren fast sechshundert aus politischen Gründen gefeuert worden, weit mehr als Polizisten. Viele waren Mitglieder der SPD oder KPD gewesen, mittlerweile wurden auch Juden systematisch aus dem Lehrkörper entfernt. Obwohl Felicie durchs Raster fiel – naturblond, auf dem Papier katholisch und nicht offensiv politisch –, hing das Damoklesschwert der Entlassung über jedem, der in den Verdacht einer allzu liberalen Unterrichtsgestaltung geriet.
Felicie hatte Cornelius erklärt, auf welche Weise sie versuchte, das Missfallen über die Schulbibliothek wettzumachen: Der Trick heiße Wagner. Sie lobte sein Werk mindestens einmal in jeder Musikstunde, und zwar in wirklich jeder, ohne Ausnahme. Schüler merkten sich Dinge nicht durch Interesse, sondern durch Zermürbung, und wenn dann zu Hause die Eltern fragten, wie denn das Fräulein Sternberg so sei, was es denn sage und ob es die deutsche Kultur hochhalte, dann fiel den Kindern als Erstes immer Wagner ein, und damit gaben sich die Alten zufrieden. Im Kunstunterricht ließ man ihr dafür sogar mal einen Liebermann oder Ury durchgehen.
Heute im Café trug sie ein geblümtes Kleid, fast ein wenig zu sommerlich für einen bedeckten Maitag. Früher war sie gern in Herrenanzügen und Krawatte ausgegangen, aber davon hatte sie sich in den letzten Monaten verabschiedet, um keine argwöhnischen Blicke auf sich zu ziehen. Im Gegensatz zu Cornelius reagierte sie auf die Zeichen der Zeit mit pragmatischer Besonnenheit. Selbst wenn er ihr gegenübersaß, hatte er oft das Gefühl, er sähe nur ihren Rücken, so viel schneller als er ging sie durchs Leben.
Cornelius hatte ihr schon gestern von der Begegnung auf der Brücke berichtet, ohne zu erwähnen, dass er im Lokomotivenqualm beinahe selbst über die Brüstung gestürzt wäre. Als er ihr vorhin vom Tod des Mädchens erzählt hatte, hatte sie das sichtlich berührt.
»Das war kein Zufall, oder?«, fragte sie.
Er stocherte nachdenklich mit dem Löffel in dem Sahneschälchen, das der Kellner mit ihrem Kaffee gebracht hatte. Bis vor Kurzem hatte auf dem Geschirr noch Cafè Français gestanden, so hatte das Kaffeehaus vor dem Krieg geheißen. Nun trug es den Namen seines Besitzers Felsche, und nach anderthalb Jahrzehnten waren endlich auch Teller und Schalen darauf abgestimmt worden. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall war. Ich hab ihr Hilfe angeboten – was man eben so macht in so einer Lage –, und sie hat gewusst, wo sie mich finden kann. Und dann taucht sie nur einen Tag später genau dort auf.«
»Mit einem deiner früheren Kollegen im Schlepptau.«
»Und das macht alles noch merkwürdiger. Sie kannte mindestens zwei Polizisten – einen Kommissar im Dienst mit lupenreiner Weste, und dann einen, den sie hinausgeworfen haben und der sich als Nachtwächter durchschlägt. Zu wem wärest du gegangen, wenn du ein ernstes Problem hättest?«
Felicie lächelte mit bezauberndem Augenaufschlag. »Fragst du mich das im Ernst?«
»Wenn du sie wärst.«
Sie mochte keine rhetorischen Fragen, darum gab sie gar nicht erst eine Antwort, sondern sagte: »Und wenn dieser Zirner das Problem war?«
»Wer weiß. Aber glaubst du, irgendwen würde das jucken, wenn ausgerechnet ich das zu Protokoll gebe?«
»Du hast ihnen nichts von dem Streit gesagt?«
»Doch, natürlich. Sie haben so einen jungen Schnösel geschickt, Uhlig, und der hatte auch gleich eine neunmalkluge Erklärung parat: Dass es sich wohl um eine Beziehungstat handeln müsse, dass die beiden Krach hatten und sie ihn deswegen erschossen hätte. Und dass sie sich dann in Panik selbst eine Kugel in den Kopf gejagt hätte.«
»Was du allerdings für Blödsinn hältst.«
»Für ausgemachten.« Er sah sich erneut nach Lauschern um, so wie er es mittlerweile ständig und überall tat. »Und nicht nur ich, wenn auch aus anderen Gründen. Das einzig Gute an der letzten Nacht war, dass Uhlig ausgerechnet von einem Schutzpolizisten gemaßregelt wurde: Dass man es in der Chefetage gewiss nicht gern sähe, wenn ein verheirateter Kommissar von seiner minderjährigen Geliebten erschossen würde.« Verbittert verzog er das Gesicht. »Sie haben schon angefangen, die Wahrheit zu verdrehen, während ich noch danebenstand.«
»Willkommen in meinem Leben«, sagte Felicie. »Im Lehrerzimmer ist das Alltag. Wenn das alles in seiner Berechenbarkeit wenigstens nicht so langweilig wäre. Die aufregendsten Momente bei uns sind mittlerweile die, in denen mal wieder jemand seine Siebensachen packen muss, alle ganz betroffen tun, aber klammheimlich denken, gut, dass es ihn erwischt hat und nicht mich.« Sie sah hinüber zur Kuchentheke, wo zwischen all den prachtvollen Torten eine mit rot-weiß-schwarzem Marzipanüberzug stand. Bislang hatte noch keiner ein Stück davon bestellt. Vielleicht traute sich niemand, das Hakenkreuz darauf anschneiden zu lassen. »Erzähl mir von Zirner«, bat sie, als sie sich wieder Cornelius zuwandte. »Was war er für einer?«
Er erinnerte sich an einen grauhaarigen, auf ernsthafte Weise attraktiven Mann, der viel Zeit allein an seinem Schreibtisch hinter hohen Aktenstapeln verbracht hatte. »Er war keiner, der jungen Frauen nachstellt. Andere geben mal einer Sekretärin einen Klaps auf den Hintern, aber er nicht. Konservativ in all seinen Ansichten. Einer, der zuletzt nur den Mund aufmachte, wenn es die Möglichkeit gab, ein Halleluja auf Hitler zu singen.«
Felicie machte ein Geräusch, als hätte sie einen Wurm in ihrem Pfirsichkuchen entdeckt.
»Aber er ist nicht immer so gewesen«, fuhr Cornelius fort. »Beim Kapp-Putsch 1920 haben wir Seite an Seite gestanden, hier draußen auf dem Platz, und da hat er mit Hingabe die Rechten zusammengeknüppelt. Er hatte kein Quäntchen Verständnis für den Aufstand und alle, die für Kapp marschiert sind.«
»Wie ist er dann selbst zu« – sie hielt kurz inne mit einem Seitenblick auf das Hakenkreuz in der Kuchentheke – »dazu geworden?«
»Ich kann’s dir nicht sagen. Zuletzt saß er ein Stockwerk unter mir, wir haben uns eigentlich nur noch gesehen, wenn Rosendahl uns zur Besprechung antanzen ließ. Irgendwas ist mit ihm passiert.«
Nicht nur mit ihm, formte sie stumm mit den Lippen und nickte zu den nächsten Gästen hinüber, drei Tische entfernt.
Cornelius’ Gedanken aber kreisten schon wieder um das Mädchen auf der Brücke. Und um das, was sie geflüstert hatte. Sie weinen alle im Keller ohne Treppe. An einem zumindest bestand kein Zweifel: Er hatte mit eigenen Augen gesehen, dass sie lebensmüde war. Sie hatte ihm geradeheraus gesagt, dass sie sterben wollte. Ich hab mitangesehen, wie ein Mensch den Verstand verloren hat. Und ich glaube, ich war schuld daran. Aber eine Kugel in den Kopf? Er war nicht einmal überzeugt, dass sie tatsächlich hatte springen wollen. Und wenn sie da schon im Besitz der Pistole gewesen wäre, hätte sie doch auch die benutzen können. Hatte also Zirner die Waffe mit zur Bücherei gebracht? Oder nicht doch eher jene dritte Person, die Cornelius in der Dunkelheit wahrgenommen hatte, diese Spukgestalt im Nebel?
Felicie legte die Gabel neben ihren Obstkuchen und tupfte sich mit der Stoffserviette die Lippen ab. »Ich hab keinen Appetit mehr.«
»Tut mir leid.«
»Nicht wegen der Toten.«
»Ich weiß.«
Sie sah ihm wieder in die Augen, und er wusste, was sie als Nächstes sagen würde. Weil sie ihn besser kannte als irgendwer sonst. »Du willst zurück in den Dienst.«
»Möglich. Ja. Wenn ich das Mädchen nicht einfach nach Hause geschickt hätte, wäre es vielleicht noch am Leben.«
»Sie war kein Kind mehr. Du konntest sie wohl kaum irgendwo festbinden.«
»Ich weiß«, sagte er wieder und dachte: Aber das ändert nichts.
»Und die Kommission?«
»Ich werde mich entschuldigen müssen.«
»Aber für was denn, um Himmels willen?« Jetzt fiel es ihr schwer, leise zu sprechen. »Dafür, dass du keine Unschuldigen überführt hast?«
»Ich hab mir keine große Mühe gegeben, irgendwen zu überführen. Damit zumindest hatten sie recht.«
Sie schien ihn mit ihren blauen Augen zu durchleuchten. »Wir lernen alle gerade, über unseren Schatten zu springen.«
Er wich ihrem Blick aus, riss sich zusammen und wandte sich ihr wieder zu. »Die werden eine Menge Bücklinge von mir verlangen. Dass ich ihnen die Scheißstiefel lecke. Auf ihr heiliges Buch schwöre.«
Keiner von beiden lächelte. Stattdessen sahen sie einander todernst und traurig an.
»Du wirst den Kuchen da drüben essen müssen«, sagte sie.
»Ja«, sagte er, »das auch.«
4
In Rosendahls Büro roch es nach kaltem Pfeifenrauch und dem Wachs, mit dem er die Enden seines Schnauzbarts zwirbelte. Er hatte sich die strenge Regel auferlegt, die erste Pfeife des Tages erst dann anzustecken, wenn sich die übrigen Büros der Polizeidirektion an der Wächterstraße leerten. Oft traf ihn die Putzkolonne noch nach Mitternacht an, während er in einer Rauchwolke tief gebeugt über Akten saß und mit einem goldenen Füllfederhalter winzige Notizen auf Karteikarten schrieb, die er am nächsten Morgen an seine Mitarbeiter verteilte. Aufgaben, Rügen, Belobigungen – und nicht selten Hinweise auf Sachverhalte, die den unerfahreneren Beamten entgangen waren.
Friedrich Rosendahl war alleinstehend, wobei die Damen im Schreibbüro munkelten, er sei früh verwitwet. Allerdings hätte er eine so intime Information niemals mit irgendwem geteilt. Es gab auch kein Bild der Verstorbenen in seinem Büro, was das Gerede im Schreibzimmer erst recht befeuerte. Kaum jemand wusste etwas über sein Privatleben, womöglich weil es keines gab.
»War eine Frage der Zeit, bis Sie wieder auftauchen, oder?«, fragte er, während er Cornelius bedächtig über seinen Schreibtisch hinweg musterte.
»Ich würde sagen, eine Frage der Notwendigkeit.«
»Aus Uhlig wird mal ein hervorragender Polizist.«
»Noch ist er das jedenfalls nicht«, sagte Cornelius. »Und irgendwer muss diese Morde aufklären.«
»Und das wären dann ausgerechnet Sie?«
»Ja.«
»Zumindest Ihre Arroganz haben Sie in den letzten Monaten nicht verloren.«
»Tut mir leid. Es ist nur … Zirner war einer von uns.«
»Blödsinn.« Rosendahls buschige Brauen rückten zusammen. »Sie mochten ihn nicht mal. Niemand mochte ihn besonders.«
»Früher war er mal ganz in Ordnung.«
Der Leiter der Kriminalpolizei ließ sich nicht beirren. »Und was wollen Sie wirklich?«
»Denjenigen finden, der Zirner und das Mädchen erschossen hat.«
»Die Polizei ist doch kein Krämerladen, in dem man mal schnell was erledigt, wenn es einem einfällt, und dann wieder verschwindet.«
»Ich bin hier nicht freiwillig weggegangen«, erinnerte ihn Cornelius eine Spur zu scharf.
Rosendahl ließ es ihm durchgehen. »Sie waren uneinsichtig, deshalb hatte die Kommission keine Wahl. Wären Sie ein wenig kompromissbereiter gewesen, wäre die Sache anders ausgegangen.«
Sie wussten beide, dass die Entscheidung der Kommission vor allem mit dem Betreiben des Parteifunktionärs Schaller und der privaten Fehde zwischen ihm und Cornelius zu tun hatte. Dass Schaller Rosendahls Veto einfach vom Tisch gefegt hatte, hatte der Kriminalrat gewiss nicht vergessen. Womöglich aber hatte er diesen Vorgang seitdem einer neuen Bewertung unterzogen. Eine, die sich besser mit seiner Beförderung und seinem Seelenfrieden vertrug. Cornelius machte ihm keinen Vorwurf.
Der Kriminalrat lehnte sich zurück und legte eine Hand auf die straff gespannte Knopfleiste seiner Weste. »Warum überhaupt Nachtwächter?«
»Was spricht dagegen?«
»Die Arbeitszeiten. Die lausige Bezahlung.«
»Da war ich natürlich vorher sehr verwöhnt.«
Rosendahls Zeigefinger stieß in seine Richtung vor. »Kein Sarkasmus, Frey! Gerade sind Sie nicht in der Position für so was.«
Cornelius erlaubte sich ein Lächeln, weil er sehr wohl wusste, dass Rosendahl sich seit Längerem für weniger Überstunden einsetzte. »Wenn Sie’s wirklich wissen wollen: Ich mag Bücher. Und es hat was Ehrenwertes, auf sie achtzugeben. Besser jedenfalls, als sich die Nächte in irgendeinem Lager für Schrauben und Nägel um die Ohren zu schlagen.«
»Sie waren mal ein guter Mann, Frey. Sie hätten diese Mörder im Naundörfchen schnappen können. Das Problem war, dass Sie es nicht wollten.«
»Einer der SA-Männer hatte die Besitzerin des Lokals erschossen, das haben wir nachweisen können«, sagte Cornelius. »Danach hat sich kein Mensch mehr für die Wahrheit interessiert.«
»Mich hätte die Wahrheit interessiert«, sagte Rosendahl leise, und das war gefährlicher als jeder cholerische Anfall. »Stattdessen haben Sie in dieser Angelegenheit nur einen einzigen Mord aufgeklärt. Einen von fünf!«
»Die Sache sollte mit einem ganz bestimmten Ergebnis enden, und das hab ich denen nicht liefern können. Und Schaller hatte schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, mich loszuwerden. Für ihn war das ein gefundenes Fressen.«
»Ich habe mich damals für Sie starkgemacht.«
»Das weiß ich, und dafür bin ich dankbar.«
»Und jetzt soll ich dasselbe noch mal tun?«
»Mit Verlaub, heute wird man auf Sie hören. Sie sind hier jetzt der Chef.«
»Hören Sie auf, mir zu schmeicheln. Selbst mein Weinhändler macht das geschickter als Sie.«
»Werden Sie’s tun?«
»Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Wenn ich durchschaut habe, was Sie an dem Fall so interessiert. Das Schicksal unseres braven Kommissars Zirner ist es jedenfalls nicht.«
»Ein toter Polizist bleibt ein toter Polizist.«
»Sicher.« Rosendahl betrachtete ihn wie durch ein Mikroskop. »Aber das ist es nicht.«
Cornelius spürte einen Schweißtropfen in seinem Haaransatz.
»Das Mädchen!« Rosendahl schlug mit der Faust auf den Tisch. »Haben Sie die Kleine gekannt?«
Das lief ja hervorragend. »Ich war’s, der die beiden gefunden hat. Genügt das nicht? Als ich sie vom Fenster aus gesehen habe, da haben sie noch quicklebendig miteinander gestritten. Irgendwas blitzte auf, und ich dachte, einer von ihnen hat ein Messer. Und als ich –«
»Ich kenne den Bericht«, unterbrach ihn Rosendahl. »Wer war sie?«
Cornelius gab sich mit einem Seufzen geschlagen. »Nur eine traurige junge Frau, die sich von einer Brücke stürzen wollte. Ich hab sie davon abgehalten. Das war in der Nacht davor. Und dann erscheint sie plötzlich an der Bücherei, wo es rundum nichts gibt außer Brachland.«
»Von der Brücke stand aber nichts in Uhligs Bericht.«
»Und Sie wissen genau, warum.«
»Ich versuche noch, es mir zurechtzulegen. Aber meine Fähigkeit der Deduktion ist womöglich etwas eingerostet.«
»Uhlig kennt mich nicht. Er hätte eine Verbindung zwischen mir und der Toten hergestellt, und das hätte die Sache erheblich –«
»Herrgott, Frey! Sie und diese« – er suchte in seiner Erinnerung nach dem Namen – »diese Emilie Abel waren miteinander bekannt. Selbstverständlich ist das eine Verbindung!«
»Emilie Abel?«, fragte Cornelius. »War das ihr Name?«
»Hat sie Ihnen den nicht genannt?«
»Sie hat gesagt, sie heißt Undine … Undine und dann irgendwas, das Italienisch klang. Ich hab ihr kein Wort geglaubt. Klang wie so ein Künstlername in einer billigen Tanzbude.«
Rosendahl erhob sich von seinem Stuhl, trat ans Fenster und blickte hinab auf die Kreuzung von Wächterstraße und Peterssteinweg, während er Cornelius schweigend seinen breiten Rücken präsentierte.
»Hören Sie«, sagte Cornelius, »sie hat mir einen falschen Namen genannt und sonst gar nichts. Keine Adresse, keine Familiengeschichte, nichts. Ich hab nur dafür gesorgt, dass sie nicht von der Brücke vor einen Zug springt. Jeder hätte das getan.«
»Ihr Mörder vermutlich nicht. Aber der hatte es wohl eher auf Zirner abgesehen als auf seine Informantin.«
»War sie das? Zirners Informantin?«
»Oh, Uhlig hat einen bunten Strauß von Theorien«, sagte Rosendahl, »von gotteslästerlichem Ehebruch über den Versuch einer erzwungenen Zeugenaussage bis hin zu einer politischen Angelegenheit.« Er blickte sich zu Cornelius um, erst nur über die Schulter, ehe er seinen ganzen Körper umdrehte. Irgendetwas an dieser Bewegung war sonderbar, wie bei einer Aufziehpuppe, deren Funktionen in einer festen Reihenfolge abliefen. Möglich, dass die neue Regierung sogar honorige Männer wie Rosendahl durch Automaten ersetzt hatte. Gerade die honorigen.
»Informantin in was für einem Fall?«, fragte Cornelius.
»Vielleicht ist Informantin das falsche Wort.«
»Was wäre denn das richtige?«
»Vorher will ich Ihr Ehrenwort, dass Sie und das Mädchen sich nicht nahestanden.«
»Sie sind der Chef der Kripo. Sie haben in Ihrer Laufbahn so viele falsche Ehrenworte gehört, dass Ihnen noch eins kaum was bedeuten kann.«
»Nicht von Ihnen.«
Cornelius runzelte die Stirn. »Sie haben mein Wort. Ich hab dieses Mädchen zum ersten Mal keine vierundzwanzig Stunden vorher gesehen. Vielleicht für zehn Minuten, länger nicht. Ich weiß nichts über sie, bis eben nicht mal ihren echten Namen.«
»Aber Sie fühlen sich für sie verantwortlich.«
Cornelius schüttelte den Kopf. »Es ist eher …« Er verstummte für einen Moment. »Es ist falsch, dass man sie einfach vergisst, nur damit man den Mord an Zirner irgendwelchen Marxisten in die Schuhe schieben kann.«
»So hab ich das aber nicht gesagt.«
»Müssen Sie nicht. Ich hab’s doch im Naundörfchen erlebt. Der Fall war in dem Moment vorüber, als klar war, dass die Toten braune Hemden trugen. Für die da oben gab es nur die eine Sorte von Tätern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Polizeipräsident dazu einen anderen Standpunkt vertritt.« Mit so einer Aussage beugte er sich weit über einen Abgrund. Aber wenn er eines begriffen hatte, dann, dass er Rosendahl nur mit Aufrichtigkeit überzeugen konnte.
»Der neue Polizeipräsident schenkt dem Fall große Aufmerksamkeit«, sagte der Kriminalrat verbissen. »Im Interesse der Öffentlichkeit vertieft er sich natürlich in viele Fälle.«
Im März war der verdienstvolle Heinrich Fleißner als Leipziger Polizeipräsident entlassen und mehrere Wochen lang in Schutzhaft genommen worden. Cornelius hatte sich mehr als einmal gefragt, ob einer der Gründe dafür wohl der Naundörfchen-Fall gewesen war. Als Nachfolger hatte man den fanatischen Parteisoldaten Oskar Knofe installiert, erst kommissarisch, seit Mai auch offiziell. Nur wenige Kriminalpolizisten hatten bislang offene Sympathien für die NSDAP gezeigt, und eine von Knofes Aufgaben war es wohl, den gesamten Apparat auf Linie zu bringen. Männer wie Zirner, die keinen Hehl aus ihrer Hitler-Verehrung machten, waren ihm da sicher äußerst genehm.
Und nun war Zirner tot.
Rosendahl ließ sich wieder hinter seinem Schreibtisch nieder. »Das alles ist nicht so einfach, wie Sie glauben. Das Mädchen war keine gewöhnliche Informantin. Sie war eine Kriminaltelepathin.«
Cornelius sog scharf die Luft ein. »Ach, kommen Sie.«
»Nein, es stimmt. Mit fünfzehn war sie das jüngste Pferdchen im Stall des Kriminaltelepathischen Instituts.«
»Das Institut wurde längst aufgelöst.«
»Natürlich. Aber glauben Sie, damit sind diese Leute einfach aus der Welt?«
In den Zwanzigerjahren war es bei der Polizei zur viel diskutierten Mode geworden, bei schwierigen Fällen vermeintliche Hellseher und sogenannte Sensitive mit ins Boot zu holen. Jahrelang war über Sinn und Unsinn dieser Maßnahmen diskutiert worden, intern in den Reihen der Kripo, aber auch in Politik und Öffentlichkeit. Begonnen hatte es in Leipzig bereits 1919, als ein Polizeirat der Sache mit einem Experiment auf den Grund gehen wollte. Er inszenierte einen fingierten Raubmord und lud den weithin bekannten Bühnentelepathen Kara Iki ein, den Fall aufzuklären. Unter den Augen geladener Reporter, Kommissare, Staatsanwälte und eines Gerichtspsychiaters hatte der Hellseher innerhalb kurzer Zeit sowohl die angebliche Leiche und den Mörder als auch die Beute und die Tatwaffe gefunden. Dabei hatte keiner der Beteiligten mit ihm sprechen oder anderweitig Hinweise geben dürfen. Der Vorfall hatte außerordentliches Aufsehen erregt und die Polizei in zwei Lager gespalten: in jene, die einer Zusammenarbeit mit Sensitiven und medial Begabten offen gegenüberstanden, und solchen, die das Ganze als ausgemachten Hokuspokus ablehnten.
In Wien, wo der Ursprung des übersinnlichen Spektakels lag, hatten findige Geschäftemacher das Institut für Kriminaltelepathische Forschung gegründet, das zwar nach wenigen Monaten wieder geschlossen worden war, es in der Zwischenzeit aber zu einem Leipziger Ableger gebracht hatte. Denn in keiner anderen deutschsprachigen Stadt hatte das Okkulte und Esoterische schon zur Jahrhundertwende derart tiefe Wurzeln geschlagen wie hier, und so war nach dem Kara-Iki-Experiment für eine Weile die Bereitschaft groß gewesen, dem Übersinnlichen bei der Polizeiarbeit einen Platz einzuräumen.
Obwohl sich nach mehreren Jahren, ein paar spektakulären Fällen und aufsehenerregenden Prozessen – bei denen die Hellseher sogar die Richter von ihren Fähigkeiten überzeugt hatten – letztlich die Zweifler durchsetzten, hatte das Tohuwabohu Spuren hinterlassen. Als man bei der Berliner Polizei schließlich gar eine eigene Abteilung eingerichtet hatte, um die kriminaltelephatischen Fälle zu katalogisieren und kritisch zu hinterfragen, hatte man sich in Leipzig gezwungen gesehen, zumindest sogenannte Hellseher-Akten anzulegen, in denen die Szene der Sensitiven und ihre Verbindungen zur Polizei dokumentiert wurden.
Cornelius nahm an, dass der Name Emilie Abel in einer dieser Akten aufgetaucht war.