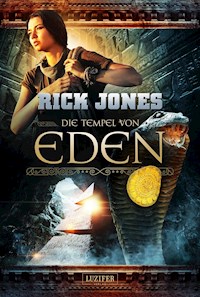Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ritter des Vatikan
- Sprache: Deutsch
Sie sind Elitesoldaten der ganz besonderen Art, denn sie stehen allein im Dienste Gottes: DIE RITTER DES VATIKAN Nach ihrem Anschlag auf den Vatikan weitet die Terror-Miliz ihre Anschläge in Europa und Amerika immer weiter aus. Als das Heilige Kreuz – die Überreste jenes Kreuzes, an dem Jesus einst starb – aus der Grabeskirche gestohlen wird, ist klar, dass die Terroristen beabsichtigen, es gegen noch verheerendere Waffen für ihren Kreuzzug einzutauschen. Die Ritter des Vatikan werden ausgesandt, das Kreuz an sich zu bringen, bevor der unheilige Austausch stattfinden kann, sehen sich jedoch einer paramilitärischen Eliteeinheit gegenüber. Wird es ihnen gelingen, das Heilige Kreuz wieder in seine Ruhestätte über dem Berg Golgatha zu bringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Heilige Kreuz
Die Ritter des Vatikan – Band 9
Rick Jones
This Translation is published by arrangement with Rick Jones Title: THE GOLGOTHA PURSUIT. All rights reserved. First published 2016.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE GOLGOTHA PURSUIT Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-639-9
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Jerusalem 14. September, im Jahre des Herrn 326
Helena, die Mutter Konstantins und mächtigste Frau des Reiches, stand am Rande einer Ausgrabungsstätte. Die Sonne lag hinter einem dünnen Wolkenschleier verborgen, und ihr Licht drang nur gedämpft hindurch. Und doch, als die Wolken für einen Moment aufrissen, schickte die Sonne biblische Lichtstrahlen in die Grube hinab, von denen Helena annahm, dass sie ein Zeichen Gottes waren.
Nachdem Helena den heidnischen Tempel hatte niederbrennen lassen, der einst auf dem Berg Golgota stand, hatten ihre Arbeiter an jener Stelle zu graben begonnen, von der sie glaubte, dass das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet worden war, noch unter dem Sand begraben lag.
Die Grabungen gingen nur langsam voran. Doch am 14. September des Jahres 326 stieß einer der Arbeiter in etwa zehn Metern Tiefe auf Widerstand. Mit vorsichtigen Handbewegungen strich er die trockene Erde von dem Objekt, um darunter eine Holzoberfläche freizulegen. Das Holz war glatt wie von einer Schreibtafel, an den Rändern jedoch etwas abgesplittert. Die in die Oberfläche eingeritzten Buchstaben waren über die Jahre verblichen, aber immer noch zu lesen:
INRI
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden
Sie gruben weiter und legten ein Kreuz frei, zusammen mit zwei weiteren.
Nachdem das Kreuz geborgen war, befahl Helena, auf dem Berg Golgota, dort, wo der Heiland hingerichtet wurde, die Grabeskirche zu errichten und das Heilige Kreuz in ihr aufzubewahren, wo es auch beinahe siebzehn Jahrhunderte verbleiben sollte.
Kapitel 1
Boston, Massachusetts Drei Jahre zuvor
Oliver Beckett saß mit übereinandergeschlagenen Beinen vor dem Au Bon Pain und genoss eine Tasse Earl Grey. Die seitenstarke Ausgabe einer Boston Globe lag ordentlich zusammengefaltet am Rand des Tisches. So wie viele wohlhabende Engländer besaß er eine makellose Erscheinung und strahlte eine gewisse Härte aus. Obwohl er ursprünglich aus London stammte, verbrachte er seine Zeit auf verschiedenen Anwesen nicht nur im Vereinten Königreich, sondern auch in Paris, Barcelona und der Insel Malta.
Sein Auftreten war stets ausgeglichen, ungeachtet seines Stresslevels. In seiner Vorstellung wurde er von jedermann bewundert. Egal, ob in Sachen Politik, Religion oder als Unterhalter, Oliver Beckett hielt sich stets für etwas Besseres. Alles begann und endete mit ihm; Leben, Tod und alles dazwischen. Es gab niemanden, der egozentrischer war oder sich gottgleicher wähnte als er.
Sein Vermögen hatte er als Waffenhändler angehäuft. Um den Verkauf von Waffen kam man nicht herum, wenn man es auf Profit abgesehen hatte – waren Kriege und Tod doch schon seit Anbeginn der Zeit das Rückgrat der menschlichen Existenz gewesen. Und deshalb hatte Oliver Beckett sein Geschäft klug gewählt. Denn für seine Güter würde es immer einen Markt geben.
Der Tag schien beinahe perfekt, mit Ausnahme von ein paar kleinen, versprengten Wolken, die über ihn hinwegzogen. Es war warm und schwül. Aber Beckett schien nie zu transpirieren, und auch das zeichnete Gentlemen wie ihn aus: Sie transpirierten, aber sie schwitzten nicht. Ob heiß oder kalt, der Mann schien sich in seinen Designeranzügen stets wohl zu fühlen.
Zehn Minuten nach Becketts Ankunft im Au Bon Pain tauchte ein kleiner Mann auf und nahm gegenüber dem Briten Platz. Er wirkte nervös und ungeduldig und machte den Eindruck, als wäre es ihm am liebsten, wenn dieser Moment bereits vorbei wäre. Das Namensschild, das er trug, wies ihn als Calvin Locke aus. Er war Chefingenieur und Waffendesigner bei System Tek und zuständig für die Entwicklung modernster Waffen für die US-Regierung und deren Militärapparat. Für Beckett war es überdeutlich, dass der Mann sich unwohl fühlte.
»Entspannen Sie sich, Mr. Locke«, sagte Beckett. Seinem englischen Akzent haftete etwas Würdevolles an, die Aura eines gebildeten Mannes. Er legte seine Hand auf die Globe, die am Rand des Tisches lag.
»Bringen wir es hinter uns«, sagte Locke.
»Wenn Sie darauf bestehen.« Beckett griff an seiner Seite hinab, brachte einen kleinen Laptop zum Vorschein, legte ihn auf den Tisch, öffnete und startete ihn, tippte ein paar Befehle ein und rief dann eine Bildergalerie auf. »Bevor ich Ihnen diese Bilder zeige, Mr. Locke, hätte ich gern das, worum ich Sie gebeten hatte.« Beckett hielt ihm die Hand entgegen. »Den USB-Stick, bitte.«
»Oh nein. Eins nach dem anderen. Zuerst will ich wissen, dass es ihnen gut geht.«
Beckett ließ sich nicht beirren. »Den USB-Stick, bitte.«
»Meine Familie.«
Für einen Moment starrten die beiden einander an, ein Duell der Blicke. Schließlich gab Beckett nach. »Meinetwegen, Mr. Locke.« Er drehte den Laptop zu Locke herum, dessen Kinn zu beben begann und dem Tränen in die Augen stiegen.
Auf dem Bildschirm waren eine Reihe von Fotos seiner Frau und seiner Tochter zu sehen. Beide waren mit Handschellen gefesselt. Isolierband klebte über ihren Mündern. Und das Entsetzen in ihren weit aufgerissenen Augen sprach Bände über das Grauen, dem sie ausgesetzt waren und welches – zumindest aus Becketts Sicht – absolut unbezahlbar war.
Beckett krümmte seinen Zeigefinger, das Zeichen für Locke, ihm den USB-Stick zu übergeben. Was er auch tat, wenn auch zögernd.
»Werden Sie meine Familie jetzt wie versprochen freilassen?«
»Natürlich, Mr. Locke. Eine Abmachung ist eine Abmachung.«
Beckett drehte den Laptop wieder zu sich, steckte den USB-Stick in den Steckplatz und übertrug die darauf befindlichen Bilder. Binnen weniger Sekunden tauchte die schematische Darstellung des M600 SR Squad-Level Precision Guided 5.56 Service Rifle auf dem Bildschirm auf. Ein Schauer strich wie ein kalter Finger über Becketts Rücken. Das war die Waffe, welche den Krieg am Boden revolutionieren würde.
Beckett sah Locke an. »Und diese Darstellung … ist das noch der Prototyp, oder wurde diese Version der Waffe schon fertiggestellt?«
»Beides«, antwortete Locke. »Sie funktioniert. Das Zielsystem wurde perfektioniert.«
»Schön«, sagte Beckett. »Sehr schön.«
»Jetzt zu meiner Familie.«
Beckett schloss den Laptop und bedachte Locke mit einem unbeteiligten Blick. »Das Verteidigungsministerium wird dahinterkommen, dass Sie die Bilder auf Ihren PC luden. Am Ende wird man alles zu Ihnen zurückverfolgen können. Und das wird bei gewissen hochrangigen Köpfen natürlich die Frage nach dem ›Warum‹ aufwerfen.«
»Ich habe meine Spuren sorgfältig verwischt«, beteuerte Locke. »Niemand wird je etwas herausfinden. Glauben Sie mir.«
»Und ob sie das werden«, sagte Beckett. »Ganz egal, was Sie über das Verwischen Ihrer digitalen Fußspuren zu wissen glauben – das Verteidigungsministerium ist in der Lage, die Quelle des Downloads aufzuspüren. Und das, Mr. Locke, sind Sie. Ich muss daher feststellen, dass Sie zu einem losen Ende geworden sind.«
»Ich gab Ihnen, was Sie verlangten«, sagte Locke. »Jetzt geben Sie meine Familie heraus.«
Beckett setzte ein gespieltes, schmales Lächeln auf. »Ich wünschte, das wäre möglich«, antwortete er. »Das wünschte ich wirklich.«
Locke warf ihm einen verwirrten Blick zu. Was?
Er war von den Bildern auf dem Laptop so vereinnahmt worden, dass er nicht bemerkt hatte, das Beckett nach der schallgedämpften Pistole unter der Zeitung gegriffen hatte, bis zu dem Moment, als dieser Locke direkt anblickte. »Ich fürchte, Ihre Frau und Ihre Tochter weilen nicht länger unter uns. Unter den Lebenden, wenn Sie verstehen. Ich habe mich heute Morgen dieses kleinen Problems bereits angenommen … nun, wie ich bereits sagte, Mr. Locke, ich kann mir losen Enden nicht leisten. Diese sind schädlich fürs Geschäft, wissen Sie?«
Locke konnte das dunkle Auge des Pistolenlaufs sehen, welches ihn unter der Zeitung hervor anstarrte.
»Auf Wiedersehen, Mr. Locke«, sagte Beckett. »Und danke für alles.«
Die Waffe gab zwei gedämpfte Plopp-Geräusche von sich, zwei Schüsse direkt in die Körpermitte. Locke wurde von den Treffern gewaltsam durchgerüttelt, zuckte, aber dann entspannte sich sein Körper und Locke sank zusammen, so weit, dass sein Kinn beinahe die Tischkante berührte.
An einem so heißen und schwülen Nachmittag war niemand in der Nähe.
Locke hatte ausdrücklich um ein Treffen an einem öffentlichen Ort gebeten, dem Beckett zugestimmt hatte. Aber Beckett hatte sich einen Platz ausgesucht, der ihm die Möglichkeit bot, auch bei Tag zuzuschlagen. Keine neugierigen Augen, keine Zeugen. Alles war genau so abgelaufen, wie Beckett es erwartet hatte.
Beckett stand auf, packte scheinbar ungerührt und bedächtig seinen Laptop ein, aber dann tat er etwas Ungewöhnliches. Mit seinen sorgfältig manikürten Fingern fuhr er durch Lockes Haar. »Richten Sie Ihrer Frau und Ihrer Tochter doch bitte Grüße von mir aus«, sagte er.
Dann verschwand Oliver Beckett.
Kapitel 2
Büro des Monsignore Vatikan 11. Februar 2016 Vier Monate nach dem Tod von Bonasero Vessucci, Papst Pius XIV
Monsignore Dom Giammacio saß in einem Ohrensessel aus feinstem Leder und rauchte eine Zigarette. Ihm gegenüber saß Kimball Hayden, der beste der Vatikanritter. Als Bonasero Vessucci noch das Amt des Papstes bekleidet hatte, hatte er Kimball gebeten, den Monsignore aufzusuchen, um gemeinsam mit ihm an dem Problem des selbstauferlegten Gefühls, sich jenseits aller Vergebung zu befinden, zu arbeiten. Nun, da Bonasero nicht länger der Bischof Roms war, hatte sich Kimball noch nie so leer gefühlt. Zu Anfang hatte er diese Sitzungen nur auf Drängen des Papstes besucht. Doch nun suchte er die Beratungen des Monsignore freiwillig auf, um zu versuchen, Sinn in einem Leben ohne Bonasero zu finden.
»Sie sagten, Sie fühlen sich leer«, sagte der Monsignore. »Aber fühlten Sie sich nicht ebenso leer, als Sie das Gefühl hatten, keine Vergebung erfahren zu können?«
»Das hat nichts mit Vergebung zu tun«, sagte Kimball. »Sie wissen, worum es geht.«
Der Monsignore nickte. »Sie vermissen ihn.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»Das tue ich. Sehr sogar. Er war mehr ein Vater für mich, als es mein leiblicher Vater je war.«
»Darüber sprachen wir bereits.«
»Ich habe das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken, Monsignore. Ich bin ein Vatikanritter. Wir beschützen jene, die sich nicht selbst schützen können. Ich verstehe das alles. Aber es findet kein Ende. Kaum haben wir ein Übel niedergerungen, tritt ein anderes auf den Plan.«
»Das Böse kann nicht besiegt werden«, erklärte der Monsignore ruhig. »Es kann nur eingedämmt werden. Wenn Sie Ihre Fähigkeit anzweifeln, weiterzumachen; wenn Sie beginnen, den Sinn ihres Kampfes anzuzweifeln, hat das Böse bereits gewonnen. Bonasero hat das verstanden, und ich bin sicher, dass er, bevor er starb, wusste, dass Sie Ihren Kampf fortführen werden. Aber dafür müssen Sie mit dem Herzen dabei sein, Kimball. Am Ende obliegt diese Entscheidung Ihnen, nicht Bonasero.«
Kimball seufzte und dachte über die Worte nach. »Ich habe darüber nachgedacht, eine Familie zu gründen und dem Vatikan dem Rücken zu kehren«, sagte er dann.
»Ist es das, was Sie wollen?«
Kimball zuckte mit den Schultern. »Ich … ich habe nur darüber nachgedacht.«
»Sie haben Zweifel, was die Zukunft anbelangt, nun, da Bonasero nicht mehr unter uns weilt. Ist Ihnen die Erlösung nicht mehr wichtig?«
Kimball sah dem Monsignore in die Augen. »Ich brauche Führung.«
»Nein, Kimball. Bonasero ist tot. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie auf eigenen Füßen stehen.«
Das war nicht die Antwort, die Kimball hören wollte.
»Hat es etwas in Ihnen ausgelöst, als ich sagte, Sie müssen auf eigenen Füßen stehen?«, fragte der Monsignore dann.
»Bonasero verstand mich. Er kannte mich.«
»Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu lernen, sich selbst zu verstehen.«
Das Leben war so viel einfacherer gewesen, als Bonasero noch an seiner Seite stand, dachte Kimball. Es war so viel einfacher und geradliniger gewesen. Nun schienen sich überall Kurven und Abzweigungen zu befinden.
Der Monsignore beugte sich in seinem Sessel nach vorn, mit seiner Zigarette zwischen den Fingern. Eine dünne Rauchsäule stieg von ihr auf. »Am Ende müssen Sie entscheiden, was das Beste für Sie ist«, sagte er. »Nicht, was Bonasero vielleicht von Ihnen erwartet hätte. Seine Seele hat nun ihren Frieden gefunden. Aber ich bin sicher, Kimball, dass er weiter über Sie wacht und nur das Beste für Sie will.«
Kimball sah den Monsignore auf eine Weise an, die dieser weder lesen noch ergründen konnte. Dann fragte der Monsignore: »Wollen Sie Ihre Reise auf der Suche nach dem Licht der Erlösung weiterführen? Ich frage das nur aus zwei Gründen, Kimball: Entweder sind Sie am Ende Ihrer Reise angekommen und glauben, dass Gott Sie endlich in seine Arme geschlossen hat, weshalb Sie über ein Leben außerhalb des Vatikan nachdenken. Oder aber Sie haben akzeptiert, dass Er Sie für immer aufgegeben hat, was bedeutet, dass Sie sich einem Schicksal ewiger Verdammnis ergeben haben.« Der Monsignore fuhr fort, seinen Standpunkt zu verdeutlichen. »Sie stehen an einem Scheideweg, Kimball, zwischen der Dunkelheit und dem Licht, und wissen nicht, welchen Weg Sie einschlagen sollen. Bonasero ist tot. Er hat Ihnen den Weg gewiesen. Nun ist es an Ihnen, den Weg zu erkennen, den er Ihnen aufzeigte, und den Pfad Gottes zu beschreiten, nach dem Sie sich so sehr sehnen. Dieses Recht haben Sie sich verdient. Nehmen Sie es nicht nur mit Ihrem Verstand, sondern auch mit Ihrem Herzen an. Innere Friede wird dort auf sie warten.«
Kimball begann, auf seiner Unterlippe zu kauen. »Ich kann nicht«, sagte er schließlich. »So einfach ist es nicht. Nicht für mich. Ich weiß, dass ich noch nicht an diesem Punkt angekommen bin.«
»An welchem Punkt? Dem Punkt, sich selbst zu vergeben? Oder Gottes Gnade?«
»Beides.«
»Am Ende müssen Sie aber eine Entscheidung treffen, Kimball. Entweder, sich aus dem Vatikan zurückzuziehen, mit dem Gefühl, niemals Erlösung zu erfahren, oder nach ihr zu suchen, denn das ist es, was Sie eigentlich wollen. Die Antwort liegt bereits in Ihnen verborgen. Das ist es, was Bonasero Ihnen all die Jahre begreiflich machen wollte. Das war der Grund, warum er Sie zu mir sandte.«
Stehen oder fallen, das war die Entscheidung, die Kimball zu treffen hatte.
Stehen oder fallen.
Entschlossen setzte sich Kimball auf. »Seit jenem Tag, als ich meine Mutter ermordet in diesem Flur fand«, sagte er, »begann ich, anders zu ticken als die meisten Menschen. Licht oder Dunkelheit – ich stehe dazwischen und werde es wohl für den Rest meines Lebens tun. Ich lebe in der Grauzone, Monsignore. Und in dieser Grauzone töte ich Menschen. Das ist es, was ich tue. Worin ich gut bin. Nur, dass ich es jetzt tue, um die Schwachen zu schützen.«
»Dieser Umstand wird Sie stets herausfordern«, sagte der Monsignore. »So wirkt das Böse. Es sät Zweifel in Ihnen und lässt sie dort Wurzeln schlagen. Und diese ernsthaften Zweifel können einen behindern. Wenn Sie diese Zweifel hegen, selbst hin und wieder, dann sollten Sie der Kirche den Rücken kehren. Aber wenn Ihr Herz Ihnen etwas anderes sagt, Kimball, dann kämpfen Sie weiter als Ritter des Vatikan. Entscheiden Sie sich für Letzteres, werden diese Zweifel immer Ihr ärgster Feind sein. Denn schlussendlich müssen Sie vom Weg der Kirche einhundertprozentig überzeugt sein.«
Kimball dachte darüber nach, was einige Sekunden in Anspruch nahm. »Ich habe die gleichen Wünsche und Sehnsüchte wie jeder andere auch, Monsignore. Aber ich weiß auch, dass ich anders gepolt bin und in gewisse gesellschaftliche Normen nicht hineinpasse. Ein Vatikanritter zu sein ist das Einzige, was ich kann. Was ich bin. Ich weiß, dass ich außerhalb dieser Mauern mit mir als Person zu kämpfen haben werde.«
»Und das werden Sie auch weiterhin«, sagte der Monsignore, »bis Sie an die Macht des Lichts glauben.«
Kimball erhob sich. »Ich lebe in der Grauzone«, sagte er trocken. »Dort fühle ich mich am wohlsten, und dort gehöre ich wohl hin.«
»Vergessen Sie nicht, was Bonasero Ihnen beibrachte. Machen Sie einen Schritt auf das Licht zu. Nur einen. Manchmal braucht es nicht mehr als nur einen Schritt.«
»Das kann ich nicht«, antwortete Kimball entmutigt. »Dieses Recht habe ich nicht. Nicht jetzt. Und vielleicht niemals. Aber ich kann Ihnen versichern, Monsignore, dass ich mein Bestes tun werde … und was kann mehr von einem Mann verlangen, als sein Bestes zu geben, oder?«
Ohne ein weiteres Wort verließ Kimball den Raum.
***
Kimball kniete vor dem Grab Bonasero Vessuccis unter der Kirche. Die Krypta war klein und beengt, aber unberührt und friedlich. Das Grab bestand aus Marmor, mit Basreliefs von Cherubim und Engeln, die den Weg in den Himmel wiesen. Der Himmel wurde dabei von eingravierten Strahlen repräsentiert, die aus ebenfalls gravierten Wolken herabzufallen schienen.
Kimball senkte den Kopf und dachte: Wie geht es dir, mein alter Freund?
Es geht mir gut. Jeder Besuch von dir ist ein Segen, das weißt du. Es verrät mir, dass du beschlossen hast, deine Suche nach dem Licht fortzusetzen.
Es geht nicht mehr um Erlösung.
Eine Pause, von der Dauer eines Herzschlags. Du bist wütend.
Das bin ich.
Dort draußen gibt es Männer, nach denen du suchst. Männer, die für meinen Tod verantwortlich sind.
Ja.
Und nun verspürst du den Drang nach Vergeltung.
Das tue ich.
Aber das ist nicht unser Weg, Kimball.
Es ist mein Weg, Bonasero. Das weißt du. Du hast es akzeptiert.
Ich habe dich als einen gequälten Mann akzeptiert und dir den nötigen Weg gewiesen, um das Gute tief in dir zu kanalisieren. Ich habe dir aufgeholfen, als du straucheltest. Ich brachte dich ins Licht, nachdem du so lange an seiner Schwelle gestanden hattest, aber nun drohst du, wieder in diese Dunkelheit abzugleiten.
Kimball seufzte. Bonaseros Stimme war so klar. Aber sie klang verändert. Eher wie Kimballs innere Stimme.
Bonasero, das Licht weist mich ab, weil ich mich nicht ändern kann. Ich bin, was ich bin. Mein ganzes Leben lang bewegte ich mich in den Grauzonen. Dort gehöre ich hin.
Nein, Kimball, das Licht hat dich nicht abgewiesen. Es akzeptiert dich genauso wie die Dunkelheit. Du stehst dazwischen. Und nun, da ich nicht mehr bin, ist es Zeit, dass du eine Entscheidung fällst.
Der Mann, der für deinen Tod verantwortlich ist … sein Name ist Mabus.
Lass es auf sich beruhen, Kimball.
Das kann ich nicht.
Ihn zu töten wird mich nicht zurückbringen, Kimball.
Er hat so viele unschuldige Menschen getötet. Gute Menschen.
Eine lange Pause des Schweigens folgte.
Bonasero?
Kimball, alles, worum ich dich bitte, ist, darüber nachzudenken. Tritt einen Schritt ins Licht und bleibe dort. Lasse dich nicht von deiner Wut verschlingen. Wenn du das zulässt, wirst du niemals wirklichen Frieden finden. Wirst du diesen Schritt tun?
Ich mache diesen Schritt schon mein ganzes Leben lang. Aber immer wieder geschieht etwas, das mich zwei Schritte zurückwirft, in das Grau.
Ich fürchte nur, dass du, wenn du ins Wanken gerätst und weiter deinen dunklen Trieben folgst, am Ende aus dem Grau wieder in die Dunkelheit versinkst, Kimball. Du wirst in Ungnade fallen und die Vergebung, die du suchst, wird für immer verloren sein.
Zärtlich strich Kimball über die Grabplatte. Ich werde es versuchen, Bonasero.
Wage den Sprung, Kimball. Dort wirst du deinen Frieden finden.
Aber Kimball wusste, dass er nicht darauf vorbereitet war, dem Weg ins Licht zu folgen. Das war er noch nie. Er wusste, dass er tapfer den Versuch wagen und am Ende kläglich scheitern würde. Das Grau war seine Komfortzone. Hier konnte er völlig frei zwischen Recht und Gerechtigkeit abwägen. Und hier konnte er ohne jegliche Restriktionen handeln.
Ich komme bald wieder, dachte er. Aber seine Gedanken blieben leer, ohne eine Antwort des früheren Papstes. Nichts als … Stille.
Während er aufstand, und sein Kopf dabei beinahe die niedrige Decke berührt hätte, strich Kimball ein letztes Mal liebevoll über den Grabstein und verließ die Krypta.
Kapitel 3
Außerhalb von Washington, D.C. 5. April 2016
Shari Cohen leitete die Eingreiftruppe des FBI, das HRT, eine Eliteeinheit innerhalb der Organisation. An diesem Tag waren sie hinter einer Gruppe einheimischer Terroristen her, die für mehrere Morde im Raum Washington verantwortlich waren. Es handelte sich bei ihnen um Radikale – obschon Amerikaner – die während ihrer Haft in staatlichen Gefängnissen zum Islam konvertierten. Dort hatten sie einen anderen Gott kennengelernt, einen, der das Töten anderer Menschen billigte, weil es keine Gnade gegenüber jenen geben durfte, deren Grundsätze nicht denen des Korans entsprachen. Und die Gefängnisse waren der perfekte Nährboden, um Überzeugungen zu ändern. Menschen, deren Leben nichts anderes als Leere mehr bereithielten, wurden nun mit einem unbeschreiblichen Hass und einem dunkleren Lebenszweck genährt. Endlich gab es für sie etwas, wogegen sie rebellieren konnten.
Eine dieser Gruppen hatte sich in einem alten Lagerhaus am Rande von Washington eingerichtet. Es war ein altes Werksgelände, welches schon vor langer Zeit verlassen wurde, als viele Jobs ins Ausland verlegt wurden, um Löhne zu sparen. Nun dienten die Gebäuderuinen als Hauptquartier für religiöse Fanatiker, die nur für das Wort Allahs lebten und starben.
Shari kommandierte die Einheit aus der Ferne eines Lieferwagens heraus, an dessen Innenwänden zu beiden Seiten Monitore hingen. Sie trug ein Bluetooth-Headset mit Lippenmikrofon und Ohrhörern, über das sie das Team an den geeigneten Ausgangspunkt für den bevorstehenden Angriff dirigierte.
Die Teams hatten bereits einen Perimeter errichtet und warteten nun darauf, das Gelände von allen Seiten zu stürmen. Als sich alle Einheiten in Position befanden, gab sie den Befehl, vorzurücken.
Es war Nacht, was für die mit Nachtsichtgeräten ausgestattete paramilitärische Einheit des FBI einen Vorteil bedeutete. Und doch wurde die Nacht durch die Fensterscheiben des Lagerhauses erhellt, von einer Reihe von Mündungsblitzen, die stroboskopartig aufblitzten. Und am Ende, mit zehn Toten und vierundzwanzig Festnahmen, würden es diese Toten sein, für die Special Agent Cohen von jemandem verantwortlich gemacht werden sollte, der während der Razzia nicht einmal anwesend war.
Und dieser Terrorist würde sie schmerzlichst dafür bezahlen lassen.
Bethesda, Maryland Am darauffolgenden Tag
Sein eigentlicher Name lautete Montrell Thompson, aber er hatte ihn in Mohammad Allawi ändern lassen. Er war ein dreifacher Schwerverbrecher mit einem gefährlich hohen Intelligenzquotienten, der sein Talent jedoch an fragwürdige Entscheidungen verschwendet hatte, welche ihn am Ende ins Gefängnis gebracht hatten. Nun, da er in den Augen der Gesellschaft wertlos war, hatte er im Gefängnis zu einem neuen Selbstwert gefunden, durch einen Gott, der ihn so akzeptierte, wie er war. Hinter Gittern hatte er eine Bestimmung und einen neuen Lebenssinn entdeckt, fühlte sich gewollt, nachdem ihm dieses Gefühl so lange fremd gewesen war. Und weil Mohammad Allawi ein Mann war, dessen Interessen sich hauptsächlich auf Elektronik und die Entwicklung primitiver wie hochentwickelter Sprengsätze konzentrierten, wurde er schnell zu einer gefragten Person. Als seine Konvertierung in der Haftanstalt Brockbridge abgeschlossen war, war er sich absolut sicher, dass Allah ihm diese Fertigkeiten verliehen hatte. Er hatte es nur erkennen müssen. Und mit diesem Erkennen kam auch das Verstehen, wieso er existierte: Er hatte ein Ziel.
Doch dieses Ziel war niedergeschlagen, sein Team ausradiert worden.
Einen Tag nach der Razzia des FBI in dem Lagerhaus, in dem er sich niedergelassen hatte, um seine Waren und Spielzeuge zu entwickeln, waren zehn seiner Brüder – davon zwei leibliche Brüder – tot, und vierundzwanzig verhaftet. Eigenartigerweise verspürte er ein schlechtes Gewissen, den Überfall überlebt zu haben. Er hatte die Party nur deshalb verpasst, weil er in D.C. auf Erkundungstour nach potenziellen Schwachstellen für einen Anschlag gewesen war. Nun saß er in einem billigen Motel nördlich der Hauptstadt und verfolgte die unablässige Heldenverehrung von Special Agent Shari Cohen des FBI, die in der mehr als lächerlich benannten Operation Eagle Swoop nach Monaten der Überwachung und harter Ermittlungsarbeiten einen national operierenden Terrorring ausgehoben und so weiter und so weiter. Ihr Fang – der in den Fernsehübertragungen tunlichst verschwiegen wurde – bestand aus einer Reihe von Sturmgewehren, mehreren Paketen C-4-Sprengstoffs und mehreren Pfund Semtex. Es war klug von ihnen, nicht zu erwähnen, dass ein solches Arsenal so nah am höchsten politischen Sitz des Landes angehäuft werden konnte, dachte Mohammad. Wenn eine solche Sammlung in Washington auftauchte, wo könnten sich dann überall noch ähnliche Lager befinden? In New York vielleicht? Boston? Los Angeles? Die Liste der Städte wäre endlos.
»Aber sie haben mich nicht geschnappt«, sagte er leise zu sich selbst, während er die Nachrichten im Fernsehen verfolgte. Auch wenn er der Fahndung entwischt war, kannte Mohammad das Spiel nur zu gut. Er wusste, dass sich die Überwachungstechniken auf dem allerneuesten Stand befanden, also hielt er sich bedeckt und arbeitete nur über falsche IP-Adressen an seinem Computer. Und er achtete darauf, nur über Kuriere zu kommunizieren, die ähnlich wie falsche IP-Adressen dazu dienten, ihre Spuren zu verwischen. Aber so getarnt seine Spur im Cyberspace auch schien, stand Mohammad Ali immer noch auf der Fahndungsliste des FBI, auch wenn er derzeit untergetaucht war.
Nunmehr allein, während sein Team höchstwahrscheinlich in einer geheimen Einrichtung weggesperrt worden war, wo sie nie wieder das Tageslicht erblicken würden, blieb Mohammad nichts anderes mehr übrig, als seine ureigenen Ziele zu verfolgen. Und Special Agent Shari Cohen stand dabei ganz oben auf seiner Liste.
Im Fernsehen waren weiterhin die Bilder einer gut gekleideten Shari Cohen zu sehen. Sie war durchaus wortgewandt auf ihrem Podium und versicherte der Öffentlichkeit, dass man die Gefahr der Terrorzelle gebannt hatte und die Menschen nun wieder in Sicherheit wären. Auch Experten der Politik lobten den Einsatz, in dem sie die Entschlossenheit des Landes im Kampf gegen den Terrorismus, sowohl hier als auch im Ausland, bekräftigten, und dass es Leute wie Shari Cohen wären, die Amerika beschützten.
Allawi spürte, wie die Wut in ihm hochkochte.
»Wir werden noch sehen, wie special du bist, wenn ich erst an deine Tür klopfe«, sagte er leise zu sich selbst. »Und was meine Brüder anbelangt … Allahu Akbar.«
Kapitel 4
Cathedral Heights, Washington, D.C. 15. April 2016 Zehn Tage nach dem Überfall auf das Lagerhaus
Die Cathedral Heights waren ein kleines Wohnviertel für Menschen mit gehobenem Mittelklasse-Einkommen. Die Häuser hier waren geräumig, beinahe dreihundert Quadratmeter groß und mit individuellen Grundschnitten. Alles war von bester Qualität: modernste Apparaturen, Granit-Arbeitsplatten, Berberteppiche und Kamine aus Naturstein, welche die gesamte Wand der Wohnzimmer einnahmen. Die Liste der Ausstattung ließ sich beliebig fortführen.
Der Fernseher befand sich im Wohnzimmer und war laut genug, dass Shari Cohen ihn noch in der Küche hören konnte, wo sie gerade Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler einsortierte. Der Nachrichtensprecher informierte die Zuschauer über die neuesten Umfragewerte der Präsidentschaftswahlen.
Die Menschen schrien während der Wahlkampfveranstaltungen. Es kam zu Ausschreitungen, ein Zeitalter der Gewalt war auf dem politischen Parkett angebrochen und der Kandidat, der um das begehrteste Amt im Land wetteiferte, unterstützte diese sogar noch. Vernunft wich dem Irrsinn, und einst zivilisierte Handlungen arteten in Akte der Barbarei aus.
Shari konnte darüber nur den Kopf schütteln. Wir kommen von unserem Weg als Nation ab. Wir verlieren unsere Menschlichkeit.
Nachdem sie den Geschirrspüler fertig beladen hatte, lief sie ins Wohnzimmer. Ihre beiden Töchter lagen bäuchlings auf dem Boden und sahen die Nachrichten. Ihr Ehemann, Gary, richtete seinen Krawattenknoten. Er schien immer in Eile zu sein, als würde er zu spät zu einem wichtigen Termin kommen, obwohl es keine wichtigen Termine gab, zu denen er erwartet wurde. Gary war einfach von Natur aus hektisch, auch dann, wenn er alle Zeit der Welt hatte.
Er griff nach einer Kaffeetasse auf dem Küchentresen, schlürfte daraus und stellte sie wieder zurück. »Na los, Kinder, wir müssen in die Schule.«
Stephanie, die Ältere der beiden, sah sich über die Schulter. »Wir haben noch zehn Minuten.«
»Sofort.«
Unter Murren standen die beiden auf, griffen nach ihren Rucksäcken und sahen ihn dann mit Na-zufrieden?-Blicken an.
»Gehen wir«, sagte er. »Ab in den Escalade.«
Während sie zum Wagen liefen und dabei die Haustür hinter sich offenließen, zog Gary Shari zu einer Umarmung fest an sich heran. »Du weißt, was heute für ein Tag ist, oder?«
Natürlich wusste sie es. Es war Date Night, der erste von zwei Tagen, den sie sich jede Woche nahmen, um auszugehen. »Ich kann dir nichts versprechen«, sagte sie. »Ein neuer Fall.«
»Das sagst du immer. Aber du findest immer Zeit dafür.«
»Dann … italienisch?«
»Du weißt, wie sehr ich das Magianni’s liebe«, sagte er. Das Magianni’s war ein italienisches Restaurant, welches das beste Veal Parmigiana weit und breit servierte, zumindest so weit es ihn betraf. Der Wein war vom Feinsten, und das Knoblauchbrot suchte seinesgleichen, dank der Kräuterbutter mit ihrer ganz eigenen Gewürzmischung. Das Magianni’s war einfach Perfecto.
Sie küssten sich. Dann sah Gary auf die Uhr. »Muss los.« Das sagte Gary immer: Muss los. Selbst dann, wenn es nicht stimmte. Er zwinkerte ihr zu, streichelte ihr noch einmal über den Arm, und lief zur Tür. »Ich wünsche dir einen schönen Tag«, rief er, ohne sich umzusehen, dann schloss er die Tür hinter sich.
Weniger als zehn Sekunden später klingelte ihr Handy.
Kapitel 5
Während seiner Inhaftierung in der Strafanstalt Brockbridge konnte Montrell Thompson alias Mohammad Allawi der Sogwirkung des Rekrutierers des Islamischen Staates nicht widerstehen. Zum ersten Mal in seinem Leben, trotz aller Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein, war ihm ein Ziel offeriert worden, und damit Hoffnung. Außerdem hatte man ihm das Gefühl gegeben, dazuzugehören und gebraucht zu werden. Nun besaß er den Willen zum Erfolg. Er glaubte an Dinge, an die er nie zuvor geglaubt hatte, den Willen eines Gottes, über den er nur wenig wusste. Aber nun hatte Allah ihm neues Leben in seine Seele gehaucht, um ihn als lebendiges Werkzeug zu benutzen, die Welt zu ändern, auf einer glorreichen Mission.
Jahrelang hatte er nichts davon besessen – keine Aufgabe, keine Ziele, keine Sehnsüchte. Er war ein brillanter Geist gewesen, aber er hatte keinen Vater gekannt, der seine Begabungen gefördert hätte, und keine Mutter, die sich zwischen all den Drogen und dem Alkohol die Zeit genommen hatte, ihn zu leiten. Also hatte er seine Familie auf der Straße gefunden, in jenen Kindern, die so waren wie er und sich selbst ohne jede Disziplin aufzogen. Er tauchte in die Kriminalität ab, wurde Laufbursche für Gangsterbanden, denn für einen Minderjährigen fielen die Strafen oft geringer aus als für Erwachsene. Dann widmete er sich gewalttätigeren Formen wie bewaffneten Raubüberfällen. Aber es war die Anklage wegen Totschlags, für die er, wenn auch erst siebzehn Jahre alt, wie ein Erwachsener verurteilt und nach Brockbridge geschickt wurde.
Dort hatte er einen Mann namens Asad kennengelernt. Ein Afroamerikaner wie er selbst, der seine Bestimmung gefunden hatte und bereit war, sie mit anderen zu teilen. Er sprach ehrfürchtig von Allah und von einer Welt, die so viel angenehmer schien, als Montrell es sich hätte erträumen können. Es war eine Welt der Einheitlichkeit: ein Gesetz, eine Regel und eine Religion. Alle waren gleich, wirklich gleich. Und das Böse würde auf immer verbannt sein, wenn erst alle nach den Gesetzen des Islam lebten. Und am Ende würde er dafür mit der Herrlichkeit des Paradieses belohnt werden, ungeachtet seiner früheren Verbrechen.
Das alles klang überaus begehrenswert.
Und so war er hineingesaugt worden, Verstand und Willen nicht mehr seine eigenen, sondern die Allahs. Und am Tag seiner Entlassung aus Brockbridge, von dem Moment an, als der erste Sonnenstrahl sein Gesicht berührte, sah er das alles als ein Zeichen seines neu gefundenen Gottes an.
Er würde tun, was Er verlangte. Und Sein Wille war, einen neuen Glauben auf der Welt zu verbreiten, unter hohen Opfern an Menschenleben, die jedoch wenig bedeuteten, da die Ungläubigen keinen Wert besaßen.
Überhaupt keinen.
Der Tag war neblig und grau. Das Wetter war schon die ganze Woche über so gewesen. Regentropfen sammelten sich auf seiner Windschutzscheibe, während er in seinem Auto Wache hielt. Am Ende der Sackgasse befand sich ein verschwenderisch teures Ziegelhaus, etwas, dass Allah nie erlaubt hätte. Er stand hier schon seit dem frühen Morgen, als der Regen noch herunterprasselte, bevor er zu einem leichten Nieselregen nachließ. Als die Mädchen das Haus verließen und zu dem Escalade liefen, der in der Auffahrt parkte, richtete sich Mohammad urplötzlich auf. In seiner Hand befand sich etwas, das an eine Fernbedienung für ein Garagentor erinnerte, von gleicher Größe und Form und mit einem Knopf, über den ein Signal ausgesandt werden konnte.
In seiner anderen Hand befand sich ein Wegwerftelefon, ein Handy, wie man es in beinahe jedem Laden kaufen konnte und das praktisch nicht nachzuverfolgen war, weil es für dessen Aktivierung weder einen Vertrag noch einen gemeldeten Nutzer brauchte. Dann, nachdem auch der Mann das Haus verlassen hatte und zu dem Escalade lief, hob Mohammad das Handy, wählte die eingespeicherte Nummer und wartete.
***
Shari nahm nach dem dritten Klingeln ab. »Hallo?«
Keine Antwort.
»Hallo?«
»Zehn meiner Brüder befinden sich dank Ihnen jetzt im Paradies«, meldete sich die Stimme schließlich. »Zwei waren meine wirklichen Brüder. Die gleiche Mutter, unterschiedliche Väter.«
»Wer ist da?«
»Vierundzwanzig weitere wurden verhaftet und werden nie wieder das Tageslicht sehen.«
Da wurde es ihr schlagartig klar. Montrell Thompson, auch bekannt als Mohammad Allawi, der Mann, der der Razzia entkommen war. Die Behörden hatten lange und ausgiebig nach ihm gefahndet, aber der Mann hatte sein Appartement ohne eine Spur verlassen.
»Montrell«, flüsterte sie.
»Mohammad«, korrigierte er sie.
»Woher haben Sie diese Nummer?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Was wollen Sie?«
»Ich will, dass Sie ans Fenster gehen«, sagte er mit ruhiger Stimme.
»Was?«
»Gehen … Sie … ans … Fenster. Recht einfach, nicht wahr?«
Das brauchte Shari gar nicht. Sie konnte direkt durch die Vorhänge blicken und sah dort ihren Mann, der in den Escalade einstieg. In diesem Moment traf es sie, als hätte man einen Eimer eiskaltes Wasser über ihr ausgeschüttet, hart und unbarmherzig.
Sie rannte nicht zum Fenster, sondern zur Tür, riss sie auf und blieb mit dem Handy an der Seite auf der Schwelle stehen. Ihr Gesicht erstarrte zu einer Maske eines Menschen, dem gerade dämmerte, dass etwas Furchtbares geschehen würde, etwas geradezu Grauenhaftes.
Während Gary und die Kinder ihr noch zum Abschied winkten, explodierten die Motorhaube und das Dach des Fahrzeugs in einem lodernden Feuerball, der in den Himmel aufstieg. Der Escalade stieg in die Luft, wo er für einen Moment zu schweben schien, dann krachte er wieder auf alle vier Räder herunter. Metall brannte, zusammen mit Knochen und Fleisch.
Shari ließ das Handy fallen und versuchte, nach ihrer Familie zu rufen, nach ihren Kindern. Sie spürte die Hitze der Flammen an ihrer Haut, als sie ihnen die Hände entgegenstreckte.
Sie bemerkte nicht den Wagen, der am Ende der Ausfahrt auf der Straße wendete und davonfuhr.
***
Er hatte ihr befohlen, zum Fenster zu gehen. Stattdessen war sie auf die Veranda gelaufen, wo sie das Schauspiel aus erster Reihe würde verfolgen können.
Umso besser, dachte Mohammad.
Im selben Moment, als sie ihre Familie warnen wollte, drückte Mohammad den Knopf auf seiner Fernbedienung. Der Escalade explodierte noch eindrucksvoller, als er es geplant hatte. All das Feuer und der Rauch, die die Leben ihrer Familie verzehrten.
Mit einem zufriedenen Grinsen im Mundwinkel startete Mohammad Allawi den Motor, wendete den Wagen und fuhr ohne jede Eile davon. Er verhielt sich, als wäre nichts geschehen.
Kapitel 6
Heute Grabeskirche Die Altstadt von Jerusalem
Sie waren zu dritt. Attentäter. Und sie operierten in den Schatten, in einer Nacht, in der die schmale Sichel des Mondes nur wenig Licht über das Areal um die Grabeskirche warf.
Sie bewegten sich mit katzenhafter Anmut und verursachten keinerlei Geräusche, als sie sich dem Eingang der Kirche näherten. Der Anführer war ein Experte im Umgang mit zweischneidigen Waffen, weshalb man ihn auch den Mann der vielen Klingen nannte. Er war ein geübter Messerwerfer, und seine Klingen bohrten sich oft in die Kehlen seiner Gegner oder zerrissen ihre Herzen. Seine Würfe waren beinahe immer tödlich, und die Klingen surrten mit einem sanften Wispern durch die Luft, bevor sie ihr Ziel trafen und sich tief hineingruben.
Die anderen beiden trugen AK-47-Sturmgewehre ohne Schalldämpfer. Ihr Plan sah vor, dass sich der Mann-der-vielen-Klingen lautlos einen Weg durch die Kirche und das Stockwerk darunter bahnen sollte, wo in einer Gruft über dem angeblichen Grab Jesus Christus einer der begehrtesten Preise auf ihn warten würde. Aber die Reliquie selbst bedeutete diesen Männern nur wenig. Ihr wahrer Wert lag in dem, wofür sie sie eintauschen würden: modernste Waffentechnik.
Die Nacht war still, und Gewalt war in diesem Teil der Region unbekannt. Aber wie alle Attentäter besaßen auch diese ein Ziel, und das bedeutete, dass andere Leben wertlos und reine Hindernisse darstellten, und nur das Erreichen ihrer Ziele alles bedeutete.
Sie huschten den Leidensweg entlang, der Seite der Kirche, und in den Innenhof, der zu den Türen der eigentlichen Kirche führte. Die Türen waren erwartungsgemäß geschlossen, und vor dem Salbungsstein direkt hinter den Toren waren zwei muslimische Wachen postiert.
Atwa, der Mann-der-vielen-Klingen, zog zwei sehr scharfe Wurfmesser hervor und begann, mit der Spitze eines Messers vorsichtig über die Oberfläche der mittelalterlichen Tür zu kratzen.
Wenige Augenblicke später wurde ein Riegel zurückgeschoben und ein Metallstab aus ihrer kreisrunden Verankerung gezogen, und die Tür öffnete sich. Das Licht brennender Kerzen fiel auf den Kirchenhof und ihr schwacher Schein erhellte eine schwarz gekleidete Gestalt, das Gesicht mit schwarzem Stoff verhüllt, mit Ausnahme seiner rabenschwarzen Augen. Wenn es eine Sache gab, auf die Atwa immer zählen konnte, dann menschliche Nachlässigkeit. Die Menschen schienen stets unvorsichtig zu werden, wenn ihr Leben zu sicher und zur Routine wurde. Für diese Wachen sollte sich das als fataler Fehler erweisen.
Bevor der Wachmann reagieren konnte, holte der Mann-der-vielen-Klingen in weitem Bogen aus und schlitzte dem Mann die Kehle auf, von einer Seite zur anderen, bis die Ränder der Wunde wie ein grässlicher Mund aufklafften. Während der erste Wächter mit den Händen an seinem Hals nach hinten umkippte und ihm hellrotes Blut zwischen den Fingern hervorschoss, warf Atwa mit Schwung und Genauigkeit das zweite Messer. Es traf den zweiten Wachmann in dessen rechtem Auge, bohrte sich tief bis in sein Gehirn hinein. Der Mann warf den Kopf zurück, ließ seine Waffe fallen, krümmte sich, fiel nach hinten und schlug einen Augenblick später hart auf dem Boden der Adamskapelle auf. Der erste Wachmann sank in die Knie und stieß dabei würgende und fürchterlich schmatzende Geräusche aus. Seine Augenlider flatterten. Dann streckte er Atwa eine blutige Hand entgegen.
Atwa stand in gottesfürchtiger Pose im flackernden Schein der Kerzen, zog ein drittes Messer hervor, beugte sich über den muslimischen Wachmann, sagte etwas auf Arabisch zu ihm und erlöste den Mann dann von seinem Elend, indem er ihm die Spitze des Messers tief in die Schläfe trieb. Danach zog Atwa das Messer wieder mit einem widerlichen Schmatzen aus dem Schädel, als steckte es in einer überreifen, saftigen Melone.
Ohne ein Wort zu sagen, hob Atwa die Hand und gab seinen Männern das Zeichen, mit ihrer Aufgabe fortzufahren, nun, da sie ins Innere der Kirche vorgedrungen waren. Lautlos hasteten sie an der Kreuzauffindungskapelle vorüber und in die Helenakapelle. Obwohl sie den Grundriss zuvor eingehend studiert hatten, kamen sie nicht umhin, die Pracht der Kirche zu bewundern. Am hinteren Ende, in einer zweistöckigen bogenförmigen Nische, befand sich die Statue der Heiligen Helena. Nur kurz verharrten sie vor der Skulptur, bevor sie sich den Stufen zu ihrer Linken zuwandten und in den als Golgotafelsen bekannten Bereich darunter begaben – jenem Ort, an dem sich Jesus‘ Kreuzigung zugetragen hatte.
Der Tunnelgang war nur spärlich von Kerzen beleuchtet, und der Geruch von schmelzendem Talg schien überall in der Luft zu hängen.
Am Ende des Tunnels war ein Durchgang zu sehen, der in ein Gewölbe führte. Darin befand sich ein Schatz von unermesslichem Wert.
Atwa legte eine Hand an die massive Holztür, die von schwarzen Stahlbändern und Nieten zusammengehalten wurde. Ohne ein Wort zu sagen, wich Atwa einen Schritt zurück und deutete auf das schwarze Stahlschloss, zu dessen Schlüsselloch zweifellos ein sehr großer Schlüssel gehörte. Der zweite Attentäter trat hinzu, griff in seine schwarze Kleidung und holte daraus ein kleines Päckchen C-4-Sprengstoff hervor. Er bearbeitete es wie Play-Doh, knetete es zwischen seinen beiden Händen, um eine Kugel daraus zu formen, und klebte diese an das Schloss. Nachdem er auch die Zünder angeschlossen hatte, trat er zurück und wartete darauf, dass der Sprengstoff mit einer kleinen Zeitverzögerung gezündet wurde. Plötzlich explodierten das Stahlschloss und Teile der Tür nach außen, und Holzsplitter und Metallfragmente regneten auf den Boden. Der Untergrund bebte. Der Lärm war ohrenbetäubend.
Nachdem der Rauch sich verzogen hatte, sahen sie das Objekt ihrer Begierde auf einem Altar am hinteren Ende des Raumes. Die Wände und auch der Altar selbst, auf dem die Reliquie ruhte, schimmerten in purem Gold. Das Leuchten schien beinahe ätherisch zu sein und in seiner an einen Heiligenschein erinnernden Art beinahe ein Eigenleben zu besitzen. Der dritte Attentäter nahm hastig die Reliquie an sich, wickelte sie in schwarzen Stoff und nickte Atwa zu: Verschwinden wir.
Sie verließen die unterirdische Kammer so schnell, wie sie sie betreten hatten. Nur, dass sie dieses Mal von den Geistlichen begrüßt werden würden, die der Lärm aufgeschreckt hatte. Atwa nahm ein Messer in jede Hand, übernahm die Führung und stürmte die Treppenstufe in die Kapelle hinauf.
Ein Priester in seinem Ornat kam die Stufen hinunter, und Atwa zielte auf ihn. Das Messer brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde, um den Abstand zwischen ihm und seinem Ziel zurückzulegen, und bohrte sich tief in die Kehle des Geistlichen. Der Priester taumelte, glitt an der Steinwand hinunter und begann dann, die Stufen hinunterzufallen.