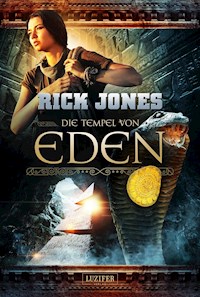Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ritter des Vatikan
- Sprache: Deutsch
Sie sind Elitesoldaten der ganz besonderen Art, denn sie stehen allein im Dienste Gottes: DIE RITTER DES VATIKAN Terroristen ist es gelungen, unter dem Tempelberg die echte Bundeslade aufzuspüren und in ihren Besitz zu bringen. Ein Krieg zwischen den großen Weltreligionen steht zu befürchten, doch dann bieten die Terroristen überraschend an, die Bundeslade als Zeichen des guten Willens und der Versöhnung dem Vatikan übergeben zu wollen. Niemand aber ahnt, dass die heilige Reliquie als trojanisches Pferd missbraucht werden soll … "Rick Jones ist die Zukunft des Thrillers." - Richard Doetsch (Bestseller-Autor von THE THIEVES OF FAITH und THE 13th HOUR) In den Achtzigerjahren begannen weltweit die ersten Forscher mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Nun, über dreißig Jahre später, wurde diese Technologie perfektioniert. In einer Forschungsstation in der unwirtlichen Gebirgsregion des Iran wurden Nanobots geschaffen, winzig kleine Roboter mit der Fähigkeit zu lernen, sich zu entwickeln … oder zu töten. Darauf programmiert, als ultimative Jäger alles zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, soll die Bundeslade nun den Nanobots als Büchse der Pandora dienen. Einmal vor den Augen der Welt geöffnet, wäre eine unsichtbare Gefahr entfesselt, welche die völlige Zerstörung Roms zur Folge haben könnte. Doch wie bekämpft man etwas, das man nicht sehen kann, und einen Feind, der immer einen Schritt voraus scheint? Band 4 der Bestsellerreihe um das schlagkräftige Elitekommando des Vatikans – ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit im Stil der TV-Serie "24".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die Büchse der Pandora
Die Ritter des Vatikan – Band 4
Rick Jones
This Translation is published by arrangement with Rick Jones Title: Pandora’s Ark. All rights reserved. First published 2016.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: PANDORA’S ARK Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-399-2
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Um keine Aktion, News oder Angebote zu verpassen,
empfehlen wir unseren Newsletter.
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Jerusalem, 956 v. Chr.
Gerade, als sich der Himmel über Jerusalem während des Sonnenaufgangs blutrot zu färben begann, stand der alte Priester auf den Zinnen, welche die Stadt umringten, und sah auf die unermessliche Größe von Shishaks Armee hinunter, die sich scheinbar endlos über die Wüstenlandschaft erstreckte.
Tage zuvor hatten Boten gemeldet, dass Shishaks Reihen bereits die Stadt Judah im Norden eingenommen hatten und nun nach Jerusalem marschierten, um deren Schätze ihren falschen Göttern opfern zu können.
Die Hebräer nannten ihn Shishak. Für die Ägypter war er als Sheshong I. bekannt, als Kriegerkönig, der keine Grenzen kannte, wenn es um den Krieg ging. Seine Legion aus 1.200 Streitwagen und 60.000 Reitern, bestehend aus Libyern, Sukkitern und Kuschiten, bahnte sich so dicht gedrängt ihren Weg, dass man zwischen ihnen keinen Fußbreit Land mehr sehen konnte.
Während der alte Priester auf dem Wall der Stadt stand und seinen Blick schweifen ließ, wehte eine warme Brise heran und blies seinen spitz zulaufenden Bart über seine Schulter. Eine unleugbare Traurigkeit angesichts der drohenden, furchtbaren Realität ergriff ihn. Selbst die sengende Wüstenhitze als Verbündeter und die hoch aufragenden Mauern würden nicht genügen, um die Armee des Pharao aufzuhalten.
Jerusalem würde fallen.
Hoch oben, aus den Wachtürmen, ertönte das Warnsignal der Hörner, ein harscher und beißender Klang, der die Massen in Aufruhr versetzte. Die Reichen rafften so viel Geld zusammen, wie sie nur konnten, während die niedrigeren Kasten sich bewaffneten, um die Truppen an der Stadtmauer zu verstärken. Jene, die jedoch die Sinnlosigkeit erkannten, sich Shishaks Reihen entgegenzustellen, flohen durch das Südtor, wo sie bereits von den Sukkiten erwartet und von deren Kampfeslust wie berauscht barbarisch abgeschlachtet wurden.
Der Priester, dessen Gesicht angesichts des Gemetzels durch die Schwerter der Armee Shishaks die Verlorenheit einer Gummimaske angenommen hatte, musste an die Schätze in ihrem Heiligen Tempel denken. Von Alter und Gebrechen gezeichnet, begann Abraham, langsam die Leiter hinabzusteigen, und betete zu Gott, dass dieser ihm genügend Zeit gewähren möge, um die wertvollste Seiner Gaben vor Shishak bewahren zu können.
Er setzte seinen Fuß auf den Boden Jerusalems, bahnte sich seinen Weg durch die aufgeschreckten Massen und versuchte zu dem Heiligen Tempel zu gelangen.
Die kunstvoll verzierten Säulen, die riesigen Bögen und die goldene Kuppel des Tempels schienen ihm zu weit entfernt, egal, wie sehr sich der alte Mann auch mühte, die Lücke zu schließen. Seine Schritte kamen ihm unendlich langsam vor, während er durch die Horden von Menschen watete, die selbstvergessen durch die Straßen rannten.
Als er schließlich den Zugang zu dem Tempel erreichte, wusste er, dass dies sein letzter Sonnenaufgang sein würde.
Mit Augen, die so schwarz erschienen, als würden sie über keine Pupillen verfügen, beobachtete Shishak von einer weit entfernten Erhöhung aufmerksam die Stadt Jerusalem. Und doch wohnten in seinem Blick auch eine große Intelligenz und das Gewicht uneingeschränkten Selbstvertrauens.
Vom Sattel seines weißen Rosses, dessen Mähne so goldgelb wie Mais schimmerte, ließ Shishak seinen Blick über seine Truppen schweifen. Er war groß und schlank, seine Haut von der Farbe gegerbten Leders. Seine Statur war kräftig, sein Kopf kahlrasiert und sein Kinn knochig und kantig. Mit seinem sehnigen Hals, der aus einer kunstvoll verzierten Halskette aus Gold und Juwelen herausragte, wurde Shishak seinem Titel als Kriegerkönig mehr als gerecht.
Neben ihm befand sich Darius, sein gefeierter Leutnant, dessen Haut so schwarz war, dass sie an Auberginen erinnerte. Seine breiten Schultern, sein gewölbter Brustkorb und die dicken Oberarme waren durch jahrelangen Umgang mit Schwert und Schild entstanden.
Augenscheinlich hatte Darius Schwierigkeiten, sein Pferd unter Kontrolle zu halten. Das Ross wieherte und stieg mit seinen Vorderläufen in die Luft, bevor es sich schließlich nach einem Ruck an den Zügeln der Kontrolle des Leutnants beugte.
»Mein König«, sagte Darius, »der Himmel besitzt die Farbe von Blut, was nie ein gutes Omen ist. Selbst mein Pferd wittert die unguten Vorboten.«
Shishak sah seinen Leutnant von der Seite an. »Dein Pferd ist nicht imstande, die Vorhersage eines Orakels zu wittern. Das dunkle Omen, welches du zu sehen glaubst, entspringt einzig deinem Herzen.« Daraufhin widmete er sich mit scheinbar teilnahmsloser Ruhe wieder der Beobachtung der Stadt Jerusalem. »Wo du eine Gefahr zu sehen glaubst«, erklärte er tonlos, »sehe ich ein Zeichen von Ra, dass das Blut unserer Feinde den Boden bedecken und eins mit dem Himmel werden wird. Und wie bereits in Judah wird ihr Blut Zeugnis unseres Sieges sein. Rot wird heute eine gute Farbe sein, Darius. Und bevor dieser Tag vorbei ist, werden die Hufabdrücke meines Hengstes im Sand von Blut gefüllt sein.«
Shishak ließ sein Pferd ein paar Schritte nach vorn traben, um seine Armee besser überblicken zu können. Ihre schiere Stärke ließ sich kaum ermessen. Das gesamte Gelände vor ihnen war mit Soldaten bedeckt, soweit das Auge reichte.
»Gewiss, mein König.« Eilig gab Darius seinen Kommandeuren das Signal, sich auf die Schlacht vorzubereiten, indem er sein Schwert hoch in den Himmel streckte, wo sich die Klinge dunkel vor dem blutroten Himmel abzeichnete. Dann ritt er an der Frontlinie entlang und heizte mit Tiraden den Blutdurst der sechzigtausend Männer an.
Als er wieder zu seinem Platz neben dem Pharao zurückgekehrt war, steckte er sein Schwert zurück in die Scheide. Um sie herum reckten Shishaks Krieger ihre Speere und Schwerter in die Höhe und skandierten ihren Sieg im Namen Ras.
»Sie warten auf Deinen Befehl, mein König.«
Shishak ließ sein Schwert aus seiner mit Juwelen besetzten Scheide gleiten und hob es gen Himmel. Das Kriegsgeschrei seiner Armee eskalierte wie im Fieber in Erwartung des bevorstehenden Kampfes. Dann wandte er sich Darius zu, mit Augen, in denen die Entschlossenheit brannte, zu kämpfen, zuzustoßen und zu töten. Er würde sich nicht zurücklehnen und das Geschehen aus der Ferne beobachten, sondern selbst in das Blutvergießen stürzen, bis die Luft kupfern stank. »Ich will alle Reichtümer des Heiligen Tempels«, erklärte er. »Alles davon soll im Tempel des Ra als Huldigung unseres Sieges dargeboten werden.«
»Gewiss, mein König.«
»Aber wir müssen ihn vor den Priestern erreichen«, fügte er hinzu.
»Die Sukkiten bahnen sich in diesem Moment bereits von Norden her einen Weg durch die Stadt, mein König.«
Shishak streckte die Spitze seines Schwertes noch etwas höher empor. »Dann setzte die Truppen in Marsch«, befahl er. »Ich will die eine Sache, die sie am meisten begehren.«
»Unsere Quellen berichten, dass sich ihr heiligster Schatz inmitten der Kammer befindet, umgeben von Bergen aus Gold.«
»Dann beanspruchen wir für uns, was rechtmäßig Ra gehört«, sagte er. Und mit diesen Worten deutete er mit seinem Schwert in Richtung Jerusalem und sah zu, wie seine Armee auf die Stadtmauern zustürmte, fest entschlossen, niemanden am Leben zu lassen.
In Jerusalem wurde er Abraham genannt, ein hochrangiger Priester, der von den Massen beneidet wurde und dessen Weisheit selbst sein hohes Alter noch überstieg. Mit über siebzig Jahren war er äußerlich so gealtert, dass seine Haut an geschmolzenes Wachs erinnerte und ihm ein Aussehen verlieh, als wäre er so uralt wie die Wüste, die ihre Stadt umgab. Trotz des brennenden Gefühls in seinen Lungen und wachsender Schwerfälligkeit in seinen Beinen hastete Abraham mit weit ausgreifenden Schritten durch die düsteren Gänge zu der heiligen Schatzkammer.
Bevor er die Tür zur Schatzkammer erreichte, kam er an drei jungen Männern vorbei, welche die Kapuzenroben eines Priesters trugen, aber die Priesterweihe noch nicht erlangt hatten. Vielmehr handelte es sich um Jungen, denen gerade ihre ersten Bärte wuchsen, an denen man schließlich ihre Position in der heiligen Hierarchie erkennen würde.
Als sie Abraham erblickten, streckte einer der Brüder dem alten Mann die Hand entgegen, um ihm Halt zu geben. Mit pfeifender Lunge und einem Gesicht so bleich wie der Unterbauch eines Fisches lehnten sie Abraham gegen eine Wand, um ihn zu beruhigen.
»Ihr müsst die anderen finden«, ließ er die Brüder atemlos wissen. »Schickt sie zur heiligen Schatzkammer … ich werde sie dort treffen.«
»Ist es der, den sie Shishak nennen, der gegen Jerusalem vorrückt?«, fragte einer der Brüder.
Der alte Mann nickte hastig. Er ist es. »Beeilt euch!«, rief er dann aus. »Uns bleibt nicht mehr viel Zeit!«
»Und was ist mit dir?«
Abraham winkte ab. »Kümmert euch nicht um mich«, sagte er. »Geht!«
Ohne weitere Fragen eilten die jungen Priester davon und ließen Abraham allein wieder zu Kräften kommen. Mit der Beweglichkeit eines gebrechlichen, in die Jahre gekommenen Mannes hastete Abraham auf wackeligen Beinen weiter durch die Gänge. Doch seine priesterliche Überzeugung, den Schatz ihres Gottes in Sicherheit zu bringen, trieb ihn immer weiter an.
Auf seinem Weg die Treppenstufen hinab mutete die Luft abgestanden, beinahe wie in einem Grabgewölbe an. An die ihn umgebenden Wände warf das Licht der gierig nach Luft leckenden Flammen gespenstische Schatten. In seiner Unterwürfigkeit seinem Gott gegenüber bat er um zusätzliche Stärke, in Worten, die nun nur noch als Flüstern über seine Lippen kamen.
»Bitte, lieber Gott, gib mir die Kraft, Dir in dieser Not zu dienen. Gib mir die Kraft, dies zu überstehen.«
Als das letzte Wort seine Lippen verlassen hatte, erreichte Abraham das Ende der Treppe. Weniger als zwanzig Meter vor ihm erblickte er den Bogengang, der in die heilige Schatzkammer führte.
Nachdem er die dicke hölzerne Tür geöffnet hatte, die von schwarzen Stahlbändern und Nieten gehalten wurde, raubte ihm wie jedes Mal stets der Anblick des Schatzes den Atem. An den Wänden brannten mehrere Fackeln. Das Licht ihrer Flammen tanzte flackernd über jedes Goldstück und verlieh selbst der kleinsten Münze einen blendenden Schein.
Die Kammer war kreisrund und in ihr erhoben sich pyramidenartig Berge aus Gold, Rubinen und Saphiren, von denen einige so hoch wie ein ausgewachsener Mensch aufragten. An der hinteren Wand gegenüber der Tür hingen die goldenen Schilder des Salomon, beinahe dreihundert an der Zahl. Jedes von ihnen glitzerte golden, wenn das Licht der Fackeln von ihrer Oberfläche reflektiert wurde. In der Mitte der Kammer befand sich jedoch der begehrteste der Schätze, etwas, das so hell schimmerte, dass es selbst das glänzendste Stück Gold noch übertraf. Von einem geradezu perfekten weißgoldenen Heiligenschein umgeben stand dort die Bundeslade.
Der Hohepriester näherte sich vorsichtig dem spektakulären goldenen Leuchten, das beinahe lebendig anmutete, und begann zu beten.
Die Lade war wundervoll gearbeitet, geschaffen aus dem Holz des Akazienbaums und mit reinem Gold bedeckt. Sie maß anderthalb Königsellen in der Breite und Höhe, und zwei Königsellen entlang des oberen Deckels, dem Gnadenthron. An beiden Seiten befanden sich zwei goldene Ringe für hölzerne Stangen, mit denen man die Lade tragen konnte. Die Oberseite der Lade wurde von zwei Cherubinen gekrönt, die sich einander zugewandt gegenseitig mit den Spitzen ihrer Flügel berührten und damit den Thron Gottes formten, während man die Lade selbst als Gottes Schemel ansah.
Und während Shishak mit seinen Truppen immer näher rückte, betete Abraham um göttlichen Beistand, der in Form von acht jungen Männern erschien, hauptsächlich Priestern, die Roben mit Kapuzen und dicke Kordeln um die Hüften trugen.
»Die Stangen«, sagte Abraham und deutete auf die langen, mit kunstvollen Verzierungen aus Gold geschmückten Holzpflöcke. »Wir haben nicht mehr viel Zeit!«
Nachdem sie die Stangen durch die goldenen Ringe geführt und befestigt hatten, griff sich Abraham eine Fackel und bedeutete den Priestern, ihm zu folgen.
Selbst mit der Kraft von acht jungen Männern taten sich die Priester schwer, die Bundeslade durch die Kammer zu hieven.
Abraham, der vorausging, erhellte mit seiner Fackel eine kleine Öffnung an der hinteren Wand. Der Gang war jedoch so tief in den Schatten verborgen, dass das Licht die Dunkelheit erst dann zu durchdringen vermochte, als er direkt vor ihm stand.
»Hier entlang«, sagte er.
Sie trugen die Lade durch eine Art Tunnel, dessen Wände nur grob behauen waren. Auch der Boden, über den sie liefen, war uneben und hügelig, was den Transport ihrer großen Last erschwerte. Am Ende des Ganges schloss sich jedoch eine zweite, beeindruckende Kammer an; eine, deren Kuppel nahtlos in Wände überging, die perfekt und ohne jeden Makel waren. Im Zentrum dieses Raumes lag ein erhöhter Steinblock, auf dem die Lade ruhen würde.
Nachdem die Priester die Bundeslade auf der Plattform abgestellt hatten, schritt Abraham die Wände entlang und entzündete Fackel für Fackel. Als sich das Licht vom Rand der Kammer ausbreitete und im Herzen der Lade traf, schien diese von einer geistigen Macht unbändiger Wärme zum Leben zu erwachen, was die Priester vor ihr auf die Knie fallen ließ.
Abraham aber schritt rastlos weiter.
Neben der letzten Fackel befand sich eine kreisrunde Aussparung, die gerade tief genug war, dass man seinen Arm bis zur Schulter hineinstecken konnte. Abraham griff nach einem Eisenring und drehte ihn nach rechts. Ein knirschendes Geräusch ertönte, als würden riesige Steine gegeneinander reiben, und der Boden unter ihnen erbebte und drohte aufzubrechen.
Während die Priester noch immer vor der Bundeslade knieten, rieselte Staub von der Decke auf sie hinab, bis ihre Umhänge die Farbe von Sand angenommen hatten. Dann, mit einem letzten Beben, stürzte der Eingang unter Tonnen von herabfallendem Gestein und Trümmern zusammen. Der Gang dahinter implodierte ebenfalls, und eine riesige, dichte Staubwolke schoss in die Kammer. Als das Beben endlich verebbte, senkte sich eine unheilvolle Stille auf sie herab.
Einer der Priester sprang ruckartig auf. Sein Gesichtsausdruck offenbarte die Erkenntnis, dass sein Schicksal von einer einfachen Drehung der Hand des alten Mannes besiegelt worden war. »Sind wir eingeschlossen?«, fragte er.
Der alte Mann platzierte die Fackel in ihrer Halterung und trat dann zu den Priestern, die sich nun alle aufgerichtet hatten. »Ihr müsst mir vergeben«, erklärte er. »Ich durfte nicht zulassen, dass Shishak in den Besitz der Bundeslade gelangt. Bei all dem Gold und den Schilden des Salomon ist sie der einzig wahre Schatz.«
»Und unsere Leben?«, fragte ein anderer. »Ihr habt uns nicht einmal die Gelegenheit gegeben, unser Heil in der Flucht zu suchen. Stattdessen habt ihr uns zu diesem Opfer verdammt.«
Abrahams Stimme war von Trauer erfüllt, aber nicht reumütig. »Hätte Shishak auch nur einen von euch in die Finger bekommen, hätte er euch das Fleisch von den Knochen abgezogen, um den Aufbewahrungsort der Bundeslade zu erfahren. Etwas, das ihm nicht gestattet werden durfte.« Dann schloss der Priester die Augen, streckte seine Handflächen in Richtung Decke und wandte sich der Lade zu. »Ihr müsst verstehen, dass dies weitaus größer ist als wir alle. Ist es denn nicht besser, in der Gegenwart Gottes zu sterben … als durch die Hand des Pharao Shishak?«
Die anderen Priester senkten ihre Häupter und mussten sich eingestehen, dass der Hohepriester recht hatte. In der Anwesenheit von Gott zu sterben war das Höchste, verglichen mit den Krummsäbeln Shishaks.
Gemeinsam begannen die Hüter der Bundeslade zu beten.
Jerusalem war gefallen. Die Leichen seiner Bewohner füllten die Straßen der Stadt, und ihr Blut floss in Strömen und wurde eins mit dem blutroten Himmel, ganz so wie von Shishak befohlen. Am Ende würde es kein schlechtes Omen bedeuten, wie von Darius befürchtet, sondern ein Vorbote ihres Triumphs, gesendet von Ra. Dessen war sich Shishak sicher.
Als der ägyptische König seine Legionen zu dem Tempel hinauf führte, war der Himmel nicht länger rot, sondern blau und voller turmhoher schwarzer Rauchsäulen, die in den Himmel hinaufstiegen, um die Morgensonne zu begrüßen. Jerusalem stand in Flammen.
Der Tempelberg war beeindruckend, selbst für Shishaks Ansprüche, dessen Vorliebe eher der ägyptischen Architektur galt. Der Tempel selbst war ein massiver Komplex aus Steinbögen und monumentalen Säulen. Die gewaltigen Gänge und riesigen Hallen übten eine fast hypnotische Wirkung auf Shishak aus, und er empfand beinahe Reue, eine Stadt besiegt zu haben, die so reich an Komplexität und Schönheit war. Für einen Moment erwog er sogar, diese architektonische Kultur in seine eigene einfließen zu lassen. Aber dann schob er den Gedanken schnell wieder beiseite, weil er ahnte, dass diese Kultur nur die Perfektion der Ägypter schmälern würde.
Am Heiligen Tempel angekommen stieg Shishak von seinem Pferd und legte seine Hand gegen das Tor, als könnte er durch die Berührung allein seine Geheimnisse lernen. Dann gab er seinen Männern das Zeichen, dieses aufzubrechen.
Es dauerte beinahe eine Stunde, bis das Tor zerstört war und ihnen Zutritt zu einem dunklen Gang gewährte, der in die Tiefen unterhalb des Tempelberges führte.
Mit seiner brennenden Fackel stieg Darius die Treppenstufen hinab. »Die Kammer liegt tief im Inneren«, erklärte er Shishak. »Wir werden viele Männer benötigen, um die Schätze zu bergen, ganz besonders die Lade.«
»Die Bundeslade steht an erster Stelle«, sagte Shishak. »Sorge dafür, dass mit größter Sorgfalt vorgegangen wird.«
»Verstanden.«
Mit mehreren Fackeln ausgestattet stiegen sie die gut erhaltenen Stufen hinab. Unten angekommen fiel ihnen der staubbedeckte Boden auf, was ihnen seltsam vorkam, wo doch der Rest des Tempels makellos war, und es sich immerhin um einen Ort der Gottesverehrung handelte. Als sie dann die Kammer betraten, waren sie überwältigt von den ungeheuren Reichtümern, die sie hier vorfanden und die ihre kühnsten Träume bei weitem überstiegen. Die Wände waren gesäumt mit den Schildern Salomons, der Traum eines jeden Plünderers. Und dazwischen türmten sich überall Berge aus goldenen Münzen und Edelsteine aller Größen, Farben und Formen auf. Und doch wirkten sie nicht üppig oder glänzend. Das Schimmern des Goldes wurde von einer dicken Staubschicht abgeschwächt, die noch immer durch die Luft wehte.
Shishak lief ins Zentrum der Halle. Dieses war leer. »Wo ist die Lade, Darius? Sagtest du nicht, sie würde sich in der Mitte der Halle befinden?«
Darius trat neben ihn. »Sie haben sie weggebracht«, sagte er. »Außer diesem Flecken hier gibt es keinen anderen Platz, an dem sie gestanden haben könnte.«
»Wenn das stimmt«, entgegnete Shishak, »würde es Hinweise darauf geben, dass man sie kürzlich bewegt hat, aber der Boden ist dick mit Staub bedeckt, ohne jeglichen Hinweis, dass sie sich überhaupt jemals hier befunden hat.« Shishak trat ein paar Schritte nach links, hob einen goldenen Kelch voll Manna auf, und warf ihn dann wütend davon. »Sie war nie hier«, verkündete er schließlich. »Sammelt alles ein und bereitet den Abtransport vor. Diese Schätze gehören in den Tempel eines wahren Gottes.«
»Jawohl.«
»Und Darius?«
»Ja?«
»Sollte einer der Soldaten auch nur ein Goldstück stehlen, will ich, dass man an ihm ein Exempel statuiert und er sofort hingerichtet wird. Und behalte besonders die Sukkiten im Auge. Söldner scheinen oftmals eine Schwäche für Reichtümer zu haben, die ihnen nicht gehören.«
»Verstanden.«
Kapitel 1
In der Nähe des Tempelberges, Jerusalem, heute
Adham Ghazi war nun schon seit vielen Jahren auf der Suche nach der Bundeslade und hatte jedes Schriftstück studiert, das über ihren Verbleib berichtete, und jede Möglichkeit ihrer Existenz erforscht. Er hatte die Kapelle neben der Kirche St. Maria von Zion in Axum, Äthiopien, besucht, nur um feststellen zu müssen, dass die dort verborgene Bundeslade ein Duplikat war. Er war nach Elephantine in Ägypten und vielen anderen Schauplätzen der arabischen Welt gereist, hatte aber auch dort immer nur Nachbildungen vorgefunden, deren Qualität von billigen Kopien bis hin zu durchaus adäquaten Imitationen reichte.
Der letzte noch zu untersuchende Ort befand sich unter dem Tempelberg in Jerusalem, den sowohl die Israelis als auch die Araber als ihr eigenes souveränes Territorium ansahen. Doch in Wirklichkeit blieb die Region in einem Schwebezustand, was ihre Zugehörigkeit anbelangte, nachdem die Vereinigten Staaten sich geweigert hatten, das Land als gänzlich zu Israel gehörig anzuerkennen, auch wenn es seitdem unter ihrer Kontrolle lag.
Seit über einem Jahr hatte Ghazi im Geheimen an einem langen Tunnel gearbeitet. Und obwohl der Prozess recht lautlos vonstattengegangen war, galt immer zu befürchten, dass er entdeckt wurde. Mit Hilfe von detaillierten Notizen und möglichen GPS-Koordinaten, die er vom Iranischen Geheimdienst bekommen hatte, verbrachte er viele lange Nächte damit, die mögliche genaue Position der geheimen Kammer ausfindig zu machen.
Nachdem sie sich bis auf fünfunddreißig Meter an die vermutete Stelle herangebohrt hatten, und aus Angst, dass die Vibrationen ihrer Bohrer die Israelis alarmieren könnten, arbeiteten sie von da an nur noch mit Spitzhacken und Schaufeln weiter, was ihr Vorankommen jedoch deutlich verlangsamte.
Aber Ghazis Geduld würde sich bald als lohnend herausstellen.
Tag für Tag und Nacht für Nacht wurden die Spitzhacken geschwungen, und Ghazi sah dabei zu, obwohl seine Hände nie wieder ein Werkzeug in den Händen gehalten hatten, seit er die Position eines Lieutenants der al-Qaida begleitete.
Als solcher war er an der Planung mehrerer Angriffe auf israelische und amerikanische Ziele involviert gewesen, sowie an Attacken gegen jeden, der mit diesen Ländern Beziehungen pflegte. Kurz vor bin Ladens Hinrichtung in Pakistan hatte dieser ihm befohlen, die Bergung der Bundeslade zu planen und zu leiten. Warum, wusste er nicht, und hatte sich auch nie getraut, danach zu fragen.
Er war ein großer und schlanker Mann, der makellos reine und fein gebügelte Kleidung trug und trotz des Staubs, der die ganze Zeit durch die Luft wirbelte, und der Hitze, die immer unerträglicher wurde, niemals schmutzig zu werden oder zu schwitzen schien. Sein Gesicht war dünn, sein Bart sorgfältig geformt, und seinen Augen wirkten dunkel, mürrisch und voll stiller Intensität. Aber er war auch über alle Maßen geduldig, und das war eine tödliche Eigenschaft, wenn man sie mit dem Drang zusammenbrachte, für eine Sache notfalls auch zu töten.
Er stand vornübergebeugt vor einem Tisch, auf dem ausgebreitet eine Karte und ein Kompass lagen. Die Luft war heiß und stickig. Die unterirdische Kammer wurde nur von ein paar wenigen Glühbirnen erhellt, die lediglich schwaches Licht spendeten. Er schien davon jedoch unbeeindruckt zu sein und studierte den auf der Karte verzeichneten Fortgang der Arbeiten. Die roten Linien zeigten an, dass sie sich dem Tempelberg immer weiter näherten. Allein mit den Spitzhacken als Werkzeugen würden sie nur langsam vorankommen, und wahrscheinlich würde es noch weitere zwei oder drei Monate dauern, selbst wenn sie rund um die Uhr arbeiteten.
Der Mann biss die Kiefer zusammen, bis die Muskeln hervortraten. Das war das einzige Zeichen von Ungeduld, welches er sich bisher anmerken ließ.
Ein Arbeiter, spindeldürr und mit Dreck beschmiert, betrat mit einer Spitzhacke in der Hand die Kammer. Aus seinem Blickwinkel war Ghazi nicht mehr als ein Schatten in dem dämmrigen Licht. »Commander, wir sind durchgebrochen.«
Ghazi hob eine Augenbraue. »Das ist unmöglich«, sagte er, »wir haben immer noch dreißig Meter vor uns.«
Der Mann nickte. »Aber wir sind auf eine Kammer gestoßen.«
Ghazi fuhr mit dem Finger seine Tabellen und Zahlen ab. Es war unmöglich, dass seine Berechnungen falsch sein konnten. Wenn es also eine angrenzende Kammer gab, war diese in den ihm zur Verfügung gestellten Plänen nicht vermerkt.
»Habt ihr einen Blick hineingeworfen?«, fragte er schließlich.
Der Araber schüttelte den Kopf. Nein. »Das Licht reicht nicht sehr weit hinein. Aber der Raum scheint groß zu sein.« Daraufhin senkte der Mann aus Ehrfurcht vor Ghazi den Kopf. »Wir dachten, es wäre besser, wenn Sie die Kammer als Erster betreten, da die Ehre der Entdeckung Ihnen gebührt.«
Ghazi lief hinaus, und als er an dem Arbeiter vorbeikam, gab er ihm einen kurzen Klaps auf die Schulter. »Das war sehr weise von dir, mein Freund.«
Der Tunnel, der zu der Öffnung in der Wand führte, war sauber ausgehoben worden. Zwar waren die Wände grob behauen, aber der Gang war doch groß genug, um sich frei darin bewegen zu können, ohne den Kopf einziehen zu müssen. Als er den Durchgang erreichte, wichen die anderen Arbeiter vor ihm zurück.
Er streckte die Hand aus und schnippte mit den Fingern, woraufhin ihm einer der Arbeiter eine schwere Taschenlampe reichte, die in der Lage war, einen Raum mit der Kraft von zehntausend Kerzen zu erhellen. Doch so leistungsstark sie auch sein mochte, gelang es auch ihr nicht, die Dunkelheit zu durchdringen.
»Es ist definitiv eine Kammer«, sagte er. »Aber es ist nicht die Kammer.«
Mit der gebotenen Vorsicht betrat Ghazi den Raum und schwenkte dabei die Taschenlampe immer wieder hin und her. Dann sah er aus den Augenwinkeln ein kurzes Funkeln, einen goldenen Schimmer, bevor dieser wieder erlosch und verschwand. Er richtete die Taschenlampe auf die Quelle des Schimmerns aus, konnte jedoch nur eine nicht näher zu bestimmende Form in der Dunkelheit erkennen. Was immer sich dort befand, lag noch außerhalb der Reichweite seiner Taschenlampe, aber es war definitiv ein Objekt.
Je näher er diesem mit seiner Taschenlampe kam, umso mehr arbeitete das Licht Formen und Umrisse heraus. Und dann wurde ihm schlagartig klar, dass er endlich die wahre Bundeslade gefunden hatte.
Er hatte all die antiken Tafeln, Texte, Schriftrollen und auch die entsprechenden Passagen in der Bibel und im Koran studiert, die Hinweise auf den Verbleib der Lade enthielten, doch die Zeugen, die von diesen Orten berichteten, hatten dort offensichtlich nur Imitate und Duplikate vorgefunden. Doch nirgendwo war ein Raum hinter der Hauptkammer unter dem Tempelberg erwähnt worden. Und da dieser Raum in den historischen Aufzeichnungen keine Erwähnung fand, schloss Ghazi daraus, dass die wahre Lade niemals gefunden werden sollte. Allah sei Dank hatte auch er sie nur durch einen glücklichen Zufall entdeckt.
Der Araber trat näher an das Artefakt heran. Die Bundeslade war vom Staub der Jahrhunderte bedeckt, aber ansonsten unangetastet. Er ließ das Licht seiner Taschenlampe über die Lade und ihren Sockel gleiten und bemerkte die Überreste der Skelette der Hüter der Lade. Seit über dreitausend Jahren hatte sich der Stoff ihrer Roben nun schon zersetzt, sodass nur noch wenige Gewebefetzen übrig geblieben waren, welche die Knochen bedeckten. Und seit dreitausend Jahren war ihr Geheimnis in Sicherheit geblieben.
Bis heute, dachte er bei sich.
Er streckte seine Hand nach der Lade aus, ließ seine Finger zärtlich über die Flügel der Cherubim-Figuren gleiten und lächelte. Die Bundeslade zu berühren bedeutete den sicheren Tod, so verkündete es jedes existierende Dokument. Und doch stand er hier, strich mit der Hand über die Lade und spürte weder Hitze noch Kälte oder elektrische Spannung. Die Lade bestand einfach nur aus purem Gold und der Mythos war nichts weiter als eine Legende, um die Massen willfährig und ihren blinden Glauben intakt zu halten.
Ein solcher Schatz aber würde mehr als Glaube und Hoffnung beinhalten.
Bald schon würden es Tod und Dunkelheit sein.
»Entfernt die Abdeckung«, befahl er.
Vier Männer, die aussahen, als hätten sie seit Tagen ohne eine Dusche geschuftet, schoben vorsichtig den Deckel zur Seite, hoben ihn an und legten ihn danach behutsam zwischen den Skeletten der Hüter ab.
In der Bundeslade befanden sich weitere Schätze.
Seit über drei Jahrtausenden unberührt lagen vier Gegenstände in dem Artefakt: Ein goldener Kelch, gefüllt mit dem Staub von etwas, das über die Zeit vergangen war; der Stab Aarons, dem Bruder Moses; und zwei steinerne Tafeln mit hebräischen Inschriften. Die Zehn Gebote.
Ghazi schien von seiner Entdeckung beeindruckt zu sein.
Mit größter Sorgfalt hob er eine der Tafeln an. Die Inschrift war noch überaus gut erhalten, und mit seinen Fingern fuhr er die Schriftzeichen ab.
»Geschrieben von den Fingern Gottes«, bemerkte er zu niemand bestimmten. Dann legte er die Tafel zurück in die Lade, mit der gleichen Vorsicht, mit der man ein Baby in seine Krippe legen würde. »Wir nehmen die Tafeln mit uns«, ergänzte er. »Den Stab und den goldenen Kelch aber lassen wir hier, als Beweis für die Israelis, dass die Bundeslade entdeckt wurde, und wir in ihrem Besitz sind. Aber seid vorsichtig, wenn ihr sie fortbringt!«
Die Bergarbeiter senkten demütig ihre Häupter, entfernten die originalen Tragestangen, die über die Zeit brüchig geworden waren und bei der kleinsten Berührung zerfielen, und ersetzten sie durch metallene Streben.
Binnen einer Stunde war die Bundeslade, bis auf den Stab des Aaron und den goldenen Kelch, aus der Kammer geschafft und auf die Ladefläche eines Lastwagens verladen worden, der etwa eine Meile vor dem Tempelberg wartete.
Während der LKW mit der sorgfältig in Stoffbahnen eingeschlagenen Lade davonfuhr, nahm Ghazi sein Satellitentelefon zur Hand und wählte aus dem Gedächtnis eine Nummer. Nach dem dritten Klingeln meldete sich ein Mann namens Zawahiri, der Ghazi fragte, ob Allah an diesem Tag auf ihn hinab gelächelt hätte.
»Bei Allahs Gnade, wir haben die Bundeslade gefunden, Zawahiri«, sagte er.
»Aber ist es auch die echte Lade?«
»Ohne Frage«, erwiderte er. »Sie war die ganze Zeit über direkt vor der Nase der Israelis, in einer nirgends verzeichneten Kammer. Doch es war Allahs Wille, dass sie in unsere Hände fallen sollte.«
»Gute Arbeit, Ghazi. Die Vorsitzenden werden zufrieden sein, dass sich Ihre Bemühungen nun endlich auszahlten und unsere Geduld bald schon belohnt werden wird.«
»Nur damit Sie Bescheid wissen, mein Freund, wir befinden uns bereits auf der Rückfahrt mit der Fracht zu unserer Basis.«
Zawahiri klang zufrieden. »Dann werde ich unsere restlichen Partner über Ihren Erfolg benachrichtigen«, sagte er. »Fahren Sie mit dem nächsten Stadium fort.«
Ghazi atmete tief die heiße Wüstenluft ein, als hätte sie eine berauschende Wirkung auf ihn, und stieß sie danach in einem langen Seufzen wieder aus. Mit geschlossenen Augen bat er für Zawahiri um die Segnungen Allahs und beendete das Gespräch.
Kapitel 2
Jerusalem, unter dem Tempelberg
Yitzhak Paled war der Leiter des Lohamah Psichlogit, jener Einheit des Mossad, die für psychologische Kriegsführung, Propaganda und verdeckte Operationen zuständig war. Für einen dünnen, schmächtig gebauten Mann war er doch drahtig und kräftig, aber er verströmte stets eine Aura, die einem riet, sich besser nicht mit ihm anzulegen.
Er stand in der zweiten Kammer unter dem Tempelberg, wo mittlerweile mehrere Lampen auf Stativen aufgestellt worden waren, die den Raum mit Scheinwerferlicht erhellten. Um die zentrale Plattform herum, auf der sich der Stab Aarons und der goldene Kelch befanden, waren die neun Hüter der Bundeslade verteilt, deren Knochen die kaffeeartige Färbung gealterten Kalziums aufzeigten.
Paled, der nahe der Plattform stand und den anderen Anwesenden um sich herum bei der Arbeit zusah, hatte sein Kinn in seine Hand gestützt. Für ihn bestand keinerlei Zweifel, dass es sich bei der fraglichen Bundeslade um die wahre Lade handelte, schon allein deswegen, weil weder er noch die israelische Regierung Kenntnis von dieser Kammer besaßen und sie in keiner der bekannten Quellen Erwähnung fand.
Die ganze Zeit über hatte die Bundeslade, bewacht von ihren Hütern, direkt unter ihren Füßen gelegen, während sich alle zuvor entdeckten Laden in Nordafrika als Plagiate oder Nachbildungen herausgestellt hatten.
Wie die Araber sie finden konnten, war ihm ein Rätsel. Noch viel wütender aber machte Paled, dass dem Mossad eine direkte Nachricht der Araber zugestellt worden war, in der es hieß, dass sie nun im Besitz der Lade wären, und das sich der Beweis dafür direkt zu Füßen der Israelis befinden würde. Er verstand dies als Schlag ins Gesicht, als eine Geste dafür, dass ihnen die arabische Welt nun einen Schritt voraus war.
Wieso aber würden sie soweit gehen und sich der Bundeslade auf die Art bemächtigen, wie sie es getan hatten? Und wie konnten sie überhaupt von ihrem Versteck wissen?
Paled zweifelte keine Sekunde daran, dass die Radiokarbonuntersuchungen an dem Stab und den Knochen bestätigen würden, dass diese über dreitausend Jahre alt sein würden, wenn nicht sogar deutlich älter.
So sehr er auch darüber nachgrübelte, kam Paled einfach nicht dahinter, was die Araber im Schilde führten. Ganz offensichtlich hatten sie die Lade zu einem bestimmten Zweck entwendet. Der Grund dafür aber blieb ihm schleierhaft.
Könnte es ihnen um Geld gehen?, überlegte er. Vielleicht Lösegeldforderungen für die Bundeslade, um damit ihre terroristischen Aktivitäten finanzieren zu können? Al-Qaida war bekannt dafür, historische Antiquitäten auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, um Geld für ihr Regime zu sammeln.
Das war die erste logische Idee, die ihm in den Sinn kam.
Aber es gab natürlich auch andere Möglichkeiten. Sie konnten die Lade auch dazu benutzen, jede Situation zu einem zentralen Streitthema zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften eskalieren zu lassen, welche dieses Artefakt für sich beanspruchten, und das konnte schnell zu erhitzten Gemütern führen, wenn man ihnen diesen Schatz verwehrte.
Die Juden, die Katholiken, die Muslime – jeder von ihnen hätte rechtmäßigen Anspruch auf die Bundeslade.
Paled rieb sich nachdenklich weiter über sein Kinn, während seine Mitarbeiter behutsam die Gebeine der Hüter einsammelten. Doch egal, wie vorsichtig sie auch zu Werke gingen, brachen die spröden Knochen immer wieder entzwei. Dann nahmen sie den Stab des Aaron an sich, platzierten ihn in einem Metallkoffer, der eigentlich für ein Gewehr gedacht war, und verschlossen ihn. Dies war fraglos ein umwerfend bedeutsamer Schatz. Aber der eigentliche Fund war natürlich die Bundeslade und die beiden Steintafeln darin. Wieso also ließen sie den Stab zurück?
»Wir sind hier so gut wie fertig«, sagte Jacob, einer der Mitarbeiter des Lohamah Psichlogit.
Paled versuchte noch einmal, einen logischen Grund für den Diebstahl zu finden, bevor er sich mit einem fragenden Gesichtsausdruck zu Jacob umdrehte. »Verraten Sie mir eines«, sagte er. »Wieso sollte jemand die Bundeslade entwenden, den Stab aber zurücklassen?«
Jacob zuckte mit den Schultern. »Um Lösegeld zu fordern?«
Paled schüttelte den Kopf. »Dann hätten sie den Stab ebenfalls mitgenommen und ihn für gutes Geld auf dem Schwarzmarkt verhökert, um damit ihre Sache zu finanzieren. Nein, ich glaube, das geht viel weiter. Ich glaube, sie haben etwas mit ihr vor.«
Jacob trat ein paar Schritte vor und dabei fielen ihm die Abdrücke der Füße der Lade auf, um die herum sich der Staub von dreitausend Jahren gesammelt hatte. »Haben Sie erste Vermutungen?«
Von denen hatte Paled einige, wenn auch nur schwach. »Als Mitglied des Lohamah Psichlogit, der die Dinge aus der Sicht der psychologischen Kriegsführung, der Propaganda und der Täuschung heraus sieht, glaube ich, dass sie die Lade als eine Art Waffe benutzen werden, ob nun psychologisch oder auf andere Weise.« Er trat auf die Plattform zu. »Sagen Sie mir, Jacob … was sehen Sie hier?«
Jacob zögerte, dachte nach. »Ich sehe die Araber, die unser eigenes Spiel gegen uns verwenden«, sagte er.
Paled nickte. »Und wenn sie dieses Spiel gut genug spielen …«, begann er, brachte den Satz aber nur in Gedanken zu Ende.
… dann könnten sie damit einen Krieg anzetteln, wie es ihn noch nie gegeben hat …
… und uns alle dabei vernichten.
Kapitel 3
Vatikanstadt, sehr früher Morgen
Aus den Augenwinkeln glaubte Papst Gregor XVII. einen flüchtigen Schatten durch die päpstlichen Gemächer huschen zu sehen.
Der Raum war dunkel, die hinteren Ecken und Winkel noch finsterer, und durch die offenen Türen, die zu dem Balkon hinausführten, fiel nur das dürftige Licht des Mondes herein. Eine schwache Brise aus Westen wiegte die Vorhänge sanft hin und her, eine anmutige Bewegung, so langsam und in sich ausgewogen, dass es den gesamten Moment wie einen Ausschnitt aus einem surrealen Traum wirken ließ. Und obwohl er die Brise spüren konnte, die in den Raum wehte, fühlte sein Geist sich weiter fiebrig und heiß an, und vielleicht war auch das der Grund, der ihn zu der Illusion führte, dass noch jemand anderes im Zimmer sei.
Trotzdem vergewisserte sich der Pontifex mit schwacher Stimme: »Ist da jemand?«
Stille.
Papst Gregor schlug seine Decke zurück, setzte sich auf und schwang seine Beine über den Rand des Bettes, bis seine nackten Fußsohlen den Marmorboden berührten.
Nach dem Tod Papst Pius XIII. war Gregor zu dessen Nachfolger ernannt worden und verrichtete bereits seit den letzten sechs Monaten sein Amt auf dem päpstlichen Thron. Unter seiner Führung regierte der Konservatismus, was ihn ein wenig von Pius liberalerem Standpunkt unterschied, nach dem sich die Kirche dem Willen der Massen durch Veränderungen und Reformen beugen müsse, weil auch die Welt sich jeden Tag veränderte. Gregor aber war der Überzeugung, dass sich die Menschen dem Willen Gottes beugen sollten, und nicht umgekehrt. Also begann das Pendel langsam wieder zu einer konservativeren Grundhaltung zurückzuschwingen, was natürlich erneut den Zorn einiger katholischer Bürger erregte.
Und obwohl er sich auch einiger Kritik aus den eigenen Reihen gegenübersah, galt er in seinem Kolleg als jemand, der auch bei Gegenwind nicht von seinem Standpunkt abwich, egal wie laut die gegnerischen Stimmen schreien würden.
Als Papst Gregor stand, fing die Welt um ihn herum an, sich zu drehen. Die Schatten schienen länger und lebendig zu werden, und diese Umrisse griffen nach ihm, versuchten ihn zurückzuziehen. Wahnvorstellungen eines verwirrten Geistes. Er taumelte, hielt inne, um sich festzuhalten, und schritt dann auf die Veranda zu, wo er von einem Windstoß empfangen wurde, der seine Haare wie die Mähne eines Pferdes nach hinten wehen ließ.
Vor ein paar Stunden noch war er so robust wie Atlas gewesen, hatte die gesamte religiöse Welt auf seinen breiten Schultern getragen. Doch jetzt fühlte er sich erstaunlich schwach und kaum dazu in der Lage, auch nur seine Hand zu heben.
Auch sein Magen brannte bei jedem langsamen Schritt, als würde er Magma verdauen. Und dann wurde sein gesamter Körper zu einem Haus des Schmerzes und wie ein Betrunkener taumelte er auf eine der Säulen neben der Verandatür zu und blickte hinaus in die Nacht.
Unter dem Licht des Dreiviertelmondes, wo der Obelisk und die Kolonnaden nichts weiter als kalte, blaue Schatten bewachten, die sich über den gepflasterten Petersplatz erstreckten, sah Papst Gregor andächtig auf die Schönheit jenes Landes hinaus, welches er regieren durfte.
Er blieb einige Zeit an der Verandatür stehen, aber der Schmerz intensivierte sich, als er taumelnd auf deren Brüstung zulaufen wollte, mit einer Hand auf seinen Bauch gepresst und die andere nach dem Geländer ausgestreckt.
Gregor bewunderte weiter das Land, das ihm mit seiner Papstschaft überantwortet worden war, während sein Atem nur noch in kurzen Stößen ging und seine Lungen Mühe hatten, genug Sauerstoff aufzunehmen, um ihn bei Bewusstsein zu halten. Sechs Monate arbeitete er nun als direkter Diener Gottes. Und in diesen sechs Monaten war er davon überzeugt gewesen, dass seine Hingabe ihn mit einer außergewöhnlich langen Regentschaft als Papst belohnen würde. Sechs Monate waren noch nicht einmal ein Blinzeln aus der Sicht des Universums, befand er. Nicht einmal annähernd.
»Ich weiß, dass Sie hier sind«, sagte er und das Atmen bereitete ihm nun noch größere Schwierigkeiten.
Aber er bekam keine Antwort und auch in den Schatten rührte sich nichts. Kein einziges Geräusch war zu hören, nicht einmal der Hinweis auf Schritte.
»Glauben Sie wirklich, dass Gott Ihre Taten ungesühnt lassen wird?«
Das schwache Rauschen einer frischen Brise fuhr an ihm vorüber, eine süße, beruhigende Melodie. Er schloss die Augen und wartete.
»Gott wird Sie dafür nicht belohnen«, rief er aus. »Egal, welches Amt Sie in der Kirche begleiten, der einzige Lohn, den er für Sie bereithalten wird, ist das Feuer der Verdammnis.«
Der Pontifex stützte sich mit einer Hand auf dem Geländer der Veranda ab, dann begann er zu wanken, vor und zurück, und drohte, auf den Platz unter ihm zu stürzen.
»Das Feuer der Verdammnis«, flüsterte er. Dann riss er die Augen auf, als er eine Hand an seinem Rücken und direkt danach den Stoß spürte, gerade kräftig genug, um ihn über die Brüstung zu stoßen. Der alte Mann begann wild mit den Armen zu rudern, während er sich zu seinem Vollstrecker umdrehte. Seine Füße verloren den Halt, er rutschte über die Brüstung, und während das Pflaster mit unvorstellbarer Geschwindigkeit auf ihn zuraste, verschwand die Veranda über ihm in immer weiterer Ferne. Der Mond kreiste um ihn herum und schien traurig auf das Ende des alten Mannes hinunterzublicken.
Dann schlug er auf den Steinen auf, hart und mit dem Geräusch einer Melone, die auf dem Boden zerplatzte.
Doch der Pontifex war noch nicht tot und nahm den Geruch von Kupfer wahr, der durchdringend in der Luft hing, während sich unter ihm Blut in alle Richtungen ausbreitete.
Er hustete Blut aus seinen aufgerissenen Lungen und starrte hinauf, um einen Blick auf seinen Gott zu erhaschen, doch stattdessen sah er einen Schatten von seiner Veranda auf sich herabschauen. Er war reglos wie eine griechische Statue und schien ein Ornat zu tragen. Dann zog sich der Umriss von der Brüstung zurück und verschwand so lautlos, wie er gekommen war.
Langsam wich das Leben aus dem Körper des Pontifex. Die Ränder seines Sehfeldes begannen erst schwarz, dann violett zu werden, und danach flackerten die Lichtblitze auf, die ihn zu der göttlichen Erleuchtung führen würden.
Der Pontifex hob seine von dem Aufprall gebrochene und verdrehte Rechte, reckte sie dem erlösenden Licht zu, welches nur er selbst sehen konnte, lächelte und gestattete sich schließlich, allem Irdischen zu entsagen.
Boston, Massachusetts, das Erzbistum Bostons
In den letzten sechs Monaten nach seiner verlorenen Kandidatur für die Nachfolge des Papstes diente Kardinal Bonasero Vessucci dem Erzbistum Bostons. Er hatte sich zuerst der Kritik und sogar der Ächtung dafür ausgesetzt gesehen, einer ausgewählten Gruppe von Kardinälen vorzustehen, die als der Rat der Sieben bekannt waren. Zusammen mit Papst Pius XIII. hatten diese erkannt, dass gefährliche Zeiten angebrochen waren und ihre Kirche zunehmend ein lohnendes Ziel abgab. Um weiterhin für ihre Unabhängigkeit, ihre Interessen und das Wohlergehen ihrer Bürger sorgen zu können, hatte Kardinal Vessucci eine geheime Gruppe von Elitesoldaten befehligt, die Ritter des Vatikan.
Ihre Missionen führten sie normalerweise an Brennpunkte überall auf der Welt, und um ihre Ziele zu erreichen, griffen sie, wenn es keine anderen Optionen mehr gab, oft zu Maßnahmen, die als brutal angesehen wurden. Bei ihren Einsätzen starben Menschen. Doch viel mehr Menschen überlebten, und das waren stets jene, die unschuldig waren oder sich nicht selbst helfen konnten.
Papst Gregor weigerte sich jedoch, ihre Notwendigkeit in einer Welt anzuerkennen, in der sich das Böse tagtäglich wie ein Krebsgeschwür weiter ausbreitete, und löste den Ritterbund alsbald auf. Unmittelbar danach versetzte er auch die Angehörigen des Rates der Sieben in alle Himmelsrichtungen der Welt, und so landete Vessucci schließlich in den Vereinigten Staaten.
Und obwohl er die Kirche liebte, vermisste er seine Soldaten, seine Ritter des Vatikan, denn er wusste, dass sich die Kirche auf diese Weise in den letzten sechs Monaten angreifbar und verwundbar gemacht hatte. Wie viele Menschen verloren ihr Leben, obwohl man sie hätte retten können?, schoss es ihm immer wieder durch den Kopf, und diese Frage stellte er sich auch jeden Morgen, bevor er mit seiner Morgenandacht begann, zusammen mit der Sorge, was wohl aus den Rittern geworden war, seit man sie aus ihren Diensten entlassen hatte.
Er wollte sich gerade zu Bett begeben, als es leise an seiner Tür klopfte.
»Einen Moment, bitte.«
Als er die Tür öffnete, stand dort der Bischof, mit einem finsteren Blick im Gesicht.
»Ja, Bischof?«
»Ich fürchte, mich haben gerade furchtbare Nachrichten ereilt, die ich mit Ihnen teilen muss.«
Der Kardinal öffnete die Tür etwas weiter, als Zeichen, dass der Bischof doch hereinkommen sollte. Der Mann blieb jedoch auf der Türschwelle stehen. »Ich wurde soeben darüber benachrichtigt, dass der Papst verstorben ist.«
Vessucci blieb der Mund offen stehen.
»Allem Anschein nach war er Opfer eines tragischen Unfalls und fiel von seinem Balkon. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt, bevor man ihn ins Gemelli brachte.«
Vessucci war sprachlos. Der Pontifex hatte sein Amt erst für sechs Monate begleitet. Außerdem war man davon ausgegangen, dass er diese Position für die nächsten zwei, wenn nicht gar drei Jahrzehnte innehaben würde, denn er war körperlich in bester Verfassung. »Wann ist das passiert?«
»Vor zwei Stunden. Man wird es bald offiziell bekanntgeben. Aber bevor es so weit ist«, erklärte der Bischof und reichte Vessucci ein einzelnes Dokument, »wünscht man Ihre Anwesenheit im Vatikan.«
Vessucci starte das Papier einen langen Augenblick an, bevor er die Hand hob, um es entgegenzunehmen. »Danke«, flüsterte er, dann schloss er die Tür. Er brauchte keinen Blick auf das Schriftstück zu werfen, um zu wissen, was darauf geschrieben stand: die Bitte, sich mit dem Kardinalskolleg zusammenzufinden und erneut eine Konklave abzuhalten. Er legte das Papier vorsichtig auf seinem Nachttisch ab und starrte in den nächtlichen Himmel hinaus.
Vor sechs Monaten war er kurz davor gewesen, selbst das Amt des Papstes zu gewinnen. Dabei hatte er auf starke Unterstützung bauen können, allerdings nicht stark genug für die beiden gegnerischen Lager, die sich am Ende gegen ihn verbündet hatten. Nun aber war die Chance auf den päpstlichen Thron in greifbare Nähe gerückt.
Kapitel 4
Las Vegas, Nevada, Innenstadt
Sechs Monate, nachdem die Ritter des Vatikan aufgelöst worden waren, war Kimball Hayden zu einem verlorenen Sohn geworden, in einer Welt, die ihn schon viel früher abgewiesen hatte. Von dem Zeitpunkt an, da er als junger Mann versucht hatte, sich im Weißen Haus einen Namen zu machen, wurde er zu einem politischen Attentäter, der ein CIA-Team für unliebsame Aufträge anführte, und galt in den eigenen Reihen schnell als der »Mann ohne Gewissen«. Denn es war ihm gelungen, das Töten schnell zu einer ausgefeilten Fähigkeit reifen zu lassen, eine Eigenschaft, die nur von sehr wenigen Menschen auf diesem Planeten geteilt wurde.
Über Jahre hinweg sonnte er sich in seinem Ego. Jeder Mord wurde zu einem weiteren Baustein seiner eigenen monumentalen Legende, die stetig wuchs, wann immer er seine Klinge über die Kehle eines Gegners zog oder eine Kugel in den Kopf eines anderen Mannes jagte. Wenn es ums Töten ging, gab es niemanden, der dabei unbeirrter und verlässlicher vorging als Kimball Hayden.
Bis zu jenem Tag, während einer Mission im Mittleren Osten, als ihn die Erleuchtung traf, nachdem er sich gezwungen sah, zwei Schafe hütende Kinder zu töten, die seine Position verraten hätten. Nachdem er sie in der Wüste begraben hatte, lag er die restliche Nacht neben ihren Gräbern, starrte in den Himmel und fragte sich, ob es wirklich einen Gott gab.
Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, traf er für sich die Entscheidung, dem Dienst für Amerika zu entsagen, und verschwand. Das Pentagon, das angenommen hatte, dass er im Einsatz ums Leben gekommen war, erwies ihm daraufhin posthum die letzte Ehre und bestattete einen leeren Sarg auf dem Friedhof von Arlington, als Symbol für seinen Einsatz als Soldat.
Aber seine Symbolwirkung der Tapferkeit auf andere wog nur wenig. Würden bestimmte amerikanische Würdenträger herausfinden, dass er noch immer am Leben war – was bedeutete, dass er noch immer über bestimmte dunkle Geheimnisse wie dem Umstand verfügte, dass frühere Regierungen den Mord eines US-Senators durch andere Mitglieder des Senats sanktioniert hatten – würden ihm all seine früheren Auszeichnungen nichts mehr nützen. Kimball Hayden würde sich extremen Widrigkeiten ausgesetzt sehen, nur um sicherzustellen, dass all die Fehlurteile früherer Politiker weiterhin unaufgedeckt blieben.
Aus diesem Grund kehrte er nie für längere Zeit in die Vereinigten Staaten zurück.
Doch dann nahm sein Leben erneut eine andere Wendung.
Während sein Sarg in Washington D. C. zur letzten Ruhe gebettet wurde, saß er in einer kleinen Bar in Venedig und sah im Fernsehen dabei zu, wie die Amerikaner zusammen mit ihren Alliierten gegen Saddam Hussein Krieg führten, um Kuwait zu befreien. Da nahm ungefragt ein Kardinal des Vatikans an seinem Tisch Platz und bot ihm eine Chance auf Wiedergutmachung an, wenn er als Ritter des Vatikan dienen würde.
Als Kimball ihn über diesen Ritterbund ausfragte, erklärte ihm Kardinal Bonasero Vessucci, dass nur ein Mann wahrer Integrität, für den Loyalität wichtiger als alles andere, mit Ausnahme der Ehre ist, ein Mann sein kann, der wahrhaftig an die Souveränität des Vatikans glaubt und für den Schutz seiner Interessen und das Wohlergehen seiner Bürger einstehen kann. Und nur ein Mann, der seine früheren Handlungen wirklich bedauert, ist ein Mann, der in den Augen Gottes würdig erscheinen wird.
So fand Kimball schließlich unter der Schirmherrschaft der Kirche sein Zuhause.
Und über Jahre hinweg setzte er sich mit seinen besonderen Fähigkeiten dafür ein, rund um den Globus Menschenleben zu retten – zusammen mit den besten Soldaten der Welt, den Rittern des Vatikan.