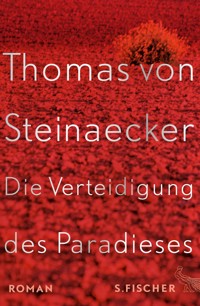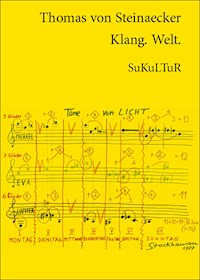Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen E-Book
Thomas von Steinaecker
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Risiken abzusichern ist ihr Geschäft. Doch sie verstrickt sich in Unsicherheiten, trügerische Phantasien und Ängste. Brillant, packend und raffiniert erzählt Thomas von Steinaeckers großer Zeitroman von unserer Welt, in der alle Sicherheiten endgültig abhanden gekommen sind und unsere Sehnsüchte in die Irre führen. Ein schlau-präzises und gespenstisch-surreales Porträt unserer Gegenwart. Renate Meißner wird versetzt, befördert und gewinnt für ihre Versicherungsgesellschaft einen großen Auftrag. Doch eine interne Evaluierung ergibt, dass in ihrer Abteilung Stellen gestrichen werden. Vielleicht war die Versetzung ein abgekarterter Spiel, um sie loszuwerden? Der große Auftrag ein Test? Sie reist nach Russland, um die Grande Dame hinter dem Projekt kennenzulernen, die Herrin über ein generationenaltes Vergnügungspark-Imperium. Die Greisin scheint erstaunliche Ähnlichkeiten mit Renates verschwundener Großmutter zu haben. In einer Welt futuristischer Jahrmarktsattraktionen verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Phantasie. Welcher Wirklichkeit ist noch zu trauen? Thomas von Steinaeckers Roman entwirft ein großes Panorama, das mit Fotos, Zeichnungen und Tabellen die Möglichkeiten realistischen Erzählens auslotet und ein phantastisches Paranoia-Spiel in Gang setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Thomas von Steinaecker
Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen
Roman
FISCHER E-Books
Ich danke Andreas Müller und Julian Doepp sowie besonders Florian Kessler und Stefanie Geiger. Ohne ihre Anregungen hätte das Buch nicht die vorliegende Gestalt. Und ich danke von Herzen Elsa Maria von Steinaecker – für ihre Erzählungen und Fotos.
Am Morgen meines ersten Arbeitstages in München, der 01. Oktober 2008, blieb ich irritiert im Untergeschoss der U-Bahnstation Nordfriedhof vor den Treppen stehen, die an die Oberfläche führten. Dort, wo die Überdachung endete und damit auch die Wärme, die sich in den unterirdischen Räumen wie eine Erinnerung an den Sommer hielt, bedeckte ein feiner Film aus Schnee die Stufen. Seit für die Region Wetteraufzeichnungen existieren, war es erst ein, zwei Mal zu einem so plötzlichen Kälteeinbruch gekommen. Außerdem hatte, wenn mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt, die RTL-Wetterfee, bei der ich mich immer fragte, ob ihr blondes Haar auch in natura so dezent matt glänzt oder ob es sich um einen digitalen Effekt handelt, leichte Bewölkung vorhergesagt, nicht jedoch Regen, geschweige denn Schnee. Als ich eine halbe Stunde zuvor meine Wohnung in der Maxvorstadt verlassen hatte, war es zwar stürmisch gewesen – irgendetwas zwischen Windstärke vier und fünf, schätze ich –, aber trocken. Bei feuchtem Belag ist das Treppensteigen mit 7-cm-Absätzen beschwerlich.
Die »Gala« sagt: »Mörder-High-Heels ruinieren Victoria Beckhams Gesundheit.« Angela Braly, geborene Fick, Geschäftsführerin von WellPoint Inc.-Versicherungen und laut Forbes die aktuell fünfmächtigste Frau der Welt, sagt: »After all I am still a woman, what do you think?« Ellen von Unwerth, Starfotografin, sagt: »The higher the heel, the better I feel.« Meine beste Freundin Lisa Miller sagt: »Nicht klagen, tragen.«
Draußen herrschte eine von den Straßenlaternen und den Lichtern in den umliegenden Gebäuden ungesund orange eingefärbte Dämmerung, durch die Flocken wirbelten. Auf der anderen Seite des Mittleren Rings bemerkte ich eine Trauergemeinde. Vor den Mauern des Friedhofs, hinter denen die schwarzen Flügel der Engelsstatuen und Kreuze hervorragten, gingen circa dreißig Frauen und Männer in langen dunklen Mänteln und mit gesenkten Häuptern eng beisammen. Es war mir, als könnte ich ihren Schmerz spüren, der in mir, ohne dass ich es kontrollieren konnte, die Erinnerung daran auslöste, wie ich selbst vor wenigen Monaten, im Juli, nur ein paar Kilometer entfernt, in einer kleinen Aussegnungshalle gestanden hatte. Doch dann steuerten die vermeintlich Trauernden nicht auf die Kapelle zu, sondern auf das Business-Towers-Areal einige Straßen weiter. Sie waren auf dem Weg zur Arbeit wie ich.
Alle vier Sekunden geschieht in Deutschland ein Unfall. Über 39 % aller Knochenbrüche in den westeuropäischen Ländern ereignen sich bei Neuschnee. Angesichts der Größe der Gruppe standen die Chancen somit nicht schlecht für ein plötzliches Ausgleiten, eine unsanfte Landung, eine kostspielige Fraktur. Und wenn es hier keinen traf, dann jemanden in der Nähe, genau jetzt, mit Sicherheit. Es würde passieren. Es passierte.
Düster und trutzig erhoben sich über den Dächern der Flachbauten und den Baumwipfeln die HighLight-Towers mit ihren 33 und 28 Geschossen, meine künftige Arbeitsstätte, in der bereits mehr Fenster erhellt waren, als ich erwartet hatte. Glücklicherweise hatte man mich zuvor genauestens informiert, wie man von der U-Bahnstation zum Areal gelangte, über Fußgängerbrücken, durch Wohnblöcke und Unterführungen unter der Autobahn hindurch, ansonsten wäre ich an diesem Morgen verloren gewesen und am Mittleren Ring entlanggeirrt, immer das Ziel, die Türme vor Augen, ohne Aussicht, sie je zu erreichen.
Die Büros der CAVERE-Abteilung München-Nord waren im 14. Stockwerk des Ostturmes untergebracht, jene der Zentrale in den 19 Etagen darüber. Während ich das Klingelschild drückte und die beiden Türen mit einem Summen von selbst aufschwangen, las ich fast ausnahmslos die Namen von Vermögens- und Steuerberatern, Anwaltskanzleien und Werbefirmen. Das war die Gesellschaft, der sich CAVERE zugehörig fühlte. So war es in Frankfurt gewesen, so war es auch hier. You think big? We too.
Der Außenlift verfügte über die übliche Notruftaste. Ordnungsgemäß wies das TÜV-Schild das nicht allzu weit zurückliegende Baujahr aus. Sanft und geräuschlos, was auf gewartete Seile schließen ließ, hob sich die Kabine empor. In meinem Taschenspiegel richtete ich meine in Mitleidenschaft gezogene Frisur. Wie immer trug ich Make-up, Puder, Wimperntusche, Lidschatten, Eyeliner und sehr dezenten roten Lippenstift. Ohne Make-up, Puder, Wimperntusche, Lidschatten, Eyeliner und Lippenstift war ich kein Mensch. Kräftig kniff ich mich. Rasch zeigten meine schmerzenden Wangen den gewünschten Effekt, ein gesundes Rosa.
Ohne einen Zwischenfall öffnete sich die Tür zum Halbrund des Empfangsbereichs der CAVERE-Abteilung München-Nord. Die Farben des Unternehmens, Orange-Blau, die in breiten Streifen an den beiden gewölbten Wänden entlangliefen, erinnerten mich an die Flagge eines Landes, dessen Name mir entfallen war. Studien haben bewiesen, dass die Farbkombination Orange-Blau die meisten Menschen in eine positive Stimmung versetzt. Der blaugraue Kurzhaarteppich harmonierte mit der steingrauen Sechser-Ledersitzgruppe vor einem Flachbildfernseher, auf dem das rote Tickerband von »n-tv« lief, sowie mit dem Gelbgrün der Birkenfeige im Topf, die gern mit einem Ficus verwechselt wird. Daneben die massive und dennoch wie mühelos geschwungene Theke aus Kastanienholz, nicht nur eine Einrichtung, eine Raumlandschaft.
Das Flattern in meinem Brustbereich, das durch das vor einer knappen Stunde eingenommene Trevilor seltsamerweise nicht abgeschwächt, sondern verstärkt worden war, schwand in diesem Moment, und meine Professionalität kehrte zurück. Lächelnd plus festen Schrittes steuerte ich auf die vielleicht 30-jährige, zu dicke Frau im braunen Hosenanzug zu.
»Guten Morgen, Frau Aktan«, las ich vom Namensschild ab und fragte mich, in welchem Verhältnis ihr Migrationshintergrund zur Ethnizität des durchschnittlichen CAVERE-Kunden in München-Nord stand.
»Guten Morgen … ähm …«, sie strich sich die langen schwarzen Locken hinters Ohr und versuchte, ihre Irritation zu überspielen, was mir Vergnügen bereitete. »… der Publikumsverkehr beginnt eigentlich erst um acht.«
»Renate Meißner.« Ich machte eine Pause, um zu sehen, welche Wirkung mein Status auf sie hatte. Keine. »Ich bin Renate Meißner. Die neue stellvertretende Abteilungsleiterin.«
»Stellvertretende … Abteilungsleiterin?«
»Renate Meißner«, wiederholte ich.
»Das ist ja merkwürdig. Davon … ähm … weiß ich ja gar nichts.« Sie blätterte in einem großformatigen Kalender. »Vielleicht ein Stockwerk höher? In der Zentrale ein Stockwerk höher?« Sie griff nach dem Telefon. »Einen Moment. Ich frage mal schnell nach …« Während sie darauf wartete, dass jemand abhob, starrte sie mir in die Augen.
»Ist hier nicht die Anmeldung für die Abteilung Nord … Ach so, macht man das oben?« Ich lachte zu laut. Frau Aktan antwortete mir nicht. Sie flüsterte in den Hörer.
Die orange-blauen Streifen. Der Nachrichtensprecher im Fernseher, der zu den Lederstühlen und der Birkenfeige sprach.
Ich versuchte, mir in Erinnerung zu rufen, wie auf der Anzeige im Lift die Vierzehn erschienen war, was mir nicht gelang. Wo war der CAVERE-Schriftzug? Der Raum passte für mich mit einem Mal viel besser zu einer Werbefirma als zu einer Versicherung. Eine Aktan ebenso.
»Frau Meißner?« Ein sonorer Bariton aus dem hellen Korridor. Ein knapp 60-jähriger, zwei Köpfe größer als ich, Halbglatze, schwarzer Schnauzer, Brille, im Eilschritt, der Nadelstreifen-Anzug von Benvenuto, darin, drahtig, ein gesunder Mann, Willy Scholz, der Leiter, ich seine Stellvertreterin. 100 %ig souverän lächelnd, löste ich mich von der schwitzig-feucht gewordenen Oberfläche der Theke, die mir Halt gegeben hatte.
»Hatte eben Strunk am Apparat.« Er entblößte die geraden weißen Zähne seines Oberkiefers, Brücken oder Implantate, eine schmerzhafte, aber hinsichtlich des täglichen Kundenkontakts sinnvolle Operation, und schüttelte mir die Hand, während er mir auf die rechte Schulter klopfte. Sein Blick, der mich ein, zwei Sekunden länger als üblich maß. »Die Nachbesserung unseres Angebots für die Fitness-Center beim Stadion scheint zu fruchten. Es handelt sich um vier Center.«
Die Empfangsdame, die aufgehört hatte zu existieren, sagte von der Seite: »Das ist mir aber jetzt wirklich unangenehm. Ich war die letzten Tage nicht im Büro, und meine Vertretung hat das vergessen zu notieren. Schön, dass Sie da sind und willkommen bei uns.«
Ich schenkte ihr ein Lächeln, mit dem ich signalisierte, dass ich ihr vergab, obwohl ich in meiner Position auch anders gekonnt hätte. Ich habe ein Herz.
Scholz streckte einladend seinen Arm aus, zum Korridor deutend, und senkte den Kopf, um mir den Vortritt zu lassen. Er trug eine Breitling-Uhr. »Wollen wir?«
Ich überlegte, ob ich auf sein Gesprächsangebot zu Strunk, dem Inhaber der Fitness-Center-Kette, ich hatte mich umgehört, eingehen sollte, war aber dann überzeugt, dass es sich empfahl, abzuwarten, bis ich mein Gegenüber besser einschätzen konnte. Scholz roch nach Fuel, dem neuen Diesel-Duft, erinnere ich mich richtig.
»Führe Sie mal ein wenig rum. Ist eigentlich, wie gesagt, was die Orientierung betrifft, ganz simpel hier. Rechts die Vermittler, gegenüber davon das Großraumbüro mit den Schadensregulierern …«
Er hätte ebenso sagen können: »Sie werden sehen, Ihre Strafversetzung, ich nenne das mal so, von Frankfurt nach München wird auch etwas Gutes haben. Stellvertretende Abteilungsleiterin ist doch auch nicht übel, noch dazu eine Beförderung. Na, wir werden schon gut miteinander auskommen, meinen Sie nicht?« Oder Ähnliches. Er hätte mich als Mensch abgeholt, plus es wäre aus der Welt gewesen. Letztlich war es allerdings positiv zu werten, dass er die Umstände meines Hierseins nicht offen ansprach. Das erlaubte die Konzentration aufs Wesentliche.
Dachte er: »Die ist es also. So sieht die also aus. Naja, ganz appetitlich. Die hat also der Walter Albrecht vernascht. Nur: Der hat sich für seine Frau entschieden, und jetzt knallt der mir seine Ex-Gespielin vor den Latz. Ob die überhaupt das Zeug hat zur SV?« Sollten ihm derartige Gedanken tatsächlich durch den Kopf gegangen sein, gebrauchte er dann das Wort »vernaschen«, »vögeln« oder »schnackseln«, oder war er letztlich so durchweg korrekt, dass er, nur für sich, mit seinem fränkischen Dialekt, den Ausdruck »etwas mit jemandem haben« verwendete?
»12SBs, oder?«, ergänzte ich.
»Ganz richtig.« Er schaute erfreut, als hätte ich ihm soeben eine gute Nachricht überbracht. »Ich sehe, Sie sind im Bilde.« Vor der geöffneten Tür zu einem dunklen Zimmer: »Ihre Kollegen von der Vermittlung. Hier Martin Luckner«, vor der geschlossenen Tür daneben, »Serdar Koban …«. Glücklicherweise war ich die einzige Frau unter den CAVERE-Nord-Vermittlern. In Frankfurt hatte vor drei Jahren eine jüngere Kollegin das Team verstärkt, wie man so sagt. Tamara Kretschmann. Vom Zeitpunkt ihres Eintreffens an rückte ich aus dem Fokus meiner männlichen Mitarbeiter. Deren Blick richtete sich, gingen wir beide auf dem Korridor an ihnen vorbei, nicht mehr allein auf mich, sondern wanderte unfreiwillig auf die Gesichts- bzw. Brust- bzw. Gesäß-Region meiner Kollegin direkt neben mir. Bald schon hatte der Frankfurter Leiter die Tendenz, Tamara Kretschmann diejenigen potentiellen männlichen Kunden anzuvertrauen, deren Nicht-Akquise für das Unternehmen schmerzhaft gewesen wäre. Anfangs unterschätzte ich diese Entwicklung – ich bin eine Gegnerin der Stutenbissigkeit –, nur um erkennen zu müssen, dass die Gegenmaßnahmen, die ich schließlich ergriff, um zu punkten – Mehrarbeit, Kreativkonzepte, Veränderung des Erscheinungsbildes –, kaum die gewünschte Wirkung hatten.
»… und hier unser Dienstältester.«
Ich las »Rolf Katzer« auf dem Schild neben einem Büro mit der Nummer 1407, das vollkommen leergeräumt war. Lediglich in der Mitte ein weißer Schreibtisch, hinter dem ein Mann kniete. Als er uns hörte, erhob er sich, ein Hüne, einen Schraubenzieher in der Hand, die neue Krawatte ruhte auf dem äußersten Punkt seines birnenförmigen Bauchs. Gelblich-braune Gesichtshaut, Falten, Kettenraucher. Ich gab ihm noch vier, maximal sechs Jahre.
Obwohl ich sofort Gernot Lindinger, den vierten München-Nord-Vermittler, von der CAVERE-Homepage erkannte, tat ich erstaunt: »Herr Katzer?« Scholz blies amüsiert Luft durch die Nase, direkt im Anschluss auch der Dienstälteste, ein seltsames Ventil-Geräusch-Echo.
»Um Gottes willen, bloß nicht. Ich heiße Lindinger. Seit 20 Jahren Vermittler dieser schönen Firma hier.« Auffallend, wie er »schön« betonte, ohne dass auszumachen war, ob er das ironisch meinte. Seine Kurzatmigkeit nötigte ihn, zwischen den Wörtern Pausen einzulegen. Ansonsten eine Stimme, die sicherlich früher eindrucksvoll sowohl in allgemeines Gelächter mit einfallen wie Untergeordnete zurechtweisen hatte können, nun aber rachitisch belegt und brüchig Lindingers desolaten körperlichen Zustand offenbarte. Möglich, dass Lindinger und der mir unbekannte Katzer aus welchen Gründen auch immer an diesem Tag ihre Büros tauschten. Man würde mich im Lauf des Tages über den neuen Kollegen aufklären, wahrscheinlich eine kurzfristige Verstärkung unseres Teams.
Als der Dienstälteste begann: »Und Sie sind also die Neue hier? Die, die’s richten soll, was? Na, ich kann Ihnen gerne erzählen, wie das hier so läuft …«, unterbrach ihn Scholz: »Ist schon gut, Gernot. Lass Frau Meißner doch erst einmal ankommen, bevor du sie hier zwischen Tür und Angel überfällst«, und tippte mir sanft an die Schulter, um mich zum Weitergehen aufzufordern. Er zwinkerte nervös.
»Schönen Tag noch! Und vielleicht bis später!« Lindingers Stimme in unserem Rücken, die »schön« ebenso wie »später« zweideutig betonte.
Draußen im Korridor drehten wir um, ohne das Ende erreicht zu haben. An den Wänden hingen großformatige Fotos von Gruppen gutgekleideter Menschen während eines Empfangs oder einer Vernissage, die an Stehtischen miteinander plauderten. Es konnte sich auch um Kunst handeln.
»Wir fahren noch schnell zum Chef von dem Ganzen, solange der im Haus ist. Lause. Danach zeige ich Ihnen Ihr Büro. Die Zentrale der CAVERE-Bayern ist ja über uns, wie Sie wissen.«
Unvermittelt hatte Scholz begonnen, imaginäre Fussel von seinem Jackett zu wischen, was darauf schließen ließ, dass ihm die Themen Zentrale und Lause nicht 100 %ig angenehm waren.
Das Büro des Vorstands im 32. Stockwerk wirkte durch die Panoramafenster noch größer, als es tatsächlich war. Ein Schreibtisch aus hellgrauem Stein, nicht Marmor, mit einem Flatscreen und einem Telefon darauf, zwei Stühle davor, ein Schrank mit Handwörterbüchern und zwei Statuen, wahrscheinlich aus Stahl, organisch, schneckengehäuse- oder ohrmuschelartig, ansonsten Weite, Leere. Die Macht zeigt sich in den verhältnismäßig riesigen Zwischenräumen zwischen den wenigen Objekten, dachte ich, als uns die Sekretärin im Bleistiftrock die Tür aufhielt und wir eintraten.
Lause war hager, circa ebenso alt wie ich und ebenso groß wie ich mit Absätzen. Er trug eine Omega-Uhr. Als Willy Scholz zwischen mir und Lause bei jedem Satz, mit dem er mich vorstellte, auf und ab wippte, Lause mit seinem klaren blauen Blick mich zwei, drei Sekunden länger als üblich maß und ich spürte, wie sich eine Angst-Kuppel um Scholz aufbaute, wie er mit den verschränkten Armen zuckte, 20 Jahre älter als der Vorstand, diesem körperlich deutlich überlegen, aber bei jeder Konferenz, bei jeder Bitte um eine finale Absegnung konfrontiert mit der Tatsache: Ich habe es nicht so weit gebracht wie du, da versuchte ich meinen eigenen professionellen Modus zu wahren, indem ich, wie ich es hin und wieder, einfach so zum Vergnügen und zur Übung tat, taxierte. Wie viel waren die Leben der beiden Männer vor mir wert? In Beziehung zu setzen war die durchschnittliche Lebenserwartung eines deutschen Mannes im Herbst 2008 mit dessen hierarchischer Position und den damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken plus den bislang geleisteten Beitragszahlungen, wobei vorauszusetzen war, dass eine höhere hierarchische Position einen umfassenderen Versicherungsschutz und damit auch eine höhere Police bedingte. Unter Berücksichtigung, dass Lause seine Position nicht länger als fünf Jahre innehatte und somit auch erst in diesem Zeitraum einen umfassenderen Versicherungsschutz in Anspruch nahm, lag der Wert Willy Scholz’ im sechsstelligen Bereich, der des Vorstands aber deutlich darunter. Ich beeilte mich, beiden zu versichern, wie sehr es mich freue, dass und so weiter.
Auf der Fahrt zurück besaß Scholz’ Haltung nichts Legeres mehr, er wirkte erschöpft. Zur Chromwand gegenüber flüsterte er: »So. Jetzt kennen Sie also auch den Vorstand. Guter Mann. Wir hoffen hier ja alle, dass er den Laden wieder flott kriegt. Sind ja sicher mit den Quartalszahlen vertraut. Dabei ist das nicht einmal unsere Schuld. Wir sind es, die die Gewinne einfahren. München fährt Gewinne ein. Und Frankfurt verzockt sie … Wie gesagt, das Aktuariat dort.« Er schüttelte den Kopf und machte eine Pause. »Bitte löschen, was ich eben gesagt habe.« Es mochte Zufall sein, dass er mich bei dem Wort »löschen« anblickte, und ich glaubte, durch seine Brille und seine enttäuschten braunen Augen hindurch in seine Seele, was immer man sich darunter vorstellen mag, blicken zu können.
»Schaffen das natürlich. Wäre ja gelacht, noch dazu jetzt, wo Sie bei uns sind, meinen Sie nicht?« Plötzlich klangen seine Sätze wieder sonor. Wir schritten durch den Empfang, er mit durchgedrücktem Kreuz, federnd, wie zuvor. Indem Scholz eben absichtlich im Lift Gefühl gezeigt hatte, war eine Vertrauensbasis zwischen uns entstanden, schien mir. Je mehr wir uns Frau Aktan näherten, desto lauter und akzentuierter sprach er jetzt, um bei Erreichen der Theke zu schließen: »Frau Aktan wird Sie jetzt zu Ihrem Büro begleiten. Sie rufen, wenn Sie etwas brauchen. In diesem Fall bitte an Kollegen Koban oder Luckner wenden. Die Anwesenheit beim Strategie-Meeting mittwochs ist obligatorisch. Das Verfassen der wöchentlichen Bilanz ist obligatorisch. Der wöchentliche Bericht für den Controller ist obligatorisch. Unsere Abteilung steht bis 31. Dezember unter der Beobachtung eines Controllers aus der Zentrale. Wie auch immer. Wegen der Zielvereinbarung für diese Woche komme ich später auf Sie zu. Die Hauptpforte wird um 21 Uhr 30 vom Facility Manager abgesperrt. Sich einsperren zu lassen, wie dies einige Kollegen schon praktiziert haben, trägt nicht zur Popularität bei. Was glauben Sie, wie mir der Betriebsrat im Nacken sitzt, dass wir hier alle auch ja und so weiter? Der Besuch der Kantine ist im Übrigen nicht obligatorisch und außerdem auch nicht empfehlenswert. Also. Weiter geht’s. Sie verstehen schon.«
Er schmunzelte. Ich versuchte, drei Adjektive zu finden, die ihn treffend beschrieben, eines für das Äußere, eines für das Innere und eines für den Gesamteindruck, ein gutes Mittel, um Menschen und ihr Verhalten in jeder Situation richtig einordnen zu können. Die Adjektive lagen mir auf der Zunge.
Auf dem Weg zu meinem Büro am Ende des Korridors erklärte mir Frau Aktan, die beiden anderen Vermittler Serdar und Martin würden bald eintreffen, auch Gerda, die Betriebsrätin aus der Schadensregulierung im 21. Stock, ihre Bekanntschaft sei »obligatorisch«, sie zwinkerte mir zu und entschuldigte sich nochmals für ihren »Blackout«. Frau Aktan nannte alle nur beim Vornamen; offensichtlich herrschten hier andere Gepflogenheiten als in Frankfurt, wo wenig von flachen Hierarchien gehalten wurde. Sie erwartete, dass ich ihr das Du anbot, was ich nicht tat. »Das Du ist ein Asset, das man nicht zu früh aus der Hand geben sollte.« Und: »Die Einwilligung ins angebotene Du ist die soziale Defloration. Man sollte da vorsichtig sein. Gerade du als Frau«, pflegte Walter zu sagen.
Ein paar Sekunden später schloss sich hinter mir die Tür meines neuen Büros. Es war nahezu 100 %ig still. Die Pressspanplatten an der Decke, die Stärke der Wände und die isolierten Fensterscheiben garantierten eine Dezibelzahl, die meinem Wunschwert entsprach. Ich muss bei der Arbeit durch die Ausschaltung aller Hintergrundgeräusche meinen Herzschlag und das leichte Sirren in meinen Ohren hören können. Nur so kann ich optimale Leistungen erbringen. Mein Blick glitt vom Computer, ein Dell, auf den weißen Schreibtisch mit der Glasplatte, den schwarzen Ledersessel über die beiden schwarzen Stühle für die Kunden zu den circa einen Meter hohen, wichtiges zusätzliches CO2 produzierenden plus das von den Möbeln abgegebene Formaldehyd neutralisierenden Grünlilien an der Fensterwand, wohl eines der wenigen Überbleibsel meiner Vorgängerin, über die ich sonst kaum Informationen besaß. Den farblichen Akzent im Raum setzte ein exakt in der Mitte der Wand gegenüber des Tisches angebrachtes silbern gerahmtes Kunstdruckplakat aus der »20th Century Hits«-Serie, die auch in den Büros in Frankfurt hing. Es handelte sich ausschließlich um Werke von Künstlern des 20. Jahrhunderts, die a) eine beruhigende Wirkung auf den Kunden und den Angestellten ausübten und b) zu den Top Twenty der teuersten Gemälde der Welt gehörten. In meinem Fall war dies das mir nur zu Genüge bekannte »Edward Hopper: Sonne in einem leeren Zimmer«. Das bedeutete, dass ich erneut keines der drei Bilder erhalten hatte, deren Originale bisher die 100-Millionen-Dollar-Marke gerissen hatten, Pollock, Klimt, Picasso.
Als ich meinen kleinen Stoffhasen aus der Tasche zog und auf dem Tisch am Computer befestigte, bemerkte ich im grauen Teppich neben dem Fenster den Abdruck eines undefinierbaren Gegenstandes: Vielleicht ein Tischchen als Ablage, für eine Teekanne oder dergleichen. Diese Art der Personalisierung des Arbeitsplatzes hatte nicht selten einen günstigen Effekt auf die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses zum Kunden. Ich zog meinen Blackberry aus der Tasche. Manche Kollegen besitzen einen Blackberry fürs Berufliche und ein weiteres Smartphone fürs Private. Dass ich mich nie an so eine Trennung gehalten hatte, die man am Ende doch nicht konsequent durchführen konnte, bereute ich neuerdings. Denn die Sehnsucht, dann Nervosität, dass Walter sich noch einmal bei mir melden könnte, hatte ich zwar mittlerweile einigermaßen erfolgreich in mir erstickt; trotzdem flackerte sie jedes Mal auf, wenn ich nach längerer Zeit wieder das Handy kontrollierte, sagen wir nach ein paar Minuten. Man konnte von einer ungesunden Emotionsabfolge sprechen: Sehnsucht → Nervosität → Wut. Während ich über mich selbst den Kopf schüttelte, fotografierte ich den Abdruck.
Ohne dass ich es wollte, tauchte in meinem Kopf die Frage auf, die ich mir in den vergangenen Wochen so oft gestellt hatte: was ich nur an Walter und überhaupt an älteren Männern, nicht fünf Jahre, sondern eine Generation älteren Männern fand. Eine Beziehung mit derartigen Alpha-Senioren besaß wenig Aussicht auf Langfristigkeit. Ich kannte die Prozentzahl nicht. Ich hatte es irgendwann einmal, bereits zu Beginn meiner Beziehung mit Walter, in der Datenbank des Statistischen Bundesamtes recherchiert. Für einen Moment stellte ich mich an die Fensterwand und ermahnte mich: »Fotze.« Manchmal half mir das beim Fokussieren.
Der Nebel hatte sich gesenkt und in wenige Nester um Büsche und Bäume verflüchtigt. Hier oben, im 14. Stock, schien bereits die Sonne, der Himmel strahlte hellblau, als hätte es den Sturm heute Morgen nie gegeben. In diesem Augenblick ertönte ein Summen, und ohne mein Zutun senkten sich die Jalousien vor meinem Fenster präzise so weit herab, dass ich gerade noch ohne elektrisches Licht auskommen würde. Einen Schalter zur individuellen Regulierung konnte ich nicht entdecken. Ich arbeitete in einem sogenannten intelligenten Gebäude. Unter mir, auf der Autobahn, standen sechs Spuren mit Autos, die im Dreisekundentakt vorwärts rückten; in der Ferne, neben dem Stadion, das unsere Widersacher Arena nannten, drehte sich auf dem sogenannten Müllberg das Windrad; darüber kreiste ein schwarzer Vogelschwarm, der im Flug in Sekundenschnelle die unterschiedlichsten Formen einnahm. Und ich erinnerte mich plötzlich, wie ich genau an dieser Stelle, 14 Stockwerke tiefer, vor fast einem Vierteljahrhundert herumgestreunt war, in einem rosa Madonna-Pulli mit Schulterpolstern. Das Gebäude, in dem ich nun arbeiten würde, sein kleiner Zwilling daneben, das Windrad, das Stadion und die Bürogebäude, Outlets und Möbelcenter wie pilzartige Ableger drumherum, hatten damals noch nicht existiert, nicht einmal als Idee. Ich war an jenem Abend direkt nach dem Abitur mit Freundinnen in einer Diskothek verabredet gewesen und hatte mich auf dem Hinweg verirrt. Ich denke, es war Oktober, Nacht, aber warm. In der Dunkelheit über dem Brachland war das Wort »Verheißung« aufgeblitzt.
Heute war ich ein unverzichtbarer Teil der Firma. Im Quartal 04/07 waren die meisten Policen der Abteilung Frankfurt-Nord über welchen Tisch gegangen? Über meinen. Wenn du nicht weißt, wo dir der Kopf steht, halten wir dir den Rücken frei. Unwetter können wir nicht verhindern, aber wir sorgen dafür, dass anschließend wieder die Sonne scheint. Träume brauchen Sicherheit. Ein Beinbruch ist doch kein Beinbruch. CAVERE war seit zwölf Jahren mein Zuhause. Ich meinte CAVERE und sagte: wir. Ich fragte nicht: Wie geht es uns gut, sondern: Wie geht es uns noch besser. CAVERE hatte einen Traum. Die Steigerung der Quartalszahlen. In unseren 11-m2-Büros träumten wir alle diesen Traum. Behalten Sie diesen Traum bei Ihrer Arbeit im Hinterkopf. Wenn wir einen Abschluss mit einem Großkunden machen, ist es Weihnachten. Es ist oft Weihnachten. Es ist zu selten Weihnachten. Wir schauen nach vorne. Was interessiert uns denn, was vor zehn oder fünfzehn Jahren war? Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Der Eintritt eines Unglücks ist eine Frage der Zeit. Uns liegen ständig aktualisierte Statistiken vor. Jeder möchte für den Fall der Fälle Vorsorge treffen. Für sich und seine Liebsten. Jeden trifft es. Auch uns. Wir sind rückversichert. Wir sind gerüstet. Für den Abschluss bedarf es der Schaffung einer Balance aus realistischer und unrealistischer Angst beim Kunden. Daran ist nichts, aber auch gar nichts verwerflich. Würden wir anders handeln, gäbe es uns nicht, vergiss das nicht. Oder, auf Deutsch: Dann könnten wir den Laden dichtmachen, so Walter. Das ist das Prinzip.
»Hallo, Herr Kaiser.«
Eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Ein Mann stand in der Tür, wesentlich kleiner als ich und glattrasiert, was seinen dunklen Teint unterstrich; nicht unattraktiv trotz des Ansatzes zur Dicklichkeit. Ich schätzte ihn auf Ende 20, Anfang 30.
»Serdar.« Er grinste eine Art Lausbubengrinsen und maß mich zwei, drei Sekunden länger als üblich. Ich machte einen Schritt in seine Richtung, aber er behielt die Hände in den Hosentaschen, deutete nur mit dem Kopf zum Empfangsraum und flüsterte: »Hab’ gleich ’nen Kunden.« Und noch leiser: »Spiele-Entwickler.« Während er sich zum Gehen wandte: »Mittags Chinesisch? Zwölf Uhr?«
Ich nickte.
»Ja?«, fragte er nach. »Zwölf Uhr? Gut. Wir sehen uns.« Und war verschwunden.
In meiner Box fand ich eine Mail meiner Vorgängerin. »Liebe Renate Meißner«, las ich. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und das nötige Glück dazu! Ihre Margarete Sandmann«, und darunter:
Wenn du etwas
öffnest,
in dem sich etwas befindet,
das etwas weiteres enthält,
hältst du ein Geschenk in den Händen
(Japan. Spruch, ca. Kamakura-Epoche)
Weitere Nachrichten von Frau Sandmann waren nicht vorhanden, sah man vom Ordner »Leichen« ab, der noch abzutragende Schadensfälle und Neupolicierungen enthielt.
Meine erste Leiche bestand in einer Ladung erstickter Kois. Ob Frau Sandmann mit dem japanischen Sprichwort darauf angespielt hatte? Auf dem Flug von Tokio nach Frankfurt war die Sauerstoffzufuhr im Bottich unterbrochen worden; alle 183 Brokatkarpfen waren verendet, darunter ein Tancho, der mit 42 Jahren mein Alter hatte und dessen Wert mit einer sechsstelligen Summe angegeben war. Der junge Mann in der Schadensregulierung, dem ich die bearbeitete Datei weiterleitete, nannte mich am Telefon »Frau Sandmann«.
»Hallo, Herr Kaiser.« Serdar stand wieder in der Tür, es war fünf vor zwölf. »Chinese?«
Auf dem Weg durch den Korridor hielt er vor der offenen Tür des dritten Vermittlers unserer Abteilung und sagte, ohne zu klopfen: »Tocktocktock.«
»Ja«, erklang eine hohe Stimme, und Martin, fast einen Kopf größer als ich, schlank, kurze hellrot-blonde Stoppelhaare, so alt wie Serdar, trat heraus. Als er mir die Hand schüttelte, schaute er scheu zu Boden, wie er auch überhaupt sofort durch die Bewegungen seiner langen Glieder und seine Augen, die unentwegt seine Umgebung scannten, Nervosität ausstrahlte. Vorprogrammierter Magenulkus, dachte ich.
»Hallo, Herr Kaiser.« Serdar knuffte Martin in die Seite, der gequält lächelte.
Serdar und Martin schienen befreundet zu sein, beziehungsweise eines jener Verhältnisse zu pflegen – der kleine Quirlige und sein langer schweigsamer Partner –, die man schon oft im Fernsehen gesehen zu haben meint, so dass man sich, kommen sie einem im wirklichen Leben unter, nicht sicher ist, ob man gerade zum Narren gehalten wird und sich fragt, wer oder was hier wen oder was nachahmt.
Im Empfangsraum klopfte Serdar auf Frau Aktans Theke. Er sagte etwas auf Türkisch und grinste ein Grinsen, das mehr bedeutete als nur Amüsement über einen Standardwitz, ein Grinsen, das eine Erinnerung an eine pikante Episode verriet. Frau Aktan verdrehte die Augen und erwiderte sehr schnell ebenfalls etwas auf Türkisch, in einer völlig anderen Tonlage, als wenn sie Deutsch sprach. Ihre Antwort enthielt die Wörter »Herr Kaiser«.
»Hallo, Herr Kaiser«, grüßte Serdar wie beiläufig den Mann im Anzug im Lift. Auch hier, nach einer kleinen Verbeugung die Erwiderung: »Hallo, Herr Kaiser« und breites Grinsen.
»Betriebsfeier. Vorgestern. Schottenhammel. Wiesn«, klärte mich Serdar dann auf der Plaza vor den Towers auf. »Endete natürlich wie immer. Totalabsturz. Der Scholz, ja? Der Scholz!«, wandte er sich prustend an Martin und schnitt eine Grimasse, als müsste er sich übergeben. Martin lachte, indem er in kurzen Abständen und stimmlos, nur mit einem Zischlaut Luft ausstieß. »Jedenfalls«, fuhr Serdar fort. »Am Ende waren wir alle nur noch Herr Kaiser. Zenzi! Herr Kaiser kriegt noch eine Maß!«, rief er einer fiktiven Bedienung zu. »Martin war der Herr Kaiser, der Scholz war der Herr Kaiser, sogar der Lause war der Herr Kaiser. Die Vermittler, die aus der Buchhaltung und die Nasen von der EDV. Alle. Herr Kaiser.«
Auf den ersten Blick mochte ein Außenseiter Serdar für den geborenen Vermittler halten. Er redete viel und mäandernd, so dass man bald nicht mehr genau wusste, worum es eigentlich ging. Wie eine Spinne wob er seine Beute in einen Kokon aus Worten und kitzelte erst ein Schmunzeln aus ihr heraus, dann einen Lacher. Je länger man ihm zuhörte, desto mürber wurde man. Stellte er dann eine Frage, die einen, von seiner energiegeladenen Körpersprache in die Enge getrieben, verwirrte, weil man nicht aufgepasst hatte, hakte er nach und hakte nach, bis er schließlich eine hastig-genervte Antwort erhielt, für die man sich auch wegen seines spöttisch-kurzen »Ach so« sofort schämte. Mir allerdings war sofort klar, dass so einer in der Branche nicht alt wurde. Für Höheres zu geschwätzig und für Routinearbeiten zu ungeduldig, würde er irgendwann, so prognostizierte ich auf dem Weg zum Chinesen, eine Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten riskieren, den Kürzeren ziehen und letzten Endes das Fach wechseln, schätzungsweise in sechs, maximal acht Jahren. Serdar würde einen sehr guten Personalleiter abgeben. Er wusste es nur noch nicht.
Martin dagegen beschränkte sich darauf, Serdars Publikum zu spielen und an seiner Seite nach im Durchschnitt vier Sätzen, immer wenn Serdar eine Pointe riss, aufzukichern und »ja« und »nein« und »echt« zu sagen, was alles drei dasselbe bedeutete, nämlich »mhm«. Im Umgang mit dem Kunden war Martin jedoch 100 %ig auf den Punkt, jeder seiner Sätze saß, ein typischer Fall von Doppel-B, Doppel-P, beruflich brillant und privat peinlich. Damals ging ich davon aus, Martin würde Karriere machen. Früher oder später würde er mir und schließlich Scholz nachfolgen. Anfang Januar 2009 erfuhr ich, er habe sich umgebracht, von einer Brücke vor einen Zug geworfen, den Fahrplan in der Jackentasche. Allerdings starb er erst Tage später im Krankenhaus an einer Infektion; die Verletzungen allein hätten seinen Tod nicht herbeigeführt. Auf seiner Einäscherung soll Serdar zusammengebrochen sein.
Von all dem ahnten wir nichts, als wir damals am 01. Oktober 2008 gegen 12 Uhr 15 beim Chinesen saßen und Martin seine Cola light trank, mit seinen noch heilen Lippen, seinem Mund, den er später wohl zu einem letzten Angst- oder Befreiungsschrei, ich weiß es nicht, aufriss.
Ich aß nichts. In einer der unvermeidlichen Quartals-Fortbildungswochen 2007 hatte ich an einem Seminar mit dem Titel »Hunger nutzen« teilgenommen. Zuerst müssen die Einteilungen in feste Mahlzeiten fallen, Frühstück, Mittag- und Abendessen. Anders als beim Großen, kann es beim Kleinen Hunger nie zur nachhaltigen Befriedigung kommen. Menschen mit Kleinem Hunger kennen den Satz nicht: Ich kann nicht mehr. Mit Kleinem Hunger kann man immer und noch mehr. Es gilt, den Kleinen Hunger als Chance zu begreifen. Wir können immer, wir können mehr. Am Anfang des Seminars wiederholten wir – 15 Teilnehmer, davon 14 Frauen – diese Worte des Trainers auf seine Aufforderung hin zunächst nur widerwillig. Natürlich darf man Hunger haben. Man soll Hunger haben. Der entscheidende Schritt ist, nicht den Hunger und die Arbeit zu trennen, sondern zu vereinen. Es gibt Momente, da taucht im Kopf beim Studium einer Akte plötzlich das realistische Bild einer Tafel Schokolade mit genau gleich großen Rippen oder einer Schale Milchreis auf. Diese Food-Images sollte man sich gestatten und ihnen instantan nachgeben. Denn, wichtig: Zuerst denken wir an Schokolade, Milchreis und was noch, und nur wenn wir uns keine Schokolade, keinen Milchreis gegönnt haben, an Schnitzel und Spaghetti und was noch. Das bedeutet, wir gestatten uns Schokolade, wir gestatten uns Milchreis und verhindern dadurch das Bedürfnis nach Schnitzel und Spaghetti. Wichtig: Natürlich darf man aufstehen und den Korridor hinunter zum Automaten laufen. Ist einmal der Kleine Hunger zum Teil des Arbeitsprozesses geworden, kann logischerweise seine Befriedigung keine Unterbrechung darstellen. Studien, die besagen, Essen brauche Zeit, Essen brauche die temporäre ausschließliche Aufmerksamkeit, sind zu ignorieren. Studien, die besagen, derartiges Essverhalten führe zu Übelkeit oder Fettleibigkeit, sind zu ignorieren.
Der Trainer trug einen grünen Cashmere-Pullover. Der Bewegung, mit der er während seines Vortrags von Dinkel-Keksen abbiss, ohne zu bröseln, haftete nichts Unpräzises oder Unpassendes an, wie es oft bei Anzugträgern aus Chefetagen zu beobachten ist, die verstohlen an Keksen knabbern. Die Schale Erdnüsse auf Konferenztischen in Chefbüros zeugt davon, dass auch die Oberen aus einer Tradition heraus, deren Ursprung keiner kennt, auf die nicht zu unterschätzende Macht des Kleinen Hungers in entscheidenden Situationen setzen. Am Ende des Seminars skandierten wir einstimmig und genuin begeistert: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger.
Auf die Höflichkeit gebietende Frage Serdars, ob ich mich schon in München eingelebt hätte, log ich, dass ich die Stadt gerade erst für mich entdeckte. Dass ich, bis ich 18 war, hier gewohnt hatte, erzählte ich nicht. Persönliches sollte eine Belohnung für Vertrauen sein. Bald ging Serdar dazu über, einen Monolog über eine US-amerikanische Fernsehserie zu halten, die er momentan auf DVD anschaue, eine Serie über das Schicksal einer jüdischen Familie im Dritten Reich.
»Die haben das ganze Lager nachgebaut, also Auschwitz, im Computer, digital, und dabei haben die sich, haben sich die Macher auf Fotos gestützt, die haben die Amis vom Flugzeug damals gemacht, ich meine, kennt ihr die? Ihr wart nie da, oder? In Auschwitz. Ich glaube, da gibt es kaum noch was. Also, diese Rekonstruktion von den, wie nennt man das, so … Baracken, das hat mich echt fasziniert, fand ich total faszinierend.«
»Ja?«, fragte Martin.
Während die beiden auf ihre Peking-Enten warteten, bemerkte ich mit Schrecken, dass mir beschämenderweise nicht einfallen wollte, ob der Zweite Weltkrieg und damit das größte Unglück des 20. Jahrhunderts, vielleicht der Menschheitsgeschichte, 1945 oder, aus irgendeinem Grund hatte ich dieses Datum im Kopf, 1949 offiziell zu Ende gegangen war.
»Aber warum ich das eigentlich erzähle, warum erzähle ich das eigentlich, ich erzähle das, weil gestern, also, als ich mir diesen Film angeschaut habe … ich weiß nicht … sagt Euch TVT was?«
»TV-Was?«, fragte Martin.
»TVT. Fernseh-Telepathie. Das war gestern, also ich habe echt angefangen, Schiss zu kriegen.«
»Ja?«, fragte Martin.
»Also, TVT. Ich sitze da und sage was zu Bettina. Irgendeinen Satz. In dem Satz kam das Wort ›Reis‹ vor. Und direkt im Anschluss sagt also dieser KZ-Häftling genau dasselbe. Reis.«
»Ein klassischer Kumule«, sagte ich.
»TVT«, sagte Martin.
»Genau. Aber dann. Zehn Minuten später. Ich sage wieder was zu Bettina. Irgendwas mit ›Bettdecke‹. Und wieder. Direkt daran im Anschluss. Dieses Mal ein Wärter.«
»Hm«, machte ich.
»Naja. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Also, ich sage noch zu Bettina was von wegen ›Das wundert mich aber jetzt schon ein bisschen‹ oder so. Und dann. Also, ihr kennt doch alle diesen Schlager: ›Ich weiß, da-di-da Wunder geschehen.‹ Also … wirklich direkt daran im Anschluss …«
»Hm«, machte ich.
»Scheiße«, sagte Martin.
»Ja«, sagte Serdar.
»Scheiße«, rief Martin.
»TVT«, rief Serdar.
»Scheiße«, rief Martin.
Martin grinste. Serdar grinste.
Mir war unklar, was hier gespielt wurde.
a) Ein Insider-Witz, b) Serdar veräppelte uns, c) Die Erzählung eines wirklichen Erlebnisses.
Auf dem Weg nach draußen deutete Serdar, der mir beim Warten auf die Rechnung das »Du« nicht angeboten, sondern aufgedrängt hatte wie einem Kunden seine Visitenkarte, auf einen über der Tür montierten Balken.
»Guck mal.«
Der mächtige, angemorschte dunkle Holzbalken übernahm ohne statische Notwendigkeit eine rein dekorative Funktion. Er stellte ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko für jeden Gast dar. Nicht nur war er zu niedrig angebracht, so dass man sich bei einer Körpergröße von über 180 Zentimeter leicht den Kopf stoßen konnte; die Seile, an denen er hing, waren lediglich an Haken in der Decke fixiert. Im Worst Case konnte so eine Fahrlässigkeit zu einem Todesfall führen, der das Restaurant und seine Besitzer ruinieren würde.
»Auf, auf«, meinte Serdar dann, den Blick starr auf den Gehsteig gerichtet. Im Sonnenschein, die noch nicht 100 %ig kahlen Bäume, die matschig grünen Rasenstreifen um mich, gelang es mir zu vergessen, wer ich war, meine Vergangenheit, meinen Beruf, meine Träume, das Jahr, den Monat. Und für Sekunden war es nicht Herbst, es war Frühling.
»Werden toughe drei Monate. Richtig tough«, hörte ich Serdar sagen. »Diese Umstrukturierung und der Controller-Typ sind doch für die oben nur das Alibi, damit einer von uns ’nen Abgang macht. Ich sag’s euch: Am 31.12. wird der Controller ’nen Strich unter unsere Abschlüsse ziehen und schauen, wer die längste und wer die kürzeste Liste hat. Schwanzvergleich.« Er guckte zu mir. »Sorry. Ist so. Ganz einfach. Und ich sag’ euch noch was: Ich werd’ nicht den kleinsten haben. Ich werd’ hier nicht den Tag erleben, an dem ich meine Sachen packen muss wie jetzt der Gernot. Und wenn, dann nur, weil’s für mich ’n paar Etagen höher geht. Das Ding wird gewuppt.«
»’tschuldigung. Welcher Gernot?«
»Lindinger.«
»Lindinger? Der Dienstälteste?«
»Gernot Lindinger.«
»Lindinger geht?«
»Nein, du. Der wird befördert, in den Aufsichtsrat, die alte Raucherlunge. Jaja, Mr -ich-verkauf-eine-Versicherung-am-Tag-ich-mach-das-schon-seit-100-Jahren-so-das-muss-langen-früher-hat-das-auch-gelangt mischt noch mal voll den Laden auf und zeigt uns Jungen, was ’ne Harke ist.« Er trötete wie eine Hupe in einer Quiz-Sendung, wenn ein Kandidat eine Frage falsch beantwortet. »Natürlich nicht! Also, klar geht der. Frührente. Freiwillig. Angeblich. Ich denke mal, das ist einfach zu viel geworden für den Alten. Das Biz ist nicht mehr so wie vor 40 Jahren, als der angefangen hat. Und bevor er mal bei ’nem Kunden oder in ’ner Konferenz was mit dem Herz hat, ist so ’ne Lösung bestimmt besser für den.«
»Darf ich fragen, wann der Nachfolger von Lindinger kommt?«
»Der Nachfolger?«
»Von Lindinger.«
»Ja. Gar nicht, ne?«
»Ach so.«
»Eben.«
»Aber Moment … als ich vorhin mit Scholz da war, stand da noch ein anderer Name an der Tür.«
»Katzer.«
»Genau.«
»Der Controller.«
»Ach … so.«
»Eben.«
Das hieß, es würde auf einen Wettkampf zwischen Serdar, Martin und mir hinauslaufen. Das war nicht von Nachteil. Ich brauchte den Wettkampf als Motivation. Ich arbeitete effizienter, wenn nicht nur eine Prämie auf dem Spiel stand. Eine Situation, die ganz nach Walters Geschmack gewesen wäre.
Während in der Unterführung, die ich am Morgen nur mit Mühe gefunden hatte, unsere Schritte widerhallten, musste ich an eine Episode aus dem Jahr 2006 denken. Im Frankfurter Messeturm, dem CAVERE-Headquarter, war Feueralarm ausgelöst worden. Zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass es in jeder Abteilung sogenannte Desaster Manager gab, die nun mit lauter Stimme Anweisungen gaben. Dies war keine Übung. Es brannte. Viele U30-Mitarbeiter, u.a. auch Tamara Kretschmann, waren sichtlich überfordert. Der ein oder andere kämpfte mit den Tränen. Nahezu geschlossen gelangten wir über die Notausgangtreppen in die Eingangshalle. Vor den Türen neben den Drehtüren, die, das sah ich sofort, nicht für einen derartigen Ansturm gemacht waren, staute es sich. Eine Frau schrie auf. Ich roch Rauch. Zu meinem eigenen Erstaunen blieb ich dennoch völlig ruhig und studierte die Szenerie vor mir. Die sogenannten Desaster Manager mahnten hektisch zur Ruhe. Mit Interesse beobachtete ich gerade ihre zuckenden Lippen, als mir jemand die Ellbogen in den Rücken drückte und es mich nach vorne riss.
»Stopp!«, rief ein Desaster Manager. Erst als sich seine Stimme überschlug, »Stopp! Alle!«, und Trillerpfeifen durcheinandergellten, kehrte Stille ein und hielten die meisten in ihrer Fluchtbewegung inne.
»Sie sind jetzt alle tot«, brüllte der Abteilungsleiter, grinste: »Wenn es wirklich brennen würde.«
Aus den Fenstern der unteren Stockwerke, die Anwaltskanzleien und Consultingfirmen gehörten, schauten Gesichter, auf denen sich Befremden spiegelte.
Dass daraufhin wirklich mehr CAVERE-Mitarbeiter an den freiwilligen Feuerübungen teilnahmen, hielt ich für unwahrscheinlich. Als ich am selben Abend in mein Büro zurückkehrte, fuhr ich mit dem Lift zwei Stockwerke höher, um wie zufällig an Walters Tür vorbeizugehen, die angelehnt war. In den Hochhäusern ringsum, auf deren oberste Stockwerke noch die letzten Strahlen der Abendsonne fielen, brannte bereits Licht. Walter saß an seinem Mahagonischreibtisch. Das schwache Blau des Bildschirms auf den aufgeschlagenen Akten, die silbernen Bilderrahmen mit den Familienfotos, eines von seiner Frau, eines von seinen Töchtern, die leere Kaffeetasse mit dem MoMa-Aufdruck.
»Sie waren nicht unten?«, sagte ich für eventuelle Zeugen gut hörbar, während ich eintrat und die Tür hinter mir schloss.
»Dieser Ton, oder was? Die Simulation?« Er blickte auf. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich für so einen Kinderkram Zeit habe?« Sein Gesicht, die beiden markanten Falten zwischen Mundwinkel und Nase noch tiefer als sonst. Wie immer hatte er über der Arbeit vergessen, die Schreibtischlampe anzuschalten. Zu einem späteren Zeitpunkt unserer Beziehung traute ich mich, auf Walters Seite zu kommen und sie für ihn anzuknipsen; an diesem Abend widerstand ich noch meinem Reflex.
Unvermittelt lehnte er sich zurück, atmete laut aus und sagte in die Düsternis: »Und wenn schon. Wäre ich eben verbrannt.« Er lachte kurz auf, nur um dann wieder vollkommen ernst zu werden und mit der flachen Hand auf den Tisch zu klopfen. Langsamer: »Wäre ich eben mit verbrannt.«
Die starke Anziehungskraft, die von Walter in solchen Momenten ausging. Walter war ein Opfermensch, Serdar jedoch auf gar keinen Fall, dachte ich an jenem 01. Oktober, als wir drei schweigend im Lift nach oben standen und nur unser Atmen und das leise Klacken der Seile aus Stahl zu hören waren. Aus Serdars Erzählung über seinen Fernsehabend konnte ich den Rückschluss ziehen, dass er eine leidlich funktionierende Beziehung führte, die Raum ließ für Gemütlichkeiten und gemeinsame Unternehmungen. Sein Auftreten verriet bei allen beruflichen Ambitionen den Wunsch nach Freizeit und körperlichem Wohlbefinden.
Wenn ich mich frage, wo der Ausgangspunkt für die Ereignisse zu finden ist, über die ich auf diesen Seiten Klarheit erlangen möchte, dann komme ich unweigerlich auf den Nachmittag meines ersten Arbeitstages in München. In diesen Stunden kippte der erste schwarze Stein und brachte unaufhaltsam eine lange, kurvenreiche Dominoreihe zu Fall, deren Ende bis an den Stuhl reicht, auf dem ich gerade sitze.
Meine Vorgängerin hatte mir im »Leichen«-Ordner, Unterordner »Neupolicierung«, einen File zu Quintus Utz hinterlassen. Der Bauunternehmer war das, was man betriebsintern einen B 1-Kunden nannte. Bei CAVERE gab es ausschließlich B 1- bis 5-, aber keine A- oder etwa C-Kunden. A-Kunden hießen Premium-Kunden. Utz hatte kürzlich die aktualisierten Unterlagen für die Errichtung einer über tausend Quadratmeter großen Luxusvilla eingereicht, die der neue Zweitwohnsitz eines saudischen Scheichs werden sollte. Der schon auf den ersten Blick einzuschätzende Umfang der vermittelbaren Bauversicherungspalette, die durch die laufenden Projekte noch nicht in ausreichendem Maße ausgeschöpft wurde, machte einen persönlichen Beratungstermin unabdingbar. Wie immer bei einem neuen vielversprechenden Kunden begann ich, in der CAVERE-Datenbank und im Internet zu recherchieren. Kennst du die Vorgeschichte eines Menschen, bekommst du eine Ahnung davon, wie er sich seine Zukunft vorstellt und welches Risiko er für ihre Verwirklichung in Kauf zu nehmen willens ist. Vor allem erfährst du etwas über seine Ängste. Sie musst du schüren, erst beiläufig, in einem Nebensatz. Zeigt dies nicht die gewünschte Wirkung, gilt es, einen Alarmzustand zu erzeugen, drohende Gefahren anschaulich zu evozieren, Feuer! Gewitter! Blitz! und so weiter, so durchschaubar wie wirksam, jedes Mal wieder, bis der Kunde endlich zum versilberten, nicht Plastik-!, Kugelschreiber greift, der in solchen Fällen bereitliegt, in deine Augen schaut, dort die Zuversicht findet, nach der er sich sehnt, und du auf seine heiser gestellte Frage: »Wo muss ich unterschreiben?« einfühlsam und doch bestimmt antwortest: »Hier. Und hier und hier.« Seine Ängste sind die Fäden, die du aus dem Dreck seiner Vergangenheit ziehst. An ihnen zappelt er.
Hermann Utz, der Vater meines Kunden für die Neupolicierung, war Anfang der 1960er einer der wichtigsten Bauunternehmer der Region gewesen. Der Aufstieg des Hauses Utz hing mit dem allerorts im Land unmittelbar nach dem Krieg einsetzenden Wiederaufbau zusammen, der sich vor allem auf die sogenannten Wahrzeichen konzentrierte. Nach einer Lehre bei dem Schausteller Haase in Norddeutschland und dem Studium in München arbeitete Utz nach 1945 inmitten von Schutthalden und ausgebrannten Häusergerippen daran, München seinen alten Glanz zurückzugeben. Innerhalb weniger Jahre wurden die Fassaden der Michaelskirche und der Residenz so originalgetreu wie möglich wieder errichtet, ganz so, als habe man die Schrecken der Zeit davor innen wie außen schadlos überstanden.
Tatsächlich erinnerte ich mich, als ich Utz’ Biographie recherchierte, an einen Bummel die Residenzstraße entlang als Mädchen neben meiner Mutter; meine Eltern hatten sich gerade scheiden lassen, glaube ich. Als ich meine Mutter erstaunt darauf hinwies, dass die Säulen der Residenz ja lediglich auf die Mauern aufgemalt seien, erwiderte sie: »Na, das hat man damals so gemacht. Das hat dem König damals gefallen so.« Und nach einer kurzen Pause: »Aber du hast schon recht, Nati. Das ist alles nicht echt hier.« Sie deutete auf die schmucken Gebäude um uns, die gerade von Touristen fotografiert wurden. Als ich antwortete, dass ich nicht verstehe, was sie damit meine, erklärte sie mir, dass an jener Stelle, an der wir uns heute befanden, vor knapp 35 Jahren kein Stein auf dem anderen gestanden habe, alles habe gebrannt, die Menschen hätten Krieg miteinander geführt. Noch immer konnte ich ihr nicht ganz folgen. Ich solle mir, versuchte es meine Mutter schließlich, Disneyland in Amerika vorstellen, wo ich immer hinwollte, seitdem ich es einmal im Fernsehen gesehen hatte. Deutschland sei ein bisschen wie ein großes Disneyland. In dem gebe es ja auch Schlösser und Häuser, die aussähen, als seien sie Hunderte von Jahren alt, obwohl das nicht stimme. Das sei doch viel schöner als so etwas Modernes. Und ähnlich sei es eben auch in München. Ich weiß noch, dass ich mich, als wir weitergingen, insgeheim fragte, was das wohl für Geschöpfe wären, die nun in diesen Nachbauten statt Mickey, Donald und Co. wohnten, zum Beispiel in der seltsamen einstöckigen Hütte in der Maximiliansstraße, die noch dazu »Kartenhaus« genannt wurde, weil dort, was ich aber noch nicht wusste, der Kartenvorverkauf für die Oper stattfand, für eben jene Staatsoper, an deren Rekonstruktion Quintus’ Vater Hermann mitgearbeitet hatte. Aufgrund der guten Auftragslage hatte er sich in den 50ern selbständig machen können und galt seitdem als Fachmann für alle Belange des Wiederaufbaus. Einerseits ging Hermann Utz einer restaurativen Tätigkeit nach, ließ klassizistische Säulen zementieren und Musenstatuen gießen; andererseits genoss er offensichtlich die neue Zeit, die Jahre des Wirtschaftswunders: Der Bau- war auch ein Partylöwe, wie es in einem Artikel im Internet hieß. Er fuhr einen Alfa Romeo Giulia, trug Hawaiihemden und war häufig zu Gast auf den Feiern und Bällen berufsferner Kreise. Das einzige Foto, an das ich mich heute noch erinnere, zeigt ihn inmitten schöner Frauen. Er hat den Mund weit aufgerissen, fletscht die Zähne und stellt die Mordsgaudi, die er gerade hat, überdeutlich aus.
Hermann Utz war mit der ausgesprochen attraktiven Schauspielerin Gudrun Eppler verheiratet, die mich, obwohl sie schwarzhaarig war, an mich selbst erinnerte und vor deren Altersfoto ich mit einem gewissen Unwohlsein überlegte, ob ich wohl gerade meinem künftigen Spiegelbild ins faltenreiche Gesicht blickte. Sie hatte es nie zu mehr Bekanntheit als zu der eines Sternchens gebracht; einige Nebenrollen in Edgar-Wallace-Filmen, wo ihr zumeist die undankbare Aufgabe zukam, hübsch auszusehen und früh zu sterben, von Irren erdrosselt, erstochen, vergast, heute vergessen.
An den wenigen Abenden, die wir gemeinsam im Bett verbrachten, liebte es Walter, wenn sonst nichts kam, Streifen wie »Der Hexer« oder »Der Frosch mit der Maske« zu gucken, die eigentlich ständig kamen, zumindest in meiner Erinnerung. Hörbar fing Walter, 15 Jahre älter als ich und als Jugendlicher regelmäßiger Kinogänger, beim ersten Auftritt gewisser Schauspieler oder bei von reißerischer Musik untermalten absurden Tötungsszenen zu schmunzeln an, als sehe er gerade etwas gänzlich anderes als ich, etwas Verzauberndes.
Mir wiederum war es völlig unmöglich, nachzuvollziehen, warum zum Teil dasselbe Publikum, das sich in den Jahren zuvor für nationalsozialistische Heimatfilme und Komödien, dann für bundesrepublikanische Heimatfilme und Komödien begeisterte, sich nun vom vermeintlich wohligen Grusel der Edgar-Wallace-Filme, dieser Mischung aus Sadismus und ungelenkem Klamauk, bereitwillig hinreißen ließ.
Vielleicht hatte Hermann Utz in all den Jahren seines Erfolges den aus der Perspektive eines Geschäftsmannes eigentlichen Sinn der Partys vergessen, die Akquise. Möglich, dass es schließlich auch allgemein weniger zu tun gab für jemanden, dessen Haupttätigkeit darin bestand, die Spuren des Dritten Reichs zu beseitigen. Kurzum, seine Geschäfte entwickelten sich ab Mitte der 60er Jahre nicht mehr in die gewünschte Richtung. Fraglich, ob er seinen gehobenen Lebensstil hätte halten können, wenn er nicht 1971 den Zuschlag für eine Siedlung nahe des Olympiadorfs bekommen hätte, das auf den inzwischen überwachsenen Schuttbergen des Krieges errichtet werden sollte.
Die Hintergründe für das, was sich anschließend ereignete, waren mir nicht ganz nachvollziehbar. Als im Jahr vor der Olympiade die Wohnblöcke hochgezogen wurden, stürzte einer der Rohbauten komplett in sich zusammen und riss acht Arbeiter mit in den Tod. Die Schuld wurde zwar nicht dem Bauunternehmer angelastet, sondern dem von ihm beschäftigten Statiker. Für die juristischen Auswirkungen war dies, was viele Laien, wie ich erfahrungsgemäß weiß, als ungerecht empfinden, freilich im Endeffekt nebensächlich, da Utz selbstverständlich für alle seine am Bau beschäftigten Arbeiter haftete. Die Versicherung deckte den Schaden nicht ab. Utz hatte sie, vielleicht aus Sparsamkeit, zu niedrig abgeschlossen. Die Firma war ruiniert.
Am 30. Dezember1971 kam der silberne »Maserati aus Ingolstadt«, in dem Hermann und Gudrun Utz saßen, auf der Landstraße zwischen Murnau und Habach von der vereisten Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor er gegen einen Baum prallte. Der Fahrer, Hermann Utz, starb noch am Unfallort; Gudrun überlebte, schwer verletzt. Fortan verbarg sie den rechtsseitig verbrannten Hinterkopf unter einem Kopftuch, als wäre ihr nun die Maske der entstellten Haushälterin, die sie Jahre zuvor in einem Edgar-Wallace-Film gespielt hatte, in Fleisch und Blut übergegangen. Weil die Gutachter der Allianz im Unterschied zu mir kein Anzeichen für einen Selbstmord sahen, wurde der Witwe die üppige Risikolebensversicherung ihres Mannes ausbezahlt. Sämtliche Schulden der Firma konnten getilgt, die Versteigerung der Bogenhausener Villa abgewendet werden.
In den Daten, durch die ich mich an diesem Nachmittag meines ersten Arbeitstages in München klickte, fand sich kein Hinweis darauf, dass Quintus frühzeitig eine Lehre bei seinem Vater absolviert hätte; stattdessen gleich nach dem Bund eine Notiz zur Anmeldung für die Aufnahmeprüfung im Fach Klavier an der Musikhochschule, was ich der künstlerischen Ader der Mutter zuschrieb. Doch nach dem Unfall verzichtete er auf das Bewerbungsvorspiel am Konservatorium und begann stattdessen, die Geschäfte zu leiten, zunächst noch, da ohne nennenswerte Erfahrung, gemeinsam mit dem Stellvertreter seines Vaters. Den Akten nach konnte bis Mitte der 90er allerdings kaum davon die Rede sein, dass die Firma Utz auch nur annähernd wieder jene Stellung in der Münchener Baubranche einnehmen würde, die sie einmal innegehabt hatte. Quintus buk kleine Brötchen. Zweimal drohte Insolvenz. Auf den Fotos bildete ich mir ein zu erkennen, warum. Die kräftige Statur hatte er vom Vater, die braunen Locken plus die wie von einem Schleier verhangenen grünen Augen von der Mutter, was ihn zwar in seinen jungen Jahren sicherlich zu einem schönen Mann machte; allerdings stand ihm eine für seine Branche unvorteilhafte Weichheit und Nachdenklichkeit ins Gesicht geschrieben. Ich stellte mir seine Klavierspielerfinger vor, die er anfangs, als noch nicht entschieden war, dass das Unternehmen seines Vaters auch seine Bestimmung werden würde, mit Handschuhen schützte, wobei es sich natürlich um reine Spekulationen meinerseits handelte. Vielleicht schlug meine Phantasie an diesem Nachmittag deshalb Kapriolen, weil Walter manchmal davon gesprochen hatte, er träume davon, »richtig« Klavier spielen zu können. Von Quintus Utz waren nur Porträtaufnahmen im Internet vorhanden.
Was jedenfalls seit circa 1997 mit der Firma Utz geschehen war, lief der pessimistischen Voraussage gründlich zuwider, die man aufgrund der Abwärtsentwicklung der vorherigen Jahrzehnte zu machen geneigt gewesen wäre. Denn während Hermann Utz’ Rekonstruktionen nach knapp einem halben Jahrhundert, in denen Autoabgase, Wind und Regen angefangen hatten, sie zu zersetzen, nun selbst restauriert wurden, eine Alzheimererkrankung Gudrun Utz in einer Klinik ihren Mann, seine Affären, den Autounfall und die für den Film auswendig gelernten Sätze vergessen ließ, wendete sich das Blatt für ihren Sohn. Nach dem Tengelmann-Zentrallager Süd in Gauting schien er das Vertrauen der Supermarktkette erworben zu haben. Bis 2008 leitete er die Errichtung von über zwei Dutzend weiteren Filialen in Gewerbegebieten, auf die Aufträge für angrenzende Logistik-Parks und Sportcenter folgten. Es handelte sich um Billigbauten, Sperrholz, Styropor, gepresste Leichtbetonwände und so weiter, in der Masse aber eine kleine bis mittelgroße Goldgrube.
So lückenhaft die Faktenlage war und so sehr sie auch durch Mutmaßungen komplettiert werden musste, so aussagekräftig war doch das Bild des 58-jährigen Quintus Utz, das ich an jenem Nachmittag schließlich vor Augen hatte. Obwohl sich einiges an Fuck-You-Money auf seinem Konto angesammelt hatte, lebte er einigermaßen sparsam immer noch in der Villa seiner Eltern, besaß nur ein Auto, war eingefleischter Junggeselle. Natürlich wäre ihm der Ausdruck Fuck-You-Money fremd. Er hätte es sich leisten können, Partys mit B-Promis zu feiern, seinen Urlaub in der Karibik zu verbringen, eine Omega-Uhr zu tragen. Er musste sich nicht darum kümmern, was die Leute über ihn dachten und ihm nicht offen zu sagen wagten, weil sie sich unschlüssig darüber waren, ob sie ihn nicht eines Tages brauchen würden. Seine Auftragsbücher waren gefüllt. Bis auf eine Affäre mit einer bekannten Fußballspielerin hörte man freilich nichts über ihn. Mit seinen naturbelassenen Zähnen lächelte er sympathisch-undurchdringlich. Was einem als Erstes bei seinem Namen einfiel, war »Utz – Wir bauen auf«, in weißer Schrift auf himmelblauen Minivans oder Transparenten an Gerüsten. All das konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er Angst hatte. Angst, dass ihm das Gleiche widerfahren würde wie seinem Vater. Zusehen zu müssen, wie in einer halben Minute über 30 Jahre Arbeit und Träume zunichte gemacht wurden. Angst, vor den Trümmern der eigenen Existenz zu stehen. Eine Redewendung, die ein Bauunternehmer mit dem Schicksal seines Vaters erfunden haben musste. Er aber befand sich genau jetzt, im Herbst 2008, an einem Wendepunkt. Vom Pressspan-Styropor-Supermarkt- zum Luxus-Villen-Erbauer. Er hatte viel Pech in seinem Leben gehabt. Jetzt war der Moment für einen Neuanfang gekommen. Er war bisher vielleicht recht zurückhaltend gewesen, was die Versicherung seiner Supermärkte beziehungsweise Lagerhallen anbelangte. It was about time to think bigger. Utz würde diesen Satz nie sagen. Er würde nie mit einer Fremden über seine Angst sprechen, schon gar nicht mit einer Versicherungs-Vermittlerin. Das wäre nicht er. Ach, wie gut, dass niemand weiß.
In den Fensterscheiben erblickte ich das Doppel meines hellerleuchteten Büros, am Tisch, vor dem Computer, verschwommen, mich selbst. Die Jalousien mussten sich wieder in die Höhe gefahren haben, als es draußen dunkel geworden war. Ich hatte über die Akten und Internetseiten zur Utz-Geschichte die Zeit vergessen. Im Korridor standen alle Türen offen. Ich warf einen Blick in das Büro Scholz’ und bemerkte etwas Alt-Vertrautes, brauchte jedoch ein paar Sekunden, bis ich wusste, was es war. Gegenüber dem sauber aufgeräumten Schreibtisch hing der Kunstdruck aus meinem ehemaligen Büro in Frankfurt. »Mark Rothko: White Center«. Ein Bild, dessen Wert ebenfalls unter 100 Millionen Dollar lag, wie ich befriedigt feststellte. Was meine eigentliche Aufmerksamkeit auf sich lenkte, waren jedoch drei silbern gerahmte DIN-A4-Urkunden an der Wand hinter dem Schreibtisch, das heißt, sie waren so angebracht, dass sie dem Kunden während eines Termins unweigerlich ins Auge stechen mussten. Die geschwungene schwarze Schrift auf dem Büttenpapier gab darüber Auskunft, dass Scholz 1991, 1998 und 2002 zu den 100 erfolgreichsten Vermittlern von CAVERE gehört hatte. Noch während ich beschloss, auch meine Urkunde vom vergangenen Jahr demnächst aus meinen Unterlagen zu Hause herauszusuchen, zu rahmen und aufzuhängen, verharrte mein Blick auf dem Datum 1991, mit dem es, ich spürte es, irgendeine besondere Bewandtnis hatte. Dann fiel es mir ein: Vor meiner Zeit als Vermittlerin war es, wie mir ein wesentlich älterer Kollege am Anfang meiner CAVERE-Karriere mit verschränkten Armen und in Falten gezogener Stirn erzählt hatte, zu einem Skandal gekommen, der in den Medien für erhebliches Aufsehen gesorgt hatte. Dem Jahrgang 1991, so mein Kollege, sei »für einen Pappenstiel« eine gemeinschaftliche Incentive-Reise ins ehemals kommunistische Prag angeboten worden, wo CAVERE ein Palais angemietet hatte. Im Eingangsbereich des weitläufigen Gebäudes warteten bereits bei der Ankunft der Gruppe 30 nackte »einheimische Freudenmädchen«, wie der Kollege sich ausdrückte. Jedes »Freudenmädchen« war am Handgelenk durch eine Art Tätowierung entweder mit einer A 1, A 2, A 3 oder einer A 4 markiert, entsprechend der alten CAVERE-Einteilung der Kunden, wobei die A 4- im Vergleich zu den A 2- und A 3-Freudenmädchen in der Mehrzahl waren. Es gab nur fünf A 1-Mädchen, so mein Kollege. Jedes Mädchen trug außerdem zahlreiche farbige Bändchen um den Arm, A 1-Mädchen gelbe, A 2 rote, A 3 grüne, A 4 blaue. Der »Reiseleiter«, ein inzwischen versetzter Frankfurter Aufsichtsrat, erklärte den Vermittlern die Spielregeln des Abends. In den aus feuerschutztechnischen Gründen nicht abschliessbaren Zimmern seien Betten aufgestellt. Nach jedem »Schäferstündchen«, der Kollege gebrauchte diesen Ausdruck, mit einem »Freudenmädchen« werde dem jeweiligen Vermittler das entsprechende Bändchen ausgehändigt. Am Morgen gebe es einen weiteren lukrativen Überraschungspreis für den, der die meisten Bändchen gesammelt und die höchste Punktezahl erreicht habe, für A 1 erhalte man logischerweise die meisten Punkte. Verrechnungen seien möglich: Drei A 4 entsprächen einer A 1 und so weiter. Der Reiseleiter stehe die ganze Nacht für Auskünfte zur Verfügung. Duschräume und Toiletten seien ausreichend vorhanden, ebenso Ruheräume mit Liegen und Automaten für Präservative. Die Mädchen seien medizinisch untersucht. Alle seien gesund. Der Reiseleiter erinnerte die Vermittler nochmals an die Einwilligung, die sie in Deutschland unterschrieben hatten, als sie in einem internen Geheimschreiben über ihren Gewinn informiert worden waren. Darin hatten sie erklärt, sie verstünden, dass jede Bildaufnahme und jeder öffentliche Bericht über die Reise zum sofortigen Ausschluss von der »Veranstaltung« im Palais führen sowie zu Hause mit einer regulären verschärften Abmahnung geahndet würde, wie sie bei groben Zuwiderhandlungen üblich sei. Der Ausflug hatte, nachdem er einige Jahre später bekannt geworden war, keinerlei gravierende Konsequenzen zur Folge gehabt, außer für jenen Vermittler, der an die Presse gegangen und deshalb entlassen worden war, da ein offensichtlicher Vertragsverstoß vorlag. Man bewege sich, so mein Kollege, bei solchen Sachen in einer rechtlichen Grauzone. Sofern nicht altersbedingt ausgeschieden oder zur Konkurrenz gewechselt, seien die 99 besten Vermittler von 1991 jedenfalls immer noch für CAVERE tätig. Manche der Teilnehmer trügen weiterhin die damals erworbenen Bändchen unter dem Sakkoärmel. Im Unternehmen nenne man sie denn auch intern eben so, »Bändchenträger«, was durchaus als Respektbekundung zu verstehen sei. »Sind denn auch Vermittlerinnen dabei gewesen? Unter den Top 100 Vermittlern hat sich doch sicherlich auch eine Frau befunden?«, hatte ich meinen Kollegen noch gefragt. Ich hatte die Frage damals tatsächlich ernst gemeint. Ich war neu im Unternehmen. Er hatte die Stirn noch tiefer in Falten gelegt, nicht dass er wüsste gemeint und sich verabschiedet. Während er den Korridor entlangging, hörte ich ihn durch die Nase schnauben, lachend. Danach hatte ich eine Zeitlang auf die Handgelenke meiner Kollegen geachtet, an denen aber nie ein Bändchen hing.
Ob die einige Jahre später lancierte CAVERE-Werbekampagne den nach dem Skandal zweifellos beim Kunden entstandenen Image-Schaden beseitigte oder ob im Lauf der Zeit der Vorfall in Vergessenheit geriet, kann ich nicht mit 100 %iger Sicherheit sagen, auch weil ich seitdem nie wieder mit einem Kollegen über jene Incentive-Reise nach Prag gesprochen hatte. Die Plakataktion, erinnere ich mich korrekt, richtete sich gegen das gängige Vorurteil, Versicherungen würden lügen, Verträge wären absichtlich in nicht verständlichem Beamtendeutsch verfasst et cetera, indem auf genau diese Klischees angespielt wurde. Ein idealer Kunde – ich glaube, es waren einige halbwegs bekannte Schauspieler darunter –, machte auf einem Foto eine betont natürliche Miene. Ich erinnere mich, dass es bei CAVERE lange Diskussionen gegeben hatte, wie ein normaler Kunde mit einem natürlichen, das heißt ungekünstelten Gesichtsausdruck auszusehen habe, da sich der Kunde nicht mit einem zu gut aussehenden Modell identifizieren könne und mit einem hässlichen Modell nicht identifizieren wolle; darüber hinaus wirke, so ein Einwand, jede Geste und jede Miene des Modells auf dem Plakat von vornherein gestellt, selbst wenn es sich um einen Schnappschuss handelte, was aber natürlich nicht der Fall war. Über jedem Foto war auf den Plakaten eine Gedankenblase angebracht: »Ich will endlich eine Versicherung, die mich nicht anlügt!« et cetera. Worüber bei uns Vermittlern damals besonders Uneinigkeit herrschte, war, ob nicht genau das Insistieren darauf, dass CAVERE anders, das heißt ehrlich, sei, als ironischer Verweis, ja, als besonders sarkastisch, das heißt unehrlich, wahrgenommen würde. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mir aber bis zu diesem Zeitpunkt, als ich am 01. Oktober vor Willy Scholz’ Urkunde stand und mir die Geschichte von der Prager Incentive-Reise und der Ehrlichkeits-Kampagne wieder einfiel, nur selten über diese Diskussion Gedanken gemacht. Man muss den Fakten ins Auge sehen. Ich weiß mittlerweile genau, wann der Satz »Ich möchte jetzt ganz ehrlich zu Ihnen sein« im Kundengespräch fallen muss und wer ihn hören will.
Aus dem Großraumbüro der Schadensregulierer auf der anderen Seite des Korridors klang das dumpfe Geräusch von Staubsaugern, die gegen Möbel stießen. Einzig im Empfangsraum unterhielt sich noch jemand, ich meinte, Scholz‘ fränkischen Akzent zu erkennen. Es war jedoch nur Günther Beckstein, der auf dem Bildschirm mit betretener Miene vor einem Strauß Mikrophone der leeren Sitzrunde in der Warteecke seinen Rücktritt als Ministerpräsident erklärte. Wichtiger: Der Dax stand bei 5800 Punkten. Alles wartete auf das Rettungspaket aus den USA. Stefan Söllner (Postbank): »Das ist die Ruhe vor dem