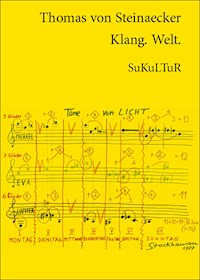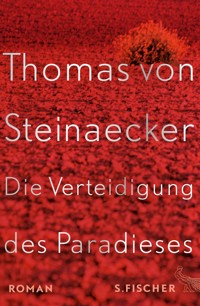
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas von Steinaecker schreibt einen atemberaubenden Roman über die Zukunft unserer Gegenwart: literarisch virtuos, philosophisch radikal und zutiefst berührend. Er möchte ein guter Mensch sein. Aber Heinz lebt in einer Welt, die Menschlichkeit nicht mehr zulässt. Deutschland ist verseucht und verwüstet, Mutanten streifen umher, am Himmel kreisen außer Kontrolle geratene Drohnen. Zusammen mit seinem besten Freund, einem elektrischen Fuchs, dem Fennek, wächst Heinz in einer kleinen Gruppe Überlebender in den Bergen auf. Er nimmt sich vor, die verlorene Zivilisation zu bewahren, sammelt vergessene Wörter und schreibt die Geschichte der letzten Menschen. Doch was nützen Heinz Wissen und Kunst jetzt noch? Da gibt es plötzlich das Gerücht, weit im Westen existiere ein Flüchtlingslager. Und die Gruppe bricht auf zu einem mörderischen Marsch ins vermeintliche Paradies …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Thomas von Steinaecker
Die Verteidigung des Paradieses
Roman
Über dieses Buch
Er möchte ein guter Mensch sein. Aber Heinz lebt in einer Welt, die Menschlichkeit nicht mehr zulässt. Deutschland ist verseucht und verwüstet, Mutanten streifen umher, am Himmel kreisen außer Kontrolle geratene Drohnen. Zusammen mit seinem besten Freund, einem elektrischen Fuchs, dem Fennek, wächst Heinz in einer kleinen Gruppe Überlebender in den Bergen auf. Er nimmt sich vor, die verlorene Zivilisation zu bewahren, sammelt vergessene Wörter und schreibt die Geschichte der letzten Menschen. Doch was nützen Heinz Wissen und Kunst jetzt noch? Da gibt es plötzlich das Gerücht, weit im Westen existiere ein Flüchtlingslager. Und die Gruppe bricht auf zu einem mörderischen Marsch ins vermeintliche Paradies … Thomas von Steinaecker schreibt einen atemberaubenden Roman: literarisch virtuos, philosophisch radikal und zutiefst berührend.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, D-60596-Frankfurt am Main, Hedderichstr. 114
Mit zwei Reklamen von Sascha Hommer
Covergestaltung: hissmann, heilmann, hamburg / Sonja Steven
Coverabbildung: Frank Mädler
Hinweis: Aus technischen Gründen weicht das E-Book an einigen wenigen Stellen in der Darstellung von der gedruckten Fassung ab.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403024-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Das schwarze Heft
Heinz
Edel sei der Mensch, [...]
I. Die Gemeinschaft
Altwort-Liste I
II. Die Offenbarung
Muba und Baba, die beiden ältesten Bakterien der Welt
Changs Erzählung
III. Planet der Affen
IV. Invasion – Explosion
Erinnerungen Ti t’e da Wan Dulis, der ältesten Schildkröte des Erdkreises, am Ende ihrer Tage
V. Der Traum
VI. Das wohltemperierte Klavier, Teil I
Begebenheit aus dem letzten Krieg
Das Blaue Heft
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Der Zehntausendmetermann Der Geschichte erster Teil
Der Zehntausendmetermann Der Geschichte zweiter Teil
Vierter Tag
Postskriptum
Kleines Prayer
Fünfter Tag
Interstellare Botschaft des Raumfahrers an seinen Sohn, Heinz
Sechster Tag
Siebter Tag
Achter Tag
Neunter Tag
Zehnter Tag
Elfter Tag
Zwölfter Tag
Dreizehnter Tag
Vierzehnter Tag
Fünfzehnter Tag
Sechzehnter Tag
Siebzehnter Tag
Das grüne Heft
Liebe Menschenfreunde, hier
Hier, im Schleuser-Camp, gibt [...]
Fisch Vogel Mensch
Heinz
Alles, was künftig geschehen [...]
Vorwort
I.
Das Große Lager existiert [...]
Frage: Wie lange sitze [...]
Zugegeben: Ich bin Insasse [...]
Ich habe den Bau [...]
(...)
Weiter. Weiterschreiben. Nicht mit [...]
Man guckt vom Papier [...]
»Ja?«, sagt die Lampe.
In meiner Zelle sitzt [...]
»Ich will, dass du [...]
»Das«, sagt Ti t’e [...]
Ich höre nicht auf.
Es ist Nacht, der [...]
Früh am Morgen. Kommen [...]
Das gelbe Heft
In Gedanken versunken blicke [...]
DATUM DES TODES: 05–14
Dank
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.
Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden,
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Das schwarze Heft
Ich wache auf, ich habe Durst. Nicht nur ein bisschen, sondern Durst à la: Noch zehn Minuten, und ich bin tot. Es ist mitten in der Nacht. In meinem Zimmer haben meine Eltern den Homie, unseren Haus-Computer, ausgeschaltet, damit ich nicht an ihm herumspiele. Also muss ich hinüber zum Lichtschalter, und das, obwohl ich wirklich riesige Angst vor der Dunkelheit habe. Und wenn ich riesig sage, meine ich schrecklich. Ich nehme also all meinen Mut zusammen, steige aus dem Bett und stolpere los. Bei jedem Schritt kleben meine nackten Füße kurz am Parkettboden fest. Dazu taucht in meinem Kopf ein absolut unheimliches Bild auf: wie sich die Haut der Sohlen in die Länge zieht. Endlich ertaste ich an der Wand den Schalter. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ich befände mich gar nicht in meinem Zimmer, sondern in einer gewaltigen, leeren Halle ohne Ausgang auf einem fremden Planeten. Aber da ist der Schalter, ich wische darüber, und es ist mein Zimmer, auf dem Boden liegt mein Spielzeug, da steht mein Kleiderschrank, da mein Tisch mit dem Mal-Screen. Trotzdem sieht im elektrischen Licht alles anders aus als tagsüber. Als wäre hier gerade eben erst etwas geschehen, das nichts für Kinder ist. Im hellen Kegel, der aus meiner Tür in den Flur fällt, husche ich los, am Zimmer meiner Eltern und dem meines kleinen Bruders vorbei, vorbei am Erbstück, dem Wandteppich, der eine golden schimmernde Stadt mit Zinnen und Türmen zeigt. Endlich in der Küche, rufe ich außer Atem: »Licht!« Sofort führt der Homie meinen Befehl aus. Ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen, um den Kühlschrank zu öffnen, strecke mich nach der Milchpackung, jetzt habe ich sie, sie ist schwerer als gedacht, aber heute rutscht sie mir nicht aus der Hand so wie letztes Mal. Ich drücke die Lasche auf. Leise ploppend zerplatzt eine durchsichtige Blase in der dreieckigen Öffnung. Das Hologramm auf der Packung ist Schönheit deluxe: Eine Kuh und ein alter Mann mit Schlapphut, grauem Bart und einem knorrigen Stab in der Hand schmiegen die Köpfe aneinander. Vor lauter Seligkeit haben beide ihre Augen zu Schlitzen verengt. Darunter steht ein Wort, von dem ich, obwohl ich noch nicht lesen kann, weiß, was es bedeutet, weil es meiner Mutter so wichtig ist. ARTGERECHT. Nur mal fürs Protokoll: Ich habe niemanden aufgeweckt und bin ganz allein nachts in die Küche geschlichen. Wenn ich meinen Eltern morgen davon erzähle, werden sie staunen. Vielleicht werden sie stolz auf mich sein. Wie die Zeit vergeht. Genau so sagen sie das manchmal. Ich führe die Kanten des Kartons an den Mund und spüre, wie die Milch durch meinen Körper fließt, durch meine Kehle, meine Brust, jetzt durch mein Herz, weiß und kalt.
Nur in absoluten Ausnahmesituationen rufe ich mir solche Glücksmomente deluxe aus der Voruntergangszeit ins Gedächtnis. Anders als sonst blieb ich also heute Morgen noch auf meiner Matratze liegen, während die anderen schon unten in der Stube rumorten. Jedes einzelne Altwort aus meiner Ich-hole-mir-Milch-aus-dem-Kühlschrank-Erinnerung flüsterte ich vor mich hin. Es ist ein ziemlicher Jammer, dass hier auf unserer Alm keiner mehr all die schönen Wörter braucht. Aber klar, was sollen die anderen auch mit Parkett, was mit Erbstück oder artgerecht anfangen, wenn das, was wirklich zählt, Vorräte, Ernte und Fleisch heißt? Ich stelle mir manchmal vor, die Altwörter wären kleine befellte Wesen und würden sterben, wenn man sich nicht richig um sie kümmert.
Ich muss gestehen, obwohl es ein wenig strange klingt: Ich habe das Gefühl, dass ich für diese Altwörter verantwortlich bin. Vielleicht versuche ich deshalb, sie mir so genau zu merken. Während ich putze, ausaste, die Schweine füttere oder was auch immer tue, sage ich mir all die inneren Listen, die ich in den vergangenen Jahren erstellt habe, wieder und wieder vor. Das hilft. In meiner aktuellen Top Ten der besten Altwörter ever steht zurzeit Salbader auf Nummer eins. Aber auch die Nummer zwei, weidlich, ist heftig. Genauso wie Amnestie. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Demonstration, Plenarsaal, Internet. Ich bin verrückt. Es ist schrecklich.
Aber ich wollte ja eigentlich von heute Morgen erzählen, von meinem fünfzehnten Geburtstag. Also. Ich bin aufgewacht, habe noch, wie gesagt, ganz kurz über ein paar Altwörter nachgedacht und bin wirklich freudigst aus unserer Schlafstube durch die Bodenluke die Leiter hinuntergeklettert, um Cornelius, Jorden, Chang, Özlem und Anne, die schon beim Frühstück saßen und besprachen, was es zu tun gebe, einen »wunderbaren Guten Morgen« zu wünschen. Das »wunderbar« habe ich ein klein wenig betont, weil dieses »wunderbar« ein gutes Wort ist, um daran anzuknüpfen, zum Beispiel mit »Einen wunderbaren Geburtstag wünsche ich dir!« oder so etwas in der Art. Kann schon sein, dass ich dabei ein wenig zu erwartungsvoll geguckt habe. Jedenfalls hat Jorden das alles wieder einmal in den falschen Hals bekommen.
»Schaust’n so?« Er blickte nur kurz von seinem Teller auf und grummelte dann in seinen langen dünnen Bart: »Is was?«
Na ja. Irgendwie war schon was: Niemand gratulierte mir zu meinem Geburtstag. Aber natürlich auch kein Grund zum Heulen, schließlich war ich ja nun wirklich kein Kind mehr. Also redete ich mir ein: Lass die erst mal richtig wach werden. Bestimmt ist Cornelius der Erste, der gleich was sagt. Irgendwie nahm ich es als ein Zeichen, dass er seinen himmelblauen Leinenanzug angezogen hatte, von all seinen Anzügen der mit den wenigsten Löchern. Cornelius trug ja trotz der Hitze immer wieder einen seiner sogenannten Sommeranzüge. Aber heute, da war ich mir sicher, trug unser weltbester Leader eben den himmelblauen extra wegen mir.
Plötzlich zischte er in Richtung Tür: »Gschgsch!« Vorfreude; doch dann sah ich das verschwommene haarige Gesicht an der Scheibe, die dunkle Gestalt, den Affen, der neugierig seine feuchte Schnauze gegen das Fenster presste. Sofort sprang Jorden, der wieder einmal in der allermiesesten Stimmung war, auf, stürmte nach draußen und begann, um ein Altwort zu gebrauchen, unflätig zu schimpfen und zu schreien. Seelenruhig wandte der Pavian unserer Hütte seinen fetten roten Popo zu und hoppelte über die Wiese, schaute sich herausfordernd lange um und setzte sich erst wieder in Bewegung, nachdem Jorden einen Stock in seine Richtung geschleudert hatte. Jetzt kam Leben auch in die anderen Affen, die in der großen Eiche am Waldrand hockten. Vor Begeisterung über das Schauspiel kreischten und sprangen sie auf den Ästen herum. Eines der Weibchen fletschte grinsend die Zähne, und es kam mir so vor, als würde es mich, Heinz, den Honk, auslachen.
In der Hütte machte sich derweil einer nach dem anderen bereit, an die Arbeit zu gehen. Ich war wirklich so nahe dran, Cornelius zu fragen, ob er nicht etwas vergessen habe. Bisher war doch immer der erste Februar, egal ob ich Mist gebaut hatte oder nicht, mein Festtag gewesen, Heinz-Tag.
Als hätte sie in diesem Augenblick meine Gedanken erraten, sagte Özlem etwas Herzliches, die Sommersprossen auf ihren hohen Wangenknochen tanzten, ich strahlte ihr ins Gesicht, freute mich riesigst – sie meinte allerdings gar nicht mich, sondern redete, während sie ihre schwarzen Locken zu einem Pferdeschwanz band, mit Chang, mit dem sie händchenhaltend abzog. Ich hörte, wie der Name Romy fiel. Sie sprachen ihn ganz fürsorglich aus. Also wollten sie nach der kranken Kuh schauen, die wir so getauft hatten und die seit gestern lahmte. Jorden war da schon weggestampft, klar, um erst einmal zu trainieren, wie er es nannte. Die anderen sagen, früher habe er sich fast ausschließlich um die Tiere und die Felder gekümmert – und jetzt mache er nur mehr seine sinnlosen Übungen. Aber die gute alte Anne, dachte ich mir, unsere Gemeinschaftsomi wird sich doch etwas für mich ausgedacht haben! Sie trat zu Cornelius, er streichelte ihr über die Schulter. Er flüsterte ihr irgendwas zu, wieder hörte ich Romy, immer bloß Romy, Anne seufzte tief, wie sie es manchmal tut, band sich ihren selbstgeflochtenen Strohhut ums Kinn und blinzelte in meine Ecke. Ich richtete mich auf. Sie sah mich gar nicht, schnarrte ein »Also dann« in Cornelius’ Richtung, und weg war sie.
Ich schwöre, all das hätte mich beinahe getötet. Ich knetete die Hände. Überlegte intensiv. Waren sie sauer auf mich? Manchmal konnten sie ja ganz schön angepisst sein, weil ich wieder, anstatt zu arbeiten, vor mich hin geträumt hatte. Früher hat Cornelius mich unseren Pinocchio genannt und gesagt, ich solle mal gut aufpassen, dass mir vor lauter Lügen nicht eine lange Nase wächst. Vor ungefähr einem Jahr hat es mir überall tierisch in den Beinen und Armen gezogen, und ich dachte schon, ich sei krank, und wenn ich sage krank, meine ich krank-krank, bis die anderen erklärten, ich komme jetzt wohl in das, was Pubertät heißt. Dann werde es bald erst so richtig schlimm mit mir. Ganz schlimm ist es nicht geworden, finde ich, aber ich bin seitdem fast jeden Monat ein Stückchen gewachsen, weswegen ich ab und zu heimlich vor unserem Spiegel im Klo stehe, dessen Glas grüne Flecken zuwuchern wie Schlingpflanzen die Tümpel im Wald. Immer wieder betaste ich meine Nase. Sie ist, wenn meine Berechnungen stimmen, mindestens einen Zentimeter länger geworden. Und obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht sein kann, befürchte ich manchmal echt, dass dieser eine Zentimeter vor allem die Folge meiner pinocchiomäßigen Untaten ist.
Als ich beispielsweise dachte, es wäre mir endlich gelungen, eine Zeitmaschine zu bauen. Das ist mir sogar jetzt noch peinlich, wenn ich das nach so vielen Jahren aufschreibe. Cornelius hatte mir damals erzählt, dass ein Mann im Vorvorjahrhundert eine Geschichte über so einen Wunderapparat geschrieben hatte und die schlauesten Forscher vor dem Untergang so nah – er hatte seinen kleinen Finger ausgestreckt –, wirklich so nah daran gewesen waren, eine Zeitmaschine zu konstruieren. Eine Art Auto, mit dem man durch die Jahrhunderte fahren konnte, vor, zurück, ganz wie man wollte. Ich rüstete also den alten, kaputten Solarjeep auf dem Schrottplatz, oben, beim Latschenfeld, um, schraubte eine Stange an, verknotete Kabel im Motor, drückte den Starter – und als ich ihn loslasse, denke ich: Yeah! Ich hab’s geschafft! Ich bin genau zwei Tage vor den »schwarzen Samstag«, den Untergang, gereist. Jetzt liegt es allein an mir, die Menschen in der Großen Ebene zu warnen. Ich rette die Städte vor der Vernichtung! Amen dazu! Niemand wird sterben! Happiness deluxe. Ich rannte los. Ich durfte keine Zeit verlieren. Auch wenn ich damals erst acht oder neun war, ist das wirklich zum Sterben peinlich. Und wen traf ich natürlich als Erstes? Jorden himself, was mich damals allerdings nicht weiter aus dem Konzept brachte, weil er ja früher als Ranger auf der Unteralm gearbeitet hatte. Ich war wirklich absolut davon überzeugt, dass er nichts von der bevorstehenden Katastrophe wusste. Ich also aufgeregt: »Herr Ranger, Herr Ranger!« Wie ein Honk. Er: »Hä?« Ich: »Bitte! Ich weiß, das hört sich unglaublich für Sie an, aber ich komme aus der Zukunft, um …« Er schüttelte den Kopf: »Mensch, Heinz. Was soll nur mal aus dir werden?« Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Keine Zeitmaschine. Keine Weltrettung durch Heinz, den Helden. Nada. Niente. Honk bleibt Honk. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, bin ich wirklich der größte Lügner, den man sich denken kann. Es ist schrecklich. Denn wer lügt, ist ein schlechter Charakter, und das darf ich auf gar keinen Fall sein, als einer der letzten zivilisierten Menschen und so. Aber das alles konnte doch unmöglich der Grund dafür sein, dass heute, an meinem Geburtstag, alle so zu mir waren! Das ist doch schon so lange her!
Den breiten Rücken mir zugewandt, kramte Cornelius in unserer Gemeinschaftskommode. Ihm schien es komplett egal zu sein, dass ich noch da war. Ich starrte auf den runden, kahlen Fleck auf seinem Hinterkopf, den er sorgfältig mit seinem wie immer akkurat auf Schulterlänge geschnittenen grauen Haar zu verbergen suchte. Unser Mini-Kühlschrank schaltete sich an. Erst summte er auf, dann hustete er elektrisch. Um ihn herum hatte sich, wie schon die Wochen zuvor, eine kleine Wasserlache gebildet. Innen ist er fast vollständig vereist. Vielleicht ist es wirklich, wie Chang mal meinte, meine Schuld, und ich habe ihn als kleiner Junge zu oft geöffnet und mit meinen Fingern über den wunderschönen Frostpelz gestrichen. Vielleicht stirbt er nach neun Jahren auch einfach an Altersschwäche. Nur: Was werden wir dann am Schlachttag mit dem Fleisch machen, das jetzt schon kaum mehr Platz darin findet, so zugewuchert wie sein Inneres ist, obwohl wir ihn wieder und wieder abgetaut haben? Als ich endlich aufstand, genau in diesem Augenblick, spornstreichs, um es mit einem der foxysten aller Altwörter zu sagen, drehte sich unser weltbester Leader um und hielt mir eine Mappe mit Heften und einen Stift hin. Triumphierend grinste er über seine gelungene Deluxe-Überraschung.
»Pardon, junger Mann, einen Moment«, sagte er und deutete mit seiner freien Hand auf das Geschenk, wobei er seine buschigen Augenbrauen in die Höhe zog, als wüsste er selbst nicht so genau, wo all die Sachen plötzlich herkamen. »Einen Moment mal. Hier habe ich etwas für Sie.« Das macht er manchmal, wenn er besonders gute Laune hat, das mit dem »Sie« und so. Das tötet mich. Ich liebe es. »Ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Die anderen – Banausen«, bei dem Wort kratzte er sich zweimal am Hinterkopf, »die anderen Banausen können damit sowieso nichts anfangen. Voilà!« Hinter seinem dichten, grauen Bart hellte sich seine Miene auf: »Führe von nun an Buch über alles, was geschieht, Heinz! Von diesem Tag an bist du der Bewahrer unserer Gemeinschaft!«
Diese Sätze hat er natürlich nicht genau so gesagt. Aber, ich schwöre, es war ein extrem feierlicher Tonfall in seiner tiefen Stimme. Und dann streckte er mir auch noch die Hand entgegen. Das ist ein alter Brauch, den man nur in den allerwichtigsten Momenten praktizierte. Zusammen mit dem »Sie« hat mich das beinahe verrückt gemacht, und wenn ich verrückt sage, meine ich glücklich. Vorsichtig blätterte ich in den Heften, die nur an den Rändern ein kleines bisschen angegilbt, ansonsten wirklich makellos weiß waren. Meine Finger strichen über den Stift mit der goldenen Gravur Faber.
Ich weiß noch, wie geschockt ich als Kind war, als Cornelius mich darüber aufklärte, dass alles, was wir sprechen und denken, nur aus – Achtung: sechsundzwanzig Buchstaben besteht. Sechsundzwanzig! Ich meine, das ist ziemlich wenig. Schon in den ersten Monaten nachdem mich Chang und Jorden in der Großen Ebene gefunden hatten, hatte Cornelius mit meinem Unterricht begonnen. Der Junge soll ja mal kein Plebs werden, wie er sich ausdrückte. Also führte er mich in die alte Elite-Kunst der Handschrift ein. Mit dem wenigen Papier auf der Alm mussten wir allerdings haushalten. Wir hatten nur zwei Ausgaben von Cornelius’ Retro-Print-Philosophie-Magazin »Der Doyen deluxe«, dessen, das gebe ich gerne zu, mir völlig unverständliche Artikel in der foxysten Altwörtersprache geschrieben sind, die man sich nur ausdenken kann. Bald waren die zwei Hefte von oben bis unten mit meinen enger und enger und übereinander geschriebenen Übungszeilen verschmiert. Aber komischerweise konnte ich auch danach nicht aufhören. Ich kritzelte weiter auf die Tischplatte, bis Jorden mich dafür anbrüllte, später heimlich in den Staub, der sich überall bei uns ansammelt, oder draußen in die Erde. Etwas war da in mir, dass ich jeden Tag von neuem irgendwelche Sätze oder kleine Phantasie-Storys notieren musste, auch wenn sie der nächste Regen fortwusch. Wie dankbar wäre ich damals für solche Hefte gewesen! Doch wie immer bei Cornelius war alles Teil eines größeren Plans, wie immer hatte er den Masterplan. Denn erst heute, mit fünfzehn Jahren, bin ich alt und klug genug für die Aufgabe, die er sich für mich ausgedacht hat, auch wenn ich schon vor ein paar Jahren auf meiner linken Kopfhälfte weiße Haare bekommen habe. Das stimmt wirklich. Tausende von weißen Haaren. Aber nur links. Wenn ich richtig informiert bin, färbten sich früher viele Leute, besonders aus der Elite, ihre Haare weiß, nur um so distinguiert auszusehen wie ich.
Väterlich fasste mich unser weltbester Leader mit seinen großen Händen an den Schultern und zog mich an sich. Sein Brustkorb hob sich schneller, ich konnte sein Herz schlagen hören.
»Hundertmillionen Dank!«, murmelte ich, meine Stimme kippte dabei gicksend, wie sie es seit etwa einem Jahr tut, wenn ich nicht aufpasse, und was eigentlich heftigst peinlich ist. In diesem Moment war es zu 100 % egal.
Regelmäßig hat Cornelius mir eingeschärft, es seien nicht zuletzt vermeintlich läppische Wörter wie »bitte« und »danke«, die einen selbst nach dem Weltuntergang noch Mensch bleiben ließen. Hier eine seiner Favoritgeschichten aus dem letzten Jahrhundert, er hat sie mir immer wieder erzählt: Zum Tode Verurteilten wird befohlen, die Hinrichtungskammer zu betreten. Vor der Tür macht der eine einen Schritt zurück, streckt den Arm aus und sagt höflich: »Bitte, nach Ihnen.« Der andere muss darüber lächeln. Er sagt: »Vielen Dank«, verbeugt sich und geht hinein.
Ich sitze allein in der Hütte. Eigentlich sollte ich schon längst im Wald sein, Pilzesammeln und so weiter. Die Affenchefs in den Eichen haben ihr Vormittagsgebrüll angestimmt, um die Jüngeren, die sich wieder einmal an die Haremsdamen herangemacht haben, in ihre Schranken zu weisen. Ein paar Monate nach dem Untergang sind sie plötzlich dagehockt. Die anderen meinen, dass die ursprünglich neun Tiere, aus denen mittlerweile eine Herde von zweiunddreißig geworden ist, aus einem Zirkus stammen. Nach der Katastrophe müssen sie sich durch eine der drei eingestürzten Schleusen gezwängt haben und bergauf bis hierher gewandert sein. Was wieder einmal dafür spricht, dass es sich anscheinend nirgendwo so gut leben lässt wie hier.
Irgendetwas ist mit mir passiert. Ich schreibe wie ein Verrückter und will gar nicht mehr von diesem Tisch weg. Jedes Mal, wenn ich die weißen Seiten entlangfahre, über dieses allerseltenste Material, Papier, Papier! aus der Voruntergangswelt, gibt mir das Power wie noch nie. Deshalb hier meine Entscheidung: Ab dem heutigen Tag werde ich jede freie Minute dafür verwenden, aufzuschreiben, was uns widerfährt. Ich schwöre, ich werde dabei die foxysten Altwörter verwenden, die sich in meiner Sammlung finden lassen. Und, das ist jetzt my own private Masterplan: Nächstes Jahr überreiche ich unserem weltbesten Leader Cornelius ein einwandfreies Buch in Heften, als Gegengeschenk, damit er sieht, er hat sich nicht in mir getäuscht. Im Ernst. Ich werde dafür sorgen, nein, ich werde dafür Sorge tragen, dass in meinen Aufzeichnungen, meinen Notaten, die Kultur des Homo sapiens überdauert, hier auf der Rosenalm, in unserem Resort, durch meine Hand. Denn ich weiß: Man kann nicht nur gehen, sondern auch wandeln. Man kann nicht nur fressen, sondern auch speisen. Man kann nicht nur hören, sondern auch lauschen. Gerne wandle ich. Gerne speise ich. Gerne lausche ich.
Und vielleicht sind ja die Hefte auch der Beweis dafür, dass das Muster unter meiner linken Achsel, das irgendwer dort vor dem Untergang eintätowiert hat wie die Faber-Gravur in den Stift, ein winziges Quadrat, in dem schwarze Schlieren ineinander verhakt sind, doch mehr bedeutet, als die anderen meinen. Ich habe stets daran geglaubt, dass das Zeichen ein Hinweis darauf ist, dass ich ursprünglich für eine besondere Position in der Gesellschaft vorgesehen war, obwohl ein derartiger Tattoo-Brauch den anderen unbekannt ist. Einzig Cornelius hatte gesagt, das könne durchaus sein, auch wenn er selbst noch nie davon gehört habe. Heute spüre ich, dass mich diese Hefte der Lösung des Rätsels meiner Tätowierung ein Stück näher bringen.
Es ist der erste Februar des Jahres elf nach dem Untergang. Mein fünfzehnter Geburtstag. Gesegnet sei der Name des süßen LORDs.
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
I. Die Gemeinschaft
Früher, mit vier oder fünf Jahren, wenn ich durch das Latschenfeld und jene in die Felswand gehauene Treppe hochstieg, die zum Eingang des Steinernen Meeres führt, konnte ich bis über die Grenzen unseres Resorts hinaus und in die Hölle sehen: die Große Ebene. Mit Jordens Fernglas waren die Löcher in den Schutzschirmen über den ehemaligen Siedlungen gut zu erkennen. Fehlfunktionen ließen das Wetter unter den Kuppeln verrücktspielen. In Waldeinsamkeit II loderten Flammen auf, in AvalonA5 wütete ein nicht enden wollender Orkan, und in Schönau schneite es wie in einer antiken Wunderkugel, die jemand ununterbrochen schüttelte. Manchmal stellte ich mir dann die Menschen darin vor. Wie sie beim Autofahren, bei der Arbeit im Büro oder im Schlaf in ihren Betten eingefroren waren, erstarrt und doch unversehrt, Dornröschen-Style, als warteten sie nur darauf, eines Tages ihre Tätigkeit zu Ende führen zu dürfen, wenn alles wieder gut wäre.
Zwischen den Kuppelruinen erstreckte sich im Licht der sengenden Sonne die graue Steppe mit ihren Hügeln. Vor dem Untergang war das einzig Gute an ihr gewesen, dass sie die riesigen Solarfelder Strom produzieren ließ, Strom, der easy für sämtliche Siedlungen, Altstädte, Garden-Zones und ich weiß nicht was gereicht hatte.
Ich wünschte, ich hätte mir die Male, die ich dort oben, am Ende der Felstreppe stand, das alles, die Siedlungen und die Steppen, genauer eingeprägt. Denn eines Tages, im Jahr drei nach dem Untergang, bildeten sich in der Großen Ebene plötzlich Nebelbänke, die immer dichter wurden, bis nur mehr die Spitzen der Schutzschirmkuppeln daraus hervorschauten. Cornelius’ einzige Erklärung dafür war, dass jetzt auch noch die Shields über den Speicherseen ausgefallen sein mussten und die Hitze derart angestiegen war, dass sogar das Grundwasser verdunstete. Seitdem war die Hölle unsichtbar geworden.
Über dem Hochtal mit der Unteralm, der Rosenalm und den Wiesen und Wäldern unseres Resorts spannt sich dagegen immer noch der schönste blaue Himmel. Beim Untergang hat unser Kraftfeld vom einprogrammierten Zyklus der vier Jahreszeiten, der hier eigentlich für Wanderer das Feeling des alten Deutschlands entstehen lassen sollte, auf eine einzige umgeschaltet, einen ewigen Sommer, mit warmen, aber nie unerträglich heißen Tagen, und mit Nächten, in denen es regnet, aber nie stürmt. Wir leben hier also seit elf Jahren unter, wie unser weltbester Leader Cornelius es halb im Spaß, halb im Ernst sagt, traumhaften Bedingungen. Er hat wiederholt betont, wie wichtig es ist, dass wir unter uns bleiben. Die wenigen anderen Survivors, denen er, Jorden, Chang, Özlem und Anne bei ihrer anfänglichen Suche nach Nahrung und nützlichen Gegenständen in der Großen Ebene begegnet sind, waren zusehends verwahrlost, bis binnen weniger Monate nach dem Untergang Einzelkämpfer und Banden die Ruinen der Städte durchstreiften. Selbst Jorden und Chang hatten deshalb seltener und seltener das Resort verlassen. Wir alle, bis auf mich natürlich, haben in Voruntergangszeiten genug Horrorgeschichten gehört und gesehen, um zu wissen, was da unten als Nächstes folgen würde. Und warum sollen wir hier auch weg? Das Vieh, das wir züchten, die Gemüsegärten und Felder, die wir angelegt haben, und die Beeren und Pilze in den Wäldern ernähren gerade mal und ganz genau sechs Personen. Zwei, drei mehr, und wir könnten alle, wie Jorden es einmal gesagt hat, nach kurzer Zeit nur mehr mit dem Messer unterm Kopfkissen schlafen.
Es ist also ein ziemlicher Vorteil, dass unser Resort als Bio-Zone schon immer streng abgesperrt war. Die anderen, die davon mehr verstehen als ich, haben viele Überlegungen und Mühe darauf verwandt, dass das auch so bleibt. Wegen der Steppenbewohner haben wir die drei uns bekannten Schleusen auf deutscher Seite getarnt. Was auf österreichischem Gebiet geschieht, davon wissen wir nichts. Aber, ich hoffe mal, das Steinerne Meer mit seinen Spalten, Geröllfeldern und Graten wird uns vor möglichen Eindringlingen schützen. Dass aber von dort in den elf Jahren, seit wir hier wohnen, bislang niemand und nichts gekommen ist, deutet darauf hin, dass auch weiter im Süden alles zerstört ist, vielleicht sogar noch schlimmer als in Deutschland. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es dort zugehen muss. Unser weltbester Leader benutzt in Bezug auf die Survivors außerhalb unseres Resorts gern eines der foxysten Altwörter aller Zeiten: Würde. Im Unterschied zu all den anderen haben wir unsere Würde bewahrt.
Aber manchmal, besonders wenn mich der Blick aus dem sonnenverbrannten, dreckigen Gesicht in unserem einzigen Spiegel im Klohäuschen streift und mich zusammenzucken lässt, bis ich bemerke, Scheiße, das bin ja ich!, kriege ich Angst. Und ich glaube, da geht es den anderen auch nicht anders. Die Angst, eines Tages aufzuwachen und zu einer jener miserablen Gestalten in der Großen Ebene geworden zu sein. Auch deshalb führen wir den Kampf gegen das Vergessen. Ohne die allwissenden Stimmen der PMs, der Personal-Manager, aus den Transmitter-Plugs im Ohr, auf die man sich vor dem Untergang verlassen konnte, weil sie auf fast jede Frage eine Antwort wussten, wie heißt diese Pflanze?, wer regierte im Jahre 117 das Römische Reich?, und so weiter, kommen uns die Namen für die Dinge, die uns umgeben, langsam abhanden. Ich stelle mir manchmal vor, wie sich in unseren Köpfen mit jedem Tag auf der Alm ein weiterer Teil unseres einstigen Wissens verabschiedet, bis uns die Welt, die Berge, Tiere und Pflanzen, immer weniger zu sagen haben und wir am Ende, im Nebel unseres Gedächtnisses tiefer und tiefer nach den spurlos verschwundenen Namen forschend, nur noch stammeln: »Knackdings« für Holz, »Hartdings« für Steine oder irgendwann »ah« für Sonne, »mampf« für Nahrung, »muh« für Milch.
Erst vor kurzem wollte Cornelius, als er nach dem Abendessen das Geschirr abräumte, ein altes deutsches Volkslied anstimmen: »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach«. Bei »klipp-klapp, klipp-klapp, klipp-klapp …« hat er gestockt. Als er »Alle Vöglein sind schon da« zu singen begann, wiederholte er »alle Vöglein, alle …« – und wiederholte es immer aufgeregter, ohne dass ihm der nächste Vers einfiel. Nach eigener Aussage ist Cornelius inzwischen nicht mehr in der Lage, die Reihenfolge der deutschen Kanzler und Kanzlerinnen wiederzugeben, ebenso wenig wie die Daten des Dreißigjährigen Krieges, der Gründung des Deutschen Kaiserreiches oder das Geburts- und Todesjahr des weltbesten Dichters Johann Wolfgang von Goethe.
Die alte Anne, unsere Gemeinschaftsomi, ist die Einzige, die selbst noch die merkwürdigsten Namen für die seltensten Kräuter und Tiere weiß, obwohl sich in den vergangenen Jahren eine schlimme Veränderung vollzieht: Immer öfter vergisst sie die selbstverständlichsten Dinge. Sie behauptet, dass das gar nicht das Schlechteste sei, wobei sie mit dieser Meinung wirklich zu 110 % allein ist. »Amnesie«, hat sie einmal erklärt, »kann auch ein Segen sein, das könnt ihr mir glauben.« Für sie war damit das Thema erledigt. Sie war ja am liebsten allein unterwegs und bastelte an ihren Strohtalismanen, weswegen Chang sie »schrullig« nennt. Wie Jorden bleibt sie zuweilen über Nacht weg, weil sie »Luftveränderung« braucht, wie sie sagt. Sie wandert, soweit wir wissen, im Resort herum und schläft in irgendwelchen Verschlägen, die sie sich selbst zusammengezimmert hat. Oft schon hat Cornelius sie deshalb geschimpft, weil ihr da draußen leicht etwas zustoßen könnte. Er hat mir erzählt, dass sie früher ganz anders war. Lauter Altredensarten und -wörter hat er benutzt, um sie zu beschreiben: eine, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hielt, eine ehrliche Haut; einen rauen Charme habe sie besessen. Er selbst habe ihren Rat immer sehr geschätzt. Ja, er tue es noch immer. Sie habe sich in der NOROFORKengagiert, der No-Robots-for-Kids-Bewegung, und vehement die Meinung vertreten, dass kein noch so perfekt auf das jeweilige Kind programmierter Robot-Tutor einen Lehrer aus Fleisch und Blut ersetzen könne. Die Gesellschaften, die sie und Bernd, ihr Mann, Cornelius’ bester Freund, gaben, seien legendärgewesen. Kostümpartys! Aber dann, ziemlich genau ein Jahr vor dem Untergang, sei Bernd zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen. Anschließend sei Anne wie ausgewechselt gewesen. Alles, worin sie bis dahin aufgegangen war, sei mit einem Mal egal gewesen. Sie habe sogar monatelang Schweigeexerzitien in einem Kloster zugebracht, sie, die doch sonst so leidenschaftlich debattieren konnte! Tragisch sei es, so Cornelius, dass gerade an dem Punkt, an dem Anne endlich wieder die Kraft spürte, noch einmal neu anzufangen, dass sich genau an diesem Punkt die Katastrophe ereignete.
In den ersten Jahren im Resort hatten Anne und Özlem viel Zeit zusammen verbracht. Beide verband ja dieses special interest für Pflanzen und Tiere. Doch das ist vorbei. Schleichend ist Anne unberechenbar geworden. Momente, in denen sie redselig und, ich lüge nicht, der superbeste Mensch der Welt ist und uns gute Laune macht mit ihren scharfen, treffenden und lustigen Bemerkungen, mit denen sie nicht einmal Cornelius verschont, können abruptest umschlagen. Plötzlich stottert sie, sie habe vergessen, was sie eigentlich sagen wolle, und brummt noch missmutig irgendetwas hinterher, das keiner recht versteht. Vor ein paar Monaten meinte Özlem, nach einem besonders krassen Stimmungsumschwung Annes, gefolgt von endlosem wirren Murmeln, sie befürchte, unsere Anne habe einen Hirntumor oder sie leide an Alzheimer. Was wir bloß unternehmen könnten. Die Begriffe, Alzheimer und Tumor, nahm ich sofort in meine Altwortliste auf, genauso wie dieses Amnesiedings.
Ich suche seitdem noch mehr Annes Gesellschaft. Und vielleicht hilft es ihr und ihrem Gedächtnis ja, wenn ich bei ihr bin. Erlaubt sie es, begleite ich sie den Bach entlang und die Wiesen hinunter, wo das Rauschen des Flusses zu hören ist und ihr Reich liegt: ihr Kräuter- und Gemüsegarten, den sie nur für sich selbst bewirtschaftet. Und was für ein Garten das ist! Als kleiner Junge konnte ich mich nicht sattsehen an den Beeten, denen Anne die Namen der Kontinente gegeben hat und die mit Mini-Wahrzeichen aus Stroh geschmückt sind. Zwischen den Blumen und Büschen erheben sich winzige Pyramiden, auf Steinen thronen Schlösser, Felsen stellen das welthöchste Gebirge dar, den Himalaya, und durch Gestrüpp schlingelt sich ein Rinnsal, der Amazonas. Zwischen all dem stand dann Anne mit ihrem breiten Hut, die Herrscherin ihres Strohplaneten, die, wenn ich sie darum bat, zu jedem Gebäude eine Geschichte parat hatte, wobei in ihrem lederbraunen Faltengesicht ihre Augen zu funkeln anfingen. Aber das war einmal. Immer öfter ist ihr Blick nur noch stumpf.
Als Maßnahme gegen das gemeinschaftliche Vergessen hat Cornelius vorgeschlagen, dass wir unsere Kühe nach den wichtigsten Erfindern, Künstlern, Sportlern und Politikern der Menschheitsgeschichte benennen. Eine ziemlich gute Idee, finde ich. So werden wir täglich an sie erinnert. Auf unseren Wiesen weiden Nero, Tizian, Einstein, Hitler, Kafka, Kennedy, Beckenbauer, Bijoy und Hu. Außerdem hängt von den Rosenstämmen vor der Hütte, die Cornelius liebevoll pflegt, der Name der jeweiligen Sorte in transparenten Hüllen. Einst haben sie in einem Krankenhaus in der Großen Ebene zur Aufbewahrung menschlichen Blutes gedient, das behauptet zumindest Chang. Unser Kampf gegen das Vergessen, er endet nie.
Vielleicht beunruhigt mich deshalb an diesem leuchtend hellen Vormittag des ersten Februars im Jahre elf nach dem Untergang, während ich mich am Esstisch in der Hütte über mein schönes neues schwarzes Heft beuge, die Frage, ob es etwas zu bedeuten hat, dass alle bis auf Cornelius nicht nur vergessen haben, dass ich an diesem Tag fünfzehn Jahre alt werde; ja, kann es sein, dass sie mich vergessen haben? Vielleicht ist ja diese Pubertät daran schuld, dass jetzt noch härtere, noch unangenehmere Zeiten anbrechen, in denen ich für die Gemeinschaft noch unwichtiger bin als bisher? Was interessiert die anderen, ob ich mich für den Bewahrer ihrer Geschichte halte oder einfach nur weiter derjenige bleibe, der ich für sie immer schon war: Krummbumm Heinz?
Ich habe kurz meine Arbeit beiseitegelegt und durchs Fenster in den Himmel über dem Hochtal geblickt, den die Schwalben ziepend durchschneiden. Ich bin ganz ehrlich: Ich betete, und zwar nicht zum allerbesten LORD, sondern heimlich, da der LORD Konkurrenz nicht ausstehen kann, zu meinem Vater. Ich besitze ja kaum Erinnerungen an die Epoche vor dem Untergang, was daran liegen kann, dass ich, als ich zu den anderen stieß, erst vier Jahre alt gewesen bin. Vielleicht ist auch jene Krankheit daran schuld, die laut Anne Trauma genannt wird. Das ist allerdings auch nur eine Vermutung, weil Anne zwar über medizinisches Wissen wie sonst niemand in der Gemeinschaft verfügt, jedoch trotzdem nicht müde wird zu betonen, dass die Jahre, in denen sie als Krankenschwester gearbeitet habe, so weit zurückliegen, dass das schon nicht mehr wahr sei. Ich muss zugeben: Rasend gerne hätte ich so ein Trauma. Denn hat Anne nicht auch gesagt, fast jede Erkrankung sei vor dem Untergang heilbar gewesen?
Vielleicht ist es ja bloß Wunschdenken, nichtsdestotrotz meine ich, eine vage Vorstellung davon zu haben, wer mein Vater war. Das Wort »Weltraumforscher« ist wirklich so fremd und selten, dass es irgendeinen Grund geben muss, warum es mir ausgerechnet dann in den Sinn kommt, wenn ich an meinen Vater denke, den ich mit Papi anreden würde. Auch erinnere ich mich an ein Zimmer im obersten Stockwerk unseres Hauses, dessen Betreten »strengstens verboten« war. Trotzdem schlich ich mich öfter hinein – um staunend vor einem riesigen Screen zu stehen, der den Querschnitt einer Raumstation animierte, vor einer Unzahl kleiner, weißer Modelle von Raumschiffen, die von der Decke baumelten, und vor einem Fernrohr an der Dachluke, das steil in den Himmel gerichtet war und in dem ich, als ich mit pochendem Herz daran trat, tatsächlich den dunklen Punkt einer Sonde zu sehen glaubte, ehe ich im Erdgeschoss die elektronische Melodie der Eingangstür hörte und leise aus dem Büro meines Vaters lief. Und dann ist da noch dieses Gefühl, das der Begriff »Wochenende« in mir auslöst. Die Wochenenden, deren Beginn Cornelius weiter verkündet, weil er es wichtig findet, dass uns nicht die alte Ordnung der Tage abhandenkommt, die Wochenenden waren früher oft nicht okay gewesen, und wenn ich sage nicht okay, meine ich nicht okay. Regelmäßig fehlte jemand. Papi. Er fehlte eigentlich immer, aber an den Wochenenden fiel es uns ganz besonders auf, weil am Montag alle anderen Kinder erzählten, was sie mit ihren Eltern unternommen hatten. Wenn mein kleiner Bruder und ich meine Mutter nach Papi fragten, antwortete sie nur knapp: »Der ist weit, weit weg.« Man konnte nicht einmal über den Transmitter mit ihm sprechen. Über diesen Wochenenden, die in meiner Erinnerung außerdem totenstill waren, lag eine fast unerträgliche Spannung. Bei jedem winzigen Geräusch hielt ich die Luft an. Oft schaltete Mutter, was sie sonst, war Papi da, selten tat, die TV-Wall an, wo viel von NOAH, der Marssiedlung, die Rede war, Astronauten in strahlend weißen Anzügen schwebten und winkten, ihre Stimmen und Mundbewegungen waren nicht synchron, so weit entfernt waren sie, Raketen starteten dröhnend, senkrecht und unendlich langsam stiegen sie in den tiefblauen Himmel. Diese Starts verfolgte Mutter so konzentriert, dass sie alles um sich herum zu vergessen schien. Aus irgendeinem Grund war ich mir damals sicher, dass Papi, immer wenn er nicht zu Hause war, ins Weltall flog, auf einer wichtigen und supergeheimen Mission in Sachen Marsbesiedelung. Im strengstens verbotenen Büro schaute ich dann durchs Fernrohr, weil ich dachte, es würde, wie in einem der Märchen, die F-87 meinem Bruder und mir zum Einschlafen erzählte, dem Betrachter auch die entferntesten Dinge zeigen, solange man sie sich fest genug wünschte. Doch leider erschienen in der Linse bloß schwarze Flecken.
In meiner Vorstellung befand sich mein Vater bei der Katastrophe, die sich ja an einem Samstag ereignete, in einer Station in der Umlaufbahn der Erde, so dass er, anders als meine Mutter und mein kleiner Bruder, von denen ich das Schlimmste annehmen muss, überlebte. Der Screen des Raumschiffs übermittelte ihm die schrecklichen Bilder, der Bord-Homie sprach ihm sein Bedauern zur fast vollständigen Vernichtung seiner Art aus und beglückwünschte ihn gleichzeitig dazu, dass sein Sohn zu den wenigen Survivors gehörte. Seitdem beobachtet Papi aufmerksam, was unter ihm auf dem blauen Planeten alias Erde geschieht. Fieberhaft arbeitet er daran, Kontakt mit den wenigen Bewohnern der Mars-Kolonie aufzunehmen, um eines Tages zusammen mit ihnen auf seinen Heimatplaneten zurückzukehren. Tatsächlich, ich lüge nicht, ist jeden Monat tagsüber für ein paar Tage hinter dem Schutzschild ein winziger, grünlich schimmernder Punkt zu sehen, dessen Ursprung mir keiner erklären kann. Das könnte, oder sagen wir: das musste das Raumschiff meines Vaters sein. Und der Tag würde kommen, da würde es mich holen.
Als ich Özlem einmal davon erzählte, bekam sie zu meiner Überraschung feuchte Augen. »Das ist wunderschön.« Und nach einer Pause, in der sie mich lange ansah: »So ist es wahrscheinlich. So muss es sein.« Sie hat mir über den Kopf gestreichelt, liebevollst wie selten, so dass ich schon währenddessen wusste, dass ich mich stets danach sehnen würde. »Glaube weiter daran, ja? Versprich mir das«, hat sie gesagt. Und ich nur so: nicknicknick.
Mit den Jahren jedoch ist das Bild, wie mein Vater da in einer schneeweißen Kapsel seine Runden zieht, für mich immer unwahrscheinlicher geworden. Ich muss gestehen: In letzter Zeit schäme ich mich sogar dafür, dass ich nicht nur die Gemeinschaft belogen habe, sondern am Ende und am meisten mich selbst. Und auch an diesem Februarsommertag klangen die Bitten, die ich halblaut in Richtung Himmel sprach, »Hilf mir«, »Komm zurück«, absolut baby-like und nicht angemessen für einen Jungen, der gerade fünfzehn Jahre alt geworden war.
In diesem Moment spüre ich den sanften, aber entschiedenen und so vertrauten Griff kleiner, weicher Pfoten am Hosenbein. F-87, mein alter Robot-Fennek und einziger best friend, hat meine Stimmung sofort bemerkt und ist unter dem Tisch hervorgekommen, wo er eingerollt gelegen hat.
»Ach, F-87. Es ist wirklich schlimm«, sage ich. »Du hast alles mitbekommen, oder? Wenn Cornelius nicht an die Hefte gedacht hätte … es interessiert sich echt keiner für mich …«
Mein elektrischer Wüstenfuchs knickt mitfühlend sein rechtes Ohr um und guckt mich mit seinen großen Augen an. Chang nennt sie Manga-Lookies. Wie bei mir selbst, seinem Master, muss der Untergang auch bei meinem Toy ein Trauma verursacht haben, so dass alles, was er mir über meine Herkunft und Eltern berichten könnte, bis auf weiteres ungesagt bleibt. Das Einzige, was F-87 zu erzählen hat, sind die einhundertundeins Märchen seines Entertainment-Speichers, die er mit samtener Stimme und in stets exakt demselben Wortlaut vorträgt, ohne dass ihm darüber hinaus etwas zu entlocken wäre.
»Schluss. Der kommt jetzt weg«, hatte Jorden in einem superüblen Moment geschimpft, als ich ihn wieder einmal durch irgendeine Ungeschicklichkeit wütend gemacht hatte. Es sei endlich an der Zeit, das einzig Wertvolle an »dem Teil«, Akku und Motor, für »sinnvollere Zwecke« zu verwenden. Und anschließend fliege »das Teil« in hohem Bogen dorthin, wo es hingehöre, nämlich auf den Schrotthaufen. Ich hätte mich sofort vor ihn stellen sollen und protestieren, wozu mich Cornelius wieder und wieder ermuntert hat. Aber in solchen Momenten habe ich größte Angst vor Jorden und muss daran denken, was mir Chang vor ein paar Jahren anvertraute: Jorden habe schon einmal jemanden umgebracht. Jorden sei Soldat der EUROPEACE-Truppe gewesen. In Kenia sei er mit seiner Einheit auch an einer Aktion gegen Terroristen beteiligt gewesen, die sich in einem Gebäude verschanzt hatten. Zimmer um Zimmer hatten sich die Soldaten vorwärtsgekämpft. In einem kleinen Raum im Keller waren sie auf die Leichen von einem Dutzend entführter Kinder gestoßen, nach denen schon lange gesucht worden war. Offensichtlich waren sie verhungert. Da man sich wichtige Informationen von dem Anführer versprach, war der Befehl ausgegeben worden, ihn unter allen Umständen lebend zu ergreifen. Jorden und ein anderer waren diejenigen, die ihn im letzten Raum des Gebäudes gestellt hatten. Jordens Kamerad berief sich später vor Gericht darauf, er habe nicht genau sehen können, was geschah, alles sei sehr schnell gegangen. Jedenfalls erschoss Jorden den Anführer der Terroristen aus nächster Nähe, obwohl dieser unbewaffnet gewesen war. Der Fall war nie geklärt worden. Auch als Jorden Chang die Geschichte erzählte, schon berauscht vom Schtix, hatte er behauptet, er könne sich nicht mehr erinnern, ob er wirklich gedacht habe, der Anführer wolle nach einer Waffe greifen, oder ob er zu aufgewühlt vom Anblick der toten Kinder gewesen war. Er wurde zwar nie verurteilt, wurde aber wenig später aus dem Dienst entlassen und fing auf der Alm als Ranger an. So weit also zu dem Thema: Stell dich doch einfach mal Jorden in den Weg! Dem Mann, der mich, ist er ausnahmsweise mal gut gelaunt, spaßeshalber »Frischling« nennt. Wie auch immer. F-87 blieb damals nach Jordens Drohung zwei Tage lang verschwunden. Jeden Abend habe ich auf der Wiese gestanden und ihm, die Hände als Trichter am Mund, zugerufen, ich würde es niemals zulassen, dass ihm jemand ein Leid zufüge, niemals! Nur die Paviane hatten mir geantwortet, kreischend, höhnend. Endlich schlich mein elektrischer Fennek aus dem Wald, setzte sich vor meine Füße und blinzelte mich mit einem zögerlichen Ausdruck an, ganz so, als vertraute er nicht darauf, dass ich, Heinz, Master und Krummbumm in einer Gestalt, ihn im Fall des Falles schützen könnte. Sein sandbraunes TARBO-Flauschefell hatte im nächtlichen Regen arg gelitten. Genau so ein Fell habe ich mir übrigens immer gewünscht. Am besten würde es meinen ganzen Körper, meine seit den Wachstumsschüben viel zu langen Arme und Beine bedecken. Außerdem ist es lausabweisend, so dass F-87, im Unterschied zur Gemeinschaft, nicht alle paar Monate von dieser Plage heimgesucht wird, wegen der wir unser Bettzeug und unsere Kleider immer wieder auskochen müssen. Mit einem Ausdruck der Wehmut erzählt Özlem zuweilen von blitzblanken Keramiktoiletten und Duschen, die es in den Städten der Großen Ebene gegeben hatte. Die Sache der Reinheit gehört zu unseren obersten Pflichten. Das hat mit dem Würdedings zu tun. Wer Mensch bleiben will, muss sauber bleiben. Eigentlich gebührt deshalb meinem Robot-Fennek, denke ich oft, ein Ehrenplatz in der Gemeinschaft.
Als ich noch klein war, habe ich oft meinen Nacken in der Hoffnung abgetastet, dort auf dieselbe winzige Einkerbung zu stoßen, die F-87 unter seinem Fell trägt und hinter der sich, steckt man den Finger hinein, der On-Off-Schalter befindet. Ich weiß, dass es lediglich der Empathie-Chip im Kopf meines Toys ist, der ihn so treu und fürsorglich sein lässt; und trotzdem: Ich liebe meinen best friend. Und wenn ich liebe sage, meine ich auch liebe. Ich spüre es in meinem Inneren.
Ich schloss das schwarze Heft. Während ich dann aus der Hütte trottete, unter der Pumpe am Bach seufzend zwei Eimer mit Wasser füllte und sie über die Wiese zum eingezäunten Eichenhain schleppte, wo schon aus dem Dickicht das gierige Grunzen und Schmatzen der Wollschweine zu hören war, zupfte mich mein lieber F-87 eifrig am Hosenbein, um mich mit einem Gänseblümchen oder einer Beere zu überraschen oder um eine seiner Slapsticknummern zu vollführen. Das geht so: Er stolpert, rappelt sich mit der Pfote winkend auf, alles in Ordnung!, mir geht’s Gold!, nur um gleich darauf erneut linkisch über die eigenen Beine zu purzeln. Und ich musste tatsächlich schmunzeln, als mir der tröstende Gedanke durch den Kopf schoss, dass, selbst wenn die Gemeinschaft vorerst nichts von meinen Aufzeichnungen erfuhr, meine neue Aufgabe doch mindestens genauso wichtig war wie die Arbeit der anderen – ja, vielleicht sogar noch wichtiger! Meine Hefte, dachte ich und schüttete Wasser in die Schweinetröge, meine Hefte würden wie der Superchip sein, von dem Cornelius einmal erzählt hatte. Er war sich zu neunzig Prozent sicher, dass die Kolonisten auf dem Mars im Besitz eines Chips sind, auf dem das gesamte Wissen der Menschheit gespeichert ist. Ebenso ist davon auszugehen, dass irgendwo auf der Erde in einem Stollen, tief im schützenden Fels, wo ihm keine atomare oder sonstige Katastrophe etwas anhaben kann, eine weitere solche Speichereinheit lagert.
Chang hatte zwar sofort daran gezweifelt, das sei nie Thema gewesen »bei uns in der Redaktion«, wie er es mit einer seiner Favoritredewendungen ausdrückte, um zu betonen, dass er vor dem Untergang als Information-Architect Zugang zu exklusiven Informationen gehabt hatte. Aber Cornelius war nicht davon abgerückt. Das sei eine Frage der Logik. Es könne einfach nicht sein, dass von heute auf morgen alles weg sei, was die Menschheit erreicht habe. Das dürfe nicht sein.
Die Wollschweine drängten sich so gierig um den Trog, dass sie mich beinahe umstießen. Im Kopf war ich ganz woanders. Ich malte mir aus, welchen Beitrag für die Menschheit ich hier leistete. Vielleicht würden künftige Resort-Generationen sich einmal aus meinen Heften vorlesen, ich würde von nun an noch genauer sein und später, bei der Reinschrift, besser formulieren müssen …
Dann kamen die Drohnen.
Zuerst merkte ich an Harry, dass etwas nicht stimmte. Harry ist das jüngste Paviankind und mein absoluter Favoritaffe, seine Mutter heißt Petunia. Warum ich die beiden so nenne, kann ich nicht genau sagen. Damals vor vielen Jahren, als sich mir beim Kühehüten die Äffin mit den kahlen Stellen auf dem Rücken und dem blonden Schopf, der wie eine zu kurze Perücke auf ihrem Kopf sitzt, zum ersten Mal näherte, Räder und Purzelbäume schlug und erwartungsvoll beide Hände aufhielt, bis ich ihr schließlich ein Lupinenbrotstück schenkte, kam mir dieser Name in den Sinn: Petunia; genau wie letzten Januar, als sie mit ihrem jüngsten Baby auf dem Rücken zu mir kam. Zack, wusste ich: Der Kleine mit den runden, schwarzen Flecken um die Augen, die wie eine Brille aussehen, heißt Harry. Petunia ist eine der wenigen in der Affenherde, die noch Kunststücke beherrschen. Als die ersten Paviane nach dem Untergang auf der Rosenalm auftauchten, führten sie die irrsten Sachen auf, Akrobatikzeug wie Pyramidebauen und so. Aber weil sie keine Belohnung von uns bekamen, hörten sie irgendwann damit auf und benehmen sich seitdem wie ganz normale Affen. Den absolut obersten Chef mit der absolut längsten und weißesten Mähne und den absolut meisten Frauen habe ich für mich Cornelius genannt. Das habe ich nie jemandem verraten. Es gibt auch einen Jorden, das ist das Männchen mit den großen Eckzähnen, das sich mit allen streitet; außerdem gibt’s ein Paar, das immer beisammenhockt und sich big-love-mäßig gegenseitig laust: logisch, Özlem und Chang; und eine ältere Pavian-Dame, die gerne abseits sitzt und stundenlang in irgendwelchen Erdlöchern herumstochert: Anne, wer sonst?
Harry jedenfalls, der mir an diesem Vormittag Gesellschaft leistete und auf meiner Schulter saß, fing plötzlich extremst zu kreischen an, und wenn ich sage extremst, meine ich panisch. Mit einem Satz sprang er an die Brust seiner Mama, die ihn schützend umarmte. Von der großen Eiche erhob sich im selben Augenblick Gekreische und Gekläffe. F-87 klappte die großen Ohren auf und schnupperte, seine feinen Barthaare begannen zu zittern. Dann versteckte er sich flugs hinter meinen Beinen. Ich war maximal beunruhigt. So hatte ich die Affen selten und mein Toy noch nie erlebt. Manchmal macht uns ein Rudel wilder Hunde zu schaffen, obwohl sie nach Jordens und Changs Feldzug vor nicht allzu langer Zeit eigentlich ihre Lektion gelernt haben. Oder waren die Mönchsgeier oben in den Felswänden der Auslöser für die Aufregung? Sie konnten es durchaus auf kleine Affen oder meinen elektrischen Wüstenfuchs abgesehen haben, obwohl ihnen seine Drähte und Dioden kaum schmecken würden. Ich hob den Kopf, auf einmal kam er mir unendlich schwer vor.
Über dem höchsten Gipfel des Resorts, wenige Kilometer von unserer Alm entfernt, segelten drei gewaltige Vögel, weiß wie Schwäne. Über Zacken und Geröllfelder zogen sie ihre Schatten hinter sich her.
Kein Laut war zu vernehmen. Sie mussten sich außerhalb des Schutzschildes befinden, weit über dem Dunst der Großen Ebene. Aber wie konnten sie bloß so hoch gestiegen sein? Gleichmäßig und starr, ohne jeden Flügelschlag schoben sie sich durch die Luft. Erst da begriff ich, und es verschlug mir den Atem: Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich mit eigenen Augen jene Apparate, über die bei uns in der Vergangenheit so heftig gestritten worden war. Da änderten die Drohnen ihren Kurs, drehten ab und steuerten in einem Bogen in Richtung Große Ebene. Noch lange, lange blickte ich ihnen nach, saugte das Bild in mich auf und starrte endlich auf jene Stelle, an der sie zu einem einzigen Punkt zusammengeschrumpft und verschwunden waren. Seltsamerweise hatte ich überhaupt keine Angst vor den Maschinen, was eigentlich normal gewesen wäre, oder davor, dass sie es sich womöglich doch noch anders überlegt und unsere Alm überflogen hätten – nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Doch ich schwöre beim süßen LORD: Die Drohnen waren in diesem Moment von einer Deluxe-Schönheit, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe!
Bei einer dringlichen Besprechung vor vielen Jahren hatte Cornelius mit den Stimmen Annes und Jordens ein neues Gemeinschaftsgesetz beschlossen: Die Drohnen sind unter allen Umständen zu meiden! Das Risiko, sie versehentlich auf unsere Spur zu setzen und in unser Resort zu führen, sei viel zu groß. Die Drohnen waren im zweiten Jahr nach dem Untergang, der, wie wir zunächst geglaubt hatten, auch ihnen den Garaus gemacht hatte, wieder aufgetaucht. In allen möglichen Gestalten hatten sie früher den Himmel über der Großen Ebene bevölkert, vom winzigen Fliegending mit Propeller und Härchenantennen bis zum schnittig-glatten Raketenjet, mit Eilsendungen und Kameras bestückt. Zwar hatten die weißen Drohnen damals, als Jorden und Chang sie zum ersten Mal sahen, über den Ruinen von Waldeinsamkeit II Care-Pakete abgeworfen; nur wenige Wochen später jedoch, in denen Özlem und Chang schon drauf und dran waren, in die Große Ebene zu ziehen, kehrten die beiden superverstört von einem Erkundungsgang zurück. Stockend berichteten sie, wie eine Drohne unvermittelt auf eine Gruppe Survivors, die freudigst über den erhofften Lebensmittelregen aus ihren Verstecken gestürmt war, das Phaserfeuer eröffnet hatte. Und das, hatten sie kleinlaut angefügt, sei kein Einzelfall, sondern bereits das dritte Mal gewesen, dass sich so ein, wie sie es nannten, »schrecklicher Irrtum« ereignet habe.
Ich erinnere mich dunkel, dass Özlem und Chang dennoch vehement gegen den Gemeinschaftsentscheid protestiert hatten. Weil ich damals wie heute noch keine Stimme besaß, die ich nach dem gültigen Voruntergangswahlrecht erst mit sechzehn erhalten werde, wie Cornelius mir versprochen hat, hockte ich, der Krummbumm, an meinem Favoritplatz zwischen den Stühlen und unterm Tisch und ließ mir von F-87 Märchen erzählen. Nur mit halbem Ohr hörte ich, wie über meinem Kopf die Diskussion auf und ab brandete. Chang sagte immer wieder sein »Ist doch ganz einfach«, was er immer sagt, wenn er recht behalten will. Sein Argument war, wenn ich mich nicht irre, dass die Drohnen wahrscheinlich vorher von irgendwelchen Banden angegriffen worden seien und von Support auf Verteidigung geschaltet hätten. Trotzdem plädierte er dafür, die Drohnen weiter zu studieren und alles daranzusetzen, eine zur Landung zu bewegen. Denn es sei doch ganz klar: Nur mit ihnen könnten wir zu ihrem Ursprungsort gelangen, dem Großen Lager, dem Camp A. Wenn ich ehrlich bin: Ich dachte damals, jetzt erzählt nicht nur F-87 ein Märchen Marke hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen und so, sondern auch Chang. Ich meine, Großes Lager? Camp A? Davon hatte ich noch nie gehört. Aber Özlem und Chang waren fest davon überzeugt, dass wir da hin müssten, koste es, was es wolle. Und Özlem, die sich sowieso mittlerweile von niemandem, nicht einmal von Jorden, etwas sagen lässt, konnte schon damals ziemlich überzeugend sein, so groß und drahtig wie sie ist; wenn ihr etwas wichtig ist, färben sich ihre hohen Wangen binnen Sekunden knallrot, so dass ihre Sommersprossen ganz schwarz werden. Die Drohnen seien doch die einzige Möglichkeit, endlich weg von der Alm zu kommen! Von meinem Platz unter dem Tisch sah ich damals, wie Cornelius das Gesicht verzog. Und auch mir rieselte es bei der Vorstellung, »endlich rauszukommen«, was nichts anderes bedeutete, als dass die Gemeinschaft die sichere Alm verlassen würde, äußerst kühl über meinen Rücken.
»Eigentlich tun mir die beiden ja leid«, sagte Cornelius später, als wir allein waren. Es sei nur allzu menschlich, dass sich Özlem und Chang an den erstbesten Strohhalm klammerten. Aber das, er klopfte dabei auf den Tisch, und das, er nahm das Brot vom Teller, und das, er deutete auf die Hüttenwände, das einfach so aufs Spiel setzen? Wofür? Denn es sei doch letztlich eine Frage der Logik: Wäre irgendein Land in der Lage, uns zu helfen, wäre das schon längst geschehen. Das ließe umgekehrt nur den Schluss zu, dass der Untergang, er verwendete ein schönes Altwort, global gewesen sei. Oder zumindest so gut wie global. Letztlich wüssten wir viel zu wenig über diese Drohnen. In den Care-Paketen habe sich kein Hinweis auf ein Lager oder ihren Ursprungsort gefunden. Also sei für ihn, Cornelius, die wahrscheinlichste Erklärung, dass man es mit Rescue-Drohnen zu tun habe, die sich nach dem Untergang automatisch aktiviert, dann einen Virus eingefangen hätten und nun steuerlos umherirrten. Viel besser als hier, in unserem Resort, könne es uns ohnehin an keinem für uns erreichbaren Ort gehen. Es mag sein, dass ich mich irre und Cornelius mir das alles gar nicht damals, sondern erst später nach und nach erklärte, aber nach dem Streit mit Özlem und Chang warnte Cornelius, ich solle mir bloß einmal vorstellen, was passieren würde, wenn die beiden nicht auf uns hörten – und solche wildgewordenen Roboter-Flieger hierherführten! Eines Morgens schwebt womöglich eine dieser Drohnen über unserer Hütte! Und was dann? Cornelius machte eine nachdrückliche Geste mit seinen riesigen Händen, die ständig in Bewegung sind und mit denen er alle Argumente ordnen und notfalls beiseiteschieben kann. »Du behältst besser mal ein Auge drauf, Heinz, und erzählst mir, was da so vor sich geht, okay?«
Guter LORD, machte mich das damals stolz, dass Cornelius mir einen derart wichtigen Auftrag erteilt hatte. Einige Zeit observierte ich Özlem und Chang unauffällig. Einmal folgte ich den beiden auf eine Lichtung im Wald, die mir bis dahin unbekannt gewesen war. Özlem und Chang setzten sich, ich versteckte mich hinter einem Busch, gerade nah genug, um ihr Gespräch zu belauschen. Özlem hielt Chang umschlungen, er hatte seinen Kopf an ihre Schulter gelegt. So etwas sieht bei den beiden immer ganz bisschen lustig aus, weil er viel kleiner ist als sie.
»Chang … nicht«, tröstete sie ihn. »Wir schaffen das. Schau mich an. Wir schaffen das.« Sie suchte seinen Mund. »Wir haben doch uns, oder?«
Chang rieb sich übers Gesicht. »Jawohl«, sagte er leise. »Sergeant.« Er nennt sie manchmal so. Mich würde das töten, würde das jemand zu mir sagen. Im Ernst.
»Weißt du, wie viel das wert ist, dass wir uns haben?«, fuhr Özlem fort. »Ich meine, die anderen, Cornelius, Jorden … aber wir …«, sie sprach ganz leise, »… lieben uns doch. Oder?« Die Situation begann, peinlich zu werden. Trotzdem nahm ich meine Pflicht war.
Chang streichelte über Özlems Wange. Eine Weile saßen sie so. Jeder auf der Alm wusste, dass ihre Beziehung, wie die nahezu aller jüngeren und modern denkenden Paare vor dem Untergang, nach einem genauen Abgleich der Persönlichkeitsprofile von Perfect Match, der Partnerschafts-Software, gestiftet worden war. Cornelius und Anne, die noch einer anderen Generation angehörten, pflegten früher, wenn Özlem und Chang sich stritten, süffisant zu bemerken, dass Perfect Match damals, bei der Zuordnung, wohl die ein oder andere Null und Eins durcheinandergeraten sei. Ich frage mich oft, wie wohl meine perfekte Partnerin ausgesehen hätte, und vor allem, was das wohl für ein Gefühl ist, das sich angeblich wie ein Blitz einstellt und anschließend bei vielen Paaren wächst und niemals aufhört, sogar über den Tod des anderen hinaus: big love.
»Weißt du, was das Verrückte ist?« Chang hatte sich wieder gefangen. »Das Verrückte ist, dass, obwohl alles so furchtbar ist, ich noch mehr gemerkt habe, dass wir …«
»Stell dir mal vor«, unterbrach Özlem ihn, »was wäre … wenn wir die beiden Letzten auf der Welt wären, die …«
Chang hob den Kopf. »Ja«, murmelte er erstaunt. Dann, mit jenem Unterton, den er sonst auch so gerne seinen Sätzen beimischt, so dass ich nie weiß, woran ich bei ihm bin, da ich die Kunst des uneigentlichen Sprechens nicht sonderlich gut beherrsche: »Wäre übrigens eine gute Überschrift für einen Artikel gewesen: ›Das letzte Perfect Match‹.«
Gespielt sauer schlug Özlem ihm auf die Schulter und wischte lächelnd an seinem Rücken herum. »Ironie-Schalter ausschalten, okay?« Plötzlich drückte Chang sie auf den Boden, ich meinte schon, sie habe ihn wütend gemacht. Aber da begann er, sie heftigst zu küssen, auf den Hals, die Schulter, ja, er biss sogar in ihr T-Shirt. Özlem zog sich die Unterhose mit der Jeans hinunter. Ich wollte wegsehen, ich schwöre es, und musste dennoch auf den schwarzen Haarfleck zwischen ihren Beinen starren. Eine fette Spinne. Auffordernd streckte Özlem Chang ihr Becken entgegen, er schob sich auf sie und nestelte unten an sich herum. Chang riss ihr mit einer Gewalt, die mich zurückzucken ließ, das T-Shirt hoch, Özlems Brüste spitzten oben aus den BH-Körbchen, Chang griff nach ihnen, gierig, und drückte sie zusammen, eigentlich musste das Özlem furchtbar schmerzen, Changs lange blonde Strähne fiel ihm ins Gesicht, er konnte gar nicht mehr richtig sehen. Beide gaben dabei Laute von sich, die ich noch nie gehört hatte und die mich am ehesten an das Drohgebrüll der Affen erinnerten. Ganz ehrlich: Ich hätte mich am liebsten weggeschlichen, hatte jedoch Angst, irgendwelche Geräusche könnten mich verraten.