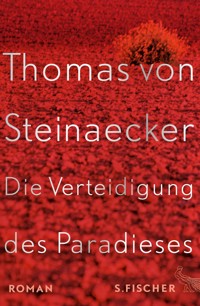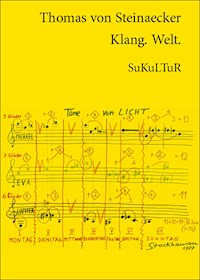19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hätte nicht alles gut werden müssen? Der neue Roman von Thomas von Steinaecker über die verpassten Chancen einer Generation In Norwegen beginnt der Winter. Der erste seit vielen Jahren. In einer abgelegenen Hütte muss sich Bastian eingestehen, dass er zu alt ist, um dort zu überleben. Anstatt zur weit entfernten Siedlung aufzubrechen, beginnt er sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mit seiner Kindheit in den 90ern zwischen Star Wars, Magnum-Eis und Lichterketten gegen Rechts. Der Herausforderung als junger Vater, Familie, Karriere und eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und mit den Jahren in der geschützten Wohnsiedlung in der Nähe Münchens, in denen die Welt immer bedrohlicher wurde. In seinem neuen Roman blickt Thomas von Steinaecker virtuos aus einer nahen Zukunft zurück auf unsere Gegenwart und zeigt, wie das Leben an uns vorbeirauscht, während wir um uns selbst kreisen. Hochaktuell erzählt »Die Privilegierten« von einer Generation, die alle Möglichkeiten hatte und dennoch scheitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thomas von Steinaecker
Die Privilegierten
Roman
Über dieses Buch
In Norwegen beginnt der Winter. Der erste seit vielen Jahren. In einer abgelegenen Hütte muss sich Bastian eingestehen, dass er zu alt ist, um dort zu überleben. Anstatt zur weit entfernten Siedlung aufzubrechen, beginnt er sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Mit seiner Kindheit in den 90ern zwischen Star Wars, Magnum-Eis und Lichterketten gegen Rechts. Der Herausforderung als junger Vater, Familie, Karriere und eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und mit den Jahren in der geschützten Wohnsiedlung in der Nähe Münchens, in denen die Welt immer bedrohlicher wurde. In seinem neuen Roman blickt Thomas von Steinaecker virtuos aus einer nahen Zukunft zurück auf unsere Gegenwart und zeigt, wie das Leben an uns vorbeirauscht, während wir um uns selbst kreisen. Hochaktuell erzählt »Die Privilegierten« von einer Generation, die alle Möglichkeiten hatte und dennoch scheitert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas von Steinaecker, geboren 1977 in Traunstein, wohnt in Augsburg. Er schreibt vielfach ausgezeichnete Romane, Graphic Novels sowie Hörspiele. Außerdem dreht er Dokumentarfilme zur Musik des 20. Jahrhunderts und der Kulturgeschichte Deutschlands, für die er internationale Preise gewonnen hat. Zuletzt erschien 2016 der Roman »Die Verteidigung des Paradieses«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war, 2021 das Sachbuch »Ende offen« und 2022 die Graphic Novel »Stockhausen – Der Mann, der vom Sirius kam«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Donnerstag
DAS ICH UND SEINE FREUNDE
Die Ironie des Schicksals
Herkunft
Der Sommer des Fernsehens
Neue Zeiten
Kamerakinder
Das Mädchen
Der Klub der Katze
Das Ende der Geschichte
KURZE ZEITRAFFER MOMENTE IM GEGENLICHT ZU ANGENEH MER MUSIK
DOING GOOD AND DOING WELL
Q and A’s
Zeit der Zärtlichkeit
The Luckiest Guy
Glitches
Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Looking for Freedom
Heal the World
Zurück in die Zukunft
MAN ENTKOMMT SICH NICHT
Freiheit
Glaube
Liebe
Inferno
UND FRIEDEN
Für A. und K. und E. und J.
»Tiger meint es bestimmt nicht böse«, sagte Ferkel langsam. »Natürlich nicht«, bestätigte Christoph Robin.
»Alle meinen es eigentlich nicht böse; das finde ich wenigstens«, bemerkte Pu.
»Doch wahrscheinlich irre ich mich.«
»Nein, du hast schon recht«, antwortete Christoph Robin.
A.A.Milne: Pu baut ein Haus
DAS ICH UND SEINE FREUNDE
Die Ironie des Schicksals
Das, was ich hier aufschreibe, kann nur eine Annäherung an die Wirklichkeit sein. Ein Programmierer in meiner Firma formulierte das einmal folgendermaßen: »Die Zahlen Zwei und Drei liegen auf den ersten Blick sehr nahe beisammen. Man könnte fast meinen, sie seien dasselbe. In Wahrheit sind es natürlich dennoch zwei völlig unterschiedliche Zahlen, die auch nicht mehr miteinander zu tun haben als eins und neunundneunzig.«
Eine Sache weiß ich allerdings ganz sicher: Zum ersten Mal bin ich der Monsterzecke am 23. August 1986 begegnet. Damals war ich vier Jahre alt. Meine Eltern wollten Quality-Time haben und sich einen Nachmittag zu zweit machen. Um auf mich aufzupassen, waren meine Großeltern an diesem Samstag extra aus Regensburg in unseren Bungalow nach Oberviechtach gekommen. Mit den Jahren hat sich in meinem Kopf folgende Erinnerung verfestigt, wobei ich davon ausgehe, dass es sich bei dem allermeisten um nachträgliche Erzählungen handelt. Was ich trotzdem noch klar vor mir zu haben meine, ist, wie ich mit meinem Großvater und meiner Großmutter in unserem Garten stehe und wir uns gegenseitig einen Ball zuwerfen. Ich sehe meinen Großvater in jenem beigen Leinenjackett, das er auch später noch regelmäßig trug. Der Rasensprenger lässt das Wasser in einem kleinen perfekten Bogen, der in der Sonne glitzert, aufs Gras fallen – was unmöglich stimmen kann, da damals Rasensprenger in der Oberpfalz kaum verbreitet waren. Der Ball war rot und hatte weiße Punkte und sprang sehr hoch, wenn er mit einem keuchenden Geräusch, als huste er, vom Boden prallte. Es war ein guter Ball. Die Sonne stach. Berührte man den Ball, tat das heiße Plastik an den Händen weh. Meine Großeltern zog es bald in den moosigen Schatten der Bäume am Rand des Grundstücks, wo wir Limonade tranken. Berührte mich meine leicht übergewichtige Oma, die im Jahr darauf an einem Herzinfarkt sterben sollte – und sie umarmte und streichelte mich ständig, was ich sehr gern hatte –, waren ihre starken Oberarme eiskalt, ihr Gesicht schweißnass. Sie zwinkerte ständig mit ihren vom Heuschnupfen geröteten Augen, als stimme etwas nicht, obwohl eigentlich alles in schönster Ordnung war. Nachträglich kommt mir das alles – wir in den fast undurchdringlich schwarzen Schatten der Bäume, mein Großvater, der immer unter dem Lärm in seiner Wohnung in Regensburg litt und nun begeistert flüsterte, wie »absolut idyllisch« und »totenstill« es hier sei, meine zwinkernde Großmutter, die nickend in seine Begeisterung mit einstimmte, obwohl sie die große Altbauwohnung in Regensburg liebte – nachträglich kommt mir das alles wie ein Zeichen vor, mit einer Bedeutung aufgeladen, die diese Szene natürlich in Wahrheit nie besaß.
Die Schatten wuchsen über den Rasen, es roch nach Abend. Meine Großmutter und mein Großvater gingen mit mir ins Haus. Am Wohnzimmertisch spielten wir ein Brettspiel aus ihrer Sammlung, sie hatten es eigens mitgebracht. Dann durfte ich fernsehen. Meine Großmutter schleppte den schuhschachtelgroßen tragbaren Schwarzweißfernseher herbei. Meistens holte meine Mutter beim Bügeln oder Abwaschen den Apparat aus dem Abstellraum, wo normalerweise sein Platz war. Ich meine mich zu erinnern, dass ich zunächst voller Unglauben und auch Sorge meinen Großvater beobachtete in Erwartung, dass er gleich entrüstet protestieren würde. Von meinen Eltern wusste ich, dass für meinen Großvater Fernsehen den Inbegriff der Totalverblödung darstellte. In der Wohnung in Regensburg gab es keinen Fernseher. War ich dort zu Besuch, bläuten mir meine Eltern immer vorher ein, auf gar keinen Fall zu erzählen, dass ich eine bestimmte Sendung zu Hause gesehen habe. Für meinen Großvater war nicht nur die Mehrheit der Sendungen Kondensate der Dummheit; sie verdummten auch denjenigen, der sie ansah. Zudem schädigten sie die Augen. Nun aber stellte meine Großmutter schnaufend den grauen Apparat mitten auf den Perserteppich im Wohnzimmer einfach so vor mich hin. Lange drehte sie an dem Rad und schwenkte die Antenne, bis sich das Schneegestöber in eine Vorabendserie verwandelte. Das machte diesen Tag nicht nur sensationell, sondern zum ultimativen Wunder. Ich dachte gar nicht weiter über den Grund für diese rätselhafte Großzügigkeit und Verleugnung der ansonsten so festen Prinzipien nach. Stattdessen glotzte ich einfach, unendlich dankbar und wunschlos glücklich.
Als das Telefon klingelte, muss ich derart von der Sendung gefangen genommen gewesen sein, dass ich den Anruf gar nicht mitbekam. Was ich mit Sicherheit weiß und sich auch zeitlich zweifelsfrei rekonstruieren lässt, ist, dass gerade die Tagesschau lief. Ich hatte bis dahin noch nie Nachrichten geguckt. Eigentlich durften das nur Erwachsene. Es war wie eine Initiation, ein einzigartiger Blick in die wirkliche Welt der Erwachsenen und das wirkliche Leben. Ich gehe fest davon aus, dass ich rein gar nichts von dem begriff, was dort gezeigt wurde, konnte aber dennoch meine Augen nicht abwenden, weil ich jede Sekunde damit rechnete, dass es sich meine Großeltern anders überlegen und den Apparat ausschalten würden.
Irgendwann erwachte ich kurz aus meiner Fernsehhypnose, als sich meine Großmutter neben mich niederließ. Aus irgendeinem Grund war mein Großvater verschwunden. Auch meine Eltern waren noch nicht zurückgekehrt. Also verbrachte ich die nächsten zwei, vielleicht drei Stunden neben meiner Großmutter vor dem Fernseher. Ohne meinen Großvater, der häufig den Standpunkt vertrat, dass »die Omi« mich zu sehr verwöhnte, schien sie es voll zu genießen, mich für sich allein zu haben. Sie knuddelte und streichelte und küsste mich mit ihrem kalten Gesicht, als gebe es kein Morgen. Blickte ich bei spannenden oder lustigen Stellen im Fernsehen zu ihr hoch, damit sie bestätigte, dass die Stellen gerade wirklich spannend oder lustig gewesen waren, lächelte sie zurück. Kurz weinte sie. Den Blick nicht vom Fernseher wendend, ergriff ich ihre feuchte Hand. Jetzt waren es zwei Dinge, die nicht enden sollten und weswegen weder mein Großvater noch meine Eltern wiederkehren sollten: das Fernsehen und die Zeit mit meiner Omi.
Erst als die Stelle am Ohr, an der ich mich bis dahin wieder und wieder unbewusst gekratzt hatte, schmerzte, unterbrach ich die Sendung.
Was habe ich da, werde ich meine Großmutter gefragt haben. Lass mal sehen, mein Schatz, wird sie geantwortet haben. Ohne etwas zu sagen, lief sie ins Badezimmer. Omi?, werde ich gefragt haben. Bin gleich wieder da, mein Schatz, wird sie geantwortet haben. Es ist alles in Ordnung, mein Liebling. Da ist nichts. Sie kehrte mit derselben goldenen Pinzette zurück, mit der mir mein Vater und später mein Großvater Späne aus dem Fuß oder der Hand herauszogen und deren Anblick in mir sofort größtmögliche Panik auslöste. Trotz ihrer massigen Statur agierte meine Großmutter flink. Mit wenigen Handgriffen hatte sie die Pinzette an mein Ohr geführt und – da zeigte sie mir schon das Ding, das sich dort festgebissen hatte. Was zwischen den geschlossenen Metallarmen klebte, war nicht viel mehr als ein schwarzer Punkt. Meine Großmutter hatte einen merkwürdigen und unpassend schönen Namen für das gefährliche Tier. Vielleicht um der Episode einen spielerischen, märchenhaften Charakter zu verleihen, vermied sie das Wort »Zecke«. Stattdessen nannte sie das Ding »Nymphe«, was, wie ich später erfuhr, tatsächlich der reguläre Begriff für eine nicht ausgewachsene Zecke war. Der Kopf dieser Kinder-Zecke steckte allerdings weiter in mir. Es war das einzige Mal, da bin ich mir ganz sicher, dass ich am vielleicht schrecklichsten Tag meines Lebens weinte. Und meine Großmutter weinte erneut, was mir mit einem Mal seltsam vorkam. Es schüttelte sie. Sie konnte gar nicht mehr aufhören. Wir sahen fern und heulten und hielten einander die Hand. Irgendwann muss ich im Glauben, am nächsten Morgen wie selbstverständlich in meiner alten Welt aufzuwachen, eingeschlafen sein.
Am nächsten Tag erfuhr ich dann, was am Nachmittag zuvor gegen 16:12 Uhr geschehen war. Meine Eltern hatten auf dem Weg in die nächste größere Stadt, Weiden, unter nie geklärten Umständen ein Signal übersehen, waren in ihrem Auto, von der Bahnschranke eingesperrt, von einem Zug erfasst und über 300 Meter weit mitgeschleift worden. Angesichts des Fotos des völlig zerquetschten Wagens, das ich sehr viel später in dem Artikel aus der Regionalzeitung mit dem seltsamen Titel Der Neue Tag sah, nehme ich an und hoffe, dass beide auf der Stelle tot waren.
Ich glaube, meine Großeltern handelten absolut richtig, dass sie mir nicht sofort die Wahrheit sagten, als der Anruf aus dem Krankenhaus kam und mein Großvater aufbrach, weil man ihn über den Zustand meiner Eltern im Unklaren gelassen hatte. Trotzdem vergrößerte im Nachhinein ihr geradezu perfektes Schauspiel meinen Schock. Sie, erwachsene Menschen, noch dazu diejenigen, die mich am meisten liebten, hatten mich belogen. Sie hatten mich an der Nase herumgeführt. Sie hatten mich auf den Arm genommen. Sie hatten mich getäuscht. Und, was für mich im Lauf der Jahre immer schwerer wog, ohne dass ich wusste, warum: Sie hatten mich dazu verleitet, unbeschwert zu sein, obwohl ich bereits allen Grund zur Trauer gehabt hätte. Ja, das Unglück meiner Eltern und mein Verhalten verbanden sich in meinem Kopf auf geheimnisvolle Weise. Ich hatte mich falsch verhalten und trug daher Mitschuld am Tod meiner Eltern.
Es war damals, Mitte der 1980er, unüblich, ein Kind zum Psychiater zu schicken, selbst in einem solchen Fall. Hätte man es doch getan, hätte man wahrscheinlich schnell eine Erklärung dafür gefunden, warum ich mir derartige Vorwürfe machte und mehr noch: warum ich mir von da an einbildete, der rumpflose Kopf der herausgerissenen Nymphe flüsterte in mein Ohr. Er besaß die Stimme des Sprechers der Tagesschau, den ich an jenem Ausnahmeabend gesehen hatte und bei dem es sich, wie mir viele Jahre später auffiel, wohl um Werner Veigel handelte, der dann auch die Sendung am Tag nach dem Fall der Mauer sprach. Ich bildete mir ein, die Nymphe mit dem Bass Werner Veigels mache mir all jene Vorwürfe am Tod meiner Eltern, die mir unformuliert in meinem kleinen Kopf herumspukten, vorzugsweise nachts, wenn ich nicht einschlafen konnte. Ich kann ihre Sätze nicht im Wortlaut wiedergeben. Vielleicht waren es auch eher Stimmungen. Wie undurchdringliche Schatten unter reglosen Buchen an einem idyllischen Sommertag. Eine Einschränkung: Wenn ich sage »ich bildete mir ein«, trifft das nicht zu. Für mich war die Stimme der Zecke und ihre Gegenwart real. So real wie die Gesten und Mimik der Liebe meiner Großmutter, die sie trotz des Abgrunds aus Verzweiflung und Trauer in sich, während wir fernsahen, zur Schau gestellt hatte.
Herkunft
Meine Großeltern, die als einzige noch lebende direkte Verwandte das alleinige Sorgerecht hatten, waren sich anscheinend einig, dass es mich in dieser fürchterlichen Situation noch mehr belastet hätte, aus meinem gewohnten Umfeld gerissen zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem meine Großmutter war, die die Entscheidung propagierte und sich ausnahmsweise gegenüber meinem Großvater durchsetzte. Ob es nicht besser für alle Beteiligten gewesen wäre, hätten mich meine Großeltern zu sich genommen, sei dahingestellt. Unser aller und mein Leben wäre auf jeden Fall vollkommen anders verlaufen. So aber zogen meine Großeltern unmittelbar nach dem Unglück aus ihrer Altbauwohnung in Regensburg, wo mein Großvater Professor für Neuere Deutsche Literatur war, nach Oberviechtach, in den Bungalow meiner Eltern. Es war ohne jeden Zweifel ein gewaltiges Opfer für beide, die die Donau-Stadt mit ihren vielen alten Kirchen und engen mittelalterlichen Gassen sehr liebten. Ich erinnere mich an den Spruch meines Großvaters, eine Stadt ohne Oper, Theater und Orchester sei keine richtige Stadt und eigentlich sei es überhaupt vollkommen undenkbar, in einem Ort, der nicht diese Mindestanforderungen an kulturellem Angebot erfüllt, zu wohnen. Ich habe allerdings den Verdacht, dass sich meine Großmutter bei aller Trauer insgeheim auch darauf freute, noch einmal die Mutterrolle zu übernehmen und ganz für mich da zu sein.
Oberviechtach war ein Dorf in der Oberpfalz mit etwa 5000 Einwohnern und lag ungefähr 20 Kilometer von der damaligen tschechoslowakischen Grenze entfernt. In den Straßen hing im Sommer oft der Geruch von Jauche aus den Kuh- und Schweineställen, die sich teilweise mitten im Ort befanden. Wahrscheinlich hätten die meisten, die sich ab und zu dorthin verirrten, um Urlaub zu machen, seine Lage zwischen dichten Fichtenwäldern und sanften Hügeln, auf deren Gipfeln Burgruinen hervorschauten, als idyllisch, vielleicht sogar verwunschen bezeichnet. Und obwohl er sich vor dem Unglück bei seinen wenigen Besuchen – meistens war nur meine Großmutter gekommen – erfreut über die Ruhe und die unberührte Natur gezeigt hatte, war Oberviechtach für meinen Großvater doch in Wahrheit einfach nur das: ein Kaff, ein Ausdruck, den er mit der für ihn typischen genussvollen Abschätzung auszusprechen pflegte, um gleich im Anschluss wie über einen nicht ganz geglückten Witz zu lachen, so dass ich mir nie ganz sicher war, ob er das Dorf wirklich so sehr hasste, wie er stets behauptete. Der Tod meiner Eltern und damit seiner einzigen Tochter ereignete sich während der Semesterferien. Seine Kurse im Wintersemester waren bereits angekündigt, aber es schien kein größeres Problem darzustellen, unter diesen Umständen kurzfristig die Unterrichtsstundenzahl auf ein Minimum zu reduzieren. Dreimal die Woche fuhr er nun die etwa eineinhalbstündige Strecke zu seinen Vorlesungen, Seminaren und Besprechungen. Obwohl mir mein Großvater damals, 1986, bereits mit seiner großen, hageren Gestalt, der Glatze und seinem angegrauten Bart wie ein uralter Mann erschien, war er erst 57 Jahre alt. Ich denke, er war auch deshalb nach Oberviechtach gezogen, weil meine Großmutter erklärt hatte, sie werde ihm »das Kind«, sprich mich, vollkommen abnehmen und ihm noch mehr als früher den Rücken freihalten, damit er neben seiner Arbeit auch weiterhin seine Kulturaktivitäten in München wahrnehmen konnte. So lautete wahrscheinlich der Deal zwischen den beiden. Der dann vollkommen hinfällig war, als meine Oma eines Sommermorgens 1987, fast genau ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter, tot im Bett lag und mein Großvater auf einmal ausgerechnet in jenem »Kaff« gefangen war, das er nicht ausstehen konnte, mit einem Kind, bei dem er letztlich absolut keine Ahnung hatte, wie er mit ihm umgehen sollte.
Unser Bungalow befand sich in einer Neubausiedlung an einem der sandigen Hänge, die sich in alle Himmelsrichtungen sanft um die Mulde erhoben, in der Oberviechtach lag. Nur eine einzige Straße, die in weiten Serpentinen zwischen Kartoffeläckern und Maisfeldern und an der einsam und wie verbannt dastehenden winzigen evangelischen Kirche vorbeiführte, verband sie mit dem Ortskern. Es war die Siedlung meiner Eltern – und zwar buchstäblich. Meine Eltern, deren Büro unter Klecka Architekten firmierte, hatten sie entworfen und ihre Entstehung bis zu ihrem Tod begleitet. Vielleicht an die zweihundert Menschen lebten dort, ich kann mich irren. Die Siedlung strukturierte sich in Rondells mit sternförmig drum herum angeordneten Häusern. Als Namen für die einzelnen Rondells hatte man bedeutsame Persönlichkeiten der deutschen Geschichte gewählt. Wir wohnten im Albert-Einstein-Rondell, auch Das Einstein genannt, das an Das Geschwister Scholl und Das Goethe angrenzte. Als meine Eltern verunglückten, war weiter oben, auf dem Rücken des Hangs, bereits ein weiteres Rondell im Entstehen begriffen. Jede Nacht brannten dort die Straßenlaternen am Rand der fertig geteerten Straße. Was fehlte, waren die Häuser, was mir die Gegend unheimlich machte, so dass ich sie bei Einbruch der Dunkelheit mied. Ein Eindruck, der sicherlich auch daher rührte, dass der Baustopp mit dem Tod meiner Eltern zusammenfiel. Beides, ihre Abwesenheit und das Brachland mit den aus der Erde und ins Nirgendwo ragenden, nackten Kabelenden und kleinen Transformatorenstationen, in denen es summte, waren für mich untrennbar miteinander verbunden. Dieses untote Rondell wurde bis Ende des Jahrzehnts Das Steffi Graf genannt.
Das Wissen darum, dass es meine Eltern gewesen waren, die die Siedlung geplant hatten, gab mir damals als Kind ein besonderes Gefühl, eine Art Auserwähltsein. Erst als Jugendlicher erfuhr ich, dass sie wegen zahlreicher Baumängel kurz vor der Insolvenz gestanden hatten, weswegen auch der Ausbau der Siedlung gestoppt worden war.
Vielleicht, weil er eine Art Neustart wollte, oder weil er es tatsächlich in gewisser Weise genoss, endlich ganz nach seinen eigenen Vorstellungen wohnen zu können, veränderte mein Großvater die ursprüngliche Funktion der Zimmer, so dass ich bereits als kleines Kind das gesamte mit Fenstern zum Garten hin ausgestattete Untergeschoss des Bungalows für mich allein hatte, oder, wie mein Großvater sagte: »das Souterrain«. Früher war darin das Büro untergebracht gewesen. An meiner Zimmertür hing noch immer das goldene Schild: Büro Klecka. Nun schlief ich an jener Stelle, wo die Schreibtische meiner Eltern gestanden und sie ihre Häuser und am Ende nie gebauten Gebäude erdacht und gezeichnet hatten.
Ohne Frage war meine Mutter eine auffallende Gestalt: groß, über 1,80 m, schlank, mit blondem Bubikopf, etwas zu langen Armen und einer auffallend asymmetrischen Gesichtsform, die ihre fast schon klassische Schönheit einerseits brach und sie andererseits genau dadurch, durch das Nicht-Perfekte, irgendwie geheimnisvoll und noch attraktiver machte. Dass sie von Anfang an etwas ganz Besonderes sein sollte, machte schon allein der Name deutlich, den meine Großeltern und hier wohl maßgeblich mein Großvater mit seinem Klassik-Fimmel für sie ausgesucht hatten: Leonore. Obwohl ich ihr Haar und ihre Gesichtsform geerbt habe, hatte ich vor allem in meiner Pubertät nicht nur Sorge, sondern geradezu Panik, mich in jenen Mann zu verwandeln, der neben ihr, die immer strahlte, irgendwie fehl am Platz wirkte und das nicht nur wegen seines geradezu auffallend durchschnittlichen Namens: Helmut, mein Vater, ein Kopf kleiner als sie, leicht untersetzt, bärtig, mit ungepflegt wirkendem schulterlangem Haar. Nichtsdestotrotz fühlte ich mich damals als Kind Helmut näher als Leonore. Laut meinem Großvater sei es die Idee seines Schwiegersohns gewesen, mir einen Vor- und Mittelnamen zu geben, den sonst keiner hatte. Bastian Balthasar. Angeblich deshalb, weil die kindliche Hauptfigur seines Lieblingsbuches zur Zeit meiner Geburt, Michael Endes Die Unendliche Geschichte, ebenso hieß. Obwohl das Exemplar des Romans meine gesamte Kindheit über in meinem Regal stand, scheute ich mich davor, es zu lesen. Die paar Male, die ich es aufblätterte und dann sofort meinen Namen erblickte, wurde es mir kalt vor Peinlichkeit, vor Angst, vor Wut, ich weiß nicht was. Nichtsdestotrotz trug mein Name, zusammen mit dem Status als Waisenkind, dazu bei, dass ich mir schon früh irgendwie fiktiv vorkam. Meine wahren Verwandten waren große Waisen wie Momo, David Copperfield, Tom Sawyer und Mowgli.
Die Plattensammlung meines Großvaters, die im Wohnzimmer acht Regalreihen umfasste, bestand ausschließlich aus Klassik. Eine große Ausnahme bildeten drei Platten mit »Tanzmusik«, wie mein Großvater das nannte: zum einen A Hard Days’ Night und Let it be von den Beatles. Zum anderen eine Platte, die angeblich die Lieblings-LP meiner Mutter gewesen war. Wenn ich, während mein Großvater an seinem Schreibtisch arbeitete, auf dem Perserteppich vor ihm lag und mich über Kopfhörer durch seine Sammlung hörte, betrachtete ich manchmal heimlich das Cover, das auf mich eine starke Anziehungskraft ausübte: Es zeigte die Band ABBA, zwei Männer und zwei Frauen, die gedrängt im zu kleinen Cockpit eines durchsichtigen Hubschraubers saßen. Aus irgendeinem Grund, wohl auch, weil eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen war, stellte ich mir vor, die blonde Frau in der Mitte sei meine Mutter und der Mann mit Bart mein Vater, kurz vor dem Start in weit entfernte Länder, vielleicht sogar zu anderen Sternen oder zu jenem Ort, an dem sie sich nun befanden. Die LP hieß Arrival.
Ich konnte mich an meine Eltern nur durch Fotos und Home-Videos erinnern. Ab und zu, am Geburtstag seiner Tochter oder am Jahrestag ihres Todes, entrollte mein Großvater im Wohnzimmer am Bücherregal die klebrige Leinwand und stellte den Filmprojektor davor. Ein leicht kokeliger Geruch breitete sich im Zimmer aus, als gehörte beides, Vergangenheit und Rauch, untrennbar zusammen. Manchmal fingen die Polster der Couch, auf der wir saßen, plötzlich zu zittern an, wie von einer leichten Erschütterung. Ich traute mich dann nie, zu meinem Großvater rüberzusehen, weil ich genau wusste, dass er sein Weinen unterdrückte.
Durch die Videos eignete ich mir einige Gesten meiner Eltern an, weil ich sie cool fand oder einfach, weil sie mir so häufig vorgeführt wurden. Möglich auch, dass dies nur der Ausgleich dafür war, dass ich es zwar irgendwie vermisste, eine Mutter und einen Vater zu haben; dass ich aber meine Eltern nicht liebte. Ich wollte meine Eltern lieben. Ich wollte mich anstrengen, meine Eltern zu lieben. Man liebte seine Eltern. Alle liebten ihre Eltern. Wie allerdings konnte ich Menschen lieben, die ich fast ausschließlich von Fotos oder Filmen kannte? Ich erzählte niemandem davon. Die Einzige, die davon wusste, war die Nymphe mit der Stimme Werner Veigels. Sie war wie Gott. Aber anders als er hatte sie ihre Freude an meinen Unzulänglichkeiten. Sie war auch nicht der Teufel. Sie musste gar nichts machen. Sie musste sich nicht in irgendeiner Weise in mein Leben einmischen. Sie schaute mir bloß zu, genau so wie ich nachmittags Zeichentrickfilme ansah und mich darüber kaputtlachte, wenn Tom von Jerry überlistet, gefoltert und hingerichtet wurde – und wieder auferstand. In meinem Kopf war sie zur Monsterzecke geworden, die in meinem Gehörgang hauste, schleimig, nackt und böse. Hätte mich ein Arzt untersucht, wäre er auf sie gestoßen, davon war ich überzeugt. Ich musste ihr Opfer darbringen, sonst würde etwas Schlimmes geschehen, zum Beispiel mit meinem Großvater. Wir konnten auf den Fahrten ins Museum oder ins Konzert mit dem Auto verunglücken. Ich konnte die Kontrolle über mein Fahrrad verlieren. Die Kindergärtnerin, Schwester Reglinde, eine Nonne, konnte sich plötzlich von mir, ihrem Liebling, abwenden und jemand anderen bevorzugen. Ich würde nicht mehr auf ihrem Schoß sitzen dürfen. Die Zecke sorgte dafür, dass dies nicht geschah. Doch damit sie dafür sorgte, musste ich manchmal das Geschirr und Besteck, das ich als eine meiner Aufgaben im Haushalt abwusch, nach dem Ausräumen aus der Spülmaschine auf der Arbeitsfläche genau parallel anordnen. Tat ich es nicht, war ich und war die Welt verloren. Ich musste mich dreimal am Ohr kratzen. Ich musste im Garten alle Gänseblümchen in einem bestimmten Quadrat pflücken, die Blütenblätter abreißen und den Fruchtknoten zerdrücken. Ich musste vor dem Einschlafen fünfzehn Mal das Wort »Zecke« sagen. Ich tat alles. Doch irgendwann, ich glaube, ungefähr als ich in die Schule kam und jeden Tag mit den anderen Kindern aus der Siedlung in den Grundschulkomplex am Fuß des Hanges ging, wurde die Stimme der Zecke von anderen und zunehmend wichtigeren Dingen übertönt. Meinem besten Freund Heime, Hausaufgaben, Hobbys, Hubba Bubba. Eines Tages hatte ich sie endlich vergessen, und sie blieb verschwunden, wie ein Spielzeug, das man in einen Karton packt und in den Keller trägt, in den man dann vermeidet herunterzusteigen, weil man sich vor der Dunkelheit fürchtet.
Der Sommer des Fernsehens
Im Jahr 1992 kehrte die Monsterzecke zurück. Im September, um genau zu sein. Am letzten Abend der großen Ferien. Am nächsten Tag würde ich aufs Gymnasium kommen. Es hieß das Leuchtenberg, auch Die Leuchte genannt, und lag etwa eine halbe Stunde von Oberviechtach entfernt. Während also die meisten anderen aus meiner ehemaligen Klasse den Weg wie bisher in den Komplex am Fuß des Hangs mit der Doktor Eisenbarth-Haupt- und Realschule gingen, benannt nach dem sagenhaften Augenarzt, der hier geboren worden war und Erblindete wieder sehend gemacht haben soll, schärfer als je zuvor, würde ich zu meinem Großvater ins Auto steigen, weil er darauf bestand, mich zumindest anfangs selbst zu bringen und abzuholen, damit ich nicht »mit den anderen« den alten, dröhnenden Bus nehmen musste, der noch vor Sonnenaufgang die Dörfer und Höfe der Umgebung abklapperte.