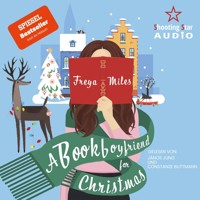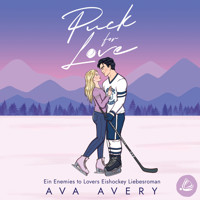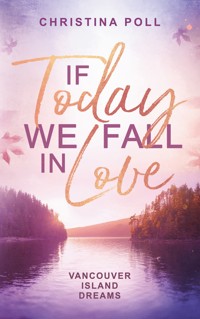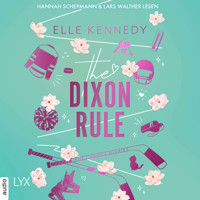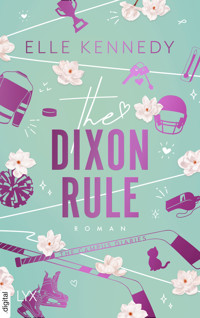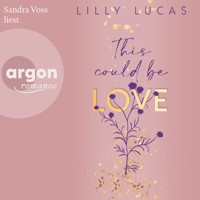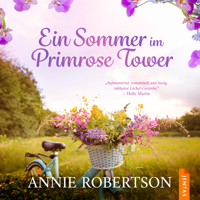14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man muss sich Jonas als einen glücklichen Menschen vorstellen, schreibt François Garde über den biblischen Propheten, den ein großer Fisch verschlang und vor Ninive wieder ausspuckte – immerhin war dieser Fisch ein Wal. Ein Wesen, das die Phantasie, die Jagdlust, den Hunger, das Sprachvermögen und die Abenteuersehnsucht der Menschheit seit jeher befeuert, ein mythisches Tier. François Garde erzählt in seinem charmanten, kurzweiligen, klugen und durchaus auch komischen Buch alle erdenklichen Geschichten und Kuriositäten über den Wal. Er reist dem Meeresriesen nach, zu den Walhäfen und dem einzigen Walrestaurant, aber er mustert auch Straßenschilder und Sternenbilder und die literarischen Spuren, die das gewaltige Tier hinterlassen hat. Ein glänzend geschriebenes, ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Buch über eines der spannendsten und mysteriösesten Wesen der Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
François Garde
DAS LACHEN DER WALE
Eine ozeanische Reise
Aus dem Französischenvon Thomas Schultz
C.H.Beck
ZUM BUCH
Man muss sich Jonas als einen glücklichen Menschen vorstellen, schreibt François Garde über den biblischen Propheten, den ein großer Fisch verschlang und vor Ninive wieder ausspuckte – immerhin war dieser Fisch ein Wal. Ein Wesen, das die Phantasie, die Jagdlust, den Hunger, das Sprachvermögen und die Abenteuersehnsucht der Menschheit seit jeher befeuert, ein mythisches Tier. François Garde erzählt in seinem charmanten, kurzweiligen, klugen und durchaus auch komischen Buch alle erdenklichen Geschichten und Kuriositäten über den Wal. Er reist dem Meeresriesen nach, zu den Walhäfen und dem einzigen Walrestaurant, aber er mustert auch Straßenschilder und Sternenbilder und die literarischen Spuren, die das gewaltige Tier hinterlassen hat. Ein glänzend geschriebenes, ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Buch über eines der spannendsten und mysteriösesten Wesen der Natur.
ÜBER DEN AUTOR
François Garde, geboren 1959 in Le Cannet, nahe der französischen Mittelmeerküste, war als hoher Regierungsbeamter u.a. auf Neukaledonien tätig. 2012 erschien bei C.H.Beck sein Roman «Was mit dem weißen Wilden geschah», für den Garde in Frankreich mit acht Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, darunter der Prix Goncourt für den ersten Roman. 2013 erschien bei Gallimard der Roman «Pour Trois Couronnes».
Thomas Schultz, geboren 1957, lebt in Berlin und ist als Übersetzer aus dem Französischen und Spanischen tätig. Neben zahlreichen Dokumentarfilmen und Essayfilmen übersetzte er Kunst-Essays für das Museo Thyssen-Bornemisza. Für den Verlag C.H.Beck übersetzte er u.a. Werke von Elisabeth Badinter, Marie-France Hirigoyen, Norberto Fuentes und François Cheng.
Inhalt
Wer sorgt sich heute um die Wale?
I: DAS TIER
1: Lachen
2: Zähne
3: Rekorde
4: Auf der Landstraße nach Saint-Pierre – 21° 1' S. – 55° 14' O.
5: Einteilungen
6: Straßen
7: Jona und der große Fisch
8: Strandungen
9: Hände
10: In der Hudson Bay – 55° 55' N. – 6° 48' W.
11: Aas
12: Louvre
13: Kühe
14: In der Bucht von Hienghène – 20° 42' S. – 164° 56' O.
15: Stürme
16: Jona und Jesus
17: Karte
II: DIE JAGD
18: Im Baskenland – 43° 29' N. – 1° 34' W.
19: Heldenepos
20: Bouvetinsel – 54° 23’ S. – 3° 21’ O.
21
22: Appetit
23: Port-Jeanne-d'Arc – 49° 34' S. – 69° 51' O.
24: Schränke
25: Diplomaten
26: Port-Louis-Philippe – 43° 48' S. – 172° 57' O.
27: Harpunen
III: DER HIMMEL
28: Azur
29: Galaxie
30: Jona und der Abgrund
31: Haiku
32: Im Naturkundemuseum – 48° 50' N. – 2° 21' O.
33: Hampelmann
34: Gesänge
35: Seelen
36: Saint-Clément-des-Baleines – 46° 14' N. – 1° 33' W.
37: Schilder
38: Das Kloster Saint-Sauveur – 43° 31' N. – 5° 26' O.
39: Einhorn
40: Jona und die Götter
41: Schlösser
42: Herausforderung
43: Schwertwale
Warum könnte, wer den intelligenten Elefanten vor seinen Wagen gespannt hat, nicht auch den dummen Wal vor sein Boot spannen? Ist es einfacher, ihn inmitten des ewigen Eisesmit einer Harpune zu durchbohren, als ihn mit freundlichen Belohnungen zu zähmen wie die anderen Haustiere?
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
Wer sorgt sich heute um die Wale?
Lange habe ich sie nicht beachtet. Ich suchte sie nicht. Und mir war nicht bewusst, dass sie immer wiederkehrten. Ich begegnete manchmal winzigsten Spuren von ihnen, aber ich sah sie nicht. Ich glaubte, nichts über sie zu wissen, und ich machte mir deswegen weiter keine Sorgen.
Ich glaube, es war auf den Kerguelen-Inseln, wo ich zum ersten Mal auf sie aufmerksam wurde. Was mich dorthin geführt hatte, um mir die einzige auf französischem Boden errichtete Walfabrik anzusehen, ist nicht so wichtig. Von eisigen Regenböen gepeitscht, durchstreifte ich die Ruinen und erahnte ganz vage das Ende einer abenteuerlichen Zeit. Die windschiefen Gebäude, die Reste von Anlegestegen, Ruderbooten und Gleisen, das niedrige mit Nägeln und Kohle übersäte Gras, selbst der tiefhängende, graue Himmel, alles in dieser verlassenen Landschaft flüsterte eine Geschichte. Ich brauchte nur die Ohren zu spitzen und dann am Abend zu schreiben.
Und doch vermochten diese wenigen beschriebenen Blätter die Wahrheit des Ortes nicht wiederherzustellen: Das Anekdotenhafte verdeckte eine Welt. Ich wollte eine Episode der Jagd auf den Wal erzählen, ohne von beiden Dingen wirklich Ahnung zu haben, und da führte mich meine widerspenstige Feder auf den Grund der Ozeane.
Ich schärfte meinen Blick.
Unmöglich, sich dem Wal wie einem Thema zu nähern – oder einer Insel. Er verweigerte sich mir, er ließ sich nicht fassen. Ich entdeckte seine Schamhaftigkeit oder seine Unauffälligkeit. Was sollte ich machen mit diesem vagen Interesse für ein ständig fliehendes Tier?
Mensch und Wal sehen sich selten. Ihre Begegnungen sind vom Tod beherrscht – gestrandete Wale oder Szenen der Jagd, des Zerlegens in Strömen von Blut – oder beschränken sich auf flüchtig aufscheinende Momente – ein Blas, eine Beule auf dem Meer, bestenfalls ein Sprung, eine Wende. Das Leben der Wale spielt sich außerhalb unserer Sichtweite ab. Unter Wasser die Reisen, die Paarungen, die Geburten, die Spiele …
«Die Sonne und den Tod kann man nicht anschauen», verriet La Rochefoucauld. Den Wal nur mit Mühe. Niemand kann ihn ganz und gar betrachten. Man muss sich mit Teilansichten, Fragmenten, bestenfalls einem Schatten begnügen.
Im Laufe der Wechselfälle, die unsere Tage und Nächte weben, habe ich gelernt, die Echos seiner Abwesenheit wahrzunehmen. Ich habe den Ozean mit dem Auge abgesucht auf der Suche nach dem leisesten Anzeichen, dem winzigsten Auftauchen einer Flosse, dem Rest eines Blases, den die Brise gleich zerstäuben würde. Ich beobachtete die Oberfläche der Fluten mit einer Begierde und einer Anspannung, die mich selbst überraschen.
Mir scheint, wenn es mir gelänge, ihn mit einem Blick zu streifen, seinen Weg einen Moment lang zu kreuzen, würde ich dadurch ein klein wenig verändert werden. Aber warum? Nach welcher Besänftigung sehne ich mich so sehr?
Hoch oben von einem Leuchtturm oder einer Klippe aus nach denjenigen Ausschau zu halten, die möglicherweise am Horizont erscheinen, würde bedeuten, sich einer Illusion hinzugeben. Wohl wissend, dass ich mich notfalls von den Ozeanen abwenden muss, begebe ich mich auf die Suche nach dem Wal. Seine vertraulichsten Mitteilungen benötigen nicht immer Salzwasser. Ich werde mich einfach umschauen und sehen, was auf mich zukommt. In Städten, Schlössern und Kirchen. In Liedern und Träumen. In Museen und Geschäften. In Zauberbüchern und auf Landkarten. In der Nähe einer Fabrik oder eines Restaurants. Beim Durchblättern eines Lexikons von hinten nach vorn. Im Himmel und sogar jenseits der Sterne.
Nach und nach beobachte ich seinen Einfluss auf mich. Seine Ruhe, seine Weisheit erweisen sich als ansteckend. Durch irgendeinen undurchsichtigen Prozess verleiht mir der Umgang mit ihm, selbst aus der Ferne, ein den Seeleuten wohlbekanntes Gefühl: ein Gebiet der Unwetter verlassen zu haben – wenn auch nur der banalen Gewitter des heutigen Lebens – und in einer vor Wind und Dünung geschützten Bucht meine Wachsamkeit senken und mich gehen lassen zu können.
Zwischen dem Wal und mir, zwischen den Menschen und den Walen existiert seit je eine Verbindung, sie stehen in einem besonderen Einklang.
Der Wal lebt und stirbt am Rande unserer Welt. An diesem Rand schreibe ich.
Der Wal spricht zu mir auf Französisch, mit leiser Stimme, kaum vernehmbar, und ich bin nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Er spricht zu mir über die Natur, über uns Menschen und über mich, den er gut zu kennen scheint. Er spricht zu mir ein wenig über sich.
Ich spitze die Ohren, und ich zittere, ich zittere vor Angst, vor Scham, manchmal vor Freude und vor allem, wenn er verstummen zu wollen scheint. Es ist doch unwichtig, ob ich falsch verstehe! Er muss sich nur weiterhin an mich wenden. Ich muss nur sicherstellen, dass der dünne Faden, der uns verbindet, nicht abreißt.
Da ich weder Gelehrter noch Seefahrer bin, muss ich mich weit mehr bemühen, um seine Botschaft entschlüsseln zu können. Nichts anderes zählt mehr für mich, den Illegitimen, als sie zu empfangen und weiterzuleiten. Mein Schweigen ist durchzogen von Achtung und Furcht, von Reue und Bewunderung und von der völligen Gewissheit über unsere Ähnlichkeit. Wenn ich mich verrückterweise taub stellen würde, verlöre ich die Gelegenheit, mich endlich mit ihm und allen Lebewesen zu versöhnen.
Was der Wal sagt, zwingt mich, ich zu sein.
Indem ich dem Wal zuhöre, scheine ich den mir angemessenen Platz in den Angelegenheiten der Welt wiederzufinden.
Während ein Fischer auf seinem Kutter zurück zum Hafen fährt, ordnet er seine Fische in Kisten, um sie auf dem Markt anzubieten. Nach seiner Art ordne auch ich meine magere Ausbeute: Wörter. Wörter, die vom Wal erzählen, in all seinen Zuständen.
I
DAS TIER
1
Lachen
Ich bin zu Besuch bei Nachbarn und bestaune ihr neugeborenes Kind in seiner Wiege. Es lallt artig vor sich hin, vergraben unter Tüchern und Decken. Seine Hand hat gerade einen pinkfarbenen Wal losgelassen. Welcher unbesonnene Onkel oder Pate hat ihm so etwas geschenkt?
Unter den Stofftieren für die ganz Kleinen rangiert der Wal auf den oberen Plätzen. Hinter dem Bären, dem Kaninchen und erstaunlicherweise hinter der Giraffe aber vor dem Delphin und allen anderen Meerestieren, und auch vor allen Vögeln.
Man hat ihn zu einer Kugel mit fröhlichen Augen und einem glückseligen Lächeln vereinfacht. Eine breite Schwanzflosse erlaubt es, ihn mit der Hand zu greifen. Und vielleicht hört der Säugling beim Einschlafen in seinem Traum den Wal lachen, den er an sich drückt.
Der Wal löst eine spontane Empathie aus, das Bild von etwas Undeutlichem, aber Sanftem, Friedlichem, Umhüllendem: kein Riese der Meere, empfindungslos gegenüber dem Leben der Menschen, sondern das Gegenteil von einer Bedrohung, ein Wohlbehagen, ein Kokon, eine gewaltige und beruhigende Anwesenheit. Trotz seines Gewichts ist das Tier harmlos und wirkt nicht gefährlich. Keinerlei Krallen, scharfe Zähne, Stachel oder Gift, nicht mal unter der Haut spielende Muskeln. Ein rundlicher Leib, von Fett umkleidet, der für seltene und langsame Bewegungen gemacht ist.
Die Begegnung eines Wals mit einem Neugeborenen in seinem Bett erscheint mir ebenso abenteuerlich wie die einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch. Die Eltern, die ein solches Geschenk machen, sorgen sich nicht um diesen Widerspruch. Sie sehen darin weder eine Bedrohung noch eine Böswilligkeit. Wenn sie wüssten … Wenn sie wüssten, was das Tier alles mit sich bringt an Risiken und Träumen, an Abenteuern und Dramen, würden sie dem Baby augenblicklich das unschuldige Stofftier aus den Händen reißen und aus dem Fenster werfen.
Aber der Wal lächelt, oder lacht. Dieser Anblick beruhigt. Sagt man im Französischen nicht: lächeln wie ein Wal?
Im Haus begegnet man dem Motiv des lachenden Wals in allen möglichen Varianten auf einer Unzahl von Oberflächen: auf Duschvorhängen, Bettwäsche, Handtüchern, Kopfkissenbezügen, Schürzen, Fußabtretern, Schultaschen, Dosen aller Größen und Formen, Kacheln … Er ist dort stilisiert abgebildet, reduziert auf eine Blase mit runden Augen und einem Mund, ein einfaches Komma im Gegensatz zum Schwanz. In eine fröhliche, einfarbige Livree gekleidet – himmelblau, orange, himbeerrot, goldgelb oder apfelgrün –, erhebt er keinerlei Anspruch auf Realismus. Nichts an ihm erinnert an das Meer, das Fleisch, die Jagd oder die Stürme, außer vielleicht eine gewisse Vorliebe für Badezimmer. Wie die Grinsekatze in Alice im Wunderland ist der Wal fast völlig verschwunden und hinterlässt uns nur sein angebliches Lachen – und das Nötigste an Körperlichkeit, damit dieses Lachen Sinn macht.
Die Wale singen vielleicht, aber lachen tun sie mit Sicherheit nicht. Sie stoßen keinerlei Töne über Wasser aus. Weder ihre Freude am Leben noch ihr Sinn für Humor sind bewiesen. Das wenige, was wir über sie wissen, nimmt oft ein tragisches Ende. Woraus also erklärt sich dieser Vergleich mit einem unverbesserlichen, zwanghaften, ansteckenden Lacher? Aus völliger Unwissenheit, oder verbirgt sich hinter dieser Heiterkeit eine Art Verlegenheit?
Wahrscheinlich ist es das breite Maul mit den Mundwinkeln, die bis hoch hinauf in die Wangen reichen. Jemand, der aus vollem Halse lacht, macht – natürlich relativ gesehen – ein ähnliches Gesicht wie ein Wal. Dieser Vergleich denkt weder an die Feinheit noch an die Komplizenhaftigkeit des Lachens. Er meint eine etwas einfältige Heiterkeit, eine arglose Einfalt in der Zufriedenheit. Alles in allem ziehe ich ein offenes, ja sogar dümmliches Lachen einem schrillen Gekicher vor. Alles in allem ist es besser, zu lachen wie ein Wal als wie eine Hyäne.
2
Zähne
Im archäologischen Museum von Saint-Germain-en-Laye bestaune ich den gravierten Zahn eines Pottwals, der aus der prähistorischen Höhle von Le Mas-d’Azil im Departement Ariège stammt, also weit weg vom Meer. Darauf sind zwei Steinböcke, der eine in waagrechter Position, der andere aufgerichtet, wirklichkeitsgetreu dargestellt.
Die übrigen Gegenstände, die in der Höhle gefunden wurden, sind aus Zähnen oder Knochen von Rentieren, Kühen oder Pferden gemacht. Der Zahn, der einem gestrandeten Tier entnommen wurde, ist von der Atlantikküste aus von Hand zu Hand gewandert. Entstand die Gravur am Strand oder erst am Ende seiner langen Reise? Und mit welchen Werkzeugen? Die Seltenheit eines solchen Zahns, die Entfernung und die sorgfältige Arbeit machen die Kostbarkeit dieses Meisterwerks aus, unabhängig von den Wertvorstellungen, die seine Schöpfer und aufeinanderfolgenden Besitzer vertreten haben mögen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Gegenstand eine einfache häusliche Funktion gehabt haben soll, zum Beispiel als Glätter zur Lederbearbeitung. Ich denke, er galt als edel, wurde bewundert, vielleicht verehrt. Ich erahne, dass er etwas Religiöses, Magisches verkörperte, Macht für den, der ihn besaß, eine sakrale Verbindung zur Jagd, zum Klan, zu den Zeigeriten oder den Opferzeremonien, mit einem geheimen Ort, wo er in Sicherheit aufbewahrt wurde. Der Steinbock und der Pottwal: die Berge und das Meer, die Beweglichkeit und die Schwere … In anderen Höhlen der Departements Charente und Ariège wurden, genau umgekehrt, Zeichnungen von Walen auf Rentierknochen gefunden. Die geistigen Bilder der Menschen aus jener Vorzeit werden sich uns auf ewig entziehen, und so können wir uns frei vorstellen, wovon sie vor zwölftausend Jahren träumten.
Vor der Vitrine stehend, erscheint mir dieser Zahn, wie er da von diffusen Lichtern erleuchtet auf einem mit grauem Samt verkleideten Sockel in seinem gläsernen Käfig ruht, wie eine Reliquie und wie eine Etappe auf meiner beginnenden Suche. Nie hätte sich sein Schöpfer je träumen lassen, dass sein Werk ihn so fern von ihm und so lange überleben und einst so pietätlos und aus solcher Nähe den Blicken durchreisender Touristen und lärmender Schüler ausgesetzt sein würde.
Dennoch glaube ich in diesem Angebot des Museums eine Gemeinsamkeit mit den Menschen aus jener Zeit zu erspüren: in einem Pottwalzahn mit zwei eingravierten Steinböcken etwas anderes zu sehen als nur den verzierten Rest eines toten Tieres; aus dieser Reliquie einen Diskurs zu machen.
Für ihre Zeitgenossen bedurfte die Botschaft keiner Kommentare. Sie entzieht sich vollkommen unserer Kenntnis, ihre Existenz erahnen wir nur. Wir verfügen nicht über ihre Codes, und dieser Pottwalzahn kündet von Geheimnissen in einer toten Sprache.
Trotz allem verbindet mich seit Saint-Germain-en-Laye etwas Unsagbares und Unmittelbares mit einem Strand des Atlantik, wo vor einhundertzwanzig Jahrhunderten an einem regnerischen Herbstabend ein Jäger und Schamane an einem gestrandeten Kadaver Gebete sprach und Rauchopfer darbrachte und ihn um die Erlaubnis für das Herausziehen des Zahnes bat. Für einige Sekunden hält jeder Besucher in seinem Schweifen inne und spürt diese Verbindung wie durch ein in Zeit und Raum geöffnetes Fenster. Er weiß nicht den Grund für diese leichte Unruhe, die ihn erfasst hat, für diesen flüchtigen Moment von Zweifel und Einklang. Er wandelt ihn in banale Neugier oder in ästhetische Bewegtheit. Er macht aus dieser Reliquie ein Kunstwerk.
Noch weiß ich nicht, was mir der Pottwalzahn von Le Mas-d'Azil sagen will.
Einige Monate später entdeckte ich weitere gravierte Zähne, und zwar solche, die im 19. Jahrhundert von den Seeleuten der Walfangschiffe bearbeitet worden waren. Während der endlosen Rückfahrt fertigten die Matrosen alles Mögliche aus den Zähnen, Knochen und Barten der Wale. Zum einen stellten sie Gebrauchsgegenstände her: Messerhefte, Eierbecher, Türknäufe, Becher, Gardinenstangen, Schaufeln, Streichholzschachteln, Buttersiegel, Wäscheklammern, Kämme, Ringe, Kerzenleuchter, Nudelhölzer, Besenstiele … Auch ihre Kinder vergaßen sie nicht: Puppen, Dominos, Fangbecher und andere Spielzeuge. Einige brachten sogar erheblich größere Teile mit, um daraus Hocker oder originelle Gartenzäune zu machen.
Doch sehr bald endeckten sie das Interesse des Bürgertums für diese Produktion und erdachten Gegenstände für den Verkauf: Brieföffner, Schuhanzieher, Kleiderhaken, Serviettenringe, Zigarettenetuis, Stockknäufe oder ganze Stöcke, Fächergestänge, Klaviertasten, Bilderrahmen, Brillengestelle, Vogelkäfige, Puppenhäuser … Und sie stellten auch rein dekorativen Nippes her aus den Schulterblättern und vor allem den Zähnen des Pottwals.
Der gravierte Pottwalzahn wurde als Kuriosität ziemlich populär. Die bemerkenswertesten Exemplare zeigen ein Schiff mit vollen Segeln oder eine Szene vom Walfang mit einem harpunierten Wal und gereichen selbst den namhaftesten Sammlungen zur Zierde, insbesondere denen des französischen Marinemuseums. Einige Stücke stellen religiöse Szenen dar, eine Prozession, eine Kreuzigung, die Dorfkirche. Die seltensten und teuersten, in Depots verborgen, zeigen unverblümt eine Tour ins Bordell.
Auch diese naiven Produktionen erreichen uns aus einer entschwundenen Vergangenheit. Wir verstehen den unmittelbaren Sinn, aber gleichzeitig wissen wir fast nichts über die Lebensumstände dieser Gelegenheitsgraveure. Auch sie sind auf ihre Weise im Dunst der Vergangenheit verschwunden, haben kein Gesicht mehr. Ihre ruhmreichen Zeiten und ihre Leiden sind uns fremd geworden. Wer zählt heute noch einen Walfänger zu seinen Vorfahren?
All diese Gegenstände sind Teil dessen, was im Französischen camelote genannt wird. Dieses alte Wort hat nicht immer Ramsch, also Massenproduktion von dürftiger Qualität bedeutet, sondern bezeichnete zu Anfang den Handel, den die Matrosen trieben. Die Bedeutungsverschiebung dieses Begriffs setzt eine ganze Epoche unserer Seefahrtgeschichte herab.
Die gravierten Pottwalzähne der beiden Museen sind nie zusammen ausgestellt worden. Nichts verbindet sie über die Jahrhunderte hinweg. Nachdem ich den einen und dann die anderen gesehen habe, entdecke ich in ihnen eine Ähnlichkeit, die mich tief berührt.
Graveure des späten Magdalénien und Matrosen des 19. Jahrhunderts waren von demselben Wunsch getrieben: den Zahn eines toten Tieres nehmen und ihn eine Geschichte erzählen lassen.
Ich möchte ihnen auf meine Art darin folgen.
3
Rekorde
«In diesem Sommer lieber Wal oder lieber Sirene?»
An einer Mauer angebracht, im fahlen Märzlicht, als die schönen Tage noch fern scheinen, überrascht mich dieses Werbeplakat für ein Fitnesscenter, und ich bleibe einen Moment auf dem Bürgersteig stehen. Als Erstes fällt mir die Boshaftigkeit, die Grobheit, die Flegelhaftigkeit, die profitgierige, vulgäre Art an diesem drohenden Augenzwinkern auf, das sich an künftige Kunden richtet.