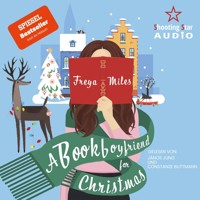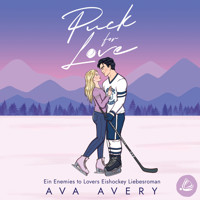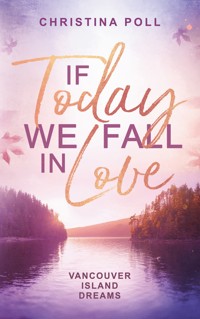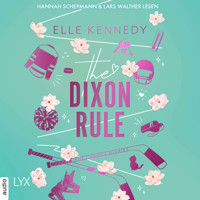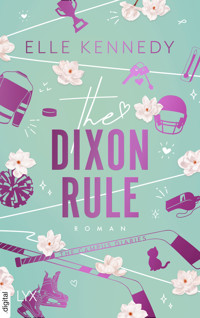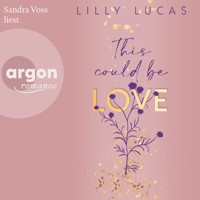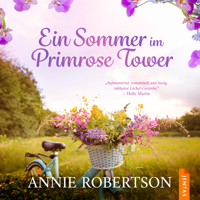17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Napoleon – bis heute die Verkörperung des großen Eroberers. Einer der Männer, die Bonaparte zu seiner historischen Größe verhalfen, war Joachim Murat, Sohn eines Gastwirtes aus einfachen Verhältnissen, Schwerenöter und Rebell. 1808 krönt Napoleon Murats schnellen Aufstieg und macht ihn zum König von Neapel. Doch Murat ist beinahe schon besessen von seinem Förderer, seine Bewunderung kennt keine Grenzen. Eine fatale Abhängigkeit, die schließlich sein Ende bedeutet. Aus der Zelle heraus lässt François Garde den gefangenen König Murat in den letzten Stunden sein bewegtes Leben erzählen.
Joachim Murat, geboren 1767 in der französischen Provinz, scheint untauglich für ein zivilisiertes Leben. Als er der Armee beitritt, verhelfen ihm seine Unangepasstheit und sein Übermut jedoch zu einer schnellen Karriere in den französischen Revolutionskriegen. Napoleon selbst wird auf den unermüdlichen Soldaten aufmerksam, schenkt ihm zunehmend Vertrauen und Verantwortung – bis hin zur buchstäblichen Krönung seiner Karriere: Napoleon macht Murat zum König von Neapel. Doch genauso rasch wie Napoleons Aufstieg vollzieht sich auch sein Fall – und mit ihm der seiner Anhänger: Murat wird zum Tode verurteilt. Aus seiner Zelle heraus lässt François Garde den gefangenen König in den letzten Stunden sein bewegtes Leben erzählen. Ein aufwühlender Roman, der historisches Wissen klug verwebt mit der großartig recherchierten Lebensgeschichte von Napoleons treuestem Diener und Kämpfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
François Garde
DER GEFANGENE KÖNIG
Roman
Aus dem Französischen von Thomas Schultz
C.H.Beck
Zum Buch
Napoleon – bis heute die Verkörperung des großen Eroberers. Doch wer verhalf dem selbsternannten Kaiser der Franzosen zu seiner historischen Größe? Einer der Männer, die an Bonapartes Seite durch Europa marschierten, war Joachim Murat.
Murat, Sohn eines Gastwirtes aus einfachen Verhältnissen, Schwerenöter und Rebell, scheint untauglich für ein zivilisiertes Leben. Als er der Armee beitritt, verhelfen ihm seine Unangepasstheit und sein Übermut jedoch zu einer schnellen Karriere in den französischen Revolutionskriegen. Napoleon selbst wird auf den unermüdlichen Soldaten aufmerksam, schenkt ihm zunehmend Vertrauen und Verantwortung – bis hin zur buchstäblichen Krönung seiner Karriere: Napoleon macht Murat zum König von Neapel. Doch Murat ist beinahe schon besessen von seinem Förderer, seine Bewunderung für Napoleon ist grenzenlos. Diese fatale Abhängigkeit kostet ihn schließlich das Leben. Denn genauso rasch wie Napoleons Aufstieg vollzieht sich auch sein Fall – und mit ihm der seiner Anhänger: Murat wird zum Tode verurteilt. Aus seiner Zelle heraus lässt François Garde den gefangenen König in den letzten Stunden sein bewegtes Leben erzählen. Ein aufwühlender Roman, der historisches Wissen klug verwebt mit der großartig recherchierten Lebensgeschichte von Napoleons treuestem Diener und Kämpfer.
Über den Autor
François Garde
wurde 1959 in Le Cannet, nahe der französischen Mittelmeerküste, geboren und war als hoher Regierungsbeamter u.a. auf Neukaledonien tätig. Bei C.H.Beck erschienen bisher «Was mit dem weißen Wilden geschah» (2014), das in Frankreich unter anderem mit dem Prix Goncourt für den ersten Roman ausgezeichnet wurde, und «Das Lachen der Wale. Eine ozeanische Reise» (2016).
Über den Übersetzer
Thomas Schultz
ist nach einem Literaturstudium an der Sorbonne Nouvelle, Paris IV und einem Filmstudium an der DFFB Berlin seit 1992 als Übersetzer aus dem Französischen tätig. Für C.H.Beck hat er mehrere Werke aus den Bereichen Essay, Belletristik und Lyrik ins Deutsche übertragen.
Inhalt
Erster Tag: 8. Oktober 1815
Der Reiter, 1774
Zweiter Tag: 9. Oktober 1815
Das Seminar, 1787
Die Kanonen, 1795
Italien, 1796
Orient, 1798
Die Verwundung, 1799
Triumphe, 1799
Dritter Tag: 10. Oktober 1815
Der Fuß und der Stiefel, 1800
Die Straße nach Neapel, 1801
Der Rausch der Macht, 1803
Feierlichkeiten, 1805
Die Krone, 1806
Vierter Tag: 11. Oktober 1815
Der Angriff, 1807
Die Falle, 1808
Die Regentschaft, 1808
Die Ruinen, 1811
Fünfter Tag: 12. Oktober 1815
Das Dekret, 1811
Der Ball, 1812
Russland, 1812
Niederlagen, 1812
Das Porträt, 1813
Der Verrat, 1814
Sechster Tag: 13. Oktober 1815
Der Vasall, 1814
Die Prinzessin von Wales, 1814
Der Untergang, 1815
Rückkehr in den Süden, 1815
Nachleben
Was man auch tut, man rekonstruiert das Denkmal immer auf die eigene persönliche Weise. Aber es ist schon viel wert, wenn man nur authentische Steine dafür verwendet.
Marguerite Yourcenar
Es gibt gewisse unbekannte Städte, in denen bisweilen so unerwartete, so aufsehenerregende und so schreckliche Katastrophen geschehen, dass ihr Name mit einem Schlag zu einem europäischen Namen wird und sie sich mitten in ihrem Jahrhundert zu einem jener historischen, von Gottes Hand für die Ewigkeit aufgestellten Marksteine erheben: Das ist das Los von Pizzo.
Alexandre Dumas
Erster Tag
8. Oktober 1815
Diese Geschichte erzählen heißt, zum Sturm auf die Festung der Zeit ansetzen und einen Waffenstillstand aushandeln.
Durch die Gitterstäbe betrachtet, sieht der Gefängnishof aus wie alle Gefängnishöfe: ein leerer Platz, der an hohe Mauern stößt. Der Sonnenschein, einzige Variable, kommt zu Besuch, enthüllt feinste Abstufungen von Farben und Texturen, unterteilt den Boden in gegensätzliche Zonen, klettert langsam wieder empor und geht. Die Dämmerung ist lang. Die Finsternis kommt spät, zögert, stürzt ein und reißt alles mit sich.
Noch am Morgen hatte er seine Gefolgsleute gezählt, als sie in dem winzigen Hafen von Pizzo gelandet waren. Sechsundvierzig! Er, der die gewaltigste Kavalleriedivision befehligt hatte, die jemals aufgestellt wurde, musste sich mit drei Offizieren und einem Dutzend Männern behelfen, die in der Großen Armee gedient hatten. Einem einäugigen und so gut wie stummen Malteser, einer Handvoll Korsen, die, egal unter welchem Vorwand, ihre Insel verlassen wollten, und einem Haufen überschwänglicher junger Burschen, abenteuerhungriger Neapolitaner und zwielichtiger Gestalten auf der Suche nach ihrem Glück. Unter ihnen wie viele Spione und von welcher Seite?
Einige Fischer, die ein Boot ausbesserten, tuschelten bei ihrer Ankunft und murrten, ohne es zu wagen sich zu rühren. Die kleine Truppe, nur mit Gewehren und Säbeln bewaffnet, stieg durch eine gewundene Gasse aufwärts Richtung Hauptplatz. Als sie vorbeizog, schrie eine Bäuerin erschrocken auf, ein Schankwirt schloss seinen Laden, ein Maultiertreiber grüßte kaum hörbar und ergriff die Flucht.
Am Brunnen, wo sich die beiden Hauptstraßen kreuzen, stillten die Männer ausgiebig ihren Durst, stellten ihre Gewehre ab und ließen sich mit einer nicht gerade militärischen Ungeniertheit im Schatten nieder. Einige Vorübergehende näherten sich neugierig. Hätte er besser seine Gardeoberstenjacke mit den funkelnden vergoldeten Epauletten tragen sollen, um mehr Eindruck auf sie zu machen? Einer seiner Offiziere wandte sich mit feierlichen Worten an sie und ermunterte sie zu rufen: «Hoch lebe der König Joachim!» Keiner wollte dieses Wagnis eingehen, und alle verschwanden.
Er spürte die Lächerlichkeit und zugleich die Gefahr seiner Lage. Nur nicht aufhören, sich zu bewegen!
«Hier bleiben wir nicht! Wir brauchen Pferde. Nehmen wir die Straße nach Neapel!»
Seine magere Schar machte sich auf, die Küste zu erklimmen, um so die Ebene zu erreichen, die sich über der Bucht erhob. Ein Carabiniere, der aus einer Seitengasse kam, machte unverzüglich kehrt.
Die Männer marschierten widerwillig und klagten über Hunger. Konnte man die Ortschaft ohne Verpflegung verlassen? Und wo zum Teufel würde man sich dann mit Lebensmitteln versorgen können in dieser armseligen Gegend? Wertvolle Minuten gingen mit Streitereien und Versprechungen verloren. Er musste einige Geldscheine aus der Tasche ziehen und vor ihren Augen hin und her schwenken, um sie zum Weitergehen zu bewegen.
Eine Gruppe von Bauern, die Mistgabeln und Rechen schwangen, kam die Straße an der Kirche herunter, man hörte sie schon von Weitem brüllen. Ohne zu zögern, weigerte er sich, den Befehl zu geben, auf sie zu schießen, wie es seine Offiziere forderten. Sein eigenes Volk niedermetzeln? Niemals. Vorrücken! Er setzte sich wieder in Bewegung und seine Gefolgschaft mit ihm. Eine weitere feindliche Gruppe erschien hinter einem Portal und stand seiner Nachhut unvermittelt Auge in Auge gegenüber. Salven von Flüchen und einige Hiebe wurden ausgetauscht. Schüsse ertönten, ein Soldat unteren Dienstgrades brach in einer Blutlache zusammen. Etwa zwanzig seiner Leute sahen sich umzingelt, legten die Waffen nieder und ergaben sich.
Dennoch zog er mit den ihm verbliebenen Männern weiter, gelangte an die letzten Häuser, setzte die Flucht an einem Olivenhain entlang fort. Seine Gegner waren ihm nicht gefolgt und schienen sich uneins zu sein über das Schicksal, das ihre Gefangenen verdienten.
Los! Mit weniger als dreißig Mann kann man ein Königreich erobern!
Ein vertrautes Geräusch erklang, Pferdehufe auf gestampftem Boden, irgendwo oberhalb von ihnen. An einer Biegung der Straße tauchte eine Reiterabteilung auf, etwa zehn Soldaten, die ihnen, Gewehr im Anschlag, den Weg versperrten. Ein Schuss wurde in die Luft abgefeuert. Die Gruppe, die ihnen zu Fuß gefolgt war, holte sie ein.
An der Spitze seiner letzten Getreuen wandte er sich um und sah aufs Meer, leer lag es da. Das Schiff, das sie abgesetzt hatte, war geflohen, entgegen den Anweisungen, die dem Kapitän Barbara ausdrücklich erteilt und zusätzlich zum verabredeten Preis mit einem Diamanten besiegelt worden waren. Es gab kein Zurück.
Ach, hätte er sich doch in diesem Moment auf Donner oder Osiris schwingen können, die beiden tapfersten Hengste seiner Stallungen, um im Kugelhagel zwischen den Baumstämmen davonzujagen! Welche Heldentaten, was für Schlachten hätten ihn dann auf seinen Thron zurückgebracht!
Erkannt, ausgepfiffen, vorwärtsgestoßen, beschimpft, geschlagen, von allen Seiten gepackt, mehr oder weniger durch die Soldaten vor der Menge geschützt, wurde er zur Festung geführt.
Er ist es nicht gewohnt, eingeschlossen zu sein. Sein an viel Bewegung und frische Luft gewöhnter Körper ist verwundert und ruht sich aus. Ja, er war immer frei, erstaunlich frei, selbst wenn er stets, ohne zu zögern, jedes Risiko auf sich genommen hat. Die Bußzelle des Priesterseminars von Toulouse, in der er mit siebzehn, achtzehn Jahren nach eigenem Dafürhalten zu oft, aber seltener, als er es verdient gehabt hätte, verweilte, wurde durch ein unerreichbares Fenster erhellt, das dazu anhielt, Gedanken und Gebete in die Höhe zu richten. Manchmal strich ein Vogel durch sein Blickfeld, und er hörte das Lärmen und Raunen der Stadt. Hier herrscht Stille, ausgenommen das Glockenläuten einer unsichtbaren Kirche, das die Stunden skandiert und zur abendlichen Versammlung der winzigen Garnison ruft. Seine Kerkermeister haben Befehl zu schweigen, was sie gar nicht erst in die Verlegenheit kommen lässt, entscheiden zu müssen, wie sie sich an ihn wenden sollen.
Selbstverständlich ist er in Einzelhaft. Man hat es nicht riskiert, ihn mit irgendjemandem zusammen einzusperren.
Es wird ohnehin nicht lange dauern. Er macht sich über sein Schicksal keinerlei Illusionen. Niemand ist daran interessiert, ihn zu retten – es sei denn, es geschieht ein Wunder, aber in Sachen Wunder hat er die Geduld des Herrn schon über die Maßen in Anspruch genommen. Auch dort oben hat er seinen Kredit verspielt. Ein Umsturz, ein Erdbeben, eine von seiner Frau ausgehobene Armee, ein aus weiter Ferne in letzter Minute erteilter Befehl? … Sich an solche Kindereien zu klammern, würde ihn nur schwächen. Nein, ihn erwartet der Tod, vielleicht sogar in diesem Hof, den die Sonne noch überflutet. Er wird sich ihm stellen.
Diese eiligst in der kleinen Festung eingerichtete Zelle bietet nur einen spartanischen Komfort. Gewiss, er hat den Luxus der Paläste in ganz Europa kennengelernt, doch dieses Bett aus Eisen, dieser Tisch und dieser Stuhl aus Holz, diese Waschgarnitur aus Steingut erinnern ihn an die vertraute Strenge der Kasernen, sie können ihn nicht kränken. Er hat schon auf Heubündeln in Ställen geschlafen, in Hütten ohne wärmendes Feuer, sogar in Straßengräben. Sein Schlaf ist unerschütterlich. Bisweilen lässt er von der Betrachtung des Hofes ab, legt sich hin, die Hände unter dem Nacken, und denkt an nichts.
Er hat keinerlei Entscheidung mehr zu treffen.
Von Zeit zu Zeit stellt sich Caroline – nie eine andere Frau – in seinen Gedanken ein, meist in Gestalt des jungen, dunkelhaarigen, lebhaften und nicht sehr hübschen Mädchens, das er einst in Mailand kennengelernt hatte. Er verdankt ihr seine glücklichsten Momente und seine schlimmsten Nöte. Er weiß noch immer nicht, ob er sie wirklich geliebt oder ob ihre Leidenschaft für ihn genügt hat, ihrer beider Leben zu erhellen. Seit zwanzig Jahren. Ein leises Lächeln liegt auf seinen Lippen.
Er trägt denselben grauen Reisegehrock wie bei seiner Verhaftung. Nichts mehr erinnert an die leuchtenden, allein für ihn in den ausgesuchtesten Samt- und Seidenstoffen angefertigten Uniformen, gespickt mit Posamentenverschlüssen, Soutachen, Bändern und Spitzen unter einem fahlgelben, mit Kupfer- und Silberornamenten punzierten Lederharnisch, und immer von einem ausladenden weißen Federbusch überragt, in dem eine mehr als ein Meter lange Straußenfeder nicht fehlen durfte. Mit diesem Helmbusch und hochgewachsen, wie er war, überragte er auf dem prunkvollen Rotfuchs, den ihm sein Schwager geschenkt hatte, alle seine Offiziere. Im Kampf wies ein nicht weniger stolzer und auffälliger Helm ihn als deutliches Ziel dem feindlichen Feuer aus. Die offiziellen Gemälde überboten einander mit prächtigen Farben und ließen keine Einzelheit seiner spektakulären Paradeuniformen aus. Er weiß sehr wohl, dass man am Hof insgeheim über seine Extravaganzen spottete, aber es war ihm und ist ihm auch jetzt noch einerlei. Glaubte man wirklich, dass allein der Zierrat ihm Ansehen verlieh? Selbst in dieser gewöhnlichen Uniform bewahrt er seine stattliche Erscheinung und imponiert damit den Wärtern.
Sie haben nicht daran gedacht, ihm das zu nehmen, was am meisten für ihn zählt: dieses segensreiche, warme, vergoldete, unerschöpfliche Licht, das er in den Ländern des Südens entdeckt hat. Ein finsterer Kerker, ja, der wäre ihm unerträglich gewesen! Alles andere ist unwichtig, solange er im Lauf der Stunden von dieser vom Himmel gefallenen Fülle zehren kann.
Im Grunde ist sein Leben unerwartet in zwei Teile zerfallen: das Leben in den Ländern der Kälte, an die er sich nie gewöhnen konnte, trotz wolfspelzgefütterter Mäntel und gewaltiger Kamine; und das in den Ländern des Mittelmeers, in denen er sich dem Glück hinzugeben hoffte.
Wenn er schon in diesem Herbst sterben muss, dann wenigstens unter gleißender Sonne, in dieser noch von Wärme zitternden Luft, in dieser Leichtigkeit, die alle Königreiche wert ist.
*
Der Reiter, 1774
Das Kind weiß, dass es den Stall nicht allein betreten darf. Vergebens hat es seinen großen Bruder gebeten, ihn mitzunehmen, um das Pferd zu sehen, das gerade eingetroffen ist und das der Knecht schon mit einem Strohwisch abgerieben und getränkt hat. Kein Maultier, keine sanfte Stute, sondern ein Rennpferd, schreckhaft, mit feinen Ohren, die noch beben vom ganztägigen Galopp.
«Du wirst dir Schelte einhandeln, Joachim! Der Herr, der bei uns schläft, ist ein Gesandter des Intendanten mit einem geheimen Auftrag für den König …»
Natürlich spinnt sich Guillaume aus den Tuscheleien der Erwachsenen einiges zusammen. Dennoch werden diese wohlklingenden Worte wahr, selbst für ihn, sobald er es wagt, sie auszusprechen. Sein kleiner Bruder hört weiter gebannt zu, noch entschlossener als zuvor. Nie wieder wird er Gelegenheit haben, solch ein Vollblutpferd aus der Nähe zu sehen. Und so geht er hinten um die Scheune herum, schlüpft durch die einen Spalt breit offen stehende Tür und nähert sich dem Tier. Der Falbe erholt sich von einem langen Ritt.
«Er ist schön, nicht wahr? Er heißt Donner …»
Das Klirren der Sporen lässt ihn ebenso auffahren wie diese Bemerkung, in der er weder den Akzent des Quercy noch den von Toulouse erkennt. Wie auf frischer Tat ertappt, weicht er zurück und senkt den Kopf. Er hatte bemerkt, dass der Vater sich mit besonderer Ehrerbietung an diesen elegant gekleideten Reiter wandte und ihm das beste Zimmer des Gasthofs gab, bevor er ihm ein großzügiges Feuer im Kamin anzündete, damit er sich trocknen und es sich bequem machen konnte, ein Glas Wein in der einen Hand und eine weiße Porzellanpfeife in der anderen. Der junge, schlanke, wortkarge Mann mit dem schmalen Schnurrbart und einem mit einer Feder geschmückten Filzhut schien die ihm übermäßig entgegengebrachte Aufmerksamkeit ganz normal zu finden.
«Ich fresse dich nicht! Und er dich auch nicht … Du darfst ihn streicheln.»
Der Knabe kommt näher, aber traut sich nicht so nahe heran, dass er das Tier berühren kann.
Der Reiter lächelt und hebt ihn auf den Arm. Der Junge spürt die Weichheit seines Wamses aus nachtblauem, mit goldenen Blumen durchwirktem Samt, die Zartheit der Spitze an den Manschetten, das leise Rascheln des seidenen Hemdes, den leichten Duft nach Moschus. Sachte führt ihn der Mann, sodass er seine flache Hand auf den Hals des Pferdes legen kann, um sie bis zu den Ohren hinaufwandern und zur Kruppe wieder hinabgleiten zu lassen. Der eben noch schüchterne Knabe strahlt schon bald, nach und nach begnügt er sich nicht mehr mit einem einfachen Antippen, er fasst fester zu, die ausgestreckte Hand in das dichte, noch schweißnass glänzende Fell vergraben, und spürt so die Wärme und Kraft der ruhenden Muskeln.
All seinen Mut zusammennehmend, bringt er mit einem Flüstern hervor:
«Sind Sie … sind Sie wirklich der Gesandte des Königs?»
«Holla, kleiner Mann, du bist aber neugierig! Sagen wir, ich bin ein Offizier Seiner Majestät.»
Das Pferd dreht den Kopf. Seine Augen begegnen denen des Knaben und wenden sich nicht ab. Nach welchem fernen Land, nach welchen sagenhaften Palästen sehnen sie sich noch immer zurück?
Die Stimme des Vaters ertönt aus dem Halbdunkel:
«Entschuldigen Sie, mein Herr. Dabei habe ich ihm hundertmal gesagt, er soll die Kunden nicht belästigen.»
«Er stört mich nicht. Ich habe einen Jungen im gleichen Alter …»
«Los, ab in die Küche!»
Der Reiter behält das Kind auf dem Arm.
«Es könnte sein, Herr Wirt, dass Sie mich in diesem Moment mehr stören als er.»
«Der Junge …»
«Lassen Sie uns allein!»
Derart schroff hinauskomplimentiert, weicht der Vater zurück, murmelt etwas und verlässt, vor sich hin schimpfend, durchs Stroh schlurfend, den Stall. Als er fort ist, setzt der Reiter den Knaben auf das Pferd und zerzaust ihm das Haar.
«Bei vollem Tempo werde ich in sechs Tagen in Versailles sein.»
«Werden Sie unsere neue Königin sehen?»
«Das ist gut möglich.»
«Sie heißt Marie-Antoinette, und ich mag sie sehr.»
«Ich werde es ihr sagen, sie wird beglückt sein, das zu vernehmen.»
Das Kind glaubt, was es hört, und freut sich darüber. Die Naivität rührt den Reiter.
«Eines Tages wirst vielleicht auch du die Königin sehen.»
Am Abend bricht ein heftiges Unwetter los, Donnerschläge grollen, hallen, rollen über die Kalksteinplateaus.
Am Morgen war der Reiter schon aufgebrochen.
*
Seine linke Schulter schmerzt noch. Im Verlauf des Scharmützels, dem allein das energische Eingreifen der Carabinieri von Pizzo ein Ende gesetzt hatte, verlor er seinen Hut und erhielt einen heftigen Schlag mit einem Stock oder einem Knüppel. Wahrscheinlich hatte sein Angreifer – ein hagerer Mann mit hängendem Schnurrbart, hassverzerrtem Gesicht und drohend ausgestrecktem Arm, der ihm auf dem Weg zur Festung im Namen seines Sohnes Beschimpfungen zubrüllte – es auf seinen Kopf abgesehen. Damals hatten seine Soldaten, mit dem Ziel, die Sicherheit auf den Straßen Kalabriens herzustellen, auf seinen Befehl hin Treibjagden auf Räuberbanden veranstaltet, als gälte es, Wolfsrudel auszurotten, wobei er es in Kauf genommen hatte, dass einige der Gejagten kurzerhand an wichtigen Wegekreuzungen aufgeknüpft wurden. Hat dieser Bauer, der es wagte, ihn zu verfluchen, nicht begriffen, dass dies der Preis ist, den man bezahlen muss, um endlich ein modernes Land zu werden? Im Namen welcher Revolten, auf der Grundlage welch würdeloser Illusionen hat einer dieser Hungerleider es gewagt, die Hand gegen seinen König zu erheben?
Denn er ist einer von ihnen, das weiß er, und hat nie aufgehört, einer von ihnen zu sein. Arm geboren und arm wie Hiob bis zu seiner Hochzeit. Danach mit Ehren und Gold überhäuft, aber ohne jemals seine Herkunft aus den Augen zu verlieren. Ganz und gar König und doch aus dem Volk.
Und es ist das Volk, das ihn an diesem verhängnisvollen Tag im Stich lässt und ihn verrät! Dabei war alles, was er seit Beginn seiner Regentschaft getan hat, darauf gerichtet, dem Volk zu helfen, es aufzuklären, seine Kinder zu erziehen, es von seinen Ketten zu befreien, ihm ein Ideal anzubieten. Und nun wenden sich diese Lastträger, Fischer, Müller, Bauern, Matrosen gegen ihn und glauben, sich auf diese Weise für die Härte ihres Lebens zu rächen. Dabei wenden sie sich gegen sich selber, rächen sich an sich selbst! Sicher, in einigen Jahren werden sie es begreifen, und die Träume, die er ihnen angeboten hat, werden sich am Ende erfüllen.
Er zweifelt nicht an der Zukunft, er bedauert nur, nicht mehr an ihr teilhaben zu können. Diese Unseligen, die ihn verhaftet haben, bemerken nichts von den großen Bewegungen, die Europa erschüttern, und er nimmt ihnen ihre Blindheit nicht übel.
Sein Leben hätte sich so abspielen sollen wie das ihre, im Schatten, in der Ungewissheit des nächsten Tages. Durch welche Zufälle, durch welche Wunder war er zu diesem Soldaten mit den strahlenden Uniformen geworden, der ganz Europa durchstreifte? Ein Faustschlag, ein nächtlicher Ritt durch Paris, der verliebte Blick eines ganz jungen Mädchens, sein durch das Glück bei den Kämpfen gestärkter Mut, insgesamt ein guter Stern, den keine Wahrsagerin sich jemals vorzustellen gewagt hätte …
Wie töricht, diese Dörfler! Indem sie einen der Ihren in Eisen legen, zerstören sie für lange Zeit all ihre Hoffnungen.
Sein Vermögen wurde beschlagnahmt. Seine Ehre mit Füßen getreten. Seine Werke und seine Vorhaben zunichte gemacht. Was er dem Volk gegeben hat, wird ihm wieder genommen werden. Was wird er seiner Familie hinterlassen? Caroline und ihre vier Kinder werden umherirren müssen, geächtet, verbannt überall in Europa, heimatlos und schutzlos. Von ihm wird nichts bleiben, bestenfalls eine strahlende Legende. Und dieser Name, den seine Nachfahren, so hofft er, wie eine Standarte tragen werden, nicht als eine Bürde.
Einige Monate lang, unter der Schreckensherrschaft, hatte er sich von ihm losgesagt, indem er einen Buchstaben änderte und sich Marat nennen ließ – eine im Übrigen völlig illusorische Schutzmaßnahme. Im Laufe der Jahre hatte er oft eigens für ihn geschaffene Titel angehäuft, mit einem maßlosen Appetit, gleich unterzeichneten und gegengezeichneten Urkunden seines Schicksals. Doch nichts konnte diesen schlichten Namen ersetzen, den er von seinen Vorfahren empfangen hatte und der wahrhaftig erst mit ihm begann.
Er erwähnt selten seinen Vornamen, Joachim, den er seinem Patenonkel verdankt. Was hat er gemein mit dem Vater der Jungfrau Maria, der immer als ein kränklicher Greis dargestellt wird? Ein Vorname dient nur dazu, zwischen den Brüdern und den Vettern zu unterscheiden, aber der Glanz seines Ruhms und ihr Schattendasein lassen gar keine Verwechslung zu.
Sicher, er hat unter dem aufgeblähten und etwas lächerlichen Namen Gioacchino Napoleone regiert: ein zweiter Vorname, aufgedrängt als ein Zeichen der Treuepflicht, eine ein wenig zu kurz geratene Leine. In seiner privaten Korrespondenz unterschrieb er lieber mit einem einfachen M, einem flüchtigen Namenszeichen unten auf der Seite.
Keinem Italiener, Ägypter, Deutschen, Polen oder Spanier ist es jemals gelungen, das U der ersten Silbe korrekt auszusprechen und das T am Ende stumm zu lassen. Die Russen rollten zudem das R wie einen überstürzten Trommelwirbel. Er hat sich an diese verschiedenen Akzente gewöhnt, als wären es Zeichen des Angenommenseins.
Und als die Kosaken, die sich untereinander die Hoffnung und Ehre streitig machten, ihn gefangen zu nehmen, sich brüllend auf die Nachhut oder die Flanken der Großen Armee stürzten, ertönten diese beiden Silben wie ein Jagdruf in der unermesslichen Weite der verschneiten Ebenen. Verzerrt durch die skythischen Kehlen und die Geschwindigkeit ihres Rittes, schienen sie auch die Manen eines anderen großen Kriegers, des Sultans von Konstantinopel, anzurufen.
Er ist mit einem dieser unbedeutenden Namen geboren, wie sie in jedem Kirchenregister und in keinem Geschichtsbuch zu finden sind. In seiner Jugend zählten nur die mächtigen Familien, etwa ihre entfernten und illustren Beschützer, die Talleyrand-Périgord. Dieses Geschlecht existierte seit Menschengedenken und schien auf ewig fortzudauern.
Und dann wurde der Adel von der Revolution hinweggefegt und durch Männer ersetzt, die aus dem Nichts auftauchten: Wer hatte bis dahin von einem Berthier oder einem Ney, von einem Oudinot oder einem Lannes gehört?
Ja, er ist einer der glänzendsten Hoffnungsträger dieser Generation, die stolz darauf ist, in ihrer Wiege nichts vorgefunden zu haben. Diejenigen, die ihn wegen des Berufes seines Vaters verhöhnen, begreifen nicht, dass sie ihm im Gegenteil eine Ehre erweisen. Sohn eines Gastwirts und König. Beides zugleich und beides voller Stolz. Welches Schicksal in der Welt könnte sich mit seinem messen?
In der Schule lernte er, was sein Name auf Lateinisch bedeutet: ein von Mauern eingefriedeter Raum. Er hat gewaltige Festungen in Trümmer gelegt, mit jahrhundertealten Gepflogenheiten gebrochen, Grenzen neu gezogen, Völker befreit. Sein Leben lang hat er Hindernisse niedergerissen. Und jetzt halten ihn die Mauern dieser einfachen Festung gefangen.
Im Grunde lässt sich sein Leben auf diese beiden Silben reduzieren, denen keinerlei Bedeutung zukam und die seit fünfzehn Jahren ganz Europa noch immer mit Verwunderung nachspricht: Murat.
Zweiter Tag
9. Oktober 1815
Dieses Leben erzählen heißt, gewaltsam in die Werkstatt des Historikers eindringen und ungeniert mit seinen Werkzeugen spielen.
Die Riegel machen ein dumpfes Geräusch, das die Stille des Zimmers bricht. Ein Oberleutnant tritt ein, gefolgt von zwei Soldaten. Der junge Mann, schlaksig, schlecht genährt, unrasiert, Ringe unter den Augen, scheint überlastet, ja erdrückt zu sein von dem Auftrag, der ihm obliegt. Er sieht Murat sichtlich verängstigt an, räuspert sich und stammelt:
«Ich bin der Befehlshaber der Garnison Pizzo. Ich muss mich Ihrer Identität versichern. Sie sind Joachim Murat, geboren am 25. März 1767 in Laba… Labastide-Fortunière in Frankreich?»
«Natürlich. Dachtest du, du hättest es mit einem Hochstapler zu tun? Ich frage mich, wer heutzutage wohl so verrückt wäre, sich meine Rolle anzueignen.»
«Auf Befehl des Königs verbleiben Sie in dieser Festung in Einzelhaft bis zu Ihrer Verurteilung.»
Der Oberleutnant betet diese Formel in aller Eile herunter wie ein Schüler seine Lektion oder seinen Katechismus, ohne sich um die Bedeutung der Wörter zu kümmern.
Es wäre amüsant, ihm mit einer Salve von Flüchen gegen Ferdinand von Bourbon zu antworten, mit so vulgären Beleidigungen, dass sie in keinem Protokoll aufgeführt werden könnten. Aber die Zeit des Zornes ist vorbei. Er beherrscht sich.
Sein Schweigen verstört den Offizier, der immer unsicherer wird.
Murat bemerkt sein Zögern, er ahnt, er könnte ihn in seinen Bann ziehen, indem er seine stattliche Erscheinung und seinen Elan zum Einsatz bringt. Wer, wenn nicht er, verstünde es, die richtigen Worte zu finden, um die Fantasie eines jungen mittel- und zukunftslosen Soldaten zu entflammen? Er hat ganze Regimenter mit seiner Begeisterung in Wallung gebracht, es sollte ihm nicht schwerfallen, diesen zaghaften Burschen für sich zu gewinnen. Wenn er abwechselnd mit Komplimenten, Versprechen von Beförderungen, Auszeichnungen und Ländereien und der Drohung, eine imaginäre, aus Korsika herbeigeholte Flotte landen zu lassen, auf ihn einredete, könnte er ihn wahrscheinlich herumkriegen, sich auf seine Seite zu schlagen. Mit den zwanzig Mann der Garnison und seinen aus den Kerkern befreiten Anhängern würde er seine spärlichen Truppen neu aufstellen. Aber dann?
Auf den Überraschungseffekt kann er nicht mehr zählen. Kein Schiff erwartet sie im Hafen, und überhaupt wird keine einzige Insel im ganzen Mittelmeer sie aufnehmen wollen. Zu Lande wie eine Räuberbande umherirrend, würden sie sich bestenfalls ein paar Tage in den Hügeln Kalabriens halten können, bevor die von Ferdinand zu ihrer Verfolgung ausgesandten und von den Bauern unterrichteten Truppen sie umzingelten. In weniger als einer Woche würde dieser Oberleutnant im Kampf getötet oder wegen Hochverrats gehängt werden.
Murat macht ihm kein Angebot und rettet ihm so das Leben. In gleichgültigem Ton lässt er nur die Bemerkung fallen:
«Lass mir heißes Wasser und ein Handtuch bringen. Und eine Decke, die Nächte sind frisch im Oktober.»
Der Offizier – was weiß er schon von Kälte, dieser Grünschnabel, der nie am eigenen Leib Russland im Dezember erfahren hat? – nimmt zögerlich Habachtstellung ein, als er diesen Befehl erhält, dann verlässt er eilig den Raum.
Das Seminar, 1787
«… Feigling, Heuchler!»
«Pfff … So antwortet ein Trottel!»
Die Faust schnellt vor und trifft den Unverschämten ins Gesicht, er strauchelt rückwärts. Während er noch die Hände an seine bluttriefende Nase führt, streckt ihn ein Haken gegen die Schläfe zu Boden. Drei andere Seminaristen stellen sich zwischen die Streitenden und leisten dann ihrem am Boden liegenden Konfrater Beistand, der unter Schluchzen mal stöhnt, mal droht.
Joachim Murat wendet sich von ihnen ab, rempelt einen herbeieilenden Priester an, rennt durch eine Tür nach draußen. Der winterlich kalte Nordwind hat sich gelegt. Er streift aufs Geratewohl durch die kalten und verlassenen Straßen von Toulouse. Ein Mädchen lächelt ihm zu, senkt dann den Blick. Ein Hund bellt klagend in der Ferne. Eine ganze Weile zittert er unter dem Ansturm vieler Gefühle.
Bis dahin ist er vor allem durch seinen hohen Wuchs und seine elegante Erscheinung aufgefallen. Seine Kameraden erkennen ihn als ihren natürlichen Anführer an, vor allem wegen der üblen Streiche, der verbotenen Ausflüge in Nachtlokale, der aufrührerischen Diskussionen. Es hagelt Strafen, sie ändern ihn nicht.
Diese neue Schlägerei – gewaltsamer als die vorangegangenen Auseinandersetzungen, die seinen Ruf begründet haben – wird ihm mit Sicherheit einen Monat Bestrafungen und Bußen einbringen. Aber was soll’s, er hat ja noch gar nicht sein endgültiges Gelübde abgelegt. Im Moment heißt es: leben!
Das berittene Jägerregiment der Ardennen, das gerade in Toulouse Station macht, sorgt seit einer Woche mit dem Glanz seiner Uniformen für Aufsehen. Seine jetzt fester gewordenen Schritte führen ihn zu einem Nachtlokal, ein Werbeunteroffizier scheint interessiert an dem großen Kerl, ein Krug Wein, ein Handschlag, eine Unterschrift. Am 23. Februar 1787, kurz vor seinem zwanzigsten Geburtstag, verpflichtet er sich ohne die Erlaubnis seines Vaters als einfacher Soldat.
Das Soldatenleben in Carcassonne, dann in Sélestat, bietet ihm unverhoffte Freiheiten. Endlich kann er sich die Haare wachsen lassen und trägt nun elegante dunkle Locken, die ihm bis auf die Schultern fallen. Mit seinen großen blauen Augen und der Erscheinung eines antiken Helden findet er bei den Frauen großes Gefallen. Sein Bildungsstand ermöglicht ihm die Beförderung zum Unteroffizier. Bewegung an der frischen Luft bekommt ihm besser als hohe Mauern.
Aber er ist des Garnisonslebens bald überdrüssig und verbirgt weder seine Enttäuschung noch seine fortschrittlichen Ideen. Die Strafe folgt auf dem Fuß. Am Ende des Jahres wird er wegen disziplinlosen Verhaltens entlassen. Er wird ebenso wenig Hauptfeldwebel wie Pfarrer und kehrt nach Hause zu seinen Eltern zurück, ohne Pläne, ohne Gewissheiten, ohne Status, mittellos. Während seine älteren Brüder nach und nach die Bewirtschaftung des Gasthofs und der Felder übernehmen, ist für ihn dort kein Platz.
Mit einundzwanzig Jahren hat er seine Chancen vertan, seine Familie enttäuscht, die ihn als Versager, als Nichtsnutz betrachtet. Da er von etwas leben muss, findet er eine Anstellung als Gehilfe bei einem Kolonialwarenhändler in Saint-Céré. Ohne jede Aussicht für die Zukunft beißt er die Zähne zusammen, entlädt Schubkarren, wiegt Kaffee und Zucker, fegt, beliefert Kunden, führt recht und schlecht die Bücher. Und wenn er ein etwas zu reges Interesse für die jüngste Tochter eines reichen Bauern aus der Gegend zeigt, bestellt dieser ihn zu sich und gibt ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er seine Tochter niemals einem Tagelöhner geben wird.
Von seinem Hinterzimmer aus verfolgt er staunend die unerhörten Nachrichten aus der Hauptstadt. Der König hat endlich die Generalstände einberufen. Der niedere Klerus und ein Teil des Adels haben sich dem Dritten Stand angeschlossen und sich zur Nationalversammlung konstituiert. Das Volk hat die Bastille erstürmt.
Ihm fallen die Debatten in den Cafés von Toulouse ein, in denen Lobeshymnen auf Voltaire, Diderot, Rousseau und die amerikanische Revolution angestimmt wurden. Anfang 1790 schwingt er sich auf sein Pferd und galoppiert bis nach Cahors. Seine Bekannten aus der Schulzeit – Kameraden, Repetitoren, Lehrer – sind in heller Aufregung. Das Departement Lot ist gerade gegründet worden und muss sich eine Nationalgarde zulegen. Dank der Unterstützung aus seiner Familie und gezielt beschönigter Dienstzeugnisse lässt er sich dort hineinwählen.
Im Kreis einer Delegation dieser bunt zusammengewürfelten und enthusiastischen Truppe begibt er sich nach Paris, um am 14. Juli 1790 am Föderationsfest teilzunehmen. Auf dem Marsfeld, als einfacher Statist in der die Nation repräsentierenden Menge, sieht er in der Ferne Lafayette auf seinem Schimmel, die königliche Familie, Talleyrand, der die Messe zelebriert, Ludwig XVI., der feierlich den Eid auf die Verfassung schwört. Während ihn bis dahin keine einzige religiöse Zeremonie mit ihrem Prunk je wirklich bewegt hatte, rührt ihn das grandiose Schauspiel, das sich vor ihm abspielt, zu Tränen. Als einfacher Delegierter inmitten Zehntausender anderer gewinnt er an diesem Tag die berauschende Gewissheit, Geschichte zu schreiben. Die gegenseitige Bekundung guter Absichten seitens des Herrschers und des Volkes trifft ihn wie eine Offenbarung. Die Macht enthüllt sich hier in ihrer den Blicken für gewöhnlich vorenthaltenen ganzen Wahrheit, und er, der kleine Provinzler, darf sich ihr nähern. Diese Faszination verfolgt ihn sein Leben lang.
Indem er die allgemeine Verwirrung nutzt und seine Sympathie für die neuen Ideen herausstellt, gelingen ihm die Wiederaufnahme in sein ehemaliges Regiment, das man in 23. berittenes Jägerregiment umbenannt hat, sowie die Beförderung zum Oberleutnant.
Sehr schnell und mit Entsetzen bemerkt er den vernachlässigten Zustand der Truppen. Die Desertionen mehren sich, der Ungehorsam nimmt zu, der Sold wird nicht ausgezahlt, es fehlt an Ausrüstung und manchmal an Verpflegung. Tatsächliche oder eingebildete Denunzierungen und Komplotte beschäftigen alle Köpfe. Die Befehle sind widersprüchlich, und niemand weiß, wer wirklich befiehlt. Er ist nicht überrascht, dass die gegnerischen Armeen vorrücken, ohne auf großen Widerstand zu stoßen. Erreichen sie Paris, wird die Revolution, an die er trotz allem glaubt, hinweggefegt und die alte Ordnung wiederhergestellt. Vor seinen Augen gehen politische Verwirrung und militärisches Versagen Hand in Hand.
Seine Einheit bewegt sich auf die Grenzen im Norden zu, und während dieses Marsches erfährt er, dass die Nationalversammlung verkündet hat, das Vaterland sei in Gefahr. Bei seinem ersten Scharmützel bemerkt er, wie ihn ein unbekannter Schauder ergreift, ein Verlangen vorzupreschen, eine Art Freude daran, die Kugeln um die Ohren pfeifen zu hören. Sein Mut und sein Elan im Gefecht rufen Bewunderung bei seinen Kameraden hervor.
Das Wesentliche spielt sich im Osten ab, wo sich die schlechten Nachrichten häufen und wo er zu seiner Verzweiflung nicht sein kann.
Die Republik richtet sich ein und zeigt ein unbarmherziges Antlitz. Die Gefängnisse füllen sich unablässig, und man verlässt sie nur zum Tode verurteilt. Sein bester Freund, ein von allen geschätzter Hauptmann, verschwindet eines Morgens.
Er wird zum Betrachter ungeheurer Ereignisse, sieht, wie die alte Welt sich auflöst und auf einen Abgrund zusteuert. Die Monarchie, der Glaube, die Stände, die großen Besitztümer, die Ehe, der Kalender, alles, was unverrückbar schien, wankt, stürzt in sich zusammen, versinkt in einer sinn- und aussichtslosen Verwirrung. Selbst die am Vorabend noch unbekannten und einen Tag lang gefeierten Tribunen werden am folgenden Tag abgeschlachtet. Wem, welchen Ideen kann er noch Glauben schenken? Inmitten der Trümmer dieser Welt, die vor seinen Augen zusammenbricht, erkennt er nichts, das in die Zukunft weist. Die ausführlichen Debatten und das Verlangen nach Glück haben zur Tyrannei und zur Guillotine geführt.
Noch benommen von diesen Wirren hat er überlebt und weiß nicht, warum er verschont geblieben ist. Aus der von Angst und Blut gezeichneten Zeit nimmt er vage die Gewissheit mit, dass ein starker Anführer und eine stabile Regierung unentbehrlich sind.
Ja, Strenge und Disziplin müssen sein. Diese Tugenden haben ihm ihre Wirksamkeit in Kirche und Armee bewiesen. Sie müssen in die Tat umgesetzt werden, um das Land zu retten: Gehorsam oder das Chaos.
*
Die Einsamkeit in seiner Zelle: eine Unbekannte, die er jetzt entdeckt und zu bezwingen sucht.
In seiner Familie, in der Armee, am Hof war er immer von Verwandten, Kameraden, Bittstellern, Widersachern, Untergebenen oder Verschwörern umgeben. Sein Leben lang ist er geritten, hat Befehlen gehorcht, Komplotte geschmiedet, hat gekämpft, angeführt, regiert, immer inmitten anderer. Wie sehr hat er ihn in all den Jahren genossen, diesen unaufhörlichen Trubel um ihn herum, der seinen Aufstieg begleitete! Und bis gestern befehligte er noch sechsundvierzig Mann …
Er lässt seine Gedanken einen Moment lang schweifen und muss an die denken, die er zu diesem letzten Abenteuer verleitet hat. Die meisten von ihnen hatten sich ihm erst eine Woche, bevor sie in See stachen, angeschlossen. Einige sind schon tot, die anderen warten gefesselt darauf zu erfahren, welches Schicksal ihnen beschieden ist. Als sie ihm folgten, wussten sie sehr wohl, dass ihnen ebenso gut Scheitern wie Erfolg beschert sein konnte. Für sie wie für ihn war es ein Spiel. Die Würfel sind gefallen. Wie er haben sie verloren. Er hat niemanden gezwungen teilzunehmen. Schnell vergisst er die Gesichter seiner letzten Anhänger, nachdem er nichts mehr für sie tun kann.
Sind sie in den benachbarten Zellen inhaftiert oder irgendwo in einem Verlies? Kein einziger Laut von draußen erlaubt ihm, das zu erraten. Vermutlich ist er der einzige Insasse auf dieser Etage.
Da er ganz allein ist, kann er mit den Wänden sprechen, kann schreien, brüllen, singen. Keiner hört ihn, jedenfalls wird niemand kommen, ihn zu unterbrechen. Kein Blick überprüft, ob er steht oder liegt, wie seine Laune ist, ob jetzt der geeignete Augenblick ist, ihn um etwas zu bitten. Kein Höfling, kein Spion beobachtet ihn.
Er genießt in diesem Gefangensein eine unerwartete Form der Freiheit.
*
Die Kanonen, 1795
Im April 1793 ist er Hauptmann, im Sommer bereits Eskadronchef. Aber zu seinem großen Verdruss findet er außer bei einigen Zusammenstößen, die jeder Bedeutung, ja jeder Gefahr entbehren, keine Gelegenheit, sich in der Verteidigung der Grenzen hervorzutun. All die Belagerungen, die Märsche kreuz und quer durch Flandern, die kurzen und glanzlosen Gefechte nehmen ihn sehr mit, während er nur von ruhmreichen Taten auf dem Schlachtfeld träumt. Und der Sold, ohnehin unregelmäßig ausgezahlt, reicht nicht aus, seinen doch eher bescheidenen Lebenswandel zu bestreiten. Seine Gläubiger gewähren ihm immer unwilliger Kredit.
An einem Herbsttag führt ihn ein langer einsamer Ritt vom Biwak durch die Felder bis auf den Kamm einer hohen Düne, die das Gelände im Westen begrenzt. Von dort oben sieht er unter einem Himmel voller Schäfchenwolken, im unablässig stürmenden kalten Wind, zum ersten Mal in seinem Leben das Meer. Diese von mächtigen unsichtbaren Bewegungen durchlaufene graue Weite, die mit Schaum umsäumt über einen langen haltlosen Strand hereinbricht, ruft in ihm ein dumpfes Gefühl von Unwohlsein hervor. Nichts hält den Blick fest außer einem am Horizont kaum erkennbaren Fischerboot, nichts in dieser unterschiedslosen Unendlichkeit spricht zu ihm.
Weder die offenen, einladenden Hochebenen aus seiner Kindheit noch der Lot, der das befestigte Cahors durchfließt, noch die Hügel und Weinberge des Languedoc noch die dichten Wälder Lothringens noch die engen und verstopften Straßen von Paris haben ihn derart überrascht und aus der Fassung gebracht. Eine Hälfte der Landschaft wogt, schillert, weicht dem Blick aus, setzt sich über jedes Maß und jede Erinnerung hinweg. Seine Stute schnaubt. Dieses prachtvolle und nasse Licht, das er noch nie und nirgends gesehen hat, fasziniert und beunruhigt ihn. Dieses flüssige Element ist nicht das seine.
Eine Woche zuvor hatte er beim Verlassen eines Wäldchens mit einem Schuss aus seinem Karabiner einen feindlichen Aufklärer niedergestreckt, der nicht so rasch auf ihn zu feuern vermochte. Er konnte genau sehen, wie seinem Opfer die Waffe entglitt, wie der Mann sich an die Kehle fasste, ihn völlig überrascht ansah, dann vom Sattel stürzte und leblos liegen blieb. Dieser blonde Kavallerist ist der erste Gegner, den er eindeutig von seiner Hand sterben sieht. Der Beruf will es so. Er hat nichts Besonderes dabei empfunden, außer flüchtigem Mitleid.
Warum erzeugt der Anblick des Meeres in ihm eine gewisse Angst, während ihn das Los dieses unbekannten Ulanen gleichgültig lässt?
Am 13. Vendémiaire des Jahres IV stehen in ganz Paris die Zeichen auf einen unmittelbar bevorstehenden Gewaltstreich der Royalisten gegen das neue Regime. Intuitiv begibt er sich eilends zum Kriegsministerium. Trotz seiner Gesuche, in den Norden oder Osten zurückkehren zu dürfen, um zu kämpfen, versieht er seit Monaten in einem dunklen Büro, das er mit drei Kollegen teilt, gelangweilt Berichte über Einquartierungen mit Anmerkungen. Für so undankbare Aufgaben hat er sich nicht erneut verpflichtet.