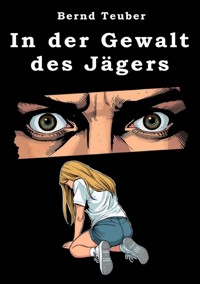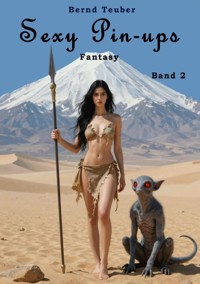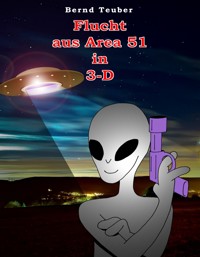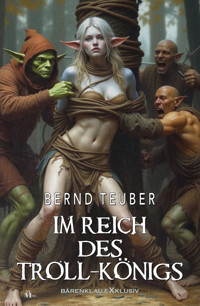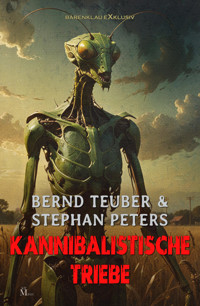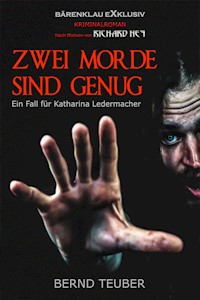3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Privatdetektivin Katharina Ledermacher wird von ihrem ehemaligen Kollegen Manfred Zobel um Hilfe gebeten. Sein Stiefsohn Fabian Joswig ist verschwunden. Bei ihren Nachforschungen stößt Katharina auf eine Mauer des Schweigens. Niemand weiß angeblich, wo sich der junge Mann aufhält.
Seine Leiche wird schließlich in der Spree gefunden. Starb Fabian durch einen Unfall?
Oder wurde er ermordet?
Die Spur führt zu einem mysteriösen Import-Export-Geschäft und Katharina gerät in höchste Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernd Teuber
Das Leben eben!
Ein Fall für Katharina Ledermacher
Ein Kriminalroman
nach Motiven von Richard Hey
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv.
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Das Leben eben!
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Verzeichnis der bisher erschienen Katharina Ledermacher-Krimis
Das Buch
Privatdetektivin Katharina Ledermacher wird von ihrem ehemaligen Kollegen Manfred Zobel um Hilfe gebeten. Sein Stiefsohn Fabian Joswig ist verschwunden. Bei ihren Nachforschungen stößt Katharina auf eine Mauer des Schweigens. Niemand weiß angeblich, wo sich der junge Mann aufhält.
Seine Leiche wird schließlich in der Spree gefunden.
Starb Fabian durch einen Unfall?
Oder wurde er ermordet?
Die Spur führt zu einem mysteriösen Import-Export-Geschäft und Katharina gerät in höchste Gefahr …
***
Das Leben eben!
Ein Fall für Katharina Ledermacher
1. Kapitel
Bei Tag erfreute sich die Stadt Berlin mit ihren Sehenswürdigkeiten und ihrer einzigartigen Atmosphäre sowohl bei den Einheimischen als auch bei den zahlreichen Touristen großer Beliebtheit. Es war eine moderne Stadt, die seit nunmehr zwei Jahren nicht mehr durch eine Mauer getrennt wurde. Gleichwohl hatte sie die bei modernen Städten seltene Eigenschaft, jene Art von Geborgenheit und Heimatliebe zu erwecken, mit der die Alten ihre überschaubaren Gemeinden betrachteten.
Die Heimatliebe eines Berliners gleicht derjenigen des bodenständigen Kleinstädters. Während dieser aber an seiner Gemeinde auszusetzen hat, dass es an kulturellen Veranstaltungen fehlt und auch sonst nichts los war, sagen die Bewohner Berlins nichts dergleichen. Das Nachtleben ist bunt und abwechslungsreich.
Doch sollte man einen Aspekt nicht außer Acht lassen, von dem sogar mancher Einheimische zugab, dass er eine zuweilen ziemlich unangenehme Eigenschaft seiner Stadt war: das wechselhafte Wetter.
Fast den ganzen Sommer über verursachten kalte Aufquellwasser, die von wärmerer Luft überstrichen wurden, ungewöhnlich dichte und dauerhafte Nebelfelder, die schon etlichen Autofahrern zum Verhängnis geworden waren. Die Statistik wusste zu berichten, dass Berlin während des Sommerhalbjahres durchschnittlich achtundzwanzig Tage und Nächte unter dichtem Nebel lag.
In solchen Nächten, wenn die Atmosphäre von nasskalten Schwaden erfüllt war, dass man Wasser zu atmen glaubte und die klamme Kälte einem bis ins Knochenmark zu dringen schien, wenn selbst das Licht der Straßenlaternen nicht von einer zur nächsten reichte, dann regte sich auch im Herzen des kühnsten Mannes, der durch die Straßen ging, ein Gefühl von Unbehagen. Ein Gefühl, als lauerte etwas Unheimliches und Drohendes im Nebel; ein Gefühl, dass man gut daran tat, schneller zu seinem Ziel zu gehen – wenn man es finden konnte.
Bei diesem dichten Nebel, der sich durch die Straßen wälzte, hatte selbst der fantasievollste Geist Mühe, sich von der Vorstellung freizumachen, dass der weißgraue Dunst alles verzehrte, was seinen Weg kreuzte.
Fabian Joswig war sich bewusst, dass seine Zeit knapp wurde. Nervös blickte er auf seine Armbanduhr. Zwanzig nach fünf. Er durfte auf keinen Fall zu spät kommen. In den Hauseingängen nahm er mitunter flüchtige Schatten wahr. Bäume und Büsche wirkten gespenstisch eingehüllt von den Nebelfetzen.
Ein seltsames Geräusch ertönte.
Es klang, als ob jemand mit einem Stück Holz auf das Straßenpflaster schlug. Fabian blieb stehen. Seine Augen versuchten, die wogenden Nebelschleier zu durchdringen, doch es gelang ihm nicht, den Ursprung dieses unheimlichen Geräuschs zu entdecken. Aber es wurde immer lauter. Dann tauchte aus dem Nebel eine hinkende Gestalt auf. Beim Näherkommen entpuppte sie sich als alter Mann.
Er trug einen breiten Schlapphut und einen langen Mantel. In regelmäßigen Abständen schlug sein Stock auf das Pflaster. Er ging an Fabian vorbei, ohne ihn anzusehen, und verschwand langsam wieder im Nebel, dunkel und geheimnisvoll. Fabian schaute ihm noch einen Augenblick hinterher, dann setzte er sich wieder in Bewegung. Nach etwa zwanzig Schritten bog er um eine Ecke und näherte sich seinem Ziel. Die Leuchtschrift über dem Eingang war nur undeutlich zu erkennen: JÄGERKRUG.
Fabian betrat die düstere Kneipe, die schon bessere Zeiten gesehen hatte. Der Geruch von verschüttetem Bier drang ihm in die Nase, als er sich einen Weg durch die Stuhlreihen zur Theke bahnte. Ein Billardtisch mit abgenutztem Spannbezug stand in einer der Ecken. An den Wänden hingen verschmutzte Spiegel. Der Boden knarrte unter seinen Füßen, während er den Raum durchquerte.
Hinter dem Tresen stand ein fetter Kerl mit Glatze. Das ehemals weiße Hemd war von Flecken übersät.
»Hallo«, grüßte Fabian.
»Hallo«, erwiderte der Wirt.
Er nahm eines der Gläser, die vor ihm standen, und trocknete es mit einem zerrissenen Lappen ab, nachdem er es kurz durch das trübe Wasser gezogen hatte, das sich vor ihm in dem Becken befand.
Fabian ließ seinen Blick durch die Kneipe schweifen. »Nicht viel los.«
»Noch zu früh. Bier?«
»Ja. Aber kein gezapftes.«
Eine Flasche wurde vor ihn gestellt. Der Wirt öffnete sie mit einer Bewegung aus dem Handgelenk. Der Flaschenöffner war in seinen Händen nicht zu sehen. Fabian fragte sich, ob er überhaupt einen benutzte. Gleichzeitig überlegte er, ob er noch ein Bier bestellen sollte. Er hatte sein Erstes noch nicht ausgetrunken. Nicht, dass er kein Bier mochte. Er trank sehr gerne Bier. Es war nur, dass er über die Art und Weise beunruhigt war, wie der dicke Wirt ihn angesehen hatte, als er in die Kneipe kam.
Als ob er gedacht hätte, dass dieser Junge nicht alt genug sei, um in der Öffentlichkeit Bier zu trinken. Es war schlimm, mit einem Milchgesicht herumlaufen zu müssen. Aber Fabian hatte hier etwas zu erledigen, und da war es keine gute Idee, unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er ärgerte sich. So eine einfache Sache wie diese Aufgabe, die er zu bewältigen hatte, und er war im Begriff, sie zu verpfuschen. Er leerte seine Flasche.
»He – noch ein Bier!«
Der Wirt nickte, öffnete eine zweite Flasche und stellte sie auf den Tresen. Mittlerweile war Fabian das Gefühl des Unbehagens, mit dem er die Kneipe betreten hatte, schon fast vertraut geworden. Er bemerkte die Blicke des Wirtes, der ihn abweisend musterte, doch er versuchte es zu ignorieren. Abermals schaute er sich um. Er kannte den Mann nicht, den er hier treffen sollte, aber das spielte keine Rolle.
Der Mann kannte ihn. Außerdem musste er sich durch einen vorher vereinbarten Satz zu erkennen geben. Fabian trank einen Schluck. In den nächsten zehn Minuten geschah nichts. Hatte sich der Mann verspätet? Oder war etwas schiefgegangen?
Während er trank, stellte er fest, dass er sich in diesem heruntergekommenen Schuppen fast wohl fühlte. Würde er irgendwann anfangen, sich in finsteren Kneipen herumzutreiben, nur um dort irgendwelche seltsamen Typen zu treffen?
Er fuhr zusammen, als ein Schatten über den Tresen fiel. Sein Blick zuckte hoch, tastete den schlanken, mittelgroßen Mann in der schwarzen Lederkluft ab, der neben ihm stand. Der Bursche war dunkelblond und hatte ein schmales Gesicht. Er lächelte höflich. Ohne eine Aufforderung abzuwarten, setzte er sich neben Fabian.
»Hallo«, sagte er.
Fabian nickte.
Der Mann bestellte bei dem Mann ein Bier und zahlte sofort. Das schmale Gesicht des Fremden war ausdruckslos.
»Der frühe Vogel fängt den Wurm«, meinte er schließlich.
»Aber erst die zweite Maus bekommt den Käse«, entgegnete Fabian.
Er hatte Mühe, sich ein Lachen zu verkneifen. Die Situation wirkte wie in einem drittklassigen Agentenfilm. Der Mann nickte. Er holte einen Zettel aus der Innentasche seiner Jacke und schob ihn unbemerkt zu Fabian hinüber. Der junge Mann steckte ihn sofort ein.
Immer noch kam ihm das, was er hier tat, vollkommen verrückt und unglaublich vor. Aber es war eine Chance, die einzige vielleicht – und er wurde sich klar darüber, dass er in seiner augenblicklichen Situation auch nach einem Strohhalm gegriffen hätte.
Der schlanke Mann erhob sich, ohne Fabian weiter zu beachten und wandte sich ab. Mit schnellen Schritten ging er Richtung Ausgang. Auf dem Weg zur Tür musste er an einem rechteckigen Spiegel vorbei. Er blickte hinein, lächelte kurz. Dann öffnete er die Tür und verließ die Kneipe.
Fabian wartete einige Minuten, legte fünf D-Mark auf den Tresen und verließ dann ebenfalls das Lokal. Unter einer Straßenlaterne, deren Licht kaum den Boden erreichte, betrachtete er den Zettel mit der Adresse. Er zerriss ihn in mehrere Einzelteile und warf sie auf die Straße. Eine Windböe wehte die Papierschnipsel davon. Fabian blickte wieder auf seine Armbanduhr. Viertel vor sechs. Vielleicht würde die Zeit noch reichen. Aber nur, wenn er sich beeilte.
Er dachte daran, ein Taxi zu nehmen, doch nirgendwo konnte er eines entdecken. Tatsächlich war er das einzige Lebewesen weit und breit. Aber er wusste, welchen Weg er gehen musste. Als er durch die spärlich beleuchteten Straßen ging, zog er den Reißverschluss seiner Jacke hoch, um die Kälte abzuwehren. Die Jacke war eine Lederimitation. Darunter trug er einen Rollkragenpullover.
Die Kombination hätte mehr als hinreichend sein sollen, um die Kühle einer normalen Augustnacht abzuwehren, aber dies war keine normale Augustnacht. Sie war nasskalt und unangenehm. Und der Nebel schien immer dichter zu werden. Die Sichtweite betrug kaum mehr als fünfzig Meter. Er ging durch die Utrechter Straße, bog rechts in die Malplaquestraße ein und erreichte die Nazarethstraße. Noch immer hatte er keinen Menschen gesehen – keine Fahrzeuge, keine Leute.
Unheimlich.
Er schüttelte den Gedanken ab und folgte der Nazarethstraße. Sie war nur von zwei Passanten bevölkert, die auf Fabian nicht sehr ermutigend wirkten. Einer war ein Betrunkener, der sich an einer grauen Hauswand aufrecht hielt. Die andere war eine unförmige alte Frau, die bewegungslos in der Mitte des Bürgersteigs stand und sich auf ihren Stock stützte. Noch zwanzig Meter weiter fühlte er ihre Augen auf sich ruhen, als wollten sie Löcher in seinen Rücken brennen.
Er bog nach links in die Liebenwalder Straße ein. Mittlerweile war er so außer Atem, dass er langsam gehen musste. Irgendwie seltsam. Fabian rauchte nicht. Früher hatte er sogar jahrelang Sport getrieben. Wahrscheinlich war es die Kälte, die ihm zu schaffen machte. Er blickte auf seine Armbanduhr. Zwei Minuten vor sechs. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr, dann würden sie den Laden zumachen.
Einen Augenblick später sah er ihn. Aus der nächsten Seitenstraße rechts leuchteten ihm in roter Neonschrift die unverkennbaren Worte entgegen: IMPORT – EXPORT. Fabian überquerte die Straße, sah Licht im Inneren des Ladens und ging kurzentschlossen hinein.
2. Kapitel
Kurz nach zwanzig Uhr ließ der Mann den dunkelroten Opel vor dem Hochhaus in der Krummen Straße ausrollen. Minutenlang blieb er im Wagen sitzen, zögerte noch mit dem Aussteigen, denn er wusste, dass er ohne ein klares Konzept hergekommen war. Manfred Zobel blickte durch die Windschutzscheibe nach oben.
Der Nachthimmel wirkte wie dunkelblauer Samt. Er war mit Sternen übersät. Sie glitzerten wie verstreute Diamanten auf dunklem Tuch und schienen zum Greifen nahe. Manfred schüttelte leicht
den Kopf. Plötzlich kamen ihm Zweifel, ob es wirklich Sinn machte, hierher zu kommen. Vielleicht war er von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Es konnte durchaus sein, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.
Manfred gab sich einen Ruck. Es hatte keinen Zweck, wenn er sich in einem Dickicht von Vermutungen verfing. Er musste so rasch wie möglich Gewissheit bekommen.