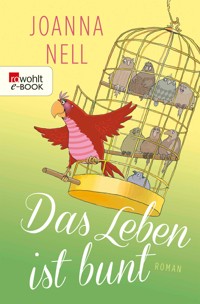
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ein charmantes, warmherziges Buch, bei dem ich mit allen Charakteren mitgefiebert habe und stellenweise laut lachen musste.» Libby Page --- Peggys Alltag ist so langweilig und beige wie die Klamotten in ihrem Schrank: Scrabble, Wassergymnastik, Arztbesuche. Auch die Enkel könnten häufiger vorbeikommen. Aber dass das Leben mit 79 noch bunt sein kann, das beweist eine alte Freundin. Als Angie neu in das Seniorendorf einzieht, mischt sie die Rentnergemeinschaft ordentlich auf. Auch Peggy erwacht aus ihrer Lethargie. Denn die früheren Freundinnen sind immer schon Rivalinnen gewesen. Und so dauert es nicht lange, bis beide für den charmanten Nachbarn Brian schwärmen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Joanna Nell
Das Leben ist bunt
Roman
Über dieses Buch
Peggys Alltag ist so langweilig und beige wie die Klamotten in ihrem Schrank: Scrabble, Wassergymnastik, Arztbesuche. Auch die Enkel könnten häufiger vorbeikommen. Aber dass das Leben mit 79 noch bunt sein kann, das beweist eine alte Freundin. Als Angie neu in das Seniorendorf einzieht, mischt sie die Rentnergemeinschaft ordentlich auf. Auch Peggy erwacht aus ihrer Lethargie. Denn die früheren Freundinnen sind immer schon Rivalinnen gewesen. Und so dauert es nicht lange, bis beide für den charmanten Nachbarn Brian schwärmen …
«Diese herzerwärmende Geschichte über das Altern – sowohl würde- als auch schmachvoll – ist eine witzige, geistreiche und durch und durch unterhaltsame Lektüre.» (Daily Telegraph)
«Spritzig und skurril ... mit einigen nachdenklichen Aspekten zum Thema Altern, Liebe, Gemeinschaft und Freundschaft.» (The Sydney Morning Herald)
Vita
Joanna Nell stammt aus England und studierte in Oxford Medizin. 2003 zog sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern nach Australien, wo sie heute als Ärztin in einer Praxis in Sydney arbeitet. Sie ist Absolventin des Australian Writers’ Centre und hat bereits mehrere Auszeichnungen für ihre Werke erhalten. Dies ist ihr erster Roman.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «The Single Ladies of Jacaranda Retirement Village» bei Hodder & Stoughton, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2020
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Single Ladies of Jacaranda Retirement Village» Copyright © 2018 by Joanna Nell
Redaktion Katharina Rottenbacher
Die Übersetzung des Gedichts von Dylan Thomas stammt von Johanna Schall
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Kai Pannen
ISBN 978-3-644-40636-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Molly und Lol
Geh nicht gelassen in die gute Nacht,
Glüh, rase, Alter, weil dein Tag vergeht,
Verfluch den Tod des Lichts mit aller Macht.
Denn weise Männer, wissend, nichts, was sie gedacht,
Hat Licht gebracht ins Dunkel, und es ist zu spät,
Gehn nicht gelassen in die gute Nacht.
Und gute Männer brüllen, schon der letzten Welle Fracht,
Und denkend ihrer Mühn, im Meer verweht,
Verfluchen Tod des Lichts mit aller Macht.
Und wilde Männer, die der Sonne Pracht
Im Fluge singend fingen, die nun untergeht,
Gehn nicht gelassen in die gute Nacht.
Und ernsten Männern, blind schon, wächst Verdacht,
Auch blindes Auge lacht und blitzt, eh es vergeht,
Verfluchen Tod des Lichts mit aller Macht.
Und du mein Vater, den, der bei dir wacht,
Verdamm und segne weinend ihn. Hier mein Gebet:
Geh nicht gelassen in die gute Nacht.
Verfluch den Tod des Lichts mit aller Macht.
Dylan Thomas 1914–1953
Deutsch von Johanna Schall
1Salomes Handtuchtanz
Peggy Smart war sich neunzigprozentig sicher, dass Montag war. Sie musterte die Beschriftung ihrer Pillenbox. Was für eine geniale Erfindung! Dank der einzelnen Kästchen mit den Wochentagen vergaß sie nie, ihre Tabletten zu nehmen. Und, noch viel wichtiger: Auf diese Weise konnte sie Brian nicht verpassen.
Mit einer frischen Tasse Tee bewaffnet, ging Peggy in Stellung. Sie hielt den dampfenden Becher umfasst und wartete. Er war spät dran heute Morgen, und ihre Zuversicht schwand. Was, wenn sie ihn doch verpasst hatte? Was, wenn er schon gefahren war? Dann musste sie vierundzwanzig Stunden warten, bis sie ihm wieder heimlich dabei zusehen konnte, wie er zu seinem Auto lief, das gestreifte Strandtuch lässig über die Schulter drapiert. Auf der Suche nach Trost wandte Peggy sich der Zuckerdose zu. Sie rührte noch ein Löffelchen Linderung in ihren Tee und drehte sich zum Küchenfenster zurück. Und da war er, zu ihrer großen Überraschung – lief mit einer Zeitung in der Hand vor ihrem Haus den Gehweg entlang. Brian Cornell sah zu ihrem Fenster hoch. Er lächelte. Und winkte ihr zu.
Erschrocken schüttete Peggy sich den heißen Tee auf die Pantoffeln. Halt suchend griff sie nach dem Fensterbrett. Brian hatte sie gesehen. Mehr noch. Er hatte gewinkt. In einem einzigen Augenblick lösten sich Monate des Zweifels in Luft auf, und Peggy wurde in das schwindelerregende Reich der Möglichkeiten katapultiert.
Sie wagte einen letzten verstohlenen Blick durch die Tüllgardinen. Der Gehweg war wieder leer. Brian und sein Morning Herald waren verschwunden. In Peggys Enttäuschung mischte sich Euphorie. Dieses Winken, so flüchtig es auch gewesen war, markierte definitiv einen Wendepunkt in ihrer aufkeimenden Beziehung.
Lächelnd reihte Peggy die Montagspillen auf der gestreiften Tischdecke auf – eine kleine Armee Chemiesoldaten im Kampf gegen das fortschreitende Alter. Sie hatte Teds Tablettenfläschchen immer noch im Schrank, weil sie es nicht über sich brachte, Medikamente wegzuwerfen. Die Tabletten gegen Sodbrennen zum Beispiel konnte sie bei einem verdauungstechnischen Notfall sicher irgendwann gebrauchen. Mit den Prostatapillen war es natürlich was anderes. Die müsste sie eigentlich in die Apotheke zurückbringen. Es sei denn, Brian hatte auch mit der Prostata zu tun. Peggy verdrängte das Bild seiner Silhouette. Es war sinnlos, so zu tun, als wäre das Leben perfekt. In ihrem Alter gab es keine Beziehung ohne Beipackzettel.
Die erste Pille verschwand mit einem Schlückchen extrasüßem Tee. Peggy aß einen Bissen Toast und schlug ihren Kalender auf. Sie hatte ihn letztes Jahr von ihren Enkelkindern zu Weihnachten bekommen. Jede Monatsseite zierte ein anderes Foto, auf dem Emily und Sam ohne sie ihren Spaß hatten. Doch Peggy Smart hütete sich zu jammern. Bloß nicht die Pferde scheu machen, lautete das Motto, wenn es um die Familie ging.
Peggy blätterte bis Oktober vor. Auf der Seite prangte ein niedliches Foto von Sam und Emily gemeinsam mit den Eltern ihrer Schwiegertochter beim Eiersammeln auf einem Bauernhof. Na toll. Ein ganzer Monat, um sie tagtäglich an ihren Platz in der Hackordnung zu erinnern. Kurz war Peggy versucht, Geraldine die Schneidezähne schwarz zu malen und Mike einen Schnurrbart zu verpassen. Doch das wäre reichlich kindisch für eine Frau von neunundsiebzig Jahren.
Seit sie letzten Monat die neue Farbcodierung in ihrem Kalender eingeführt hatte, hatte Peggy ihres Wissens noch keinen einzigen Termin versäumt. Sie gratulierte sich täglich aufs Neue zu ihrem Einfallsreichtum. Rot für Arztbesuche, Lila für die medizinische Fußpflege, Blau für den Friseur. Und dann gab es noch die Gold-Termine. Peggy hatte sich aus Emilys flauschigem grünem Federmäppchen einen Stift geborgt, um den Einkaufszettel zu schreiben, und vergessen, ihn zurückzugeben. Jetzt hatte der goldfarbene Glitzerstift einen Ehrenplatz neben dem Kalender. Er war für die Versammlungen des Siedlungskomitees reserviert. Immer am ersten Donnerstag im Monat. Eigentlich musste sie, seit Brian Schatzmeister war, die Daten gar nicht mehr markieren. Wenn es um Herzensangelegenheiten ging, funktionierte Peggys Gedächtnis tadellos.
Brian Cornell.
Die Vorstellung, wie er sich ihren Sonntagsbraten schmecken ließ, jagte ihr Schauder über den Körper. Sie stellte sich seine schmalen Gesichtszüge bei Kerzenschein vor und wie seine Hand auf der geklöppelten Spitzendecke nach ihrer griff. Ein einziger Bissen von ihrem köstlichen Dattelkuchen, und um den gutaussehenden Witwer wäre es geschehen.
Aber so was konnte sie unmöglich einfach nebenbei ins Gespräch einflechten. «Guten Abend, Brian. Haben Sie das Budget für die Bepflanzung der Auffahrt schon freigegeben? Oh, und wo wir gerade dabei sind: Würden Sie bei Gelegenheit zu einem romantischen Candle-Light-Dinner bei mir vorbeikommen?»
Vier Jahre Smalltalk, ein Kompliment über ihre selbstgebackenen Brötchen und die unvermeidlichen Fragen über das Befinden – weiter hatten sie sich immer noch nicht vorgewagt. Entweder handelte es sich hier um langsam schwelende Leidenschaft auf völlig neuem Niveau oder um vergebliche Liebesmüh.
Es war allgemein bekannt, dass Frauen ab einem gewissen Alter unsichtbar wurden, sogar für Männer über achtzig. Es war, als wäre Peggy Smart vollkommen neutral geworden. Sie verschmolz dermaßen perfekt mit dem geschmackvollen Dekor der Seniorensiedlung, dass sie schlicht nicht mehr vorhanden war. Das war wenig verwunderlich. Sie war weder aufregend noch glamourös. In jeder Hinsicht ausgesprochen unscheinbar. Ihre Phantasie war nichts anderes als genau das: ein Hirngespinst.
Seufzend schlürfte Peggy den sirupartigen Bodensatz aus ihrer Tasse. Eine Frau durfte doch wohl noch träumen, oder nicht? Eines Tages würde sich die perfekte Gelegenheit ergeben. Bis dahin leistete ihr die Erinnerung an Ted weiter Gesellschaft. Und Basil war schließlich auch noch da. Er schnarchte in seinem Körbchen vor sich hin, und die Frühstücksreste zitterten in seinen grauen Schnurrhaaren.
«Jetzt gibt es nur noch dich und mich, alter Knabe», sagte sie.
Vielleicht war es besser so. Wäre Ted noch am Leben, er würde sich im Grabe umdrehen.
Zweimal wöchentlich entkleideten sich die wagemutigeren Bewohnerinnen des Jacaranda Retirement Village gemeinsam in der beengten Sammelumkleide des siedlungseigenen Hallenbads. Peggy hatte jedes Mal damit zu kämpfen, sich ihre Verlegenheit nicht anmerken zu lassen, indem sie streng darauf achtete, den Blick nur ja auf Augenhöhe zu halten. Es war schwierig, dieses Übermaß an nacktem Fleisch mit dem von ihrer Mutter unablässig gepredigten Anstand in Einklang zu bringen. Sheila Martin war offensichtlich die Einzige, die eine ähnlich strenge Erziehung genossen hatte wie Peggy. Sie zog sich zum Umziehen sogar in eine abgeschlossene Kabine zurück wie eine viktorianische Dame in ihren Badekarren.
Die Wassergymnastik war der ultimative Gleichmacher, eine Atempause von den politischen Winkelzügen und Machtspielchen des Alltags in der Seniorensiedlung. Hier, in der Sammelumkleide, standen die Frauen Schulter an Schulter in ihren «Unaussprechlichen» – praktisch, baumwollen, in sämtlichen Weißtönen, standardmäßig industrietauglich verstärkt. Peggy hatte die Lizenz zum ungestraften Tragen vernünftiger Unterwäsche immer als einen der unerwarteten Vorzüge des Altwerdens empfunden.
Bequeme Schlüpfer. Große Schlüpfer. Die Sorte Schlüpfer, die im Dreierpack verkauft wurden.
Weil sämtliche anständigen Exemplare heute zum Trocknen auf der Leine hingen, versteckte Peggy ihren Notfallschlüpfer, solange es ging, unter den Rockfalten. Er war im Laufe der Zeit zu einem undefinierbaren Grau verwaschen, aber das Gummi war noch tadellos in Schuss, und sie brachte es nicht über sich, das Exemplar allein aus ästhetischen Gründen in den Müll zu werfen. Ihr Badeanzug sah kaum besser aus. Der schwarze Stoff war unten am Gesäß, wo sich das Elasthan bereits aufgelöst hatte, ein wenig schlaff. Aber er erfüllte noch immer seinen Zweck, und außerdem wurde das ausgeleierte Material mit jedem Tragen bequemer. Peggy hatte es nicht eilig, das fadenscheinig gewordene Stück zu erneuern. Sie hasste Einkaufen. Neue Unterwäsche war schon eine Herausforderung, aber Badebekleidung war eine Klasse für sich. Nichts passte, egal, was das Etikett behauptete. Dieser hier war als «Figurwunder» tituliert worden. Das einzige Wunder an dem Ding war jedoch, dass sie es nicht sofort ins Geschäft zurückgetragen und wegen irreführender Reklame ihr Geld zurückverlangt hatte. Sie wickelte sich das Handtuch um die Hüften, um das schlabberige Hinterteil zu kaschieren, und tippelte auf Zehenspitzen über die nassen Fliesen zum Schwimmbecken.
Um Punkt zehn Uhr überließ Peggy Smart ihre Zipperlein der Schwerelosigkeit des Wassers im flachen Nichtschwimmerbereich.
«Dann mal los, meine Damen. Schnappen Sie sich eine Schwimmnudel und suchen Sie sich einen Platz.»
Alle liebten Libby, die junge Schwimmlehrerin. Natürlich konnte es keine der Frauen mit ihrer schlanken Figur aufnehmen, und ihr Anblick war die reinste Erholung von der Grübchenparade in der Sammelumkleide. Außerdem gewährte Libby der Wassergymnastikgruppe jedes Mal bereitwillig kleine Einblicke in ihr Privatleben: ihre unzuverlässigen Freunde, ihre exotischen Reisepläne und ihr Traum vom Muttersein. Peggy empfand Libbys Geschichten als erfrischende Abwechslung zu dem üblichen Hickhack rund um das ewig gleiche Thema: «Wer übertrumpft wen mit welcher Unpässlichkeit?»
Mavis Peacock hüpfte mit einer pinkfarbenen Schwimmnudel an ihr vorüber. «Morgen, Peggy», flötete sie. «Hast du meine Nachricht bekommen, wegen dem Empfang am Freitag?»
Peggy nickte. Der Termin war garantierte Brian-Zeit und stand längst mit Glitzergold in ihrem Kalender. Peggy ließ sich keine Gelegenheit entgehen, sich als aktive, intelligente Frau zu präsentieren, die sich großmütig für die Belange der Gemeinschaft engagierte. Eine moderne Frau. Und Schöpferin allseits bewunderter Backwaren.
«Zu Beginn joggen wir ein bisschen auf der Stelle.» Libby simulierte am Beckenrand einen Dauerlauf, während ihr knackiger Körper der Schwerkraft bei jedem Sprung ein Schnippchen schlug. Mavis stand wie immer ganz vorne und produzierte mit ihren wogenden Brüsten riesengroße Wellen. Sheila Martin, deren Spatzengestalt über keinerlei natürlichen Auftrieb verfügte, klammerte sich verzweifelt an ihrer Nudel fest.
Libby joggte lässig zu ihrem iPod hinüber und drehte die Lautstärke auf. «Los, los, meine Damen, ich will die Arme sehen.» «I’m Walking on Sunshine» singend klatschte sie über dem Kopf in die Hände und lud sie alle ein, mit ihr im Sonnenschein zu spazieren.
Peggys Schulter protestierte, und sie wechselte zu stummem Applaus auf Brusthöhe.
Mavis kam an ihre Seite gehüpft. «Wir haben diesen Monat einige Neuzugänge», sagte sie. Ihre flatternden Flügel gewannen zunehmend an Schwung, und sie sah aus, als würde sie jeden Moment abheben.
«Und jetzt die Nudeln unter die Achseln, auf den Rücken gelegt und: Zeigt her eure Füßchen.»
«Ich trage dich für die Häppchen ein?» Mavis neigte zu rhetorischen Fragen.
«Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen!» War das ein wenig zu dick aufgetragen?
«Na los, meine Damen! Hoch die Beine! Kick und kick und kick und kick!»
«Wie gut, dass wir uns in Sachen Verpflegung auf dich verlassen können», erklärte Mavis. «Es sind diesmal gleich ein paar neue Bewohnerinnen dabei, und bei so wenigen Männern habe ich Jim Wilde und Brian Cornell gebeten, zur Unterhaltung der weiblichen Neuzugänge die Gastgeber zu spielen.»
Peggy hörte abrupt auf zu strampeln. Bei der Vorstellung, wie ihr Brian mit irgendeinem alleinstehenden Golden Girl auf Schmusekurs ging, während sie sich im Schweiße ihres Angesichts in der Küche abrackerte, zog es ihr förmlich das Wasser unter den Füßen weg. Ehe sie wusste, wie ihr geschah, versank sie. Ihre Zehen suchten tastend nach festem Boden. Die gedämpfte Musik drang nur noch verzerrt an ihr Ohr. Streifen aus Sonnenlicht marmorierten das stille Blau, das sie umfing wie eine weiche Decke. Wie leicht es doch wäre, den Kampf aufzugeben und sich heimlich davonzumachen. So wie Ted.
Um sie herum strampelten sich auf unsichtbaren Fahrrädern die bleichen Schenkel von Frauen ab, die waren wie sie. Außerhalb des Beckens wurde gezankt und getratscht, gelacht und mit Fotos von den Enkelkindern angegeben. Hier unten waren sie alle gleich: Sie traten alle Wasser.
Nach vier Jahren Kampf, sich allein durchs Leben zu schlagen, war Peggy die Mühe leid. Sie fragte sich immer wieder, ob es nicht leichter wäre, einfach aufzugeben. Die Enkelkinder würden traurig sein, aber Grandma Geraldine und Grandpa Mike waren schließlich auch noch da. Ihre Kinder David und Jenny würden zweifellos gebührend trauern und dann in ihrem Testament Trost finden. Und Brian? Würde er überhaupt mitbekommen, dass sie nicht mehr da war?
«Ich habe Peggy schon lange nicht mehr gesehen», würde er vielleicht sagen. Irgendwann.
Die letzten Bläschen entwichen Peggys Mundwinkel und stiegen nach oben. Plötzlich fiel ihr das längst überfällige Buch aus der Leihbücherei wieder ein und die nasse Wäsche in der Waschmaschine. Nein, sie war noch nicht bereit abzutreten. Strampelnd kam Peggy zurück an die Oberfläche.
«Ich dachte an Blätterteigpastetchen», rief die nichtsahnende Mavis über die Musik hinweg, als Peggy prustend auftauchte. «Und irgendwas mit Räucherlachs, falls du das hinbekommst.»
Peggy stellte sich vor, wie sie Mavis ein mit Pilzcreme gefülltes Pastetchen ins Gesicht drückte und fragte: «Möchtest du den Räucherlachs auch noch kosten?» Stattdessen griff sie hustend nach der Schwimmnudel und lächelte gezwungen: «Wie wär’s mit Miniwienern im Schlafrock?»
Libby zog sich die Trainingsjacke aus und enthüllte ein Fähnchen von Unterhemd. Ihre kecken Brüste standen stramm wie gestürzte Götterspeise. «So, meine Damen, und jetzt tun wir was für unseren guten alten Beckenboden.» Sie knickte die Schwimmnudel und schob sie sich zwischen die honigfarbenen Oberschenkel. «Wir wissen ja alle, wie wichtig es ist, den Beckenboden in Form zu halten, wenn wir älter werden. Außerdem ist das gut fürs Liebesleben!»
Libby hatte bestimmt einen hervorragenden Beckenboden, dachte Peggy. Aber sie hatte ja auch keine zwei neun Pfund schweren Babys zur Welt gebracht. Zumindest noch nicht. Sie konnte mit dem Bus verreisen, ohne einen einzigen Gedanken an die nächste Toilettenpause zu verschwenden, und sich im Flugzeug bedenkenlos ans Fenster setzen.
«Wir konzentrieren uns auf unseren Beckenboden, ziehen ihn nach innen und oben und kneifen vorne und hinten alles zusammen.» Libby lag auf dem Rücken und machte es vor. «Anspannen, entspannen, anspannen, entspannen.» Im Takt der Musik quetschten ihre Oberschenkel die Nudel zusammen.
Das ist doch lächerlich, dachte Peggy. Wir planschen hier rum, lauter Frauen über siebzig, in unseren Bauchwegschwimmanzügen, und konzentrieren uns zur Verbesserung des Liebeslebens auf mythische Muskelgruppen.
Libby und ihre Nudel kamen langsam in Fahrt. «Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine volle Blase kontrollieren …»
Kein Problem, ich muss ständig eine volle Blase kontrollieren. Ich versuche es zumindest.
«… und sich gleichzeitig ein Lüftlein verkneifen.»
Peggy versuchte, ein Kichern zu unterdrücken. Es entkam ihr durch die Nase. Hinter sich hörte sie es glucksen. Eine andere lachte laut. Peggy hatte alle Mühe, nicht hysterisch loszuprusten. Die todernste Miene, mit der Mavis versuchte, ihren schlaffen Damm zu disziplinieren, machte die Situation noch komischer. Schließlich konnte sich fast keine von ihnen mehr vor Lachen halten. Endlich fing auch Mavis’ Mundwinkel verdächtig an zu zucken. Ihre Augen weiteten sich, dann wieherte sie los.
Peggy tat vor lauter Lachen das Gesicht weh, und ihre Oberschenkel brannten, so sehr presste sie die Knie zusammen. Entflohene Schwimmnudeln schwammen durchs Becken wie Suppennudeln. So hatte Peggy seit Jahren nicht mehr gelacht. Sie hatte sich nicht getraut. Mitgerissen von einem Augenblick weiblicher Solidarität bogen und krümmten die Frauen sich vor Lachen, während die liebliche Libby am Beckenrand zappelte wie eine auf dem Rücken liegende Schildkröte.
Zurück in der Umkleide, kicherten die Aqua Girls immer noch. Es kam kurz zu einem peinlichen Moment, als Mavis sich aus ihrem Einteiler schlängelte, das Gleichgewicht verlor und um ein Haar auf Peggys Schoß gelandet wäre – ein Beinahezusammenstoß der unerwünschten Sorte, der Peggy dazu brachte, ihr Revier mit den Ellbogen zu verteidigen. Es war unmöglich, sich in dieser Enge ordentlich abzutrocknen. Das ganze Geschlängel und Gewinde kam ihr fast vor wie ein neumodischer Freitanz. Der Duft von Talkumpuder hing in der Luft wie Weihrauch. Der ganzen Angelegenheit haftete etwas eigenartig Spirituelles an. Die heilige Verbundenheit der Ältesten, die Feier der Weiblichkeit, der Weisheit und der Fähigkeit, über die Absurdität des Lebens zu lachen.
Peggy fiel der Artikel wieder ein, den sie vergangene Woche beim Friseur gelesen hatte. «Warum Frauen Freundinnen brauchen». Irgendwas mit Oxymoron oder wie das hieß, dieses Hormon, das stillende Mütter mit ihren Säuglingen verband. Offensichtlich wirkte es entzündungshemmend und förderte Gefühle von Ruhe, Zufriedenheit und Empathie. Drei Eigenschaften, von denen ihre Seniorensiedlung ruhig noch ein wenig mehr gebrauchen könnte.
Doch was Peggy trotz all dem, was die hormongeschwängerte Verbindung zwischen Frauen zu bieten hatte, vermisste, war echte Intimität, die tiefere Verbindung zu einem anderen Menschen. Seit sie in die Siedlung gezogen war, hatte sie viele Bekanntschaften gemacht, doch keine ging über geteilte Schwimmnudeln, verschenkte Weihnachtspastete oder ein gelegentliches «Gib mir mal das Popcorn rüber» am Filmabend hinaus. Selbst die anderen Mitglieder des Siedlungskomitees waren kaum mehr als nette Bekannte. Leider galt das auch für Brian.
2Gottes Wartezimmer
Peggy schraubte das Sardellenglas zu und wischte sich die Hände am Handtuch ab. Wo um alles in der Welt war nur ihr Urinprobenbehälter hingeraten? Sie hatte zuerst im Kühlschrank nachgesehen und dann zur Sicherheit auch noch in der Mikrowelle. Das Becherchen war nur einer von vielen Gegenständen, die in letzter Zeit ständig verschwanden. Peggy brauchte nur etwas aus der Hand zu legen, und schon löste es sich in Luft auf. Hätte sie es nicht besser gewusst, sie hätte schwören können, dass jemand sich heimlich in ihre Wohnung schlich und absichtlich ihre Sachen versteckte. Die Lesebrille war am schlimmsten. Das blöde Ding kam ständig an den unmöglichsten Stellen wieder zum Vorschein, gerne auch oben auf ihrem Scheitel oder wahlweise in der rechten oder linken Hand.
Das Positive war, dass sie sich wegen des geopferten Sardellenglases jetzt wenigstens auf Salade niçoise heute Abend freuen konnte. Der Gedanke, die restlichen Sardellen einfach wegzuwerfen, war Peggy ein Gräuel. Sie hasste es, Lebensmittel zu verschwenden, und war eine ausgemachte Improvisationskünstlerin, vor allem bei Zutaten wie Sardellen. Dazu noch Kartoffeln, Ei und Thunfisch aus der Dose. Welch ein Luxus für einen Dienstagabend.
Der Weg vom Bad ins Schlafzimmer sah aus, als würde nachts statt einem Paar Lammfellpantoffeln Größe 38 eine Herde Gnus ins Bad und wieder zurück wandern. Peggy erwog, einen neuen Vorleger zu kaufen, um die verschlissene Auslegeware zu kaschieren. Ted wäre dagegen gewesen. Er hatte nie viel für überflüssige Heimtextilien übriggehabt. Aber Ted war dahin, genau wie der Teppichflor.
Peggy wickelte das Konservenglas in mehrere Lagen Papierservietten und versenkte es auf dem Grund ihrer Handtasche. Das Letzte, was sie wollte, war, mit einer Probe frischem Mittelstrahlurin in den Händen Brian über den Weg zu laufen.
Der Hügel kam ihr steiler vor als sonst, und Peggy blieb auf halber Strecke stehen, um Atem zu schöpfen. Vor ihr schleppten Umzugsmänner Möbel über die Rampe eines großen Transporters in eine leerstehende Erdgeschosswohnung. Ein vierschrötiger Mann balancierte ein unförmiges Samtsofa auf seinen Schultern und lächelte Peggy freundlich zu, als sie auf die Straße trat, um an dem Transporter vorbeizukommen. «Guten Morgen, meine Liebe», sagte er.
Peggy wusste nicht, ob sie geschmeichelt oder pikiert sein sollte. Sie war so daran gewöhnt, ignoriert zu werden, dass sein Gruß sie völlig überrumpelte. «Sie sollten nicht auf dem Gehsteig parken. Das ist für jemanden in meinem Alter sehr gefährlich!», sagte sie.
Sein Lächeln versiegte. Augenblicklich bereute Peggy ihren Ausbruch. Er hatte nur versucht, nett zu sein. Alte Gewitterziege, dachte er jetzt bestimmt.
Zum Gemeindezentrum hin flachte der Hügel ab. Das Zentrum war der Knotenpunkt der Siedlung, hier tauschten die Bewohner Freundlichkeiten, Klatsch und Tratsch aus. Der gepflegte Empfangsbereich war absolut hochglanzbroschürentauglich, nur den retuschierten Senioren aus den Anzeigen war Peggy bis heute nicht begegnet. Mit Ausnahme von Brian. Brian war eine ganz heiße Nummer. Definitiv die oberste Stufe auf Peggys Backofenskala.
Auf der Rückseite des Gemeindezentrums lag die kleine Arztpraxis. Peggys Ansicht nach überwog die bequeme Erreichbarkeit Dr. Szczpanskis Einfühlungsvermögen nur marginal. Sie hätte David ja gebeten, sie zu Dr. Steele zu fahren, ihrem altvertrauten Familienhausarzt, doch den hatte Peggy bereits überlebt.
Im Wartezimmer ging es zu wie in einem Bienenstock. Silberhaarige Siedlungsbewohner saßen auf den gepolsterten Bänken wie aufgereihte Weihnachtskugeln. Einige sahen aus, als würden sie schon Jahrzehnte warten.
Hinter einem Blumenkasten in der Ecke des Wartezimmers spähte Sheila Martin mit finsterer Miene hervor. Am besten, man reagierte gar nicht. Die Schriftführerin des Siedlungskomitees hatte Freunde an allerhöchster Stelle, und das Letzte, was Peggy wollte, war eine Wiederholung des berüchtigten Scrabble-Abends, der die Siedlung in zwei Lager gespalten hatte.
Im Raum war es stickig, und Peggy wurde sehr warm und ein wenig benommen zumute. Sie musste sich hinsetzen, und zwar am besten freiwillig, ehe sie auf dem Boden landete.
«Hier. Setzen Sie sich.»
Peggy drehte sich um. Ausgerechnet Brian hatte sich erhoben und bot ihr seinen Platz an. Ihr Herz setzte einen Schlag aus und fing dann an, wie wild gegen ihre Rippen zu pochen. Sie wusste alles über Brians Knie. Sie hatten auf der letzten Versammlung ein paar kostbare Minuten mit dem Vergleich ihrer künstlichen Gelenke zugebracht. Ein Profi wie Brian hatte sich natürlich beide Knie in einer Privatklinik von einem Chirurgen mit Bindestrich im Namen machen lassen. Peggy hingegen war in einem öffentlichen Krankenhaus gewesen. Ihr Operateur besaß nur einen einzigen Nachnamen, und sie hatte sich das Zimmer mit einer Dame geteilt, die die halbe Nacht gestöhnt hatte. Doch vieler kleiner Unannehmlichkeiten zum Trotz war Peggy dankbar und mit einem einwandfrei funktionstüchtigen neuen Gelenk nach Hause gegangen. Auf den Ersatz des zweiten wartete sie noch immer geduldig.
«Das geht auf gar keinen Fall», sagte Peggy.
«Ich bestehe darauf», sagte Brian und winkte die errötende Peggy auf seinen Platz. «Für eine Dame stehe ich grundsätzlich auf.»
Peggy vergaß zu atmen.
Mit seiner Paisley-Fliege sah Brian heute besonders disintegriert aus oder wie das hieß. Gemessen an den bewundernden Blicken im Raum war Peggy nicht die Einzige, die so dachte. Die Feindseligkeit in Sheila Martins Blick sickerte wie Senfgas zwischen den angestaubten Ficus-Blättern hervor. Wieder tat Peggy so, als würde sie nichts merken.
Sich in Brian zu verlieben, war keineswegs geplant gewesen. Ein amouröses Abenteuer hatte sie nun gar nicht im Kopf gehabt, als sie mit dem Tausendteilepuzzle der venezianischen Gondel begonnen hatte. Es war an einem verregneten Nachmittag im Clubhaus gewesen. Sie hatte sich bereits seit ein paar Minuten auf Randstücke konzentriert, als jemand sich ohne Vorwarnung über sie beugte und ein Puzzlestück in ihre Seufzerbrücke einsetzte. Zutiefst empört, machte Peggy sich innerlich bereit, den dreisten Täter aufs schärfste zurückzuweisen, drehte sich um und blickte in die von einer Gleitsichtbrille vergrößerten hellblauen Augen von Brian Cornell. Witwer. Vereidigter Buchprüfer, wie sie später erfahren sollte. Lexusfahrer.
Völlig verdattert hatte Peggy die obere rechte Ecke fallen lassen. Sie purzelte unter den Tisch und kam nie wieder zum Vorschein. Später strich jemand das «1000 Teile» auf der Schachtel durch und schrieb «999» darunter. Seit dieser Begegnung hatte Peggy das Gefühl, nach dem fehlenden Teilchen zu suchen. Nach dem Brian-förmigen Teil zur Vervollständigung ihres persönlichen Puzzles.
«Sie können sich gerne hier mit hinquetschen, Brian», sagte Mavis Peacock und rutschte ein Stückchen zur Seite. Brian lehnte mit einem höflichen Winken ab und wandte sich wieder dem Evakuierungshinweis an der Infotafel zu.
«Dauert es schon wieder länger?», fragte Peggy, als sie seinen Platz einnahm, in der Hoffnung, Brian in einen kleinen Smalltalk zu verwickeln. Die dem Stoffbezug entströmende Wärme stieg wie Flammen in ihr hoch. Sie spürte es in sich rieseln und fragte sich bange, ob sie schon wieder auf die Toilette musste.
«Frau Hanski-Panski ist noch gar nicht gekommen», sagte Celia Davenport hinter der Seniorenzeitung hervor. «Es gibt Leute, die was Besseres zu tun haben, als ihre kostbare Zeit damit zu verschwenden, auf Frau Doktor Griesgram zu warten.»
«Was hast du denn schon Wichtiges zu tun?», fragte Mavis mit ihrer schrillen Schulrektorenstimme. «Zündkerzen polieren oder was?»
Celia raschelte mit der Zeitung zwischen ihren ölverschmierten Fingern. Sie murmelte etwas just außer Mavis’ Hörweite, das Brian zum Grinsen brachte. Peggy mochte Celia. Sie war geradeheraus und zupackend. Es hieß, als junge Lady Celia sei sie angesichts eines drohenden Debütantinnenballs samt anschließender Ballsaison mit all den gesellschaftlichen Scharaden, die zum Ziel hatten, ihr einen passenden Ehemann zu bescheren, in London Waterloo in den Zug nach Southampton gestiegen und habe per Schiff die Flucht in Richtung Australien angetreten. Von da an ohne Zugriff auf ihr Erbe, hatte sie eine Ausbildung zur Mechanikerin absolviert und sich als Spezialistin für Traktoren einen Namen gemacht.
Peggy fragte sich oft, was eine so robust wirkende Frau wie Celia beim Arzt wollte. Dasselbe galt für Brian. Auf der Suche nach verräterischen Anzeichen musterte sie ihn verstohlen. Hoffentlich kam er nur zur Vorsorge. In unserem Alter, dachte sie, kann man gar nicht oft genug zur Vorsorge gehen.
Dann erschien Christine, die Siedlungsleiterin, im Wartezimmer, und alle Köpfe fuhren herum. Christine sah immer aus wie frisch aus dem Ei gepellt. «Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber Frau Dr. Szczpanski kann heute nicht kommen», verkündete sie.
Eine La-Ola-Welle des Unmuts wogte durch den Wartebereich.
«Ich hatte um zehn Uhr einen Termin!», sagte Mavis und zog mit Nachdruck den Reißverschluss ihrer Handtasche zu. «Das ist absolut unmöglich!»
«Aber», fuhr Christine fort und lächelte durch ihr perfektes Make-up hindurch, «ich würde Ihnen gern Dr. Stephen Lim vorstellen. Er ist Allgemeinarzt und wird ab sofort am Dienstag- und Donnerstagvormittag im Jacaranda Retirement Village seine Sprechstunde abhalten. Ich bin mir sicher, Sie heißen ihn bei uns herzlich willkommen.» Hinter ihr stand ein junger Mann mit dunkel gerahmter Brille und kragenlosem Shirt.
Dr. Lim folgte Christine mit seiner großen schwarzen Arzttasche ins Sprechzimmer. Er wirkte sehr jung für einen Arzt. Doch das traf im Vergleich zu dem alten Dr. Steele eigentlich auf jeden zu.
Mavis wandte sich an ihre Nachbarin. «Ich weiß nicht, ob ich von einem Mann behandelt werden möchte. Die können nicht besonders gut zuhören.»
«Wer will sich schon dein Gejammer anhören?» Celia faltete den Senior zusammen und verschränkte die Arme. «Solange er weiß, was er tut, ist mir das egal.»
«Aber was, wenn es um … intimere Dinge geht?», flüsterte Mavis für jeden hörbar.
«Er ist Arzt, kein Anlageberater», sagte Celia.
Peggy fing Brians Blick auf. Er zwinkerte ihr zu und grinste. In Peggys Heiterkeit mischte sich ein bisschen Besorgnis bei der Vorstellung, wie sie ihr Sardellenglas einem fremden, kaum der Pubertät entwachsenen Mann in die Hand drückte. Sie schlug ihr Buch auf und versuchte, nicht an das zu denken, was ihr bevorstand.
Der Duft von frisch getoasteten Sandwiches aus der Cafeteria lenkte Peggy von ihrer Lektüre ab. Gerade, als es spannend wurde. Es musste inzwischen fast Mittag sein, und außer ihr war niemand mehr im Wartezimmer. Voller Vorfreude knickte Peggy die Ecke der Seite um. Sie hatte dieses Buch schon so oft gelesen, dass sie es beinahe auswendig kannte, und das war auch gut so, weil sie schon wieder ihre Lesebrille verlegt hatte. Draufgänger in Weiß. Eins neunzig groß, mit einem Kinn wie gemeißelt und strahlend blauen Augen, widmet der weltbekannte Herzchirurg Dr. Sebastian McBride sein Leben dem Heilen und Brechen von Herzen. Natürlich hatte das nichts mit dem echten Leben zu tun, aber welche Frau brauchte nicht ab und zu ein wenig Eskapilismus, oder wie das hieß, in ihrem Leben?
«Peggy Smart?» Dr. Lim stand in der Tür und lächelte sie freundlich an.
Peggy stopfte das Buch in ihre Tasche, schaukelte ein wenig vor und zurück und hatte schließlich genug Schwung gewonnen, um aufzustehen. Die Hand, die er ihr reichte, war warm und glatt wie eine Kinderhand.
«Ich bin Dr. Lim, aber Sie können mich gern Stephen nennen.»
Peggy dachte kurz darüber nach. Aus der Nähe sah er sogar noch jünger aus – als hätte er sich die Brille seines Vaters ausgeliehen. Auf seinem Kinn prangte ein Pickel. Sie war alt genug, um seine Großmutter zu sein. In was für einer seltsamen Welt sie doch lebte. Jahr für Jahr wurde ihre Generation noch ein Stückchen weiter abgehängt, während die Zeit immer schneller verging. Doch jetzt war sie da, die perfekte Gelegenheit, um zu demonstrieren, dass sie durchaus in der Lage war, mit der wild galoppierenden Zeit mitzuhalten.
«Danke, Dr. Stephen», sagte sie. Die Worte kamen ihr ganz natürlich von den Lippen. «Nennen Sie mich Peggy.»
«Okay. Was kann ich für Sie tun?»
Peggy fischte das Sardellenglas aus den Tiefen ihrer Handtasche, wickelte es aus und stellte es behutsam vor sich auf den Tisch. Die Urinprobe changierte zwischen Chardonnay und Wermut. Sie konnte dem jungen Arzt nicht in die Augen sehen. Es war so peinlich, als läge zwischen ihnen ein abgeschlagenes Körperteil. Sie wappnete sich innerlich für das unvermeidliche Antibiotikum, das er ihr sicher gleich verschreiben würde und das ihr außer sieben Tagen Übelkeit nicht viel bringen würde. Wieso konnte sie es nicht einfach aussprechen? Wieso hatte sie nicht den Mut, ihn um Hilfe für ihr Problem zu bitten, anstatt zu hoffen, dass ihr ein Wunder widerfuhr? Sie war eine erwachsene Frau, Mutter zweier Kinder – drei, wenn sie Basil mitzählte – und Großmutter. Aber alte Gewohnheiten waren nun einmal nur schwer zu verändern.
Dr. Stephen räusperte sich und schwieg. Er konsultierte seinen Bildschirm und klickte sich mit der Maus durch Peggys Krankenakte. Nach ein paar Minuten lehnte er sich zurück, platzierte die Ellbogen auf den Armlehnen und legte die Spitzen seiner Kinderfinger vor dem Gesicht zusammen.
«Als Arzt ist man immer auch ein bisschen Detektiv», sagte er. «Man muss stets nach Hinweisen Ausschau halten.»
«So wie Inspector Barnaby, meinen Sie?»
«In gewisser Weise, ja.»
Die Hinweise waren ja wohl offensichtlich. Das Zehenkrümmen, das Lippenzusammenpressen, das Händeringen. Von dem Glas auf dem Tisch und dessen Inhalt ganz zu schweigen.
«Die Diagnose ergibt sich aus der Geschichte. Das war das Allererste, das ich in meinem Medizinstudium gelernt habe.»
Peggy wurde nervös. Geschichte war noch nie ihre Stärke gewesen. Ted hatte sich im Fernsehen ständig diese endlosen Kriegsdokumentationen angesehen: die beiden Weltkriege, der Amerikanische Bürgerkrieg, der Vietnamkrieg. «Ich habe es mehr mit Tierdokus», sagte sie.
Dr. Stephen räusperte sich. «Nein, ich meine die Krankheitsgeschichte. Wann haben die Beschwerden begonnen, was hat Linderung verschafft, was hat sie verschlimmert? Solche Dinge.»
«Ach so, natürlich.»
«Also. Kehren wir noch einmal ganz an den Anfang zurück. Seit wann haben Sie schon Probleme beim Wasserlassen?»
Wie Luftblasen stiegen eine ganze Reihe unschöner Szenen aus Peggys Unterbewusstsein an die Oberfläche. Sie schob die ungebetenen Bilder beiseite.
Nein. Selbstmitleid kommt nicht in Frage. Ich werde vor diesem reizenden jungen Mann ganz gewiss nicht in Tränen ausbrechen.
«Solange ich denken kann. In dieser Beziehung war ich schon immer anders als andere Menschen. Bereits als Kind hat meine Mutter mich für meine Missgeschicke bestraft. Das hat es nur noch schlimmer gemacht. Sie sagte, ich wäre verkehrt, bei mir wäre was nicht in Ordnung.»
«Und Sie sind deswegen nie behandelt worden?»
«Es war mir immer zu peinlich, mit jemandem darüber zu sprechen. Bis jetzt. Ich dachte immer, meine Mutter hätte recht gehabt und ich wäre so eine Art Missgeburt. Ich glaube, ich habe einfach gelernt, es zu verbergen.»
«Es war bestimmt nicht leicht für Sie, all die Jahre heimlich zu leiden.»
«Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, so zu tun, als wäre ich normal. Jedenfalls gut genug, um zu heiraten und zwei Kinder großzuziehen. Dann kam irgendwann die Menopause, und von da an ging es nur noch bergab.» Zusammen mit den ganzen anderen Widrigkeiten: das Herzrasen, die nächtlichen Schweißausbrüche, die dafür sorgten, dass sie jeden Morgen die Bettwäsche wechseln musste, und die ständigen Hitzewallungen, die immer völlig aus dem Nichts kamen. Der arme Ted musste sich vorgekommen sein, als lebte er mit einer Betrügerin zusammen: eine schwitzende Fremde im Körper seiner Ehefrau, die bei der kleinsten Kleinigkeit aus der Haut fuhr.
Zu ihrem Schreck spürte Peggy, wie eine Träne sich aus dem Augenwinkel löste und ihr über die Wange rann. Dr. Stephen reichte ihr eine Schachtel Kosmetiktücher, und sie putzte sich die Nase. Wieso ging ihr das nach all den Jahren plötzlich so nahe? Hatte es damit zu tun, dass sie Brian begegnet war? Eines musste man den Heldinnen ihrer Groschenromane lassen, die Frauen von heute waren viel direkter als ihre Generation. Es lag an ihr, den ersten Schritt zu machen. Doch ihr war, als hätte eine riesige Inkontinenzeinlage sämtliches Selbstvertrauen aufgesaugt.
Dr. Stephen reichte ihr den Papierkorb hinüber und hörte aufmerksam zu, während Peggy ihm ihre Geschichte erzählte. Als sie bei Teds Tod anlangte, war der Papierkorb voll von durchweichten Kosmetiktüchern.
«Es tut mir schrecklich leid. Ich bin normalerweise nicht so nah am Wasser gebaut.»
Dr. Stephen legte seine Hand auf ihre. «Ich würde Ihnen gerne helfen», sagte er. «Wenn Sie bereit sind, mir zu vertrauen.»
Peggy nickte. Was blieb ihr anderes übrig? Zum ersten Mal in ihrem Leben gab es einen Hoffnungsschimmer.
«Ich verspreche nichts, aber wir können ein paar Dinge versuchen», sagte Dr. Stephen.
Peggy beugte sich gespannt zu ihm vor, bereit, die Zauberformel zu empfangen, die eine gehemmte alte Dame mit einem peinlichen Geheimnis in eine selbstbewusste reife Frau verwandeln würde, die der Toilette lang genug fernbleiben konnte, um einen Mann namens Brian gefahrlos zum Abendessen zu sich zu bitten.
«Ich bin bereit», sagte sie feierlich.
«Gut. Zuerst muss ich Sie untersuchen.»
Peggy schluckte. Sie untersuchen? Vermutlich meinte er damit nicht nur einen flüchtigen Blick auf ihre Mandeln. Verflixt, damit hatte sie nicht gerechnet, aber wie hatte Celia vorhin bereits so treffend gesagt? Er war Arzt, kein Anlageberater.
Als Dr. Stephen endlich die Gummihandschuhe in den Abfalleimer schnalzte, hatte Peggy im Geiste sämtliche Blumentöpfe auf ihrer Terrasse neu arrangiert und sich für eine neue Sitzgarnitur unter der Minipergola entschieden. Und sie hatte die Fahrt in das nette Gartencenter geplant, wo man zwischen Saatgut und wetterfesten Kinkerlitzchen so nett Kaffee trinken konnte.
Dr. Stephen zog diskret den Vorhang hinter sich zu, während Peggy sich anzog.
Aus Angst, ihm sowieso schon viel zu viel Zeit gestohlen zu haben, knüllte sie die Strumpfhose zusammen und stopfte sie zu Draufgänger in Weiß in ihre Handtasche.
Nervös nahm sie wieder Platz. «Muss ich operiert werden?» Peggy hasste Krankenhäuser, vor allem seit das mit Ted geschehen war. «Ich frage nur, weil ich neulich zufällig gehört habe, wie Marjorie von ihrer Cousine erzählte, der ein Intimchirurg den Beckenboden einer rumänischen Bodenturnerin versprochen hat.»
«Ich fürchte, eine Operation würde hier nicht helfen», sagte Dr. Stephen und erläuterte ihr dann sehr detailliert ihr Leiden, welches durchaus weit verbreitet war und außerdem nichts, wofür man sich schämen müsste.
«Wollen Sie etwa sagen, ich bin nicht die Einzige?» Damit hatte sie nicht gerechnet. Allerdings wäre Peggy auch nie auf die Idee gekommen, über so etwas bei einer Tasse Tee zu plaudern.
Dr. Stephen lächelte ein wenig süffisant und reichte ihr eine Broschüre. Sie war voll anatomischer Schaubilder und gespickt mit Fachjargon, der den Gedanken nahelegte, sie könnte womöglich eher einen Anwalt als einen Arzt brauchen. Ein grauhaariges Paar auf Fahrrädern zierte den Titel. Abgesehen von dem Zahnpastalächeln hätten das ebenso gut Brian und sie sein können.
«Jede dritte Frau leidet im Laufe ihres Lebens irgendwann an Inkontinenz. Sie wären überrascht, wie viele junge Frauen davon betroffen sind. Ich habe ständig damit zu tun.»
«Jede dritte?» Peggy durchkämmte im Geiste das überfüllte Wartezimmer, in dem sie vorhin gesessen hatte. Welche ihrer Mitbewohnerinnen wohl genau dasselbe peinliche Leiden vor der Welt verbargen wie sie?
«Ich möchte, dass Sie einen Termin bei einer Kontinenzberaterin vereinbaren. Hier ist die Telefonnummer.» Dr. Stephen reichte ihr eine Visitenkarte. Schwester Slack. Das klang reichlich unseriös. Slack wie Schlapp? Die größte Herausforderung wäre, bei diesem Namen ein ernstes Gesicht zu wahren.
«Vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen.» Peggy hätte den jungen Arzt um ein Haar umarmt. Stattdessen schüttelte sie kräftig seine Hand und tupfte sich den nächsten Schwall Tränen weg.
Wieder im Wartezimmer, öffnete Peggy die Handtasche, um nach der hastig hineingestopften Strumpfhose zu sehen. Dabei fiel ihr versehentlich das Buch aus der Tasche, und als sie sich danach bückte, kippte die Handtasche um, und der Inhalt verteilte sich auf dem Fußboden. Es gelang ihr, die Geldbörse und den Schlüsselbund zu retten, doch die straff zusammengeknüllte Strumpfhose wagte den Sprung in die Freiheit und kullerte über die Auslegeware. Den Blick noch immer von Tränen verschleiert, tasteten Peggys Finger vergebens auf dem Teppichmuster herum.
«Hier», sagte eine Frauenstimme. «Das haben Sie verloren.»
Jemand drückte ihr die zusammengeknüllte Strumpfhose in die Hand, gefolgt von Draufgänger in Weiß. Peggy lief es eiskalt den Rücken hinunter. Die Stimme jagte ihr einen eisigen Schauder der Erinnerung über den Rücken.
Peggys Herz fing an zu galoppieren wie ein aufgescheuchtes Fohlen.
War das tatsächlich möglich?
Nach all den Jahren?
Angie.
3Die Hausschlüsselkrise
Zusammenpuzzeln. Das war Peggys Lieblingswort beim Scrabble und brachte immerhin neunundzwanzig Punkte. Sie wartete immer noch auf den richtigen Augenblick, es ins Gespräch zu streuen und Brian mit ihren Scrabble-Kenntnissen zu beeindrucken.
«Ist alles in Ordnung?»
«Wie bitte?» Peggy hatte keine Ahnung, wo sie war und wie sie hier gelandet war. Sie sah sich um und suchte zwischen Seidenblumenarrangements und gerahmten Aquarellen nach Hinweisen.
Wo bin ich?
Christine fasste sie sanft an der Schulter und dirigierte sie zu einem Stuhl im Foyer. «So, da wären wir. Setzen Sie sich und ruhen Sie sich einen Augenblick aus.»
Sich ausruhen. Sich wieder zusammenpuzzeln. Die fehlenden Teile finden und wieder zusammensetzen. Und zwar schnell. Verwirrt zu wirken, war nun wirklich das Letzte, was sie brauchen konnte. Peggy setzte ein möglichst aufgeräumtes Gesicht auf und strahlte Christine an. «Was für eine hübsche Jacke!», sagte sie.
Christine runzelte die Stirn. «Soll ich David anrufen?»
Es hatte keinen Sinn, ihr etwas vorzumachen. «Nein danke. Mir geht es gut», sagte Peggy.
«Oder Jenny? Soll ich lieber Jenny anrufen?»
«Nein! Jenny auf gar keinen Fall!» Nicht ihre Tochter. Das konnte sie unmöglich riskieren. Ein einziger besorgter Anruf von Christine, und schon würde Jenny vor der Tür stehen und mit ihr einen «kleinen Ausflug» unternehmen, von dem es kein Zurück mehr gäbe. Schwups, und schon würde Peggy sich in irgendeinem Seniorenheim wiederfinden, mit einer Tasse Tee und einem Keks in der Hand vor dem Fernseher geparkt, auf ewig verurteilt zu Bares für Rares.
«Soll ich Dr. Lim bitten, nach Ihnen zu sehen?»
«Ich komme gerade von ihm», sagte Peggy und umklammerte die Broschüre und die Visitenkarte der Blasentante.
«Halten Sie es für möglich, dass Sie eben einen winzigen Schlaganfall erlitten haben?»
Christine hatte zwar die Stimme gesenkt, trotzdem befanden sie sich in Hörweite der Warteschlange an der Kaffeetheke. Bis zum Nachmittagstee hätte sich die Nachricht von Peggy Smarts «Schläglein» wie ein Lauffeuer in der Siedlung verbreitet. Was Geheimnisse betraf, ging es hier schlimmer zu als im Hauptquartier vom MI5.
«Mir geht es gut.» Los, gib dir mehr Mühe, aber übertreib es nicht. «Ich stand nur ein kleines bisschen unter Schock. Das ist alles.» Ehrlich gesagt war Peggy sich nicht sicher, was den größeren Schrecken verursacht hatte: sich untenrum für einen Mann frei zu machen, der jung genug war, um ihr Enkel zu sein, oder aus heiterem Himmel diese Stimme wieder zu hören.
Angie. Angie Valentine. Internationale Jetsetterin. Fabelhafte Fashionista. Glamouröse Karrierefrau, die sogar mal für die Vogue gearbeitet hatte. Peggy hatte vor einigen Jahren einen Artikel über sie gelesen. Zuerst war sie völlig aus dem Häuschen gewesen, so unvermutet das vertraute Gesicht wiederzusehen, und hatte sich, sobald die Sprechstundenhilfe ihrer Podologin telefonierte, heimlich die Seite aus der Zeitschrift gerissen. Wahrscheinlich hatte sie den Artikel zwischen die Seiten ihres Tagebuchs gesteckt und irgendwann weggeworfen, denn sie hatte seit sehr langer Zeit nicht mehr an Angie gedacht. Bis heute. Was hatte eine Frau wie Angie Valentine ausgerechnet an einem so entschieden unglamourösen und nicht internationalen Ort wie dem Jacaranda Retirement Village zu suchen?
Christine reichte Peggy ein Glas Wasser. Warum taten Leute das? Wasser war nun wirklich das Letzte, was Peggy im Augenblick brauchte. Schon beim Anblick klarer Flüssigkeit krümmten sich ihre Zehen.
«Soll ich Sie zu Ihrer Wohnung fahren?»
Bitte nicht. Alles, nur nicht der Golf-Buggy. Der Golf-Buggy war nun wirklich der Anfang vom Ende.
«Mir geht es schon wieder viel besser. Danke. Ich werde wohl nach Hause spazieren und Basil an die frische Luft lassen. Nicht, dass er noch anfängt, sich Sorgen zu machen», sagte Peggy.
Christine blickte sich nach beiden Seiten um und beugte sich vertraulich zu ihr vor. «Wo wir gerade dabei sind, ich möchte Sie vorwarnen. Uns ist da eine winzige Angelegenheit zu Ohren gekommen», flüsterte sie und maß die exakte Größe besagten Problems zwischen Daumen und Zeigefinger ab.
Im Jacaranda Retirement Village gab es keine «winzigen Angelegenheiten». Weltkriege waren wegen weniger vom Zaun gebrochen worden. «Was für eine Angelegenheit?»
«Es geht um Basil. Es gab eine Beschwerde.»
Peggy sträubten sich die Nackenhaare. «Was für eine Beschwerde denn?» Der arme kleine Shih Tzu war taub und so gut wie blind. Er verließ die Wohnung lediglich, um irgendwo kurz das Bein zu heben, und bellte, außer wenn der Postbote kam, so gut wie nie.
«Na ja. Wir haben einen Antrag auf Revidierung der Regeln zur Haltung von Haustieren erhalten.»
«Welche Art von Regeln?»
«Gesundheit und Sicherheit der Siedlungsbewohner.»
Wie um alles in der Welt sollte Basil jemandes Gesundheit oder Sicherheit gefährden? Peggy wusste, dass der Tag, an dem sie ihn einschläfern lassen musste, irgendwann kommen würde. Sie hatte sich immer vorgestellt, dass David sie dann zum Tierarzt fahren würde, aber er hatte inzwischen mit seinem Beruf und den Kindern zu viel um die Ohren. Mit Mel verheiratet zu sein, war an sich schon ein Fulltimejob. Zur Not konnte sie zwar immer noch Jenny fragen, aber ihre Tochter wohnte zu weit weg auf dem Land. Peggy kannte die Strecke gut. Sechs Stunden hin und zurück, vierzehn Toilettenpausen.
«Das verstehe ich nicht. Als ich in meine Wohnung zog, hieß es, ich dürfe Basil behalten, bis er stirbt.»
«Der genaue Wortlaut war, Sie dürften Basil behalten, solange es keine Beschwerden gibt.» Christine legte mitfühlend den Kopf schief. «Jetzt gibt es eine Beschwerde.»
«Von wem?»
«Darauf zu antworten, steht mir nicht zu. Sie erhalten zu gegebener Zeit ein offizielles Schreiben, doch es genügt wohl zu sagen, dass Basil eine Frist gesetzt bekommt, es sei denn, das Komitee entscheidet auf der nächsten Versammlung zu seinen Gunsten.»
«Eine Frist wozu?»
«Zur Ausweisung.»
«Wie lange wird die sein?»
«Vier Wochen.»
Die Automatiktür stellte sich stur, als Peggy darauf zustürmte. Sie trat ein paar Schritte zurück und wedelte hektisch mit den Armen. Endlich reagierte der Sensor, und die Türen glitten auf. Heiße Luft wehte durch das Foyer wie ein Föhn. Aus der Cafeteria ertönte Protestgemurmel.
Alte Meckerliesen!
Manchmal hasste Peggy die Siedlung und bereute es, dass sie das Haus nach Teds Tod so schnell verkauft hatte. Jennys Worte spukten ihr im Kopf herum. «Denk doch nur mal an die vielen Aktivitäten, Mum», hatte sie gesagt. «Und jede Menge Leute in deinem Alter.»
Genau das war ja das Problem. Die tägliche Rollatorparade war eine permanente Erinnerung an ihre eigene Endlichkeit. Es war, wie auf einen Zug zu warten, der vielleicht noch jahrelang nicht und dann plötzlich ohne jede Vorwarnung angedonnert kommt. Peggy fühlte sich völlig in der Schwebe: zu alt, um jung zu sein, und zu jung, um alt zu sein.
Als sie den Parkplatz überquerte, frischte der Wind auf. Staub wehte ihr ins Gesicht, und sie musste husten. Armer Basil. Welcher kaltherzige Mensch beschwerte sich über ein unschuldiges Hündchen? Sie würde ihm heute Abend etwas ganz Besonderes zu fressen machen. Hackfleisch mit Kartoffeln. Seine Lieblingsspeise.
Vor der Haustür angekommen, streckte Peggy die Hand in ihre Tasche und wühlte nach dem Haustürschlüssel. Sie schüttelte die Tasche ein paarmal hin und her und lauschte auf das Klimpern. Wo war der Schlüssel hin?
Mit wachsendem Unmut räumte sie die größeren Einzelteile vor sich auf den Gehweg. Strumpfhose. Brieftasche. Eselsohriges Taschenbuch. Lesebrille … aha. Da ist sie also. Kein Schlüsselbund.
Ein altvertrautes Kribbeln in der Blase trieb sie zur Eile an. Basil kratzte auf der anderen Seite an der Tür und wollte so dringend raus wie sie rein. Peggy kontrollierte die Innentaschen und wippte auf den Absätzen vor und zurück, um sich abzulenken.
Als das Innenfutter blank vor ihr lag und noch immer kein Schlüssel in Sicht war, erwog sie ernsthaft, sich in die Gardenien zu erleichtern, wie Basil es morgens häufig machte. Sie trippelte auf der Stelle, krümmte die Zehen, wand sich hin und her, presste die Zähne zusammen und durchwühlte hektisch sämtliche Außentaschen ihrer Handtasche.
Nichts.
Plötzlich spürte Peggy jemanden hinter sich näher kommen.
Bitte verschwinde, wer du auch sein magst!
«Ich glaube, den haben Sie verloren.»
Peggy drehte sich um. Brian kam auf sie zu. «Ich rufe Ihnen schon seit dem Parkplatz hinterher, aber Sie haben mich nicht gehört.»
Ausgerechnet Brian.
«Danke sehr.» Peggy riss ihm den Schlüsselbund aus der Hand und rang sich mit zusammengebissenen Backenzähnen ein Lächeln ab. Brian zögerte. Was? Wartete er etwa auf ihre Einladung hereinzukommen oder hatte er Angst, sie hätte eine Kiefersperre? Das frische Früchtebrot auf der Anrichte neben dem Wasserkocher fiel ihr ein. Eine Scheibe wäre jetzt herrlich, mit einer schönen Tasse Tee, und dazu Brians Gesellschaft.
Sie steckte den Schlüssel ins Schloss. Krampf folgte auf Krampf, jeder immer noch drängender als der letzte. Sie konnte keine Sekunde länger warten.
«Es tut mir leid, Brian, ich muss dringend los.»
Brians dunkle Augenbrauen furchten sich fragend zusammen. Obwohl seine Haare beziehungsweise das Wenige, was davon noch übrig war, schneeweiß waren, hatten seine Augenbrauen erstaunlicherweise ihre Farbe behalten. Peggy riskierte den Bruchteil einer Sekunde und stellte sich Brian als gutaussehenden jungen Mann vor.
«Na», sagte Brian, «dann will ich mich mal wieder auf den Weg machen.»
Er tippte sich an die Krempe seines Strohhuts und ging davon.
4Lieblich oder trocken?
Wie kam es, dass Peggy in der Lage war, allein beim Anblick der Regale ihrer Speisekammer Dutzende kulinarische Variationen zu kreieren, und zwar mit den aufregendsten Geschmackskombinationen, ihr es aber, wenn es um ihre Garderobe ging, völlig an Vorstellungskraft mangelte? In ihrem Kleiderschrank sah es aus wie in den Regalen bei Oxfam, derart vollgestopft mit nicht zueinanderpassenden Kleidungsstücken, dass es unmöglich war, die einzelnen Teile auseinanderzuhalten, ganz davon zu schweigen, sie harmonisch miteinander zu kombinieren.
Das war alles viel zu anstrengend. Kein Wunder, dass es in der Siedlung Leute gab, die sich irgendwann einfach aufgegeben hatten und im Nachthemd oder im Pyjama durch die Gegend liefen. Wieso konnte sie nicht auch zu den Frauen gehören, die in Sachen Garderobe immer das richtige Händchen besaßen? Von wegen immer, Peggy Smart wäre auch schon mit ab und zu zufrieden gewesen, ach was! Einmal im Leben das richtige Händchen würde schon reichen. Von Natur aus stilsichere, modebewusste Frauen wie Angie Valentine schienen einen Instinkt dafür zu besitzen, was ihrer Figur schmeichelte und was sich kombinieren ließ. Das musste ihnen in den Genen liegen – Angie Valentine als Mitglied einer Untergattung von Frauen mit der genetischen Prädisposition, grundsätzlich immer zu den richtigen Accessoires für einen eleganten, niveauvollen Look zu greifen.
Dabei sparte Women’s Weekly nicht mit Ratschlägen: Kleiden Sie sich passend zu Ihrer Körperform, achten Sie bei den Basics schon bei der Anschaffung auf den richtigen Mix, vermeiden Sie Querstreifen. Ein Artikel hatte Damen jenseits der sechzig empfohlen, Schwarz zu meiden, es sei denn für Beerdigungen. Peggy war, seit sie in die Seniorensiedlung gezogen war, schon auf einigen Trauerfeiern gewesen. Ehrlich gesagt, sie hatte mehr Menschen auf einer Trauerfeier getroffen als zur Happy Hour. Das einzig Gute war, dass die Trauergäste heutzutage oft aufgefordert waren, in den Lieblingsfarben des Verstorbenen zu erscheinen. An der aktiven Beerdigungsszene in ihrer Siedlung lag es, dass sich inzwischen ein Kaleidoskop an Primärfarben in ihre ansonsten eher neutrale Garderobe mischte.
Im Küchenradio lief schon die Feierabendsendung, und Peggy geriet in Panik. Ihr lief die Zeit davon. Sie musste für die Willkommensveranstaltung heute Abend noch die Häppchen vorbereiten. Sie musste sich wirklich beeilen, aber der offene Kleiderschrank lag leider als undurchdringlicher Dschungel zwischen ihr und den Lachs-Blinis.
Basil lag auf dem Bett, die Pfoten vor sich ausgestreckt wie eine schneeweiße Sphinx, und sah ihr zu.
«Bitte sag mir, was ich anziehen soll.»
Sie sehnte sich danach, dass Ted etwas für sie heraussuchte, ihr den Reißverschluss zumachte und ihr sagte, sie sehe wunderbar aus. Sie hätte sogar noch im Kartoffelsack seine rosa bebrillte Zustimmung bekommen.
Peggy schloss die Augen und versenkte die Hand in der Wand aus Kleidungsstücken. Was sie auch herauszerren mochte, sie würde es anziehen. Dazu noch ein Spritzer Parfüm, und fertig. Außerdem würde Brian sowieso viel zu sehr damit beschäftigt sein, die weiblichen Neuzugänge zu unterhalten, um sie auch nur zu bemerken.
Abgesehen davon war Peggy nach dem Vorfall mit dem Hausschlüssel ohnehin noch nicht wieder bereit für eine Begegnung.
In der kleinen Clubhausküche herrschte glühende Hitze. Schweiß lief Peggy den Hals hinunter und durchtränkte das Polster aus Taschentüchern, das sie sich in den Ausschnitt geschoben hatte. Am Anfang hatte das tiefe Dekolleté sie gar nicht gestört. Das Kleid, das sie blind von der Stange geangelt hatte, sah ganz passabel aus, auch wenn sie sich beim besten Willen nicht daran erinnern konnte, welcher ihrer verblichenen Mitbewohner ausgerechnet Königsblau geliebt hatte. Ihre Massen in den Stoff zu quetschen, erinnerte Peggy an das Verteilen von Kuchenglasur in einem Spritzbeutel. Zum Glück bedeckte das Kleid ihre Knie.
Doch als sie anfing, sich in der Küche zu schaffen zu machen, wendeten die Dinge sich zum Schlechteren. Das Kleid schien in der feuchtheißen Luft zu schrumpfen. Sie kam sich vor wie vakuumverpackt. Der Synthetikstoff klebte an ihr und rutschte bei jedem Schritt ein Stückchen weiter die schweißnassen Oberschenkel hinauf. Peggy bekam schreckliche Angst, die Neuzugänge versehentlich mit sehr viel mehr Pikantem zu begrüßen als nur ein paar Knabbereien. So, wie sie aussah, konnte sie eine Begegnung mit Brian definitiv nicht riskieren. Sie würde sich den ganzen Abend in der Küche verstecken müssen.
«Du hast dich mal wieder selbst übertroffen.» Jim Wilde mopste sich ein Pastetchen von der Platte. Wann immer es irgendwo umsonst etwas zu essen oder einen wohlgeformten Knöchel zu bewundern gab, konnte man sich darauf verlassen, dass Jim ein bisschen frech wurde.
«He, Pfoten weg, die sind für unsere Neuen.»
«Bist du dir wirklich sicher, dass du mich nicht doch heiraten willst, Deidre?» Jim steckte sich das Pastetchen ganz in den Mund und zwinkerte.
«Wie immer vielen Dank für das freundliche Angebot», erwiderte Peggy, «aber nein danke.»
Im Leben nicht.
Jim war völlig harmlos und hatte ein Namensgedächtnis wie ein Sieb, aber das war Teil seines Charmes. Er gehörte in der Siedlung zu den lebendigsten Exemplaren. Er hatte für einen Mann seines Alters eine gute Figur und außerdem einen Satz kostspieliger Keramikveneers im Mund. Mit seinen Jeans und der Lederjacke sah er aus wie ein alternder Rockstar, und genau das war er auch. Sein hinfälliges Gehör und die Reibeisenstimme zeugten von einem Leben auf der Überholspur bei voller Lautstärke. Betrüblicherweise sang er inzwischen nur noch unter der Dusche. Seine leidgeplagten Nachbarn nannten es «Jimmys Wassermusik», auch wenn die Melodien eher Hendrix als Händel waren.
«Ich liebe den Willkommensabend», sagte er und schnappte sich das nächste Pastetchen. Dann warf der nicht mehr allzu wilde Jim Wilde ihr unter seinen buschigen Augenbrauen einen feurigen Blick zu und tänzelte mit einem Elvis-Kräuseln auf der Oberlippe summend davon. Nach ein paar Schritten blieb er stehen und massierte sich die Rückseite des Oberschenkels. Armer Jim. Offensichtlich machte ihm sein Ischias wieder zu schaffen. Peggy fragte sich, wie viele Frauen er wohl heute Abend noch mit Deidre ansprechen würde.
Von ihrem Aussichtspunkt an der Ausgabe sah sie zu, wie die Bewohner einzeln oder paarweise eintrafen. Zu den Frühankömmlingen gehörte Mavis, glänzend in Kirschrot, und direkt dahinter huschte Sheila Martin in Marineblau herein. Peggy musste unwillkürlich an David Attenborough denken. Sehen Sie nur, wie der Storch auf dem Rücken des ahnungslosen Wasserbüffels reitet. Sie grinste und schob sich ein Pastetchen zwischen die Lippen.
Das Clubhaus füllte sich schnell. Jim ging an der Tür in Stellung und trennte die Ankömmlinge in einzelne Damen und Paare, wobei er Letztere zur Unterhaltung an Mavis weiterleitete. Dank des üblichen Mangels an alleinstehenden männlichen Exemplaren, ob Neuzugänge oder nicht, zog Jim aus seiner Position den größtmöglichen Vorteil. Peggy war hin- und hergerissen zwischen ihren Pflichten an der Theke und dem Schauspiel vor ihren Augen. Es war faszinierend, einen Profi wie Jim in Aktion zu erleben, zuzusehen, wie er auf der Suche nach dem nächsten Opfer den Blick durch den Raum schweifen ließ. Wieder kam ihr David Attenborough in den Sinn.
Gerade als Peggy zwischen zwei Tabletts Miniwienern im Schlafrock eine Verschnaufpause einlegte, betrat Celia den Saal. Sie hatte den unvermeidlichen Overall gegen Jeans und ein sauberes T-Shirt getauscht, und Peggy stellte sie sich als junge Frau vor, rittlings auf ihrem geliebten Motorrad. Sie und ihre Maschine waren beide derselbe Jahrgang und beide erstaunlich gut erhalten, auch wenn es heutzutage eher das tiefe Röhren des Motors war, das die Männerherzen höherschlagen ließ, als die ausgerissene Debütantin.
Sie steuerte direkt auf die Ausgabe zu und verkündete: «Ich brauche einen Drink.»
«Dann mach dich nützlich und biete Sherry an.» Peggy wies mit dem Kinn auf ein Tablett voll identischer Gläser. «Lieblich links, trocken rechts.»
«Okey-dokey. Vielleicht genehmige ich mir aber zuerst selbst ein paar. Bei meiner Enfield hat die verfluchte Kupplung den Geist aufgegeben. Wie mich das nervt. Manchmal glaube ich, das alte Mädchen macht mehr Ärger, als sie es wert ist.»
Celia wohnte nur ein paar Türen weiter, und Peggy war an den hochtourigen Motorenlärm gewöhnt. Aus Celias Garage ergossen sich oft die Einzelteile ausgeschlachteter Motoren ins Freie hinaus und oft genug auch bis auf den Weg zur Haustür hinüber. Niemand schien sich daran zu stören. Zu Peggys Erstaunen wirkte Brian an Celias Hobby besonders interessiert. Sie hatte ihn bereits des Öfteren vor der Garage stehen sehen, um Celias enthüllte Teile zu bewundern.




























