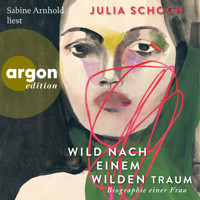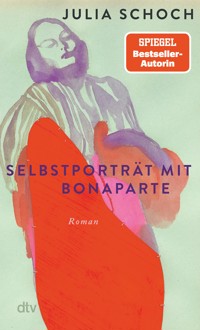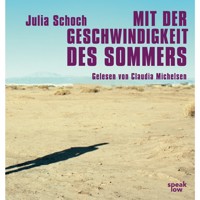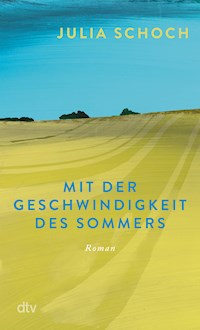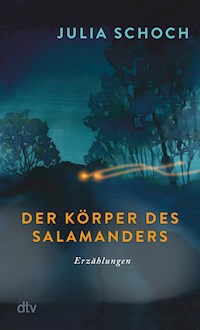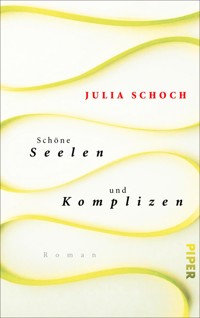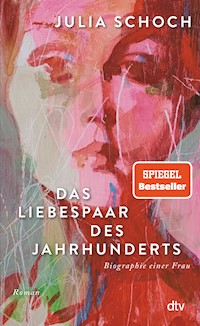
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biographie einer Frau
- Sprache: Deutsch
Wo geht die Liebe hin, wenn man sagt, sie ist verschwunden? Eine Frau will ihren Mann verlassen. Nach vielen Jahren Zusammenleben und Ehe ist sie entschlossen und bestürzt zugleich: Wie konnte es nur dazu kommen? Während sie ihr Fortgehen plant, begibt sie sich in ihren Gedanken weit zurück. Da waren die rauschhaften Jahre der Verliebtheit, an der Universität, zu zweit im Ausland und später mit den kleinen Kindern, aber da gab es auch die Kehrseite – Momente, die zu Wendepunkten wurden und das Scheitern schon vorausahnen ließen. Doch ist etwas überhaupt gescheitert, wenn es so lange dauert? Julia Schoch, literarische Archäologin ihres Lebens, legt frei, was im Alltag eines Paares oft verborgen ist: die Liebesmuster, die Schönheit auch in der Ernüchterung. Ein Loblied auf die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Im Grunde ist es ganz einfach: Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter, und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Erstaunlich, dass es so einfach ist. Und noch etwas erstaunt mich: Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt: Ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen.«
Eine Frau will ihren Mann verlassen, damit beginnt das Buch. Nach vielen Jahren Zusammenleben und Ehe ist sie entschlossen und bestürzt zugleich: Wie konnte es dazu kommen? Während sie ihr Fortgehen plant, begibt sie sich in ihren Gedanken weit zurück. Da waren die rauschhaften Jahre der Verliebtheit nach dem Mauerfall, erst an der Universität in einer ostdeutschen Stadt, dann zu zweit im Ausland und später mit den kleinen Kindern, aber da gab es auch die Kehrseite – Momente, die zu Wendepunkten wurden und das Scheitern schon vorausahnen ließen. Doch ist etwas gescheitert, wenn es so lange dauert?
Julia Schoch, literarische Archäologin ihres Lebens, legt frei, was im Alltag eines Paares oft verborgen ist: die Liebesmuster, die Schönheit auch in der Ernüchterung. Ein Loblied auf die Liebe.
Julia Schoch
Das Liebespaar des Jahrhunderts
Roman
almost you
almost me
almost blue
Chet Baker
Im Grunde ist es ganz einfach: Ich verlasse dich.
Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter, und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist. Und noch etwas erstaunt mich: Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe.
Am Anfang habe ich zu dir gesagt: Ich liebe dich.
Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen.
In diesem Fall allerdings, dem letzteren, darf man nicht warten. Man muss es sagen, gleich wenn der andere hereinkommt. Am besten, es gelangen keine anderen Wörter dazwischen. Man darf nicht ins Plaudern geraten, sonst ist der ganze Plan hin.
Ich gebe zu, es fällt mir schwer, den Satz auszusprechen, es leichthin zu tun. Denn: Was wird danach geschehen? Ich mache mir keine Illusionen. Wenn er heraus ist, ist die Grenze überschritten. Danach ist nichts mehr zurückzunehmen.
Ich habe mich immer gefragt, wie man Sachen, die gesagt worden sind, wieder zurücknehmen kann. Die Wendungen Das habe ich nicht so gemeint oder Vergiss, was ich gesagt habe ergeben für mich keinen Sinn. Statt einer Zurücknahme ist nur ein Erwachen möglich. Worte ändern etwas. Ist der Pfeil erst abgeschossen, holt man ihn nicht mehr zurück.
Ich verlasse dich. Ich weiß nicht genau, wann ich den Satz zum ersten Mal gedacht habe. Und wie viele Male seither. Ich habe ihn sehr lange geübt. Irgendwann fangen bestimmte Vorstellungen an, einem so vertraut zu sein wie das eigene Gesicht, das man jeden Morgen im Spiegel erblickt.
Wenn ich an die Zeit unseres Zusammenseins denke, erschrecke ich. So viele Jahre! So viele Jahre lassen sich auf ein paar Stunden Erinnerung zusammenstauchen.
Das gefällt mir nicht.
Andererseits will man auch nicht dreißig Jahre brauchen, um sich an dreißig Jahre zu erinnern. Ich will es nicht.
Was am weitesten zurückliegt, taucht für gewöhnlich am klarsten auf.
Damals bewohnte ich eine kleine Wohnung in einer Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Die Wohnung lag im sechsten Stock. Es war die Wohnung, in der ich auch die letzten Jahre meiner Jugend verbracht hatte, zusammen mit meinen Eltern. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie bereits verschwunden, jeder in eine andere Richtung, es gab keine Familie mehr. Sie hatten sich getrennt, ungefähr im selben Moment, als ich zu studieren begann, und ich lebte allein darin.
In meinem Schlafzimmer standen ein Bett und ein Tisch. Auf dem Tisch hatte ich eine Menge Bücher gestapelt. Und neben den Büchern stand ein Halmaspiel.
Es war Sommer, die Semesterferien hatten gerade begonnen. Eines Abends klingelte das schwere schwarze Telefon bei mir im Flur. Damals gab es nur Telefone mit einer Schnur dran. Ich stand im Flur und hing an der Schnur. Dieser Reim ist unbeabsichtigt (solche Dinge passieren).
Du hast mich angerufen.
Magst du Vanilletee?, hast du gefragt.
Ich hätte jedes Getränk als mein Lieblingsgetränk bezeichnet, Hauptsache, es kam von dir.
Zehn Minuten später hast du mit dem Vanilletee vor meiner Wohnungstür gestanden. Ich ließ dich rein. Wir setzten uns zum Teetrinken auf den Boden. Das machten damals alle so, es war Mode. Wenn man auf eine Party kam, saßen alle auf dem Boden. Ich glaube, so ist es leichter, sich zu umarmen und gemeinsam auf den Teppich zu sinken. Wir haben es genauso gemacht. Du hast mich umarmt, und dann sind wir zusammen auf den Teppich gesunken.
Sogar den Tee haben wir ausgelassen.
Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, hast du neben mir gelegen. Darüber habe ich mich gewundert. Dann wurde es Mittag, und du warst immer noch da. Mir schien, du warst seit Langem der erste Mensch in meinem Leben, der nicht sofort wieder verschwinden wollte. So sehr war ich die Unverbindlichkeit gewohnt.
Wir verbrachten den Tag auf meinem Balkon unter der Markise. Es war so heiß, dass wir der Wäsche beim Trocknen zusehen konnten. Unten fuhr träge die Straßenbahn vorbei. Wir lasen gemeinsam ein Buch. Es hieß »Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof«. Ein komplizierter Titel, den wir schön fanden. Zuerst las ich es, danach du. Es war nicht sehr dick, und wir schafften es beide am selben Tag.
Ich gab dir einen Schlüssel für die Wohnung. So würdest du nach Belieben kommen und gehen können. Du bist tatsächlich wiedergekommen, immer nachts.
Nach einer Woche sagte ich zu dir: Ich will mich nicht für jemanden ganz und gar aufgeben.
Du hast mich mit großen Augen angesehen und gefragt: Und worum geht es sonst in der Liebe, deiner Meinung nach?
Ich war froh, dass du es so gesehen hast. Ich war nämlich längst dabei, mich aufzugeben.
Ich ging zum Frisör. Er schnitt mir die Haare ab.
Ich habe sie mir wegen der Hitze abschneiden lassen, sagte ich, als wir uns das nächste Mal trafen. In Wirklichkeit wollte ich so aussehen wie du.
Dann, plötzlich, bist du nicht mehr gekommen. Ich machte mir Sorgen. Nicht so sehr um dich. Ich machte mir Sorgen um unsere Geschichte. Schließlich war es eine Liebesgeschichte. Um solche Geschichten muss man sich ganz besonders kümmern, sagte ich mir, vor allem, wenn sie gerade erst beginnen.
Mit einer Flasche Kirschlikör und selbstgebackenen Keksen, in die ich Haschkrümel gemischt hatte, machte ich mich auf den Weg zu dir. Deine Wohnung lag außerhalb der Stadt. Die Fahrt mit dem Bus dauerte eine halbe Stunde. Ich klingelte, aber niemand öffnete. Ein paar Minuten schlich ich um das innen hell erleuchtete Haus. Dann fuhr ich wieder zurück. Ich musste rennen, um den letzten Bus noch zu kriegen, es war schon kurz nach Mitternacht.
Die Kekse schickte ich dir per Post.
In der Mensa der Universität traf ich dich wieder. Es waren immer noch Ferien, deshalb war die Mensa wie ausgestorben. Ich dachte, du würdest so tun, als wären wir uns nie begegnet. Aber du hattest mich nicht vergessen.
Ich sagte: Warum sitzt du hier drin? Draußen ist schönes Wetter. Es sind Ferien!
Du hast die Augen zusammengekniffen und gesagt: Ich mache Ferien, wann ich will.
Du hattest so eine Seelenruhe, da wurde ich auch ganz ruhig. Gleichzeitig war ich aufgeregt.
Oft hast du mich in deinem Auto mitgenommen. Es war ein brauner VW Jetta. Wir fuhren raus aus der Stadt. Einmal flog in der Dämmerung ein Fasan vor uns auf. Ein anderes Mal streifte ein Uhu mit seinen Schwingen die Windschutzscheibe. Beim Herunterkurbeln des Fensters brach mir die Kurbel ab. Du hast gelacht. Den ganzen Sommer über fuhren wir so, mit halb heruntergelassenem Fenster.
Als der Sommer zu Ende war, habe ich dich gefragt: Was ist das zwischen uns?
Statt einer Antwort hast du mich eingeladen, zu einem Picknick im Park.
Wir schlossen einen Drei-Jahres-Pakt. Du hast gesagt: Wenn wir drei Jahre schaffen, sehen wir weiter.
Plötzlich kam ein fremder Hund auf uns zugerast und hat nach dem Käse in unserem Picknickkorb geschnappt. Der Hund ging sofort japsend und würgend zu Boden. Ungerührt, ja fast mit Häme hast du zugeschaut. Als bekäme einer, der sich in unsere Angelegenheiten mischt, sofort die Quittung.
Dann ist der Hund weggerannt.
Und du hast mich geküsst.
(Diese Erzählung erscheint mir wie die Zusammenfassung eines Films, den ich vor sehr langer Zeit und auf einem sehr alten Fernsehgerät gesehen habe. Ich kann nur einzelne Szenen wiedergeben, während mir die Gesamtdramaturgie entfallen ist.)
Es war nicht Schluss nach drei Sommern.
Wir haben einunddreißig Sommer zusammen erlebt. Sechs davon wurden in den Nachrichten als Jahrhundertsommer bezeichnet.
Während dieser Zeit haben wir 42 Reisen unternommen, 27-mal sind wir ins Ausland gefahren.
Wir haben vier Küchen angeschafft.
Fünfmal wurde uns ein neuer Ausweis ausgestellt.
Einmal haben wir einen Brand miterlebt und mussten evakuiert werden.
Wir waren insgesamt siebenmal in der Notaufnahme, viermal wegen eines unserer Kinder und dreimal wegen uns selbst.
Sechsmal wurden wir bestohlen.
Wir haben sechs verschiedene Autos gehabt. Keins davon haben wir neu gekauft.
Wir haben insgesamt neuneinhalb Tage auf Ämtern verwartet.
Wir haben 912 Partien Halma gespielt.
Wir haben 8667 Schulbrote geschmiert und 41 Geburtstagstorten gekauft.
In diesen Jahren haben wir 173 500 Fotos gemacht.
Wir hatten insgesamt 76 Infektionen. (Die meisten davon machte ich durch.)
Wir hatten vier Operationen, davon eine schwere.
Wir haben 1405-mal ein Bad genommen.
281-mal waren wir beim Frisör.
Wir haben beide ein Kopfkissen zerfetzt (jeweils an einem anderen Tag und aus verschiedenen Gründen).
Achtmal schafften wir uns einen neuen Laptop an.
Wir waren auf Beerdigungen und auf Hochzeiten. Aber die habe ich nicht gezählt.
Ich bin mir nicht sicher, ob Jahreszahlen unserer Geschichte etwas Wesentliches hinzufügen würden. Ob unsere Geschichte davon abhängt. Sollte man die Liebe nicht besser beschreiben, ohne sie einer bestimmten Zeit zuzuordnen? Oder braucht es ein Anfangsjahr? Würde es also etwas ändern, wenn ich sagte: Wir lernten uns 1991, 1994 oder im Jahr 2000 kennen? Solche Angaben würden mir das Gefühl vermitteln, wir wären nur das Produkt einer bestimmten Epoche, die Folge gewisser historischer Umstände. Als hätte alles so kommen müssen, wie es gekommen ist. Es käme mir vor, als wäre ich eine Gefangene der Zeit.
Andererseits ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Es gibt keine Variante unserer Geschichte.
Fest steht: Wir waren jung. Es hatte gerade eine Revolution gegeben. Die Berliner Mauer, ja sämtliche Grenzen waren ein paar Jahre zuvor gefallen. Es herrschte Freiheit, wie es damals hieß, die Welt stand uns offen. (Auch das sagte man so.) Trotzdem schien es, als wollten alle meine Freunde, mich eingeschlossen, sterben. Mit großer Geste zugrunde gehen – oder wenigstens das Land verlassen. So stellten wir uns das vor. (Für die meisten Menschen in unserem Alter war es üblich, das neue, große, wiedervereinte Deutschland abzulehnen.) Aber wahrscheinlich hatte es gar nichts mit Politik zu tun. Wir waren uns sicher, die Existenz ist ein düsterer Ort. Sie verlangte nach stummer, poetischer Revolte. Und kein Geschichtsereignis, nicht einmal ein hoffnungsfrohes, würde daran je etwas ändern. Jeder an eine Packung roter Gauloises geklammert, saßen wir in der Cafeteria der Universität, tranken Kaffee und zitierten mit melancholischer Miene Gedichte von Georg Trakl. Eins hieß »De profundis«. Es begann so:
Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fällt.
Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.
Du hast unserer Komödie voller Ungeduld zugesehen.
Ich halte nichts vom Unglücklichsein, hast du schulterzuckend gesagt. Es ist Energieverschwendung.
Von da an achtete ich auf dein Kommen und Wegbleiben. Die Gründe fürs Sterbenwollen gingen mir alle aus.
Ich fand dich stattlich. Ein Wort, das zu der Zeit kein Mensch gebrauchte und das wie aus einem fernen Jahrhundert zu mir angeflogen kam. Als hätte es nur darauf gewartet, endlich wieder einmal benutzt zu werden. Damit ich es für den einzig Richtigen benutzte: dich.
Im Gegensatz zu den meisten Studenten, die Jeans mit Löchern und Trainingsjacken trugen, hast du dich wie ein Dandy gekleidet. Sogar die Dozenten hast du mit deiner Eleganz beschämt. Der Schnitt deiner Anzüge und Hemden war aber nicht modisch, sie schienen eher aus einem Film zu stammen, einem Film mit Cary Grant oder James Stewart. An anderen Tagen bist du herumgelaufen wie ein Bibliothekar: Hornbrille, Schlaghosen, dazu senffarbene Plateauschuhe, die dich noch größer machten, als du ohnehin schon warst.
Du warst so schön, dass du vollkommen gelassen hässlich sein konntest.
Bevor du den Seminarraum betreten hast, hast du jedes Mal gewartet, bis alle anderen saßen. Die Tür flog auf, und du standst da, mit wehendem Mantel, sodass alle Gesichter sich dir zuwandten.
Ich habe später oft daran zurückdenken müssen, wie du jedes Mal dastandst, in diesem wunderbaren wehenden Mantel. Aber dann, noch später, dachte ich immer häufiger etwas anderes. Ich dachte: Nein, der Mantel wehte nicht. Er konnte nicht wehen. Es war ein grüner Igelitmantel, ein steifes Etwas. Trotzdem war es so: Du standst da, mit wehendem Mantel, sodass alle Gesichter sich dir zuwandten. Nicht mal eine Entschuldigung musstest du erfinden, so sehr bewunderte man deine Auftritte.
Ich liebte dich sofort. Wenn wir uns im Stehen unterhielten, musste ich den Kopf in den Nacken legen, um in dein Gesicht zu sehen. Ich stand vor dir und schaute hoch – diese Haltung! Es scheint, es war von Anfang an abgemacht, dass ich dich anhimmelte.
Damals arbeitete ich an den Wochenenden in einem Kino. Es war alt und lag in einem Hinterhof, mitten in der Stadt. (Die großen Multikomplexkinos, draußen in den Shoppingcentern oder am Bahnhof, wurden gerade erst gebaut.) Wenn ich nachmittags das Tor aufgeschlossen hatte, räumte ich Süßigkeiten auf den Tresen, warf die Popcornmaschine an und fegte den Saal. Im Winter heizte ich das Gebäude mit Kohle, die ich wie auf einem Schiff mit einer Forke in den Ofen schippte. Bevor die ersten Zuschauer kamen, nahm ich mir ein Eis aus der Gefriertruhe. Dann ertönte der Gong. Ich stellte mich ganz hinten in den Saal, halb verborgen vom Vorhang, und schaute der Vorführung eine Weile zu.
Ich erzählte dir von meiner Arbeit, dem Kino.
Du kanntest es.
Ach, sagte ich.
Ich sagte dir nicht, dass ich dich früher schon einmal dort gesehen hatte, ein paar Wochen bevor du mit dem Vanilletee vor meiner Tür gestanden hast. Du warst mit einem rothaarigen Mädchen zusammen gewesen. Ihr Anblick hatte mir einen leichten Stich versetzt. Nicht weil sie übermäßig hübsch gewesen wäre. Sie war nicht hübsch gewesen, ganz und gar nicht. Und trotzdem hattest du ihre Hand gehalten und deinen Arm um ihre Schulter gelegt. Kurz war mir der Gedanke gekommen, du wärst vielleicht ein Heiliger. Jemand, der imstande ist, in einem anderen Menschen ein Wunder zu entdecken.
Dass es also auch bei mir möglich sei.
Später, nach dem Vanilletee, gab ich dir die Nummer des Kinos. Das Telefon, das neben dem Tresen an der Wand hing, klingelte oft, und ich wünschte mir jedes Mal, du wärst es. Aber es waren nur Leute, die nach dem Programm und den Anfangszeiten der Filme fragten.
Du bist am liebsten überraschend aufgetaucht. Meist war es schon kurz vor Mitternacht, nach dem Ende der letzten Vorstellung, und ich schloss das Gebäude ab. Du hast ein Stück entfernt gestanden, an einer Hausecke. Als hättest du befürchtet, jemand anderem zu begegnen als mir, hast du in der Dunkelheit gewartet. Das gab unseren Treffen etwas Exklusives. Ich fand es aufregend, dass du aus unserem Zusammensein ein Geheimnis machtest. Ich stieg in dein Auto, und wir fuhren los (der Uhu, die Fasane, die märkische Landschaft bei Nacht).
Die Spannung jedes Mal, bevor wir übereinander herfielen.
In jenem ersten Jahr hatte ich nicht das Bedürfnis, jemandem von uns zu erzählen. Ich schrieb nichts auf. Ich war vorsichtig. Noch ist es nicht dran, das Erzählen, sagte ich mir. Das Erzählen war in meinen Augen etwas, das erst am Schluss kommt. Es kommt sehr weit hinten, dachte ich, in einer fernen Zeit, die mir vollkommen abstrakt erschien. Fing man zu früh damit an, war womöglich alles zerstört.
Nicht einmal meiner Mutter, die ich nur selten sah, sagte ich etwas. Als sie sich darüber wunderte, dass ich so glücklich war (ein für mich ungewohnter Zustand), sagte ich nur: Ich habe jemanden kennengelernt.
Zum ersten Mal besuchte ich dich in deiner Wohnung. Bevor ich hineinging, sagtest du:
Ich muss dich warnen, es ist kein Schloss.
Ich ging rein, und es war kein Schloss.
Zuerst war es mir egal. Dann schlug ich dir vor, die Matratze gegen ein Bett zu tauschen, den Tapeziertisch gegen einen Schreibtisch. Während ich redete, hast du auf einem ausgeblichenen Klapppolster gesessen und mir lächelnd zugehört, die Arme hinter dem Kopf verschränkt.
Ich kaufte dir eine Musikanlage, eine Kommode, einen Läufer und einen nussbaumfarbenen Stuhl mit geschwungenen Beinen. Du hast dich darüber gefreut, aber ich merkte, dass du nichts davon vermissen würdest, wenn es eines Tages verschwunden wäre.
Das Einzige, an dem du zu hängen schienst, war ein Servierwägelchen, auf dem eine weiße Napoleonbüste aus Gips stand.
Es war Teil deiner Persönlichkeit, dass du wie ein Einsiedler gelebt hast, scheinbar ohne Bedürfnisse warst. Deine Aufmachung, der Mantel, die altmodischen Anzüge, die wenigen Dinge, die du besessen hast – all das konnte man als Zitat verstehen, aber manchmal schimmerte etwas durch, und dann konnte ich sehen, dass du dir vielleicht deshalb nichts aus den Dingen gemacht hast, weil du dir nichts daraus machen durftest. (Wenn man arm ist, liegt es vielleicht nahe, Reichtum zu verachten.) Aber in Wahrheit spielten solche Einteilungen keine Rolle. Wir kamen nicht aus einer Welt, in der es darum gegangen wäre, ob jemand vermögend war oder nicht. Wir interessierten uns für andere Dinge. Wir dachten über Freiheit und Anarchie nach, über die Irrationalität des Kleinbürgers, über die Sinnlosigkeit von Utopien oder die Trägheit der Masse.
Mit dem Geld, das ich im Kino verdiente, lud ich dich in Restaurants ein, in die Pagode, ein zweistöckiges China-Restaurant, das damals beliebt war, ein anderes Mal aßen wir italienisch, griechisch.
Im Gegenzug brachtest du mir manchmal Blumen mit, langstielige Sonnenblumen oder kanadische Goldrute, die du dir auf dem Weg zum Parkplatz lässig über die Schulter gelegt hast wie ein Cowboy sein Gewehr. Du spieltest mir Musik von Chet Baker vor und brachtest mir Offiziersskat bei. (Die Tatsache, dass ich als Tochter eines ehemaligen Offiziers das Spiel nicht kannte, amüsierte dich.) Wir spielten Halma und Scrabble. Manchmal würfelten wir auch. Ich zeigte dir, wie man mit einem Luftgewehr in die Mitte einer Zielscheibe trifft, und schenkte dir Bücher von Peter Handke und Wolfgang Hilbig. Die meisten Bücher in deinem Regal hatten etwas mit Erotik zu tun, der Erotik der Moderne, François Villon, Henry Miller, Charles Bukowski, Georges Bataille, Brecht (die Liebesgedichte), einer bestimmten Form von Frivolität. Die Bücher stammten aus einer anderen Zeit, der Zeit vor mir. Ich wusste nicht, wer sie dir geschenkt hatte. Ich wusste nicht mal, ob du sie gelesen hattest. Hattest du dich in sie versenkt? Vor dem Regal kniend, kommentierte ich die einzelnen Titel. Ich machte mich lustig darüber, was dir egal war.
Als Jugendlicher habe ich »Der stille Don« von Scholochow gelesen, sagtest du bloß, stell dir vor, vier Bände Scholochow!
Es klang gedankenverloren, irritiert, als könntest du es selbst nicht fassen. Seither waren nur acht oder neun Jahre vergangen, aber die Welt war eine vollkommen andere geworden.
Dein Leben schien aus lauter Geheimnissen zu bestehen. Fast widerstrebend hast du mir erzählt, du würdest in einer Band spielen. Ich versuchte herauszufinden, wo die Band auftrat. Es war eine aufwendige Suche, man musste sich die Informationen aus privat gedruckten Zeitschriften oder den Gesprächen Eingeweihter zusammenklauben. Als ich den Ort des nächsten Auftritts herausbekommen hatte, fuhr ich ohne dein Wissen hin. Auch der Club war nicht einfach zu finden. Dann, endlich, stand ich vor der Bühne, aber es war zu spät, dein Auftritt war vorbei, es spielte bereits die nächste Band. Du hast mit ein paar Leuten im Saal gestanden und hast zugesehen. Es waren nicht sehr viele gekommen, was es mir schwer machte, mich zu verstecken. Dann merkte ich, dass ich mich gar nicht zu verstecken brauchte. Weil du nicht mit mir gerechnet hattest, hast du mich auch nicht gesehen. (Irgendwann später habe ich es dir erzählt. Du warst nicht verärgert, eher überrascht. Dass du mich nicht bemerkt hattest, schien dich weniger zu erstaunen als mich.)
Mir gab die Sache zu denken. Offenbar hatte meine Anwesenheit keinerlei Magie verströmt. Aber zu jener Zeit verschwanden diese Verletzungen rasch wieder, sie gerieten in den Hintergrund, wurden überdeckt von Zärtlichkeiten, von der Gewalt der Zärtlichkeit, die allen Anfängen innewohnt.
Auf unsere Verabredungen bereitete ich mich mit beinahe zeremoniellen Handlungen vor. Ich stieg in die Badewanne, wusch mir die Haare, wählte sorgfältig meine Kleidung aus. (Was hieß, sie musste sich auf raffinierte Weise ausziehen lassen.) Dann traf ich dich an einer bestimmten Kreuzung im Stadtzentrum, und wir fuhren zu dir. Bei Kerzenschein hast du Tarotkarten ausgelegt, das keltische Kreuz. Ich erfuhr, dass meine Persönlichkeitskarte der Wagen ist, deine Lebenskarte ist die Sonne. Sogar aus der Hand hast du mir gelesen. Ich hatte gute Anlagen, aber die rechte Hand unterschied sich deutlich von der linken, was bedeuten konnte, dass ich gegen mich arbeitete. Deine Ehrgeiz- und Karrierelinie war kürzer als meine, was du mit einem Seufzer quittiert hast.
So was kann man nicht ändern, man muss das Beste draus machen, sagtest du.
Nichts davon kam mir albern vor. Wenn ich über die Brücken in der Stadt lief, warf ich jedes Mal ein kleines Geldstück hinein und wünschte mir die Ewigkeit. Ich sagte mir, so ein Rausch währt nicht lange. Man selbst sorgt dafür, dass er nicht lange währt. Es kann traurig sein, bei Mondschein über eine Brücke zu gehen. Ja, traurig und zum Fürchten. Aber während ich das dachte, rannte ich, ich rannte und dachte zugleich, die Brücke unter mir hört nicht auf, das dunkle Wasser funkelt ewig.
Im September lagen wir am See. Wir fuhren mit den Rädern eine Holperstraße entlang, dann ein langes Stück durch den Wald. Du auf einem alten Damenrad, ich hinter dir her mit einem Rennrad, von dem immerzu die Kette absprang. Wir aßen Kirschkuchen, tranken mitgebrachten Wein. Über den Kiefern ein hoher Wolkenhimmel, darunter grünes Schilf. Die Tage kamen mir vor wie die letzten Tage im Frieden. Ich war darauf gefasst, dass jeden Moment Flugblätter auf uns herabrieseln würden, die eine Katastrophe verkündeten.
Im Gegensatz zu dir war mir das Glück unheimlich. Ja, ich glaube, so war es, so dachte ich es.
Das Lateinlehrbuch auf den Knien, lernte ich für das Große Latinum. Die Studienordnung schrieb das so vor. Wir hatten beide kein Latein in der Schule gehabt, und ich musste den Stoff von mehreren Jahren in zwei Semestern schaffen. Doch das machte mir nichts aus. Ich lernte die Vokabeln wie verrückt, ich vertiefte mich in die Texte. Dass die Epoche, von der sie handelten, so weit zurücklag, gefiel mir. Ich wollte keine Literatur lesen, in der es um die Gegenwart ging. Die Gegenwart, das waren du und ich. Ich wollte sie nicht teilen mit Autoren, die in der Hinsicht anderer Meinung waren.
Du sahst mir ruhig dabei zu, wie ich lernte.
Bleibt das Leben so einfach?, fragte ich dich.
Natürlich, sagtest du.
Ich lachte. Ach ja?
Du sahst mich ernst an. Dann sagtest du: Keine Ahnung, aber ich will es so.
Wenn zwei sich lieben, glaubt man anfangs an ein Wunder. Oder man denkt an Biologie, an chemische Prozesse. Und später, wenn ich über uns nachdachte und darüber, was uns zusammengebracht hat, zog ich noch andere Dinge in Betracht. Wir waren beide in einer Diktatur aufgewachsen. Wir kannten dieselben Filme, dieselbe Musik, wir hatten die gleiche Sehnsucht gehabt. (Es ist schwer, die süße Ausweglosigkeit zu beschreiben, in der unsere Kindheit stattgefunden hat. Eine Art sanftes Mahlwerk.) Wir hatten uns beide geschämt beim Anblick der Leute, die wie im Rausch ihre Einkaufstüten füllten, als sie zum ersten Mal in den Westen fahren durften. Und wenn wir im Ausland waren, fühlten wir uns – selbst nach Jahren – immer ein bisschen wie Davongekommene. Wir hatten Glück gehabt. Der Lauf der Welt in unserem Teil der Welt meinte es eindeutig gut mit uns.
Eine lange Zeit sah ich selbst dort Ähnlichkeiten, wo es gar keine gab. So dachte ich zum Beispiel, unsere Väter hätten nur auf den ersten Blick verschiedene Berufe gehabt. Dass sie im Grunde dasselbe Ziel im Leben verfolgt hätten – trotz ihrer Verschiedenheit. Denn obwohl dein Vater ein Künstler gewesen war, der mit seiner Kunst den Staat kritisiert hatte, und meiner ein Staatsdiener, hatten sie ihn doch schließlich beide gebraucht für ihr Leben, nur von verschiedenen Seiten her. So dachte ich mir das. Der Beweis: Als er plötzlich verschwand, der Staat, und mit ihm die ganze Ideologie, hatte es beiden, deinem und meinem Vater, den Boden unter den Füßen weggerissen.
(So was geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Auch wenn in den Geschichtsbüchern Jahreszahlen stehen, die das Ende eines politischen Systems auf den Tag genau festlegen, dauert es oft lange, bis man es den Menschen anmerkt. Plötzlich sind dreißig Jahre vergangen, und man denkt: Das alles hat ihm offenbar den Boden unter den Füßen weggerissen. Als würde jemand in Zeitlupe, über Jahre hinweg, ausrutschen.)
In Wahrheit gab es da keinerlei Parallelen. Auch wenn ich mir eine Entsprechung wünschte, eine Ähnlichkeit, die uns verband.
In Wahrheit war es so: Indem ich mich dir und deiner Familie anschloss, konnte ich meine eigene beschämen. Ja, in gewisser Weise tilgte ich meine Herkunft durch die Liebe zu dir.