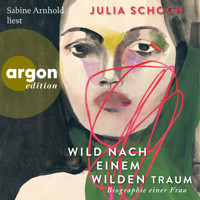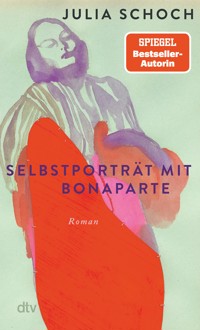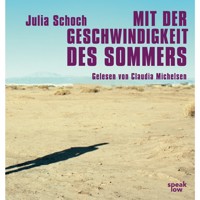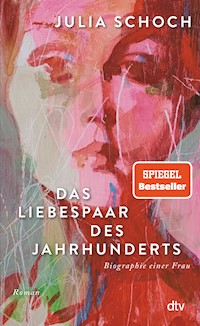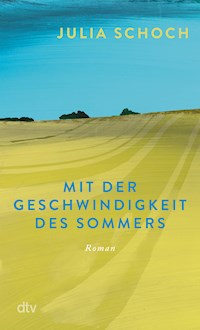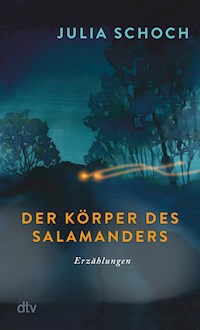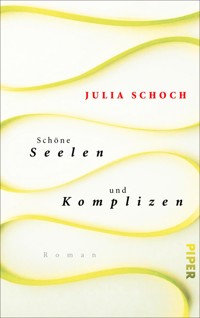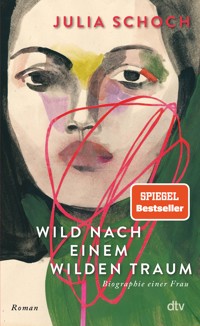
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biographie einer Frau
- Sprache: Deutsch
Eine poetische Bilanz Die Erinnerung an eine Liebe kann intensiver sein als diese Liebe selbst Eine Frau lernt fern von zu Hause einen Mann kennen, Katalane und Schriftsteller, und hat mit ihm eine Affäre. Diese Liebe bringt alles ins Wanken – nicht nur die Beziehung zu ihrem Ehemann, auch ihre Sicht auf die Dinge, ihre Arbeit. Was sie erlebt, lässt eine Entscheidung in ihr reifen, die mit Risiken verbunden ist: ganz bei sich zu sein und künftig als Schriftstellerin zu leben. Aber kann jemand, der ganz bei sich ist, noch bei anderen sein? Bei einem Ehemann, bei Kindern? Jahre später steht sie erneut an einem Kipppunkt ihres Lebens und begegnet dem Katalanen wieder: Ein Bogen schließt sich zwischen Vergangenheit und Jetzt. Julia Schoch krönt mit diesem Roman einer folgenreichen Begegnung ihre außergewöhnliche Trilogie. Nach dem großen Erfolg von Julia Schochs Bestsellerroman ›Das Liebespaar des Jahrhunderts‹ (monatelang weit oben auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, mehr als 80.000 verkaufte Exemplare) nun der krönende Abschluss ihrer Trilogie. »Was ich in der Trilogie erzähle? Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und oft nicht wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner.« Julia Schoch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Eine Frau lernt fern von zu Hause einen Mann kennen, Katalane und Schriftsteller, und hat mit ihm eine Affäre. Diese Liebe bringt alles ins Wanken – nicht nur die Beziehung zu ihrem späteren Ehemann, auch ihre Sicht auf sich selbst, ihre Arbeit. Was sie erlebt, lässt eine Entscheidung in ihr reifen, die mit Risiken verbunden ist: ganz bei sich zu sein und künftig als Schriftstellerin zu leben. Aber kann jemand, der ganz bei sich ist, noch bei anderen sein? Bei einem Ehemann, bei Kindern? Jahre später steht sie erneut an einem Kipppunkt ihres Lebens und begegnet dem Katalanen wieder: Ein Bogen schließt sich zwischen Vergangenheit und Jetzt.
Nach den ersten beiden Büchern der ›Biographie einer Frau‹ – über Herkunft, Familie und das überraschende Auftauchen einer Halbschwester sowie über eine langjährige Partnerschaft und Ehe – folgt nun das dritte. Mit diesem Roman über eine folgenreiche Liebesbegegnung, der zugleich ein Schlüssel zu Julia Schochs Schreiben ist, vollendet sie ihre außergewöhnliche Trilogie.
»Was ich in der Trilogie erzähle? Dass wir unterschiedliche Rollen im Leben haben und nie genau wissen, was wir für andere sind. In den drei Büchern möchte ich Gerechtigkeit walten lassen. Ein Wunschtraum, vielleicht. Aber ein schöner.« Julia Schoch
Julia Schoch
Wild nach einem wilden Traum
Biographie einer Frau. Drittes Buch
Roman
»Ich schulde ihnen gar nichts« –
würde die Liebe sagen
zu diesem offenen Thema.[1]
Aus »Danksagung« von Wisława Szymborska
Ich setze noch einmal an, an einem anderen Punkt.
Zu jener Zeit, die inzwischen Jahre zurückliegt und von der hier die Rede sein soll, wollte ich diesen Mann, den Katalanen, unbedingt. Dabei gab es doch schon einen in meinem Leben. Einen Mann, meine ich. Genauer gesagt: meinenMann.
Ich habe es immer sehr schnell gewusst. Jemand betritt den Raum, er kommt herein, schließt die Tür, steht da oder setzt sich an einen Tisch. Vier oder fünf Sekunden, dann bin ich mir im Klaren darüber, dass es geschehen wird.
Mit dem Katalanen war es anders. Er gefiel mir nicht. Er war weder schön noch elegant, noch hatte er etwas Athletisches an sich. Wenn man die Augen zusammenkniff, konnte man ihn vielleicht für den jungen Javier Bardem halten. (Ein Bild von heute, keine Erinnerung. Ich glaube nicht, dass ich zu der Zeit schon einen Film mit dem spanischen Schauspieler gesehen hatte.) An einem seiner Eckzähne fehlte ein Stück, und sobald er lachte, was häufig geschah, wurde mein Blick unweigerlich von dieser Lücke angezogen. Auch das Piercing an seiner Unterlippe störte mich. Es sagte mir, dass er anfällig war für Moden. Er schwamm auf der Welle der Gegenwart. Das missfiel mir. Es missfiel mir, weil es bedeutete: Er kam direkt aus dem Jetzt. Nein, ein Zeitreisender war er ganz und gar nicht. Deshalb war ich von mir selbst überrascht, dass ich eines Abends, als er mir vorschlug, in sein Zimmer zu kommen, ohne zu zögern aufstand und ihm folgte.
Oft heißt es, man hätte die Wahl. Dass man in bestimmten Momenten des Lebens eine klare Entscheidung treffen könnte. So liest man es, so stelle ich mir das vor. Jemand steht an einer Weggabelung und fragt sich: Welcher ist wohl der richtige Pfad, der, der mich ans Ziel führt. Aber gibt es so was tatsächlich? Und selbst wenn ich es mich gefragt hätte – um welches Ziel hätte es sich handeln sollen?
Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie vor Kreuzungen gestanden und in aller Ruhe überlegt. Ich bin einfach weiter und weiter gegangen, vielleicht sogar gerast, wie ich auch in die Liebe gerast bin, und irgendwann, später, dreht man sich um und ist erstaunt.
In Gedanken, für mich und also insgeheim, habe ich ihn immer nur den Katalanen genannt. Vermutlich, weil er sich selbst so genannt hat. Wenn von uns jemand sagte: Ah, Barcelona, Spanien!, dann sagte er: Ich bin kein Spanier, ich bin Katalane. Aber er sagte es lachend, sodass man nicht genau wusste, wie ernst es ihm mit dieser Richtigstellung war. Vielleicht dachte ich an ihn auch deshalb so, unter diesem Namen, weil ich nie einen anderen Menschen aus Katalonien näher kennengelernt habe, weder vorher noch danach. Bis heute ist er der einzigeKatalane in meinem Leben geblieben.
Vor allem war er der Einzige in unserer Gruppe, an den ich mich genau erinnere. Wobei das Wort Gruppe eher unpassend klingt im Zusammenhang mit den zehn oder elf Individuen, zu denen wir beide, der Katalane und ich, gehörten. Zehn oder elf Leute verschiedener Herkunft, mit unterschiedlichen Sprachen, die sich zufällig zur selben Zeit an demselben Ort aufhielten, in A., einer Künstlerkolonie im Nordosten der USA, im sogenannten Hudson Valley, ungefähr zwei Stunden von New York entfernt.
Die meisten von uns waren Schriftsteller – eine Bezeichnung, die mir nur schwer über die Lippen kam, wenn es um mich ging. Ich war froh, dass ich dort, in A., das englische Wort writer verwenden konnte, das mir banaler und weniger anmaßend erschien.
Genau wie ich hatte der Katalane gerade sein erstes Buch veröffentlicht, aber im Gegensatz zu meinem war das von ihm in seiner Heimat offenbar sehr erfolgreich gewesen. Ich hörte davon beim sogenannten warm-up, der offiziellen Vorstellungsrunde, die am ersten Abend unseres Aufenthaltes stattfand. Zusammen mit dem Leiter und der Leiterin des Hauses, einem jungen Ehepaar, saßen wir im Salon. Ich erinnere mich, dass ein Raunen durch die Runde ging, als er die Verkaufszahlen seines Buches nannte. Man konnte sehen, wie sehr er die Anerkennung genoss. Er setzte sogar nach, indem er betonte, in seinem Land sei das immens.
Dann sollten wir reihum berichten, woran wir in den kommenden Wochen arbeiten wollten. Mir war diese Zeremonie unbehaglich. Zu sagen, wovon das Buch handelte, das ich vorhatte zu schreiben, empfand ich als beinahe obszön. Als müsste ich meinen Rock hochschieben, um eine Narbe oder ein Mal vorzuzeigen, irgendetwas, was sonst unter der Kleidung verborgen blieb. Der Katalane schien mit dieser Übung keinerlei Mühe zu haben. Wortgewandt und routiniert erklärte er sein Projekt. Ich erinnere mich, dass mich seine Leichtigkeit abstieß. Gleichzeitig bewunderte ich ihn dafür.
Als Kind habe ich geglaubt, Schriftsteller seien das Gegenteil eines Durchschnittsmenschen, besondere Persönlichkeiten mit einer speziellen charakterlichen Grundausstattung. In gewisser Weise sogar Heilige. Vielleicht lag es daran, dass ich als Kind nur tote Autoren kannte. Fest steht: Diese Vorstellung verflüchtigte sich irgendwann. Zum Zeitpunkt meines Aufenthalts in A. war mir längst klar, dass sie sich untereinander genauso unterschieden wie andere Leute auch. Sämtliche menschlichen Eigenschaften waren auch hier verbreitet. Genau wie in der Welt da draußen gab es Angeber und notorische Lügner, Kleinkarierte und Weitherzige, Möchtegernphilosophen und Schwätzer, Witzbolde und ewig Verhuschte, Onkelhafte und schlichtweg Nette, tropfnasige Eigenbrötler, Aufrichtige, Trantuten und Einfühlsame, moralisch Anständige und absichtlich Böse, Schmallippige, Chaoten und Brüllaffen. Das Einzige, was sie alle verband, war ein gewisses Durchhaltevermögen, der Ehrgeiz, einen Text beenden und ihn veröffentlichen zu wollen.
Das fiel mir ein, während der Katalane darüber sprach, woran er in der Kolonie arbeiten wollte, und ich fragte mich, ob die kommenden Wochen ausreichen würden, um herauszufinden, zu welcher Kategorie er gehörte.
Um die äußerlichen Gegebenheiten gleich klarzumachen: A., die Künstlerkolonie, war keine Stadt, auch keine Ortschaft, bloß eine Ansammlung von Gebäuden auf einem Hügel inmitten der Natur – drei Häuser im amerikanischen Stil (Holz und Veranden), eins davon das Haupthaus, in dem sich Büros und ein Salon befanden und in dem abends die gemeinsame Mahlzeit eingenommen wurde, außerdem zwei Carports und ein Wasserspeicherturm, wie sie typisch für amerikanische Farmen sind. Wenn man dort oben stand, auf der Kuppe des Hügels zwischen den Häusern, und unten von der Landstraße her ein Auto einbog, war es wie in einem Westernfilm: Automatisch legte man die Hand als Sonnenschutz an die Stirn und versuchte zu erspähen, wer sich da wohl näherte. Meist handelte es sich um den Lieferwagen des Kochs, der im Nachbarort wohnte und jeden Tag vorbeikam, um das Abendessen für uns zuzubereiten. Manchmal, aber nur sehr selten, ließ sich auch ein Besucher blicken, der den Skulpturenpark besichtigen wollte – ein angrenzendes Stück Wald, eine Art Freiluftmuseum, in dem bizarre Kunstobjekte aufgestellt waren: riesige neonfarbene Hasen und Penisse, ein Bettgestell, zwei überdimensionierte Säuglingsköpfe … Das Gelände hatte etwas Beängstigendes, was auch damit zusammenhing, dass in regelmäßigen Abständen Geräusche aus Lautsprechern zwischen den Bäumen ertönten. Sie vertrieben die Tiere, sodass der Wald wie ausgestorben war.
Vor Kurzem erzählte mir ein Freund, der ebenfalls Schriftsteller ist und dort ein paar Wochen verbracht hatte, dass das Anwesen ausgebaut worden sei. Anstelle des Waldstücks sei ein professionell betriebener Art and Sculpture Parc entstanden.
Der Ort existiert noch?, fragte ich. Fast war ich beleidigt. Ich empfinde es als Beleidigung, dass die Dinge nach mir weiterexistieren, ganz so, als wäre nichts geschehen. Offenbar, sage ich mir dann, ist meine Präsenz nicht stark genug, um die Zeit zum Stillstand zu bringen.
Mittlerweile, erzählte mein Freund, führen angelegte Wege über das Gelände, und jedes Wochenende kommen viele Leute, um sich die Ausstellungen und Kunstaktionen anzuschauen. Mittels einer App laufen sie die einzelnen Stationen ab, und wenn man damit durch ist, kann man in einem kleinen Café sitzen und etwas essen.
Er beschrieb es mir in allen Einzelheiten, er war da gewesen. Ich nehme an, dass ich mir im Internet Bilder davon ansehen könnte, aber ich will nicht. Ich will meine Erinnerung nicht abgleichen mit der Gegenwart. Vermutlich, weil ich weiß, dass ich nicht weiterschreiben könnte, wenn ich die Wahrheit kennen würde. Die Wahrheit! Für mich ist A. noch immer ein abgeschiedener Ort. Kein Zaun, keine Einfahrt, ich glaube, nicht mal ein Schild gab es, das Durchreisende auf das Anwesen aufmerksam gemacht hätte. Nichts weiter als ein paar Häuser und ein Wasserspeicher inmitten einer Gegend, deren Bewohner, so schien es mir, alle weggelaufen waren.
Ich muss tatsächlich nur Augen für ihn gehabt haben, den Katalanen. Wer die anderen Künstler waren, ihre Namen und was genau sie taten, all das habe ich zum größten Teil vergessen.
An eine Autorin erinnere ich mich. Sie kam aus England und ist später berühmt geworden. (Oder sie war es bereits, und ich wusste nur nichts davon.) Eine kleine Frau, die einem freundlichen Troll glich, der mit wachen Augen seine Umgebung inspiziert. Gleich am ersten Abend fragte sie mich, welche Obsessionen ich hätte. Zu meiner Überraschung fiel mir sofort etwas ein. Ich sagte ihr, ich sei mir sicher, ich würde eines Tages durch die Hand eines anderen Menschen sterben. Es wird von hinten passieren, sagte ich, er ist in meinem Rücken, ich habe keine Chance. Mein großspuriger Tonfall war mir nicht peinlich. Im Gegenteil, wie sehr ich es genoss, so zu reden! Zumal niemand Anstoß daran nahm. Die Troll-Frau jedenfalls schien mit meiner Antwort überaus zufrieden.
Außer ihr ist mir noch eine Installationskünstlerin im Gedächtnis geblieben. Sie war Schwedin oder Dänin und ernährte sich vegan, etwas, was die meisten zu der Zeit für einen Spleen hielten. (Hätte ich vor zwanzig Jahren darüber geschrieben, hätte ich ihr Verhalten, ihre Lebenseinstellung ganz sicher ironisiert.) Ich erinnere mich an ihre stille, unnachgiebige Art. Dass sie nicht abließ von ihrer Überzeugung, brachte den Koch im Laufe der Wochen immer mehr auf. Abend für Abend streute er ihr aus einer kleinen Tüte Nüsse auf den Teller, wie um sie zu bestrafen für ihre Extravaganz. Eine Reaktion, die sie offenbar gewohnt war, denn sie nahm es ungerührt hin.
Wir alle gingen uns nicht etwa aus dem Weg, aber wir sprachen höflich miteinander, und fast nie über Kunst oder Literatur, als wären wir auf der Hut. (Nicht an das Heiligste rühren!) Tagsüber sahen wir einander kaum, höchstens zum Kaffeekochen in der Gemeinschaftsküche. Nur abends, nach dem Essen, bildeten sich Grüppchen auf der Veranda des Haupthauses, man trank etwas und blickte in die Nacht.
Hin und wieder blieb auch der Koch. Wenn er seine Gerätschaften, Warmhalteplatten, große Schüsseln und anderes Zubehör, wieder in seinem Wagen verstaut hatte, setzte er sich in einen der Lehnstühle. Ganz ungeniert mischte er sich in unsere Gespräche. Einmal wollte er wissen, was wir von der Anwesenheit der Amerikaner in Afghanistan hielten. Er sagte, seit den Anschlägen in New York habe er Angst. Auf einmal hasse alle Welt Amerika. Ich erinnere mich, dass er sagte, Ideologien seien ihm egal. Es interessiert mich nicht, in wessen Namen ein grausamer Angriff geschieht, sagte er und schaute ernst in die Runde. Brutalität bleibt Brutalität. Aber bestraft werden muss so was, oder etwa nicht?
In der ersten Nacht, in der Dunkelheit in meinem Zimmer, unter dem dünnen Laken, sah ich die Zahnlücke des Katalanen vor mir, seine leicht gedrungene Gestalt – die Figur eines Ringers, der nicht mehr aktiv ist und dessen Körper in meiner Wahrnehmung mit lauter Makeln behaftet war. Ich sagte mir, dass sich Sichtweisen ändern können. Vorlieben, Einstellungen, Phantasien können sich ändern. Der Ventilator an der Decke summte, und plötzlich war ich mir sicher, dass ich keine Zeit verstreichen lassen durfte. Dass schon viel zu vielZeit verstrichen war.
So, wie es dort geschehen ist, will ich auch hier gleich über die Schwelle gehen: Es passierte sehr bald nach unserer Ankunft. Vielleicht war es der zweite, der dritte oder der vierte Abend, ich weiß es nicht mehr. Verhaltene Gespräche, Gläsergeklirr, im Innern des Hauses Licht, draußen Finsternis, Sterne (nehme ich an). Der Katalane, der bis dahin am Geländer der Veranda gelehnt hatte, richtete sich auf und gab mir über die Köpfe der anderen hinweg ein Zeichen. Jedenfalls deutete ich es so: Er hielt seine rechte Hand mit den gespreizten Fingern in die Luft. Dann verschwand er. Fünf Minuten später verließ ich ebenfalls die Veranda und stieg hinauf zu seinem Zimmer. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, was seine Geste zu bedeuten hatte. Oben angekommen, klopfte ich an die Tür, sie war nur angelehnt. Er stand da, in der Mitte des Raums, und erwartete mich.
Als hätten wir uns zuvor über den Ablauf verständigt, zog er sich ohne Umschweife das T-Shirt über den Kopf. Ich habe nichts zu ihm gesagt über das fehlende Stück an seinem Zahn oder das Piercing, während er mich küsste. Und auch über das kleine Tattoo links oben auf seiner Brust, ein Ornament, irgendein Symbol, bin ich kommentarlos hinweggegangen. Er stand vor mir, die Arme ausgebreitet, als wollte er sagen: Hier bin ich, legen wir los. Wir zogen noch ein paar weitere Kleidungsstücke aus, sanken gemeinsam aufs Bett.
Es dauerte nicht sehr lange, dann war es vorbei. Wir lagen da, mit flimmerndem Herzen und ein wenig außer Atem, bevor wir, jeder für sich, unserer Wege gingen. Ich stieg die Treppe wieder hinunter und ging ins andere Haus, in dem das Studio lag, das mir für die nächsten Wochen zugeteilt worden war.
Ungefähr so machten wir es, der Katalane und ich.
Diese Dinge gelingen leicht, kommt es mir vor. Sie erzählen sich rasch. Aber vielleicht kommt es mir auch nur deshalb so vor, weil es nicht das ist, worum es mir bei alldem geht.
Worum es mir geht … Ich sage noch, wieso – wieso ich dorthin zurückkehre. Vielleicht ist es mir selbst noch nicht klar.
Manche Phasen meines Lebens scheinen wie in eine ewige Dämmerung getaucht. Ich sehe mich durch lange, dunkle Flure gehen, an deren Ende ich leise eine Tür aufdrücke, sehe mich unter einer verschneiten Dachschräge an einem Tisch sitzen oder in fahlem Novemberlicht, ohne dass ich imstande wäre, mich zu rühren. Aber dort, in A., lag alles in gleißendem Sonnenlicht. Es ergoss sich über das weite endlose Tal. Sonne – und Nebel, beinahe Rauch, der morgens über den Bergen, den Catskill Mountains, aufstieg.
Was zurückbleibt, ist Landschaft.
Tagsüber war es heiß, in den Nächten dagegen schon sehr kalt, und in den Gesprächen, die sich in der Gemeinschaftsküche ergaben, war häufig vom Indian Summer die Rede. Den Gästen standen Fahrräder zur Verfügung, und vor dem Abendessen fuhr ich über die Landstraßen der Umgebung. Die wenigen Autos, denen ich begegnete, hupten bei meinem Anblick. Mais und Himmel und, hin und wieder, weiter weg, ein Gehöft, aber keine Menschenseele, sodass schwer einzuschätzen war, welche der Häuser und Scheunen noch bewirtschaftet wurden und welche nicht.
Zurück von meiner Tour, stieg ich in das Schwimmbecken, das hinter Hecken verborgen neben dem Haupthaus lag. (Niemand sonst schwamm darin. Eine mögliche Erklärung fand sich erst gegen Ende meines Aufenthalts, als ein Mann auf mich zugestürzt kam, offenbar der housekeeper,den ich bis dahin noch nie auf dem Gelände gesehen hatte. Er zeigte mir eine Maus, die er zusammen mit einer Menge Blättern am Morgen aus dem Wasser gefischt hatte. Er konnte es nicht fassen, dass jemand im Pool schwimmen ging. In diesem Dreck zu baden!, rief er kopfschüttelnd.)
Am ersten Abend, als der Katalane mich in seinem Zimmer erwartet und ohne ein Wort geküsst hatte, erfasste mich dasselbe Gefühl, das ich einmal nach einer Ohrfeige empfunden habe: Man ist hellwach und zugleich wie betäubt. Nachdem wir miteinander geschlafen hatten, wollte ich so schnell wie möglich verschwinden. Ich wollte vergessen, was passiert war, diesen Mann vergessen, der so überzeugt von sich schien, dass ihm ein stummes Zeichen genügte, um mich in sein Zimmer zu delegieren. Wie er es wahrscheinlich immer machte, dachte ich. Ich war mir sicher, ich würde nie mehr mit ihm schlafen wollen. Aber noch in derselben Nacht fand ich den Gedanken absurd, es bei diesem einen Mal zu belassen. Ich hatte nur ein Bedürfnis: dass es ein weiteres Mal passierte.
Ich habe schon von meinem Unbehagen erzählt, mich vor den anderen Künstlergästen über mein Schreibvorhaben zu äußern, mein aktuelles Projekt. Dieses Unbehagen hing einerseits damit zusammen, dass ich den Eindruck hatte, ich würde nicht in eine Schriftstellerkolonie gehören. Nicht dass ich mich selbst nicht für eine Schriftstellerin hielt. Das tat ich durchaus. Auch wenn ich in gewisser Weise, wie ich dachte, unrechtmäßig hier war: Zu dem Aufenthalt in A. war ich nur gekommen, weil ich kurzfristig für jemanden eingesprungen war. Der Unfall eines anderen hatte mir dieses Glück beschert. Ich erinnere mich, dass von einer Operation die Rede war, noch dazu von einer ziemlich schweren, und ich diesen Umstand insgeheim bejubelt hatte.
Andererseits lagen die Dinge viel einfacher. Der eigentliche Grund für mein Unbehagen, was mein Projekt anging, war der: Ich hatte keins, nicht mal den Plan für ein Projekt. Später habe ich oft daran zurückgedacht. Was genau hatte ich gesagt, als ich an der Reihe war und gefragt wurde? Ich vermute, ich habe vorgegeben, an einem Roman zu schreiben, der fast fertig sei und verschiedene Dinge miteinander verbinde – love & history, habe ich vielleicht gesagt (wie ich es später oft getan habe, wenn ich gezwungen war, in einer Fremdsprache zu erklären, worum es in meinen Büchern geht).
Wie dem auch sei. In einem Punkt bin ich mir sicher: Die Geschichte, die ich in den Wochen in A. schließlich geschrieben habe, die Geschichte mit dem Soldaten, habe ich in der Vorstellungsrunde mit keiner Silbe erwähnt. Wie auch hätte ich am ersten Abend, noch ganz zu Beginn, von etwas sprechen können, von dem ich selbst noch gar nichts wusste?
Damals ist es mir nicht aufgefallen, ich habe mir den Zusammenhang nicht klargemacht: Vermutlich ist es in höchstem Maße logisch gewesen, dass ich auf meinen Fahrten mit dem Rad durch die Landschaft oberhalb des Hudson River schon nach kurzer Zeit in die Landschaft meiner Kindheit und damit zu der Begegnung mit dem Soldaten zurückgekehrt bin. Während ich über die stillen Landstraßen fuhr, verschmolz der amerikanische Ostküsten-Spätsommer wie in einer Doppelbelichtung mit den Sommern meiner Kindheit im Nordosten Deutschlands, ganz in der Nähe der polnischen Grenze. Ohne dass ich es darauf angelegt hatte, rief der Anblick der menschenleeren Wege und monotonen Äcker dasselbe vertraute Gefühl in mir wach. Genauer gesagt war es das vertraute Gefühl des Abgeschiedenseins. Als wäre man von aller Welt verlassen.Auch wenn dort, oberhalb des Hudson, das meiste um ein Vielfaches größer war, die Felder noch weiter schienen und die Ferne noch ferner.
Früher oder später kehren alle Schriftsteller zu ihrer Kindheit zurück. Das hat mein Mann einmal gesagt. Ich erinnere mich sehr genau daran. Es klang ein wenig verächtlich, ganz so, als wäre diese Art des Schreibens eine der leichteren Übungen, als bräuchte es dazu nicht viel. Wahrscheinlich hat er recht. Am weitesten entfernt von der eigenen Gegenwart, dem Jetzt, ist die Kindheit zugleich das Naheliegende. Ich bin der beste Beweis: In dem Moment, da ich glaubte, ich würde ins Unbekannte aufbrechen, kehrte ich um. Kaum war ich in A., kaum hatte ich mit dem Katalanen geschlafen, setzte ich mich hin und schrieb über das, was hinter mir lag.
Noch etwas Wichtiges: Damals war es noch nicht sehr lange her, dass ich mein Studium beendet und an der Universität eine Stelle als Assistentin für Literaturwissenschaft angenommen hatte (derselben Universität, an der ich auch meinen Abschluss gemacht hatte und meinem Mann begegnet war). Pro Semester musste ich zwei Kurse geben, Recherchearbeiten erledigen und eine Doktorarbeit entwerfen (Thema: Utopien in der neueren Literatur). Allerdings hatte ich die freie Zeit zwischen den Semestern bislang ausschließlich dafür genutzt, ein paar Erzählungen zu schreiben. Wenn meine Professorin sich nach dem Stand meiner Doktorarbeit erkundigte, präsentierte ich ihr stets ein neues Exposé. Dem Aufenthalt in A. hatte sie nur zähneknirschend (oder vielmehr seufzend) und unter der Bedingung zugestimmt, dass ich endlich meine Promotion vorantriebe.
Ich erinnere mich, dass der Katalane lachte, als er das erste Mal in meinem Zimmer stand und die Stapel von Büchern und Kopien auf meinem Schreibtisch sah. Er selbst habe alles, was er brauche, in seinem Laptop, erklärte er. Ich ärgerte mich über sein Lachen, aber vor allem ärgerte ich mich über mich selbst – dass ich mich damit abgeschleppt hatte, Fachtexten zur Lyrik im 19. Jahrhundert (das Thema eines meiner Kurse, den ich vorbereiten wollte), einem Band Baudelaire, Utopielektüre, sogar ein Wörterbuch hatte ich über den Ozean hergebracht.
Bislang hatte ich in all das noch nicht hineingeblickt.
Während ich grollend dastand, begutachtete der Katalane mein Zimmer. Er inspizierte die Möbel und die vom Fliegengitter verpixelte Aussicht. Vor allem die Treppe, die hinauf zum Schlafboden führte, hatte es ihm angetan.
Falls ich mich nach dem ersten Abend bei ihm im Zimmer gefragt haben sollte, was unsere wortlose, gierige Begegnung zu bedeuten hat, ließ er keinen Zweifel an der Beantwortung dieser Frage: Bei einem Mal würde es nicht bleiben. Offenbar hatten wir uns arrangiert.
Der Soldat und das Mädchen – der Titel eines Films auf einem Plakat, darauf zwei Gestalten inmitten von Kiefern und Birken. So habe ich es manchmal vor mir gesehen, wenn ich später daran zurückdachte. Kein düsterer, dichter Wald, sondern ein lichtes Wäldchen, die hellen Schonungen Mecklenburgs. Damals hieß der Landstrich so, heute heißt er wieder Vorpommern. Ich habe diese Bezeichnung nie gemocht. Sie erinnert mich an eine Zeit in Schwarz-Weiß, eine alte Zeit, in der müde Menschen mit Handkarren voller Gepäck über schlammige Straßen ziehen, an Kinderlieder, in denen Häuser abgebrannt und Eltern gestorben sind. Etwas, das schon lange vorbei und überwunden war, als wir dort ankamen.
Unsere Epoche sei anders, neu, hieß es, sie sei die Zukunft selbst. Damals ging der Zeitstrahl für mich nur in eine Richtung. Er war eine gerade, nach oben gerichtete Linie, und auf dieser Linie schritt die Geschichte der Menschheit stetig voran.
Die Siedlung, in der meine Eltern mit ihren beiden kleinen Töchtern eine Wohnung beziehen, am Rande der Garnisonsstadt E. am Stettiner Haff, besteht aus fünfzehn oder zwanzig Wohnblöcken, in jedem Block dreißig Familien. Vor allem die Frauen sind erleichtert: Warmwasser, ein Bad mit Wanne, Fernwärme in Form von Nachtspeicheröfen, so groß wie Kommoden. Die Annehmlichkeiten eines modernen Lebens der Siebzigerjahre. Morgens laufen die Kinder in einer großen Traube zur Schule, die Frauen zum Bus, der sie zur Arbeit bringt. Die Männer gehen in eine andere Richtung, Richtung Wald, wo der Militärstützpunkt liegt.
Dort, im Wald, ist es auch, dass ich ihm zum ersten Mal begegne.
Ich bin mit dem Rad unterwegs. Wir Kinder fahren oft mit dem Fahrrad durch den Wald, ein Stück weiter gibt es tiefe Sandkuhlen, in die man sich hinabrollen lassen kann. Er sitzt da, auf einem umgestürzten Baum, einer Eiche vielleicht (also doch nicht nur Kiefern und Birken?), und ruft mir etwas zu. Ich bleibe stehen und steige vom Rad. Als hätte er nicht damit gerechnet, dass ich seinem Ruf folge, wirkt er mit einem Schlag verschüchtert. Ich gehe zu ihm. Ein Soldat ist nichts Seltsames für mich. Die Armee ist mir vertraut, weil die Väter sämtlicher Kinder aus der Siedlung Armeeangehörige sind. Mehrmals im Jahr unternimmt die Schule einen Ausflug zum Stützpunkt. Man zeigt uns die Fahrzeuge, Lkws und Panzer, in die wir klettern dürfen, lässt uns kleine Parcours überwinden und bewirtet uns anschließend mit Würstchen und Kakao. Seltsam ist nur, dass dieser Soldat allein hier ist, außerhalb des Kasernengeländes, auf der anderen Seite des Zauns.
Er erklärt mir, man habe ihn zum Pilzesammeln rausgeschickt. Als Beweis hält er mir einen Eimer hin.