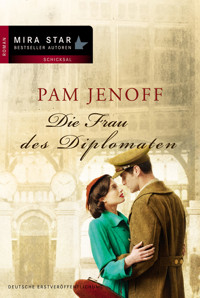9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Geschichte über die Macht der Freundschaft.
Krakau, 1942: Als die Nazis im jüdischen Ghetto eine Razzia durchführen, bleibt Sadie und ihrer Familie nur die Flucht in die Kanalisation. In der Finsternis unterhalb der Stadt sehnt sich Sadie nach Licht und den glücklichen Tagen ihrer Kindheit. Auf einem ihrer Streifzüge in den Tunneln schaut sie durch ein Gitter hinauf nach draußen und entdeckt ein Mädchen, das auf dem Markt Blumen kauft. Eine Freundschaft scheint nahezu unmöglich, doch allen Gefahren zum Trotz beschließt die 18-jährige Ella, Sadie zu helfen ...
Inspiriert von wahren Begebenheiten – der neue Roman der New-York-Times-Bestsellerautorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Krakau, 1942: Sadie und ihre Eltern können sich nahezu glücklich schätzen. Im Krakauer Ghetto haben sie ein Zimmer für sich, während andere jüdische Familien noch enger zusammengepfercht leben müssen. Als die Razzien der Nazis jedoch zunehmen, fasst Sadies Vater einen Entschluss: Sie müssen raus aus dem Ghetto – und der einzige Weg hinaus führt durch die Kanalisation. Dass die dunklen Tunnel unter der Stadt jedoch ihre langfristige Bleibe werden, damit haben weder die 18-jährige Sadie noch ihre schwangere Mutter gerechnet. Als Sadies Vater bei der Flucht verunglückt, sind die beiden plötzlich auf sich allein gestellt – bis Sadie durch ein Gitter hinauf auf den Marktplatz schaut und Bekanntschaft mit einem Mädchen macht. Ella möchte ihrer neuen Freundin unbedingt helfen, doch dass sie sich dabei selbst in Lebensgefahr begibt, wird ihr allzu schnell bewusst …
Über Pam Jenoff
Pam Jenoff hat jahrelang in Krakau als Vizekonsul der amerikanischen Botschaft gelebt. Als Expertin für den Holocaust in Polen war sie im Pentagon tätig und wurde für ihre Arbeit von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen ausgezeichnet. Ihre Romane sind internationale Bestseller. Heute arbeitet sie als Anwältin und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Philadelphia.Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Romane »Töchter der Lüfte« und »Die Frauen von Paris« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Pam Jenoff
Das Mädchen mit dem blauen Stern
Roman
Aus dem Englischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog: Krakau, Juni 2016
Kapitel 1: Sadie — Krakau, März 1942
Kapitel 2: Ella — Krakau, Juni 1942
Kapitel 3: Sadie — März 1943
Kapitel 4: Sadie
Kapitel 5: Ella — April 1943
Kapitel 6: Sadie
Kapitel 7: Ella
Kapitel 8: Sadie
Kapitel 9: Ella
Kapitel 10: Sadie
Kapitel 11: Ella
Kapitel 12: Sadie
Kapitel 13: Ella
Kapitel 14: Ella
Kapitel 15: Sadie
Kapitel 16: Ella
Kapitel 17: Sadie
Kapitel 18: Sadie
Kapitel 19: Ella
Kapitel 20: Sadie
Kapitel 21: Ella
Kapitel 22: Sadie
Kapitel 23: Ella
Kapitel 24: Ella
Kapitel 25: Ella
Kapitel 26
Epilog: Krakau, Juni 2016
Anmerkung der Autorin
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für mein Schtetl.
Bald sehen wir uns wieder.
Prolog
Krakau, Juni 2016
Die Frau vor mir ist gar nicht die, die ich erwartet habe.
Vor zehn Minuten stand ich in meinem Hotelzimmer vor dem Spiegel, zupfte einen Fussel von der Manschette meiner hellblauen Bluse, rückte einen Perlenohrring zurecht – und betrachtete mich angewidert. Aus mir war eine dieser typischen Frauen Anfang siebzig geworden: kurz geschnittenes graues Haar, kräftige Statur, praktischer Hosenanzug, der enger saß als noch vor einem Jahr.
Ich warf einen Blick auf die Pfingstrosen auf dem Nachttisch. Sie waren in Packpapier eingeschlagen, nur die tiefroten Blüten schauten hervor. Ich trat ans Fenster. Das Hotel Wentzl, in dem ich logierte, war ein umgebautes Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert. Es lag in der südwestlichen Ecke des Rynek, dem weitläufigen Hauptmarkt der Stadt. Die Lage hatte ich bewusst gewählt, mein Zimmer sollte exakt diese Aussicht haben.
Auf dem großen Platz, dessen südliche Ecke eine kleine Kuhle bildete und mich an ein Sieb erinnerte, herrschte reges Treiben. Zwischen den beiden Kirchen und den Souvenirständen der Sukiennice, den imposanten, lang gestreckten Tuchhallen, die den Platz teilten, drängten sich Touristen. Es war ein warmer Juniabend, in den Straßencafés saßen Leute zusammen, die nach der Arbeit noch einen Schluck tranken. Andere eilten mit Einkäufen über den Platz und warfen besorgte Blicke zu den dunkler werdenden Wolken über der Wawel-Burg.
Ich war bereits zweimal in Krakau gewesen. Einmal gleich nach dem Fall des Kommunismus und dann zehn Jahre später, als ich ernsthaft mit meiner Suche begann. Dieses verborgene Juwel einer Stadt nahm mich sofort für sich ein. Zwar wurde es von den touristischen Hochburgen Prag und Berlin überschattet, doch die Altstadt von Krakau, mit ihren unversehrten Kirchen und den originalgetreu restaurierten Gebäuden aus Stein, war eine der elegantesten in ganz Europa.
Jedes Mal, wenn ich kam, hatte die Stadt sich verändert. Alles war neuer und glänzender geworden – »besser« in den Augen der Bewohner, die Jahre des Elends hinter sich hatten. Mittlerweile erstrahlten die ehedem grauen Gebäude in leuchtendem Gelb oder Blau, und die alten Gassen kamen mir vor wie ihre eigene Filmkulisse. Die Widersprüche innerhalb der Gesellschaft ließen sich an den Einheimischen ausmachen. Modisch gekleidete junge Leute telefonierten im Gehen mit ihren Handys, ohne auf die Händler aus den Bergdörfern zu achten, die von Planen auf dem Boden handgestrickte Wollpullover und selbst gemachten Schafskäse verkauften, oder auf die babcia mit dem Kopftuch, die auf dem Gehsteig saß und bettelte. Unter einem Schaufenster, auf dem mit großer Schrift WLAN und PC-Nutzung versprochen wurde, pickten Tauben auf dem harten Kopfsteinpflaster, so wie es seit Jahrhunderten gewesen war. Unter all dem Modernen und Aufpolierten schimmerte die Barockarchitektur der Altstadt trotzig hindurch und stand für die Geschichte, die sich nicht übertünchen ließ.
Es war jedoch nicht die Geschichte, die mich hierhergeführt hatte – oder zumindest nicht jene Geschichte.
Der Trompeter auf dem Turm der Marienkirche blies den Hejnał, der die volle Stunde markierte.
Ich richtete meinen Blick auf die Ecke im Nordwesten des Platzes und wartete auf die Frau, die jeden Tag um 17 Uhr erschien. Noch konnte ich sie nirgends entdecken. Vielleicht würde sie an diesem Tag nicht kommen. In dem Fall wäre meine Reise um die halbe Welt umsonst gewesen. Am ersten Tag hatte ich mich vergewissern wollen, dass es sich bei ihr um die richtige Person handelte. Am zweiten wollte ich sie ansprechen, aber dann fehlte mir dazu der Mut. Morgen würde ich zurück nach Hause in die Vereinigten Staaten fliegen. Demnach war heute die letzte Gelegenheit.
Endlich tauchte sie hinter der Apotheke auf, unter dem Arm einen Regenschirm. Für eine Frau um die neunzig überquerte sie den Marktplatz erstaunlich flotten Schrittes. Auch ging sie nicht gebeugt, sondern hielt sich kerzengerade. Das weiße Haar hatte sie auf dem Kopf zu einem lockeren Dutt zusammengesteckt, einzelne Strähnen hatten sich gelöst und rahmten ungezähmt ihr Gesicht. Im Gegensatz zu meinem langweiligen Outfit trug sie einen knöchellangen, leuchtend bunten Rock aus einem glänzenden Stoff und mit lebhaftem Muster. Es sah aus, als tanzte der Rock bei ihren Schritten um ihre Beine, und beinahe glaubte ich, ihn rascheln zu hören.
Sie verhielt sich ebenso wie an den beiden vorangegangenen Tagen, als ich beobachtet hatte, wie sie zum Café Noworolski ging und von den Tischen draußen denjenigen verlangte, der am weitesten von dem großen Platz entfernt unter den Arkaden lag. Offenbar wollte sie dem Lärm und dem Trubel nicht zu sehr ausgesetzt sein.
Bei meinem letzten Besuch in Krakau war ich noch auf der Suche nach ihr gewesen. Nun wusste ich, wer sie war, und wo ich sie finden konnte. Ich musste nur noch meinen Mut zusammenraffen und zu ihr gehen.
Die Frau setzte sich an ihren Tisch und schlug eine Zeitung auf. Ohne zu ahnen, dass wir uns gleich begegnen würden – oder dass es mich überhaupt noch gab.
In der Ferne war Donnergrollen zu hören. Dann fielen die ersten Regentropfen, tüpfelten das Kopfsteinpflaster wie dunkle Tränen. Ich musste mich beeilen. Sollte die Außenterrasse des Cafés geschlossen werden und die Frau verschwinden, würde sich alles, wofür ich gekommen war, in Luft auflösen.
Im Geist hörte ich die Stimmen meiner Kinder, die erklärten, in meinem Alter sei es viel zu gefährlich, allein so weit zu reisen, zumal es dafür keinen Grund gebe und ich hier nichts mehr in Erfahrung bringen würde. Vielleicht sollte ich wirklich umkehren und abreisen. Es wäre für niemanden von Bedeutung.
Außer für mich selbst – und für sie. In Gedanken hörte ich ihre Stimme, so wie ich sie mir vorstellte. Sie erinnerte mich an den Grund meines Kommens.
Ich straffte meine Schultern, griff nach dem Blumenstrauß und verließ das Zimmer.
Ich überquerte den Marktplatz – und hielt inne. Mit einem Mal begannen mich Zweifel zu plagen. Wonach suchte ich und was wollte ich überhaupt erreichen? Ich lief weiter, spürte kaum die dicken Tropfen auf meinen Haaren.
Beim Café schlängelte ich mich an den Tischen vorbei. Der Regen war stärker geworden, die Gäste draußen beglichen ihre Rechnungen und machten sich zum Aufbruch bereit. Ich näherte mich dem Tisch der Frau mit dem weißen Haar. Sie blickte von ihrer Zeitung auf. Ihre Augen weiteten sich.
Nun sehe ich ihr Gesicht aus der Nähe und stehe wie erstarrt.
Die Frau vor mir ist gar nicht die, die ich erwartet habe.
Kapitel 1
Sadie
Krakau, März 1942
Nach dem Tag, an dem sie die Kinder holen wollten, wurde vieles anders.
Wir wohnten im Ghetto, in einem dreistöckigen Haus, das wir uns mit einem Dutzend Familien teilen mussten. Dort verbarg ich mich tagsüber im Kriechraum des Dachbodens. Bevor meine Mutter sich morgens auf den Weg in die Schuhfabrik machte, begleitete sie mich nach oben, überreichte mir einen sauberen Eimer als Toilette und ermahnte mich mit strengen Worten, mich bis zum Abend nicht von der Stelle zu rühren.
Doch in der noch immer winterlichen Kälte meines Verstecks, in dem ich weder herumlaufen noch mich überhaupt großartig bewegen oder gar stehen konnte, fror ich nicht nur, ich wurde auch rastlos. Jede Minute schien sich endlos zu dehnen, und die Stille wurde nur hin und wieder von kleinen Geräuschen unterbrochen. Sie kamen von den Kindern, die jünger als ich waren und sich auf den Kriechböden der Nachbarhäuser verbargen. Auch sie konnten weder herumlaufen noch sich beschäftigen. Zum Ausgleich verständigten sie sich bisweilen durch Klopfen und Kratzen, hatten ihre eigenen Morsezeichen entwickelt. Wenn mir allzu langweilig wurde, machte ich mit.
»Die Freiheit ist da, wo man sie findet«, sagte mein Vater gern, wenn ich mich über mein eingeschränktes Leben beklagte. Er neigte dazu, die Welt so zu sehen, wie er sie sich wünschte. »Das größte Gefängnis steckt in unseren Köpfen.« Er hatte gut reden. Zwar verrichtete er im Ghetto körperliche Arbeit, die weit von der des Steuerberaters entfernt war, der er vor dem Krieg gewesen war, aber er kam wenigstens vor die Tür und begegnete anderen Menschen. Niemand pferchte ihn auf einem Kriechboden ein. Ich hingegen hatte das Haus kaum einmal verlassen dürfen, seit wir vor einem halben Jahr hierherziehen mussten.
Zuvor hatten wir nahe dem Stadtzentrum im jüdischen Viertel Kazimierz gewohnt, nun waren wir südlich des Weichselufers im Ghetto von Podgórze gelandet. Ich wollte ein normales Leben führen, ein eigenes Leben, wollte aus dem Ghetto hinaus zu den Orten laufen, die ich kannte. Manchmal malte ich mir eine Straßenbahnfahrt zum Rynek aus, bummelte im Geist an den Geschäften entlang, ging ins Kino, streifte über die grünen Hänge am Stadtrand.
Wenn wenigstens Stefania, meine beste Freundin, bei mir oder den Kindern oben im Nachbarhaus gewesen wäre. Vielleicht hätte ich mich dann nicht so allein gefühlt. Doch Stefania wohnte auf der anderen Seite des Ghettos in dem Bereich, der für Familien der jüdischen Polizei vorgesehen war.
Diesmal war es jedoch weder die Langeweile noch die Einsamkeit oder die Kälte, die mich aus meinem Versteck trieb. Ich war einfach hungrig. Ich hatte zum Frühstück an diesem Morgen nur eine halbe Scheibe Brot bekommen, noch weniger als bisher. Meine Mutter hatte mir ihre halbe Scheibe angeboten, die ich aber nicht angenommen hatte. Sie brauchte Kraft für den langen Tag in der Fabrik.
Irgendwann im Laufe des Vormittags begann mein leerer Magen zu schmerzen. Ich musste an die Gerichte denken, die es vor dem Krieg bei uns gegeben hatte, schmeckte eine sämige Pilzsuppe, einen herzhaften Borschtsch, die wunderbaren Piroggen, die meine Großmutter gemacht hatte. Zu guter Letzt fühlte ich mich vor Hunger so geschwächt, dass ich mein Versteck verließ und hinunter ins Erdgeschoss stieg, zu der Gemeinschaftsküche, die aus nicht mehr als einer Kochplatte bestand, und einem Spülbecken aus dessen Hahn lauwarmes, bräunliches Wasser tropfte.
Ich suchte nicht nach Brot – selbst wenn welches da gewesen wäre, ich hätte es niemals gestohlen. Ich wollte nur nachsehen, ob irgendwo Krümel lagen, und gegen den Hunger ein Glas Wasser trinken.
An einem Brotmesser hafteten ein paar Krümel, die ich ableckte. Danach trank ich mein Glas Wasser.
Und dann fing ich an, das abgegriffene Exemplar von Der Graf von Monte Christo zu lesen, und blieb länger unten, als ich vorgehabt hatte. Das Schlimmste an meinem Versteck auf dem Kriechboden war nämlich, dass es dort zu dunkel zum Lesen war. Ich war eine Leseratte, und mein Vater hatte so viele Bücher wie möglich aus unserer alten Wohnung mitgeschleppt, obwohl meine Mutter dagegen gewesen war und gesagt hatte, wir bräuchten den Platz in unseren Koffern für Kleidung und Nahrungsmittel.
Mein Vater war auch derjenige gewesen, der mir gezeigt hatte, dass Lernen etwas Schönes ist, und der mich ermutigt hatte, von einem Medizinstudium an der Jagiellonen-Universität in Krakau zu träumen. Inzwischen hatten die Deutschen mit ihren Rassengesetzen ein solches Studium für Juden unmöglich gemacht. Und dann hatten sie die Universität ganz geschlossen.
Stattdessen konzentrierte mein Vater sich nun auf meine Allgemeinbildung oder ging, trotz seines langen, harten Arbeitstags, abends mit mir naturwissenschaftliche Problemstellungen durch.
Vor ein paar Tagen hatte er irgendwo Der Graf von Monte Christo für mich aufgetrieben, und ich hatte mich darauf gestürzt. Dummerweise konnte ich auch abends, wenn ich nicht mehr in meinem Versteck war, nicht lange lesen, denn mit Beginn der Sperrstunde mussten wir das Licht löschen.
Nur noch ein bisschen, sagte ich mir nun und blätterte die Seite um. Welche Rolle spielten schon ein paar Minuten?
Mit einem Mal hörte ich draußen Reifen quietschen. Wagentüren schlugen zu, Befehle wurden gebrüllt. Ich erstarrte. Als ich einen Blick aus dem Fenster wagte, sah ich, wer gekommen war – SS, Gestapo und Angehörige der jüdischen Polizei, die stets das taten, was die Deutschen von ihnen verlangten. Offenbar planten sie eine Razzia, um den nächsten Schub Juden festzunehmen und in eines der Lager zu deportieren.
Ich rannte aus der Küche über den Flur und die Treppe hinauf. Unten wurde die Eingangstür aufgebrochen und die Deutschen stürmten ins Haus. Dass ich es noch rechtzeitig zum Kriechboden schaffte, war ausgeschlossen.
Stattdessen hetzte ich in unsere Wohnung im dritten Stock. Panisch und mit hämmerndem Herzen blickte ich mich um und wünschte, wir hätten einen Schrank oder eine Anrichte, in denen ich mich verbergen konnte. Doch in dem winzigen Raum standen nur eine Kommode und zwei Betten.
Allerdings gab es noch andere Verstecke, etwa hinter der Gipswand, die eine Familie vor einer Woche im Nachbarhaus eingesetzt hatte. Nur würde es mir nicht mehr gelingen, dort noch unbemerkt hinzugelangen.
Mein Blick fiel auf den Überseekoffer am Fußende meines Betts. Kurz nachdem wir hier eingezogen waren, hatte meine Mutter mich auf ihn als Versteck hingewiesen, und wir hatten ausprobiert, ob ich hineinpasste. Was ich mit Ach und Krach tat.
Dennoch war der Koffer viel zu auffallend, um ein gutes Versteck abzugeben. Doch etwas Besseres hatte ich nicht. Und so krabbelte ich hinein und zog den Deckel zu. Dabei dankte ich dem Himmel, dass ich ebenso klein und zierlich wie meine Mutter geraten war. Normalerweise hasste ich meine Körpergröße, die mich zwei Jahre jünger aussehen ließ, aber in diesem Augenblick war sie ein Segen. Darüber hinaus war ich aufgrund der Mangelernährung im Ghetto noch dünner geworden.
Allerdings hatten wir uns, als wir den Koffer als Versteck getestet hatten, vorgestellt, dass meine Mutter, sobald ich darin wäre, eine Decke oder Kleidungsstücke darüberlegen würde. Damit konnte ich nun nicht dienen. Ich konnte mich lediglich einrollen und die Arme um mich schlingen, woraufhin mein Blick genau auf die weiße Armbinde mit dem blauen Stern fiel, die alle Juden tragen mussten.
Aus dem Nachbargebäude war ein lautes Krachen zu hören. Es klang, als wäre die Gipswand mit einem Hammer oder einer Axt eingeschlagen worden. Demnach hatten die Polizisten das Versteck gefunden, vielleicht hatte die frische Farbe es ihnen verraten. Geschrei ertönte, also hatten sie auch ein Kind entdeckt. Hätte ich mich dorthin geflüchtet, wäre es mir nicht anders ergangen.
Schritte näherten sich unserer Wohnung. Die Tür flog auf, und mein Herz verkrampfte sich. Ich hörte jemanden atmen, spürte den Blick, der durch das Zimmer wanderte. Tut mir leid, Mama. Ich wartete darauf, dass der Koffer geöffnet wurde, und wappnete mich. Dann überlegte ich, ob man nachsichtiger wäre, wenn ich freiwillig hervorkäme und mich ergeben würde.
Die Schritte entfernten sich und wurden den Flur hinunter leiser, ehe nacheinander die Türen geöffnet wurden. Die Tür zu unserem Zimmer ließ er offen.
Vor zweieinhalb Jahren war der Krieg nach Krakau gekommen, an einem warmen Herbsttag. Da hatten wir zum ersten Mal Luftschutzsirenen gehört, und die Kinder, die draußen gespielt hatten, waren Hals über Kopf nach Hause gerannt. Dann marschierten die Deutschen ein, besetzten Polen und erklärten unser Land zu ihrem Generalgouvernement.
Zuerst wurde unser Leben hart, dann grauenvoll. Es gab kaum noch etwas zu essen, und für Grundnahrungsmittel mussten wir uns in langen Warteschlangen anstellen. Einmal war eine ganze Woche über kein Brot aufzutreiben.
Und dann, vor ungefähr einem Jahr, strömten Tausende Juden von außerhalb nach Krakau. Sie folgten einem Befehl des deutschen Generalgouverneurs, hatten Dörfer und kleine Städte verlassen und trugen ihre Habseligkeiten auf dem Buckel. Als sie bei uns eintrafen, wirkten sie benommen. Damals fragte ich mich, wie sie alle bei uns in Kazimierz unterkommen wollten; wir lebten ja schon in reichlich beengten Verhältnissen. Dann stellte sich heraus, dass diese Neuankömmlinge per Dekret in einen Teil von Podgórze ziehen mussten, um den herum eine hohe Mauer errichtet worden war.
Meine Mutter arbeitete mit der Gmina, der jüdischen Gemeinde, zusammen und half den Leuten, sich zurechtzufinden. Anfangs luden wir einige von ihnen noch zu uns zum Essen ein – Freunde von Freunden –, doch dann durften sie den ummauerten Bereich, oder das Ghetto, nicht mehr verlassen. Sie hatten uns Geschichten aus ihren Dörfern oder Städtchen erzählt, die man kaum fassen konnte, weil sie so schrecklich waren. Mitunter schickte meine Mutter mich aus dem Esszimmer, damit ich sie nicht hörte.
Einige Monate nach der Errichtung des Ghettos wurde auch uns befohlen, dorthin zu ziehen. Als mein Vater es mir verkündete, wollte ich es nicht glauben. Wir waren keine Flüchtlinge, sondern Einwohner von Krakau, und wir hatten stets in unserer Wohnung in der Ulica Meiselsa gelebt. Eine bessere Adresse war kaum vorstellbar, die Straße lag am Rand des jüdischen Viertels, man konnte zu Fuß ins Zentrum der Stadt laufen, und das Büro meines Vaters in der Ulica Stradomska war so nahe, dass er zum Mittagessen nach Hause kommen konnte. Zudem befand sich unten im Haus ein Café, in dem es abends Klaviermusik gab. Die Klänge drangen bis zu uns hinauf, und manchmal tanzten meine Eltern dazu. Doch auf Anordnung des Generalgouverneurs waren wir ebenso wie die Flüchtlinge Juden, und das war ausschlaggebend. Man gestand uns einen einzigen Tag zu, um zu packen und umzuziehen. Und jeder durfte nicht mehr als einen Koffer mitnehmen. Die Welt, die ich mein Leben lang gekannt hatte, verschwand.
Nun hob ich den Deckel des Überseekoffers ein wenig an, linste durch den Spalt und versuchte, etwas auf dem Flur zu erkennen. Wir hatten das Glück gehabt, für unsere Familie ein ganzes Zimmer zugewiesen zu bekommen. Das Privileg verdankten wir meinem Vater, der in der Fabrik zum Vorarbeiter aufgestiegen war. In anderen Zimmern hausten teilweise zwei oder drei Familien zusammen. Dennoch hockten auch wir aufeinander, und jedes Geräusch, jede kleine Szene unseres Alltags wurde verschärft.
Die Polizisten schienen mittlerweile im ganzen Haus über die Flure zu laufen. »Alle Kinder rauskommen!«, riefen sie. Es war nicht das erste Mal, dass sie tagsüber erschienen, um die Kinder zu holen. Sie wussten, dass die Eltern dann in der Arbeit waren.
Aber ich war kein Kind mehr. Ich war achtzehn Jahre alt und hätte arbeiten können, ebenso wie andere, die so alt wie ich oder sogar jünger waren. Jeden Morgen bekam ich mit, wie sie unten auf dem Plac Zgody zum Appell antraten und anschließend zu einer der Fabriken in- oder außerhalb des Ghettos trotteten. Ich wollte sogar arbeiten, auch wenn ich wusste, wie schwer und furchtbar es sein würde. Ich konnte es am Schritt meines Vaters erkennen, schleppend und schlurfend wie der eines alten Manns, ebenso an den rissigen Händen meiner Mutter, die manchmal sogar bluteten.
Doch als Arbeiterin wäre ich wenigstens nach draußen gekommen, hätte mit anderen Leuten reden können. Meine Eltern hatten lange darüber debattiert, ob ich arbeiten oder mich verbergen sollte. Mein Vater hatte für Ersteres gestimmt. Arbeitsausweise waren im Ghetto begehrt, denn Arbeiter wurden von den Deutschen geschätzt, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in eines der Lager deportiert wurden, war geringer.
Meine Mutter widersetzte sich meinem Vater nur selten, doch diesmal tat sie es. »Sadie sieht jünger aus, als sie ist. Sie ist zart, und die Arbeit, die man ihr geben würde, wäre zu schwer für sie. Die Deutschen sollen sie gar nicht erst sehen, dann ist sie am sichersten.«
Und wenn man mich nun entdeckte? Würde sie dann immer noch glauben, dass sie recht gehabt hatte?
Die Schritte auf den Fluren wurden leiser, und dann verhallten sie. Im Haus wurde es wieder ruhig.
Ich rührte mich nicht. Die Stille konnte eine Falle sein, bisweilen taten die Polizisten nur, als gingen sie wieder. In Wahrheit lagen sie dann auf der Lauer und warteten darauf, dass man sich sicher fühlte und aus dem Versteck hervorkam. Ich blieb im Überseekoffer.
Nach einer Weile begannen meine Glieder zu schmerzen, dann wurden sie taub. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Wieder hob ich den Kofferdeckel leicht an und spähte ins Zimmer. Das Licht war blasser geworden. Demnach war die Sonne schon dabei, unterzugehen.
Irgendwann waren auf dem Flur erneut Schritte zu hören, schwere, schlurfende Schritte. Diesmal waren es Arbeiter, die schweigend und erschöpft von ihrem Tagewerk zurückkehrten. Ich versuchte, mich zu entrollen. Doch meine Muskeln waren verkrampft, meine Bewegungen unbeholfen.
Noch bevor ich den Deckel öffnen konnte, stürzte meine Mutter ins Zimmer. »Sadie!«, rief sie und klang hysterisch.
»Jestem tutaj«, erwiderte ich. Ich bin hier. Vielleicht hörte meine Mutter mich nicht, denn ich schaffte es nicht mehr, den Kofferdeckel zu öffnen. Ich drückte noch einmal, aber einer der beiden Riegel schien sich verhakt zu haben.
Meine Mutter rannte hinaus auf den Flur. Ich bekam mit, dass sie die Treppe hinauflief und die Tür zum Dachboden aufriss. »Sadie!«, rief sie und dann ein ums andere Mal: »Wo bist du?« Sie begann, im ganzen Haus nach mir zu suchen, und je länger sie mich nicht fand, desto schriller wurde ihre Stimme.
»Mama!«, schrie ich. Noch einmal versuchte ich, den Deckel aufzustemmen; er bewegte sich nicht.
Meine Mutter kehrte zurück. Sie öffnete das Fenster, vielleicht wollte sie von dort aus nach mir rufen, doch in dem Augenblick gelang es mir, den Kofferdeckel aufzustoßen.
Mühsam richtete ich mich auf und traute meinen Augen nicht. Meine Mutter stand auf dem Fensterbrett, ihre zarte Gestalt hob sich dunkel vor der grauen Abenddämmerung ab.
»Was tust du da?«, fragte ich und überlegte, ob sie auf der Straße nach mir Ausschau hielt. Aber warum dazu auf die Fensterbank klettern? »Mama?«
Sie drehte sich um, ihre Miene war schmerzverzerrt. Und ich begriff, warum sie auf der Fensterbank stand. Sie dachte, die Deutschen hätten mich mitgenommen, zusammen mit den Kindern aus dem Nachbarhaus. Sie wäre gesprungen, hätte ich mich nicht aus dem Koffer befreit. Ich war ihr einziges Kind, ihr Ein und Alles, und ohne mich wollte sie nicht mehr leben.
Ein Schauer kroch mir über den Rücken. »Ich bin doch da«, sagte ich und lief zu ihr. Als sie schwankte, hielt ich sie fest und fühlte mich schuldig. Warum hatte ich nicht auf sie gehört und war auf dem Kriechboden geblieben? Normalerweise tat ich alles, um ihren Wünschen zu entsprechen und ein seltenes Lächeln aus ihr hervorzulocken. Und nun hatte ich ihr so großes Leid zugefügt, dass ich sie um ein Haar verloren hätte.
Ich half meiner Mutter vom Fensterbrett herunter und schloss das Fenster.
»Ich war vor Angst außer mir«, sagte sie, als wäre das eine ausreichende Erklärung für das, was sie vorgehabt hatte. »Du warst nicht auf dem Kriechboden.«
»Ich habe mich hier versteckt.« Ich deutete auf den Überseekoffer. »Das hatten wir doch so abgemacht. Wir haben ihn ›das zweite Versteck‹ genannt. Ich hatte bloß Schwierigkeiten, wieder herauszukommen. Warum hast du nicht hineingeschaut?«
Meine Mutter runzelte die Stirn. »Ich dachte nicht, dass du noch hineinpasst.« Nach kurzem Schweigen fingen wir an zu lachen. Und für ein paar Sekunden war es, als wären wir wieder in unserer Wohnung in der Meiselsa, und unser Leben wäre noch wie früher. Ich redete mir ein, wenn wir noch lachen konnten, würde vielleicht alles wieder gut. An diese Vorstellung, so verrückt sie auch war, klammerte ich mich wie an einen Rettungsring auf dem Meer.
Ein Schrei hallte durch das Haus, gefolgt von einem zweiten. Uns blieb das Lachen im Halse stecken. Es waren die Mütter der Kinder, die die Polizei mitgenommen hatte. Dann hörte man draußen etwas aufschlagen. Ich lief zum Fenster. Meine Mutter fasste meinen Arm. »Sieh nicht hin«, sagte sie. Es war zu spät. Frau Kolberg vom Ende des Flurs lag reglos auf der verrußten Schneedecke des Bürgersteigs, der Rock wie ein Fächer ausgebreitet, die Glieder seltsam verrenkt. Als sie erkannt hatte, dass ihre Kinder fort waren, hatte wohl auch sie nicht mehr leben wollen. Ich fragte mich, ob diese Reaktion bei manchen Müttern instinktiv erfolgte, oder ob die Mütter des Ghettos darüber gesprochen und für den Fall, dass ihr schlimmster Alptraum wahr werden sollte, einen Selbstmordpakt geschlossen hatten.
Dann kam mein Vater heim. Seiner erschütterten Miene entnahm ich, dass er von der Razzia erfahren hatte und wusste, dass anderen Familien die Kinder geraubt worden waren. Er schloss meine Mutter und mich in die Arme und drückte uns fest an sich.
Meine Eltern setzten sich auf ihr Bett und ich mich auf meins. Ich betrachtete die beiden Menschen, die ich innig liebte.
Meine Mutter war eine Schönheit, grazil und anmutig, ihr Haar so weißblond, dass sie mir als Kind manchmal wie eine Prinzessin aus dem hohen Norden erschienen war. Jedenfalls ähnelte sie nicht im Mindesten anderen Jüdinnen, und hinter ihrem Rücken tuschelten die Nachbarn, wahrscheinlich käme sie auch gar nicht aus Polen. Wären mein Vater und ich nicht gewesen, hätte sie niemals ins Ghetto gemusst, sondern irgendwo als Nichtjüdin leben können.
Ich hatte zwar ihre Statur geerbt, sonst jedoch das dunkle, krause Haar meines Vaters und seinen olivfarbenen Teint. Es war unverkennbar, dass er und ich Juden waren. Auch mein Vater war einmal schmal gewesen, mittlerweile hatte die schwere körperliche Arbeit ihn jedoch kräftiger gemacht.
Mein Vater war mein Verbündeter. Ihm konnte ich erzählen, was mich beschäftigte, konnte ihm Geheimnisse anvertrauen und über meine Wunschträume sprechen. Früher, als es noch möglich war, war er abends und an den Wochenenden mit mir durch Krakau gewandert, hatte mir die Geschichte der Stadt nahegebracht und mich auf die Relikte ihrer vergangenen Größe hingewiesen.
Doch auch mein Vater war nicht in der Lage, uns vor der zunehmenden Bedrohung seitens der Deutschen zu schützen. Sicher, die Zustände im Ghetto waren von Anfang an schrecklich gewesen, aber bisher hatten wir uns hier wenigstens einigermaßen sicher fühlen können. Wir lebten in einer jüdischen Gemeinschaft, hatten sogar einen Judenrat, den die Deutschen ernannt hatten, und der unser Leben regelte. Mehr als einmal hatte mein Vater erklärt, solange wir uns unauffällig verhielten und den Besatzern gehorchten, würden sie uns in Ruhe lassen. Und irgendwann wäre der Krieg und mit ihm womöglich auch die deutsche Schreckensherrschaft in unserem Land zu Ende. Zumindest hofften wir das. Nach dem heutigen Tag war ich nicht mehr ganz so zuversichtlich.
Ich ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen und empfand sowohl Ekel als auch Furcht. Anfangs hatte ich hier nicht sein wollen, nun hatte ich Angst, man würde uns zwingen, das Ghetto zu verlassen.
»Wir müssen etwas unternehmen«, flüsterte meine Mutter, als hätte sie meine Gedanken erraten.
»Morgen gehe ich mit Sadie zum Judenrat und beantrage für sie eine Arbeitserlaubnis«, sagte mein Vater. Diesmal widersprach meine Mutter ihm nicht.
Vor dem Krieg war es schön gewesen, in Krakau ein Kind oder Jugendlicher zu sein. Nun mussten wir uns nützlich machen, zeigen, dass wir einen Gebrauchswert besaßen, um uns ein wenig Sicherheit zu erkaufen.
Doch meiner Mutter ging es nicht nur um die Arbeitserlaubnis. »Sie werden wiederkommen«, sagte sie. »Und dann haben wir vielleicht nicht mehr so viel Glück wie heute.«
Ich nickte. Wir sollten hier nicht länger tatenlos ausharren.
»Alles wird gut, kochana«, sagte mein Vater. Ich fragte mich, wie er das so einfach behaupten konnte, zumal es überhaupt nicht danach aussah.
Meine Mutter legte ihren Kopf an seine Schulter. Sie vertraute ihm.
»Ich werde mir etwas einfallen lassen«, fuhr mein Vater fort. »Wenigstens sind wir noch zusammen.«
Die Worte schwebten durch das Zimmer, waren halb Gebet, halb Versprechen.
Kapitel 2
Ella
Krakau, Juni 1942
Der Sommer hatte begonnen, und in den frühen Abendstunden war es noch warm. Ich überquerte den Marktplatz und wanderte durch die Arkaden der Tuchhallen, vorbei an Ständen voller Blumen, die sich nur noch wenige leisten konnten oder wollten. Trotz des schönen Abends waren die Straßencafés nicht mehr ganz so voll wie früher, aber sie hatten noch geöffnet und auch gut zu tun. Bei ihren Gästen handelte es sich nun um Bier trinkende Wehrmachtssoldaten und um Polen, die es gewagt hatten, sich an den Nachbartischen niederzulassen. Wenn man nicht allzu genau hinschaute, hätte man meinen können, nichts habe sich geändert.
In Wahrheit hatte sich so gut wie alles geändert, schließlich hielten die Deutschen die Stadt mittlerweile seit drei Jahren besetzt. An den Tuchhallen und dem Backsteinturm des Rathauses hingen Hakenkreuzfahnen. Der Rynek war inzwischen der Adolf-Hitler-Platz, und aus traditionellen polnischen Straßennamen waren Reichstraßen, Wehrmachtstraßen und so weiter geworden. Der Sitz des deutschen Generalgouverneurs war auf dem Wawel, und die Stadt voller Wehrmachtsoldaten, Sipo und SS, wobei Letztere mit schweren, schwarzen Stiefeln zu dritt oder viert in einer Reihe die Bürgersteige patrouillierten, andere Fußgänger aus dem Weg drängten und die Bewohner der Stadt generell nach Lust und Laune schikanierten.
An einer Ecke verkaufte ein Junge in kurzer Hose das deutsche Propagandablatt Krakauer Zeitung, das unsere frühere Tageszeitung ersetzt hatte. »Fürs Klosett«, flüsterten wir untereinander und meinten damit, dass die Zeitung nur als Klopapier taugte.
Dennoch tat es mir gut, durch den milden Abend zu spazieren und die warme Sonne auf meinem Gesicht zu spüren. Ich war neunzehn Jahre alt, und seit ich denken konnte, durch die Straßen der Altstadt gelaufen, zuerst an der Hand meines Vaters, später allein. Ihre Wahrzeichen gehörten zur Topographie meines Lebens, vom Barbakan am Florianstor bis zur Burg Wawel oben auf dem Hügel, von dem aus man einen weiten Blick über die Weichsel hatte. Inzwischen schienen meine Spaziergänge das Einzige zu sein, das weder die Zeit, in der wir lebten, noch der Krieg mir nehmen konnte.
Ich kehrte in keines der Straßencafés ein. Früher hätte ich mich dort mit Freunden getroffen, wir hätten uns unterhalten, gescherzt und gelacht. Währenddessen wäre die Sonne untergegangen und wenig später die Außenbeleuchtung eingeschaltet worden. Auf den Bürgersteigen wären goldene Lichtpfützen entstanden. Nun gab es abends kein Licht mehr, wir mussten die Stadt verdunkeln, um sie vor Luftangriffen zu schützen. Niemand, den ich kannte, traf sich noch mit Freunden und Bekannten. Überhaupt waren Einladungen selten geworden. Wer hatte schon genügend Lebensmittelmarken, um Gäste bewirten zu können? Wir waren alle nur noch mit unserem Überleben beschäftigt. Geselligkeit war ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten konnten.
Kein Wunder also, dass ich mich häufig einsam fühlte. Mein Leben war in Krys’ Abwesenheit viel zu ruhig geworden. Ich hätte so gern mit Freunden zusammengesessen und geplaudert. Aber so war es nun einmal.
Ich verdrängte die düsteren Gedanken, warf einen Blick in das Schaufenster eines Modegeschäfts; die ausgestellten Kleidungsstücke konnte sich kaum noch jemand leisten.
Ich drehte eine zweite Runde über den Marktplatz, wollte den Rückweg zu dem Haus hinauszögern, in dem ich mit meiner Stiefmutter lebte.
Allerdings wäre es unklug, noch länger draußen zu bleiben. Wenn es dunkel wurde und die Sperrstunde nahte, hielten die Deutschen uns nun immer öfter an, kontrollierten unsere Papiere, verhörten uns und durchsuchten unsere Taschen.
Ich verließ den Markt, lief die große Ulica Grodzka hinunter und bog in die Ulica Kanonicza, eine alte, gewundene Gasse, deren einst buckligen Kopfsteine mit der Zeit von zahllosen Schuhsohlen geebnet und poliert worden waren. Hier, nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt, lag das schöne Stadthaus, in dem ich von jeher gelebt hatte. Und wie jedes Mal stimmte mich sein Anblick froh, sosehr es mir auch widerstrebte, es mit meiner Stiefmutter teilen zu müssen. Der Putz der Fassade war leuchtend gelb, die Geranien in den Blumenkästen auf den Fensterbänken feuerrot. Aus Sicht der Deutschen war das Haus vermutlich sogar zu gut für Polen, dennoch war es bisher nicht beschlagnahmt worden.
Als ich vor dem Eingang stand, kamen Erinnerungsbilder an meine Familie in mir auf. Diejenigen, auf denen meine Mutter zu sehen war, wirkten verschwommen. Ich war noch ein kleines Kind, als sie starb. Als die Jüngste unter meinen Geschwistern beneidete ich die anderen um die vielen Jahre, die sie mit meiner Mutter verbracht hatten, wohingegen ich mich kaum an sie erinnern konnte. Mittlerweile waren meine Schwestern verheiratet, die eine mit einem Rechtsanwalt, mit dem sie nach Warschau gezogen war, die andere mit einem Schiffskapitän. Gemeinsam lebten sie in Danzig.
Am meisten jedoch fehlte mir Maciej, mein Bruder, der acht Jahre älter als ich war. Er hatte sich stets Zeit für mich genommen und sich mit mir beschäftigt, war überhaupt ganz anders als der Rest der Familie. Maciej wollte weder heiraten noch interessierten ihn die Berufe, zu denen mein Vater ihm riet. Als er siebzehn war, riss er nach Paris aus. Wenig später lebte er dort mit einem Franzosen namens Philippe zusammen. Aber auch Maciej kannte die Knute der Deutschen, seit sie Frankreich besetzt und die einstige Stadt des Lichts verdunkelt hatten. In seinen Briefen klang er allerdings recht gut gelaunt, woraus ich schloss, dass das Leben in Paris wohl doch noch etwas besser als das unsere war.
Als meine Geschwister aus dem Haus waren, war ich mit meinem Vater – meinem Tata – allein. Mein Vater besaß in Krakau eine Druckerei, doch nach einer Weile schien er geschäftlich immerzu in Wien zu tun zu haben. Eines Tages kehrte er von dort mit Ana Lucia zurück. Damals war ich zehn Jahre alt. Er hatte sie geheiratet, ohne mir vorher etwas davon zu sagen.
Bereits als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich diese Frau hassen würde. Vielleicht lag es an ihrem schweren Pelzmantel, an dessen Kragen die Köpfchen toter Tiere baumelten, die mich unglücklich und vorwurfsvoll zugleich anzusehen schienen. Als Ana Lucia die Luft an meiner Wange küsste und ihr Atem wie ein Zischen klang, roch ich den süßlichen Jasminduft ihres Parfüms. Dann trat sie zurück und musterte mich so kalt, als wäre ich ein unerwünschtes Möbelstück, mit dem sie sich abfinden musste, weil es zum Haus gehörte.
Als der Krieg begann, meldete mein Vater sich als Freiwilliger, obwohl er das in seinem Alter nicht mehr hätte tun müssen. Er gehorchte seinem Pflichtgefühl gegenüber dem Land und den jungen polnischen Soldaten, von denen einige während des letzten Großen Kriegs noch gar nicht geboren waren.
Es dauerte nicht lange, bis wir das Telegramm erhielten, dass er bei den Kämpfen in Ostpolen verschollen war, und man davon ausgehen könne, dass er tot war. Bei der Erinnerung begannen meine Augen zu brennen. Der Schmerz war noch so frisch wie an dem Tag, an dem die Nachricht kam. Manchmal träumte ich, er wäre nur in Kriegsgefangenschaft und würde irgendwann zu uns zurückkehren. Ein anderes Mal wurde ich wütend und fragte mich, wie er mich mit Ana Lucia hatte allein lassen können. Sie war wie die böse Stiefmutter im Märchen – nein, schlimmer, denn sie gab es wirklich.
Als ich die Hand auf den Griff der Eingangstür legte – eine schöne Bogentür aus Eichenholz –, registrierte ich den Stimmenlärm von drinnen. Ana Lucia hatte wieder Gäste. Ich ließ die Hand sinken.
Die Partys meiner Stiefmutter waren immer laut, auch wenn sie diese »Soireen« nannte, um sie vornehm klingen zu lassen. Zur Verköstigung gab es alles, was man zurzeit an anständigem Essen auftreiben konnte, dazu Wein aus dem schwindenden Vorrat meines Vaters, und hinterher Wodka, den Ana Lucia mit Wasser streckte.
Vor dem Krieg hatte ich an den Geselligkeiten in unserem Haus mitunter teilnehmen dürfen, damals handelte es sich noch um die Gäste meines Vaters, um Schriftsteller und Intellektuelle. Ich liebte die hitzigen Debatten, die sie bis in die Nacht führen konnten. Doch jene Männer und Frauen waren nicht mehr da; sie waren nicht bereit gewesen, sich der deutschen Besatzungsmacht zu beugen. Diejenigen, die dazu in der Lage gewesen waren, hatten in der Schweiz oder in England Zuflucht gesucht, die weniger Glücklichen waren verhaftet und in die Konzentrationslager der Deutschen deportiert worden.
Ana Lucia hatte sie durch die schlimmste Sorte Menschen ersetzt, die ich mir vorstellen konnte, sprich Deutsche, und je höher ihr Dienstgrad, desto besser. Falls man meine Stiefmutter mit einem Wort beschreiben wollte, wäre »Opportunistin« zweifellos passend gewesen. Dementsprechend hatte sie frühzeitig beschlossen, unsere Besatzer zu ihren Freunden zu erklären. Jedes Wochenende saßen an unserem Tisch stiernackige Rohlinge, die das Haus mit ihrem Zigarrenqualm verpesteten und unsere Teppiche verdreckten, weil sie sich nicht die Mühe machten, ihre Stiefel auf der Fußmatte vor der Tür abzutreten.
Anfangs behauptete Ana Lucia, dass sie mit den Deutschen fraternisiere, um an Informationen über das Schicksal meines Vaters zu gelangen. Das war zu der Zeit, als wir noch hofften, er wäre nur gefangen genommen worden. Doch selbst als klar wurde, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit umgekommen war, lud meine Stiefmutter weiterhin Deutsche ein, sogar mehr als zuvor. Sie musste auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nehmen, machte nur noch das, was sie wollte.
Ich wagte es nicht, Ana Lucia auf ihr schändliches Verhalten anzusprechen. Mein Vater galt als tot, und ein Testament hatte er uns nicht hinterlassen, so dass meine Stiefmutter nun über unser Haus und Vermögen verfügte. Sollte ich ihr Ärger bereiten, würde sie mich vor die Tür setzen und wäre endlich das Möbelstück los, das sie nie gewollt hatte. Und ich stünde vor dem Nichts. Deshalb ließ ich Vorsicht walten, zumal Ana Lucia mich oft genug daran erinnerte, dass wir es allein ihren guten Beziehungen zur Besatzungsmacht verdankten, dass wir in unserem schönen Haus bleiben konnten, genug zu essen hatten und es uns gestattet war, uns frei in der Stadt zu bewegen.
Ich warf einen Blick durch das Fenster des Vorderzimmers, sah das feine Porzellan und die Kristallgläser auf dem Tisch. Die Gäste, die diese Dinge benutzten, blendete ich aus. Stattdessen stellte ich mir dort meine Familie vor, so wie es früher gewesen war. Ich hörte, wie ich meine Schwestern anbettelte, mit mir zu spielen; sah Maciej, der mich um den gedeckten Tisch herum jagte, bis meine Mutter rief, dass wir aufpassen sollten, bevor wir gegen den Tisch stießen und die Gläser herunterfielen.
Als Kind glaubt man, die Familie wäre für immer da. Doch die Zeit und ein Krieg hatten mir bewiesen, dass dem nicht so war.
Da es mir vor Ana Lucia und ihren Gästen mehr graute als vor dem Verstoß gegen die Sperrstunde, wandte ich mich ab. Trotz der zunehmenden Dunkelheit lief ich wieder los, ohne recht zu wissen, wohin ich gehen sollte. Das Betreten von Parks war uns Polen um diese Uhrzeit verboten, das Gleiche galt für Kinos, die besseren Cafés und Restaurants. Es war, als würde meine Ziellosigkeit mein Leben widerspiegeln, in dem ich in einer Art Niemandsland gefangen war. Ich hatte niemanden, zu dem ich gehen konnte, und niemanden, der mich begleitete. Im besetzten Krakau glich mein Dasein dem eines Kanarienvogels, der in seinem Käfig kaum Platz zum Umherflattern hatte.
Wahrscheinlich wäre alles anders, wenn Krys noch da wäre, dachte ich, während ich erneut Richtung Rynek wanderte. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn der Krieg meinen Freund nicht gezwungen hätte, Krakau zu verlassen. Dann würden wir jetzt vielleicht unsere Hochzeitsfeier planen oder wären bereits verheiratet.
Ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn hatten wir uns kennengelernt. Da saß ich mit Freunden in einem Café, das in einem Innenhof lag. Krys kam mit einer großen Kiste voller Gemüse durch die Passage, die uns von der Straße trennte. Er war attraktiv, hochgewachsen und breitschultrig, die Gesichtszüge scharf gemeißelt. Sein Blick schien den ganzen Innenhof zu erfassen. Als er an uns vorbeikam, fiel eine Zwiebel aus seiner Kiste und rollte bis zu mir. Er kniete sich nieder, um sie aufzuheben, sah mich von unten herauf an und lächelte. »Ich liege vor Ihnen auf den Knien«, sagte er. Manchmal überlegte ich, ob er die Zwiebel absichtlich hatte fallen lassen oder das Schicksal sie zu mir gerollt hatte.
Er fragte, ob ich am Abend mit ihm spazieren gehen würde. Ich hätte Nein sagen sollen. Es schickte sich nicht, mit jemandem auszugehen, den ich vor einer Minute zum ersten Mal gesehen hatte. Aber er gefiel mir, und ich sagte Ja. Und während des Spaziergangs verliebte ich mich in ihn. Es lag nicht nur an seinem guten Aussehen. Er war einfach anders als die jungen Männer, die ich zuvor kennengelernt hatte, und seine Ausstrahlung war so stark, dass sie jeden anderen verblassen ließ.
Krys kam aus einer Arbeiterfamilie, hatte keinen Schulabschluss und sich alles, was er wusste, selbst angeeignet. Seine Zukunftsvisionen waren kühn und aufregend, seine Vorstellungen, wie eine gerechte Welt aussehen sollte, faszinierend. Überhaupt war er der klügste Mensch, dem ich jemals begegnet war. Und er interessierte sich für meine Meinung, auch das war neu für mich.
Es dauerte nicht lange, bis wir uns ständig sahen. Aber wir waren ein ungleiches Paar. Ich war gesellig, liebte Partys und das Zusammensein mit meinen Freunden. Krys hingegen war ein Einzelgänger, der lange Spaziergänge und gute Gespräche vorzog. Menschenmengen waren ihm zuwider. Auf unseren Wanderungen zeigte er mir Orte, die er für sich entdeckt hatte, verwunschen wirkende Wälder und Ruinen früherer Schlösser, von denen ich nicht einmal gewusst hatte, dass es sie jemals gegeben hatte.
Einige Wochen nach unserer ersten Begegnung spazierten wir abends über die Sankt-Bronisława-Anhöhe vor den Toren der Stadt und sprachen über die Ursachen des Nationalismus, der sich seit Jahren in großen Teilen Europas ausgebreitet hatte. Mit einem Mal fiel mir auf, dass Krys mich beobachtete.
»Ist was?«, fragte ich.
»Als ich dich zum ersten Mal sah, dachte ich, du wärst vielleicht wie die anderen jungen Frauen aus deiner Clique und würdest dich vor allem mit oberflächlichen Dingen beschäftigen«, erwiderte er.
Ich hätte beleidigt sein und ihn fragen können, warum er dann Interesse an mir hatte, aber ich wusste, was er meinte. Meine Freundinnen interessierten sich hauptsächlich für leichte Romane, amüsante Theaterstücke und die neueste Mode.
Krys küsste mich. »Ich bin froh, dass du anders bist.«
Wir hatten heiraten und reisen wollen, hatten vorgehabt, die ganze Welt kennenzulernen.
Dann kam der Krieg. Ebenso wie mein Vater meldete Krys sich gleich in den ersten Tagen als Freiwilliger. Er setzte sich stets für das ein, woran er glaubte, und nun gehörte auch der Kampf gegen die Deutschen dazu.
Ich hatte ihn gebeten, noch zu warten, und gesagt, vielleicht sei der Krieg schon bald beendet, doch Krys ließ sich nicht beirren.
Das Schlimmste war jedoch, dass er sich von mir trennte, bevor er aufbrach. »Niemand weiß, wie lange ich fort sein werde«, sagte er. Oder ob du zurückkommst, fügte ich im Geist hinzu. Es war ein so furchtbarer Gedanke, dass ihn keiner von uns aussprach. »Vielleicht lernst du einen anderen kennen«, fuhr er fort. »Und dann sollst du dich frei fühlen.«
Was für eine absurde Idee, dachte ich. Selbst wenn es in Krakau noch junge polnische Männer gegeben hätte, hätte mich keiner von ihnen interessiert. Ich beschwor Krys, sich nicht von mir zu trennen, sogar inständiger, als mein Stolz es eigentlich zuließ. Mein Wunsch war, dass wir uns verlobten oder sogar heirateten, ebenso wie andere Paare, bei denen der Mann in den Krieg zog. Ich wollte etwas haben, das von unserer Liebe zeugte. Doch Krys beharrte auf seinem Entschluss, und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es unmöglich, ihn umzustimmen.
Die letzte Nacht verbrachte ich bei ihm. Wir wurden intimer, als wir vielleicht hätten werden sollen, doch das war mir einerlei. Wer wusste schon, wann wir dazu wieder Gelegenheit hätten – womöglich nie. Ich weinte, als ich mich in den frühen Morgenstunden nach Hause schlich und so leise in mein Zimmer schlüpfte, dass meine Stiefmutter es nicht mitbekam. Am Tag darauf verabschiedete ich Krys am Hauptbahnhof.
Es dauerte nicht lange, bis die polnische Armee der Übermacht der deutschen Truppen erlag. Viele unserer Soldaten kamen verwundet zurück, andere demoralisiert. Krys war nicht unter ihnen. Und seine Briefe, die mit der Zeit ohnehin seltener und distanzierter geworden waren, blieben mit einem Mal ganz aus. Seitdem quälte mich die Frage, wo er sein mochte; für Polen waren die Kampfhandlungen doch beendet. Wäre er in Kriegsgefangenschaft geraten oder umgekommen, hätten seine Eltern es erfahren und die Nachricht an mich weitergegeben. Ein ums andere Mal sagte ich mir, dass Krys noch lebte, und es an den allgemeinen Kriegswirren lag, dass ich von ihm keine Post mehr erhielt.
In der Ferne schlugen die Glocken der Marienkirche zur vollen Stunde. Sieben Uhr. Aus alter Gewohnheit wartete ich auf den Trompeter, der den Hejnał blies. Es war ein Signal, das noch aus dem Mittelalter stammte, eine Warnung vor dem Einfall feindlicher Horden. Seitdem die Deutschen bei uns eingefallen waren, durfte das Signal nur noch zweimal am Tag ertönen.
Ich überquerte den Marktplatz, überlegte, ob ich einen Kaffee trinken sollte. Doch als ich mich einem Straßencafé näherte, blickte mich einer der Wehrmachtsoldaten, die dort saßen, so einladend an, dass ich eilig weiterlief.
An den Tuchhallen begegnete ich Magda und Klara, zwei Frauen, die ich kannte. Arm in Arm machten sie einen Schaufensterbummel. Ich begrüßte sie.
»Oh, hallo«, sagte Magda und richtete den aus der Mode gekommenen Hut auf ihrem brünetten Haar. Vor dem Krieg war sie eine meiner besten Freundinnen gewesen, doch nun hatte ich sie seit Monaten weder gesehen noch von ihr gehört. Sie schien meinem Blick auszuweichen.
Klara war eine flatterhafte Person, aus der ich mir nie viel gemacht hatte. Sie hatte sich das blonde Haar zu einem modischen Bob schneiden lassen und die Augenbrauen zu zwei so hohen Bögen gezupft, dass es aussah, als würde sie unentwegt staunen. »Wir haben ein paar Einkäufe gemacht«, erklärte sie mit einem selbstgefälligen Lächeln.
Und warum hatten sich mich nicht dazu eingeladen? »Ich wäre gern mitgekommen«, sagte ich an Magda gewandt. Auch wenn wir uns seit einer Weile nicht gesehen hatten, hoffte ich, sie würde mich auffordern, sie zu begleiten.
Magda schwieg. Klara aber, der die Freundschaft von Magda und mir von jeher ein Dorn im Auge gewesen war, wurde deutlich. »Warum hätten wir dich einladen sollen? Wir haben angenommen, dass du den Abend mit den Freunden deiner Stiefmutter verbringst.«
Meine Wangen begannen zu brennen, als hätte sie mir eine Ohrfeige verpasst. Seit Monaten ging ich davon aus, dass meine Freunde und Freundinnen sich wegen der allgemeinen Notlage nicht mehr trafen. Dabei hatten sie sich nur nicht mehr mit mir getroffen. Offenbar glaubten sie, dass ich, ebenso wie meine Stiefmutter, mit den Deutschen fraternisierte.
»Mit den Freunden meiner Stiefmutter habe ich nichts zu tun«, erwiderte ich so ruhig wie möglich. Doch weder Magda noch Klara ging darauf ein. Für einen Moment herrschte unangenehmes Schweigen.
»Wie auch immer.« Um zu zeigen, dass mir ihre Zurückweisung nichts anhaben konnte, reckte ich mein Kinn. »Ich habe alle Hände voll zu tun. Dinge, die erledigt werden müssen, bevor Krys zurückkommt.« Von der Trennung hatte ich niemandem in meinem Freundeskreis erzählt. Es lag nicht nur daran, dass ich meine Freunde kaum noch sah, oder mir das Bekenntnis peinlich gewesen wäre. Ich wollte es mich einfach nicht sagen hören. Es hätte die Trennung real gemacht. »Er wird bald wieder bei mir sein, und dann können wir endlich unsere Hochzeit planen.«
»Das hoffe ich für dich«, entgegnete Magda, woraufhin ich mich schuldbewusst fühlte. Ihr Verlobter hatte zu den Professoren gehört, die die Deutschen bei einer Razzia der Universität festgenommen hatten. Seitdem hatte man nichts mehr von ihm gehört.
»Wir müssen weiter«, sagte Klara. Wieder wünschte ich, sie oder Magda würden mich bitten, mit ihnen zu kommen. Erbärmlich, wie ich war, hätte ich meinen Stolz hinuntergeschluckt und mich ihnen angeschlossen, nur um noch einmal Gesellschaft zu haben.
»Bis die Tage«, sagte Klara und zog Magda mit sich fort. Ich blickte ihnen nach. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt. Wahrscheinlich redeten sie über mich. Wenig später trug der Wind ihr Gelächter zu mir.
Mir doch egal, dachte ich trotzig und zog meine Jacke enger um mich; in die laue Abendluft hatte sich ein frisches Lüftchen gemischt. Im Weitergehen malte ich mir aus, wie es sein würde, wenn Krys wieder bei mir wäre. Dann würden wir da weitermachen, wo wir aufgehört hatten, und diese schreckliche Zwischenzeit würden wir versuchen zu vergessen.
Kapitel 3
Sadie
März 1943
Ein seltsames Schaben, das von unten heraufdrang, hatte mich geweckt. Es war nicht das erste Mal, das mich nachts ein Geräusch aus dem Schlaf riss. In dem Haus, in dem wir wohnten, waren auf die Schnelle papierdünne Wände eingesetzt worden, um die einst großen Räume in kleine zu unterteilen, die entsprechend hellhörig waren.
Aber auch in unserem Zimmer war es nachts nicht still. Mein Vater schnarchte oder atmete beim Schlafen schwer; meine Mutter stöhnte, wenn sie versuchte, für ihren angeschwollenen Bauch eine bequeme Position zu finden. Oder meine Eltern flüsterten miteinander, wenn sie dachten, ich schliefe.
Allerdings verbargen sie vor mir nicht mehr so viel wie früher. Warum hätten sie es auch tun sollen? Ich bekam doch selbst mit, wie sehr sich unser Leben Tag für Tag nur noch verschlechterte.
Der Winter war eiskalt und entbehrungsreich gewesen. Sowohl junge als auch alte Ghettobewohner waren verhungert, Krankheiten erlegen oder von SS-Wachen erschossen worden. Letzteres konnte aus kleinstem Anlass geschehen, vielleicht, weil man nicht schnell genug einem Befehl gefolgt war oder beim morgendlichen Appell nicht stramm genug gestanden hatte.
Die Razzia vor einem Jahr erwähnten meine Eltern und ich nicht mehr.
Allerdings hatte ich inzwischen eine Arbeitserlaubnis und ging, ebenso wie meine Mutter, morgens im Ghetto in die Schuhfabrik. Dafür hatte mein Vater gesorgt. Auch dafür, dass meine Mutter und ich zusammenarbeiten konnten und keine Schwerarbeit verrichten mussten. Dennoch waren meine Hände voller Schwielen, schließlich hatte ich es zwölf Stunden täglich mit hartem, rauem Leder zu tun. Und von der gebückten Haltung und den immer gleichen Handgriffen schmerzte mein ganzer Körper.
Auch im Leben meiner Mutter hatte es eine Veränderung gegeben. Sie war mit fast vierzig Jahren noch einmal schwanger geworden. Ich hatte stets gewusst, dass meine Eltern sich ein zweites Kind wünschten. Und nun, in der denkbar schlimmsten Zeit, hatte sich ihr Wunsch erfüllt. Das Baby würde im Sommer kommen, hatte mein Vater gesagt. An der zarten Gestalt meiner Mutter sah man bereits den gerundeten Bauch.
Meine Eltern freuten sich auf den Nachwuchs. Auch ich hätte es gern getan, früher hatte ich von einem kleinen Bruder oder einer kleinen Schwester geträumt. Doch inzwischen war ich neunzehn Jahre alt, hätte selbst schon ein Kind bekommen können, und dachte eigentlich nicht mehr an Geschwister. Zudem fragte ich mich, wie wir im Ghetto ein Kind ernähren und beschützen könnten. Doch das Baby war unterwegs, ganz gleich, ob ich es richtig fand oder nicht.
Wieder hörte ich dieses merkwürdige Schaben. Diesmal war es noch lauter, als würde jemand versuchen, etwas auszukratzen.
Vielleicht arbeitete einer am Abflussrohr der Toilette. Wir hatten nur ein Klosett im Haus, und das war immerzu verstopft. Aber wie kam derjenige dazu, sich ausgerechnet in der Nacht daran zu schaffen zu machen?
Verärgert setzte ich mich auf. Ich hatte unruhig geschlafen, was jedoch kein Wunder war. Da es uns nicht gestattet war, nachts die Fenster zu öffnen, war die Luft im Zimmer so abgestanden und stickig, dass sie meinen Schlaf beeinträchtigte.
Ich blickte zum Bett meiner Eltern und verspürte eine leichte Panik, als ich feststellte, dass sie nicht da waren. Sicher, an manchem Abend entfloh mein Vater der Enge unseres Zimmers, ignorierte die Vorschrift, im Haus zu bleiben, und setzte sich unten auf die Eingangsstufen, wo er mit anderen Männern aus dem Haus plauderte und rauchte. Doch inzwischen hätte er längst zurück sein müssen. Und wo war meine Mutter? Sie verließ das Zimmer nachts nicht. Demnach musste etwas vorgefallen sein.
Nun waren auf der Straße laute Stimmen zu hören. Es waren Deutsche, die Befehle brüllten. Ich erstarrte vor Angst. Immer wieder gab es im Ghetto groß angelegte Razzien. Mein Vater sprach bereits davon, dass das ganze Ghetto »liquidiert« werden solle. Doch in unserem Haus war seit der Razzia vor einem Jahr weder SS noch Sipo gewesen. Mir saß der Schreck seit jenem Tag noch in den Knochen, und ich hätte schwören können, dass sie erneut auf dem Weg zu uns waren.
Ich stand auf, streifte meinen Morgenmantel über und schlüpfte in meine Hausschuhe. Dann verließ ich das Zimmer, um nach meinen Eltern zu suchen.
Leise stieg ich die Treppe hinunter. Überall war es dunkel, nur aus der Toilette unten drang schwaches Licht. Ich tappte dorthin und zog die Tür auf.
Im ersten Moment blendete mich das Licht, ich blinzelte aber nicht nur ob der Helligkeit, sondern auch vor Staunen. Das Klo war von seinem Platz entfernt worden. An seiner Stelle klaffte ein Loch im Boden. Und mein Vater lag auf den Knien und brach mit bloßen Händen Stücke aus dem Rand des Lochs, um es größer zu machen.
»Papa!«, sagte ich.
Er blickte nicht auf. »Los, zieh dich an!«, befahl er in einem so scharfen Ton, wie ich ihn bisher noch nie von ihm gehört hatte.