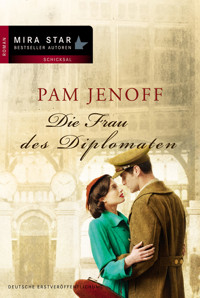
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Spannung erwartet: der zweite Roman von Bestseller-Autorin Pam Jenoff ("Der Kommandant und das Mädchen"). Deutschland 1945: Die Jüdin Marta hat den Naziterror überlebt. Als sie dem amerikanischen Soldaten Paul begegnet, beginnt sie auf eine glücklichere Zukunft zu hoffen. Aber der Plan, den Geliebten in London wiederzutreffen, scheitert: Pauls Flugzeug stürzt über dem Ärmelkanal ab! Schwanger und verzweifelt heiratet Marta den Diplomaten Simon Gold, der ihr eine Stelle als Sekretärin im britischen Außenministerium verschafft. Als sich der Verdacht erhärtet, dass es einen Spion in den Reihen der Regierung gibt, ist Marta die einzige, die den Verräter enttarnen kann: Eine dramatische Reise in die eigene Vergangenheit beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Pam Jenoff
Die Frau des Diplomaten
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Ralph Sander
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Cora Verlag GmbH & Co. KG,
Valentinskamp 24, 20350 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright dieser Ausgabe © 2011 by MIRA Taschenbuch
in der Cora Verlag GmbH & Co. KG
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Diplomat’s Wife
Copyright © 2008 by Pam Jenoff
erschienen bei: Mira Books, Toronto
Published by arrangement with
HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Claudia Wuttke
Titelabbildung: Harlequin Books S.A.
SBN (eBook, PDF) 978-3-86278-061-7 ISBN (eBook, EPUB) 978-3-86278-060-0
www.mira-taschenbuch.de
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung:
In Liebe
1. KAPITEL
Ich weiß nicht, wie viele Stunden oder Tage ich auf dem harten, kalten Boden lag und auf den Tod wartete. Eine Zeit lang kam es mir so vor, als sei ich bereits tot, eingehüllt in die Finsternis und Stille meines Grabes, unfähig zu sprechen oder mich zu rühren.
Ein stechender Schmerz zuckt durch meine rechte Seite. Nein, es ist noch nicht vorbei. In winzigen Wellen kehren die Geräusche zurück in meine Wahrnehmung: das Scharren der Ratten hinter dem Mauerwerk, tropfendes Wasser, das zu weit entfernt ist, als dass ich es erreichen könnte. Auf dem eisigen Beton beginnt mein Kopf schmerzhaft zu pochen.
Nein, ich bin nicht tot. Noch nicht, aber bald, denn lange kann ich es nicht mehr ertragen. Im Geiste sehe ich den Wachposten über mir stehen, wie er eine Eisenstange in die Höhe reckt, um damit zuzuschlagen. Mein Magen verkrampft sich. Habe ich geredet? Nein, erwidert eine Stimme irgendwo in meinem Inneren. Du hast nichts gesagt. Das hast du gut gemacht. Es ist eine Männerstimme. Alek. Oder vielleicht Jakub. Aber natürlich kann es keiner von beiden sein. Alek ist tot, die Gestapo hat ihn erschossen. Und Jakub ist vermutlich auch tot, es sei denn, er hat es mit Emma bis zur Grenze geschafft.
Emma. Ich sehe noch immer ihr Gesicht vor mir, wie sie auf der Eisenbahnbrücke über mich gebeugt steht. Ihre Lippen fühlten sich kühl auf meiner Wange an, als sie mir den Abschiedskuss gab. „Gott möge dich behüten, Marta.“ Zu schwach, um etwas zu erwidern, nickte ich nur und schaute ihr nach, wie sie zum anderen Ende der Brücke lief und in der Dunkelheit verschwand.
Nachdem sie fort war, drehte ich den Kopf zur Seite und sah den dunkelroten Fleck, der sich unter mir im Schnee bildete. Blut. Mein Blut. Oder vielleicht sein Blut? Der Kommandant lag nur ein paar Meter von mir entfernt reglos auf dem Boden. Sein Gesicht hatte etwas Friedliches, fast Unschuldiges an sich, und einen Moment lang konnte ich verstehen, wie es möglich war, dass Emma etwas für ihn empfunden hatte.
Aber ich hatte nichts für ihn empfunden. Ich hatte ihn getötet.
Die Seite, auf der die Kugel aus der Waffe des Kommandanten in mich eingedrungen war, begann entsetzlich zu brennen. In weiter Ferne hörte ich Sirenen, die allmählich näher kamen. Für einen Augenblick bedauerte ich, dass ich Emma zum Gehen aufgefordert hatte, anstatt ihr Angebot anzunehmen und mir von ihr helfen zu lassen. Aber ich hätte sie auf ihrer Flucht nur aufgehalten, und am Ende wären wir beide umgekommen. So hatte wenigstens sie eine Chance. Alek wäre stolz auf mich gewesen. Jakub auch. Ich schloss die Augen und stellte mir vor, wie auch Jakub sich über mich beugt, während der Wind mit seinem braunen Haar spielt. „Danke“, sagt er tonlos, und dann verschwindet auch er.
Als die Gestapo eintraf, lag ich mit geschlossenen Augen da und wünschte mir einen schnellen Tod. Als den Männern klar wurde, dass ich den Kommandanten getötet hatte, zweifelte ich nicht daran, auf der Stelle erschossen zu werden. Doch einer der Männer wandte ein, dass sie mit ihrer Munition sparsam umgehen müssten, und ein anderer ergänzte, dass man mich sicherlich befragen wollte. Also hoben sie mich vom Boden auf. „Sie wird sich noch wünschen, wir hätten sie gleich hier erledigt“, meinte einer von ihnen, als man mich brutal auf die Ladefläche eines Lastwagens warf.
Wenn ich jetzt an diese Worte zurückdenke, schaudert es mir, weil sie sich bewahrheitet haben. Das Ganze ist jetzt Monate her, vielleicht sogar Jahre. Die Zeit verliert hier an Bedeutung, da jeder endlose Tag von Einsamkeit, Hunger und Schmerz geprägt ist. Das Schlimmste ist die Einsamkeit. Seit man mich hergebracht hat, bin ich keinem anderen Gefangenen begegnet. Manchmal lege ich mich ganz dicht an die Wand und glaube, in der Zelle nebenan jemanden reden oder auch nur atmen zu hören. „Hallo?“, flüstere ich und drücke mein Ohr an die Fuge zwischen Wand und Boden. Aber ich erhalte nie eine Antwort.
Wenn im Korridor Schritte zu hören sind, überkommt mich jedes Mal Angst. Ist es der Junge, der mich mit seinen dunklen, leeren Augen anstarrt, während er ein Tablett mit verschimmeltem Brot und bräunlichem Wasser vor mich hinstellt? Oder ist es einer von ihnen? Wenn sie mich foltern, dann stets in unregelmäßigen, unberechenbaren Zeitabständen. Mal lassen sie mich tage- oder wochenlang in Ruhe, dann wieder holen sie mich jeden Tag aus meiner Zelle. Sie stellen mir immer wieder die gleichen Fragen, wenn sie auf mich einprügeln: Für wen haben Sie gearbeitet? Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, Kommandant Richwalder zu töten? Wenn ich ihnen die Namen nenne, dann lassen sie mich in Ruhe, versprechen sie mir. Aber ich verrate nichts, also prügeln sie mich weiter, bis ich das Bewusstsein verliere. Ein paarmal haben sie mich zurückgeholt, um gleich wieder von vorn anzufangen. Aber meistens wache ich erst wieder auf, wenn ich allein in meiner Zelle bin, so wie jetzt auch.
Trotzdem habe ich nichts verraten. Ich habe mich gut geschlagen, und innerlich muss ich lächeln. Doch dann ist meine Zufriedenheit auch schon wieder verflogen. Ich hatte fast gehofft, zu Tode geprügelt zu werden, als sie mich das letzte Mal holten. Aber ich lebe, und sie werden mich weiter foltern. Ich beginne zu zittern. Jedes Mal ist es schlimmer als das Mal zuvor. Ich ertrage es nicht länger. Bevor sie mich erneut abholen kommen, muss ich gestorben sein.
Wieder jagt ein Stich durch meine Seite. Die Deutschen haben mir kurz nach meiner Ankunft hier die Kugel herausgeholt. Zu dem Zeitpunkt verstand ich nicht, warum sie sich die Mühe machten, mir das Leben zu retten. Aber da hatten sie auch noch nicht mit ihren Verhören begonnen. Der Schmerz wird stärker, ich beginne zu schwitzen. Plötzlich kommt es mir so vor, als sei es in der Zelle kälter geworden, und ich merke noch, wie ich abermals in eine Bewusstlosigkeit gleite.
Irgendwann werde ich wieder wach. Der Gestank meiner eigenen Ausscheidungen hängt in der Luft. In weiter Ferne ist ein tiefes, ungewohntes Grollen zu vernehmen. Durch meine geschlossenen Augenlider bemerke ich einen schwachen Lichtschein. Wie viel Zeit ist vergangen? Ich nehme die Hände ans Gesicht. Mein rechtes Auge ist so geschwollen, dass ich es nicht öffnen kann. Ich reibe mein linkes Auge und wische die dicke Kruste weg, die sich im äußeren Augenwinkel gebildet hat. Blinzelnd sehe ich mich um. Den Raum kann ich so wie alles andere nur verschwommen wahrnehmen, da sie mir gleich nach meinem Eintreffen im Gefängnis die Brille abgenommen haben. Ich bemerke einen schwachen Strahl Tageslicht, der durch das winzige Fenster gleich unter der Decke in die Zelle fällt und eine kleine Wasserlache auf dem Boden bescheint. Meine ausgedörrte Kehle schmerzt. Wenn ich es nur bis zu dieser Pfütze schaffen könnte! Aber ich bin noch immer zu schwach, um mich von der Stelle zu rühren.
Das Grollen verstummt, dann höre ich Schritte im Stockwerk über mir, schließlich auf der Treppe. Die Wachen kommen zu mir. Als die Tür aufgeschlossen wird, mache ich die Augen zu. Leise Männerstimmen dringen an meine Ohren, und ich muss mich dazu zwingen, ganz ruhig dazuliegen und nicht zu zittern. Sie sollen nicht wissen, dass ich wach bin. Die Schritte werden lauter. Ich rechne fest damit, brutal gepackt und geschlagen zu werden. Die Männer scheinen sich uneins zu sein, und dann auf einmal fällt mir auf, dass sie gar nicht deutsch reden. Ich strenge mich an, um etwas zu verstehen. „… zu krank“, sagt eine Stimme. Das ist auch nicht Russisch, und auch keine slawische Sprache. Englisch! Mein Herz macht vor Schreck einen Satz.
„Sie muss hier raus.“ Ich öffne das linke Auge einen Spaltbreit. Zwei Männer in dunkelgrünen Uniformen stehen in meiner Zelle. Sind das Briten? Oder Amerikaner? Ich blinzle, kann aber nicht erkennen, welche Flagge sie am Ärmel tragen. Wurden wir etwa befreit?
Der kleinere Mann steht mit dem Rücken zu mir, und über seine Schulter kann ich sehen, wie der andere in meine Richtung deutet. „Sie muss hier raus“, wiederholt er wütend, doch der Kleinere schüttelt den Kopf.
Ich muss die beiden auf mich aufmerksam machen. Ich versuche mich aufzusetzen, doch die Schmerzen sind einfach zu stark. Stattdessen begnüge ich mich damit, einen Arm zu heben, während ich tief durchatme und zu husten beginne. Der größere der beiden Uniformierten schaut zu mir. „Sehen Sie?“, ruft er, als er mit hastigen Schritten auf mich zukommt. Der Kleinere antwortet nicht, sondern schüttelt abermals den Kopf und verlässt die Zelle.
Der Soldat kniet sich neben mich. „Hallo.“
Als ich etwas erwidern will, kommt nur ein Röcheln über meine Lippen. „Shht“, macht er und legt einen Finger auf meine Lippen. Er will nach meinem Arm greifen, doch ich zucke zurück. Zu lange hat jede menschliche Berührung für mich nur Schmerz bedeutet. „Schon okay“, sagt er leise und deutet auf die Flagge an seinem Ärmel. „Amerikaner. Schon okay.“ Erneut streckt er seine Hand nach mir aus, diesmal deutlich behutsamer. Ich zwinge mich dazu, nicht wieder zu zucken, als er meinen Arm anhebt und dabei seine schwieligen Finger um mein Handgelenk legt. Ich habe fast vergessen, dass es auch so sanfte Berührungen gibt. Er fühlt meinen Puls, die andere Hand legt er vorsichtig auf meine Stirn. Er legt die Stirn in Falten und beginnt hastig auf Englisch zu reden, wobei seine blauen Augen hin und her zucken. Ich schüttele den Kopf, so gut ich kann, damit er sieht, dass ich ihn nicht verstehe. Mitten im Satz bricht er ab, seine Wangen laufen rot an. „Oh, sorry.“
Aus dem Gürtel zieht er eine Metallflasche und gießt etwas Wasser in den Deckel. Er legt eine Hand hinter meinen Kopf, und ich gestatte mir, mich etwas zu entspannen, als ich die Wärme spüre, die seine Finger an mich abgeben. Sein Jackettärmel verströmt einen erdigen Geruch, der eine Kindheitserinnerung weckt an Kiefernnadeln und Waldboden. Er hebt meinen Kopf leicht an, als hätte er ein kleines Kind vor sich, und hält den Deckel an meine Lippen. „Trinken Sie.“ Ich schlucke das Wasser, das er in meinen Mund tropfen lässt. Es schmeckt salzig und auch ein wenig nach Metall, aber das kümmert mich nicht. Ich trinke den Deckel aus, und er füllt ihn wieder auf.
Während ich trinke, betrachte ich sein Gesicht. Er ist nur ein paar Jahre älter als ich, höchstens dreiundzwanzig oder vierundzwanzig. Sein dunkles Haar ist an den Seiten kurz geschnitten, auf dem Kopf ist es dagegen wellig. Auch wenn er mich im Moment sehr ernst ansieht, verraten die Fältchen um seine Augen, dass es in seinem jungen Leben schon viel zu lachen gegeben hat. Er sieht nett aus. Und attraktiv. Plötzlich wird mir bewusst, wie elend ich aussehen muss, und dass meine strähnigen Haare von Schmutz und Blut verklebt sind.
Ich trinke noch einen letzten Schluck, dann wird die Anstrengung doch zu viel, und ich sinke in mich zusammen, während er meinen Kopf vorsichtig wieder auf dem Boden ablegt. Nicht!, möchte ich rufen, als er die Hand wegzieht. Seine Berührung hat längst etwas Vertrautes und Tröstendes. Stattdessen lächle ich schief, um ihm meine Dankbarkeit zu zeigen. Er nickt und sieht mich mit großen Augen an. Ich merke, wie er überlegt, warum ich wohl in diese Zelle gesteckt wurde und wer mich so zugerichtet hat. Er will aufstehen, aber ich greife in Panik nach seiner Hand.
„Schon gut.“ Er kniet sich wieder hin und deutet mit einer Kopfbewegung Richtung Tür. „Arzt.“ Er will mir jemanden herschicken, der sich um mich kümmert. Ich werde etwas ruhiger, lasse ihn aber nicht los. „Es wird alles gut“, beteuert er und drückt meine Hand. „Sie kommen hier raus.“ Raus? Meine Augen beginnen zu brennen. Sollte der Albtraum wirklich vorüber sein? Ich kann es fast nicht glauben. Eine einzelne Träne läuft mir aus dem Augenwinkel. Er wischt sie mit einer sanften Berührung fort.
Dann räuspert er sich und zeigt mit der freien Hand auf sich. „Paul.“
Paul. Ich starre ihn an und wiederhole im Geiste seinen Namen. Ich weiß nicht, ob ich ein Wort herausbringen kann, doch ich will, dass auch er meinen Namen erfährt. Ich schlucke, dann hole ich tief Luft. „M-Marta“, kommt mir über die Lippen. Dann versinke ich wieder in tiefer Dunkelheit. Die Anstrengung der letzten Minuten war einfach zu viel für mich.
2. KAPITEL
„Na, sind wir wach?“ Eine forsche, fremde Frauenstimme dringt durch die Dunkelheit. Sind die Deutschen zurück? Hastig atme ich ein. Etwas ist anders als zuvor. In der Luft hält sich nicht länger der Geruch von Exkrementen, stattdessen riecht es nach Alkohol und frischer Farbe. Die Geräusche der Ratten und der leise fallenden Wassertropfen sind geschäftigem Rascheln und einem sanften Stimmengewirr gewichen.
Abrupt öffne ich die Augen und stelle verblüfft fest, dass ich mich nicht länger in meiner Zelle befinde, sondern in einem großen Raum mit leuchtend gelben Wänden. Wo bin ich? Am Fußende meines Betts steht eine Frau. Ihr Gesicht kann ich nur verschwommen sehen, dennoch erkenne ich, dass sie einen weißen Kittel und eine Haube trägt. Sie kommt näher und fühlt meine Stirn. „Wie geht es Ihnen?“ Ich schlucke unschlüssig. Meine Seite tut mir noch immer weh, doch es kommt mir jetzt mehr wie ein dumpfer, pochender Schmerz vor. „Ich heiße Dava. Wissen Sie, wo Sie sind?“ Sie spricht kein Polnisch, trotzdem kann ich sie verstehen. Jiddisch! Seitdem ich das Ghetto verlassen habe, hat in meiner Gegenwart niemand mehr Jiddisch gesprochen. Die Sprache klingt dem Deutschen sehr ähnlich, zudem hat die Frau einen leichten Akzent, sodass ich fürchte, es könnte sich um einen weiteren Trick der Deutschen handeln. Die Frau scheint meine Sorge zu bemerken und antwortet rasch auf ihre eigene Frage: „Sie sind in einem Sammellager der Alliierten, in der Nähe von Salzburg.“
Ein Lager? Salzburg? Meine Gedanken überschlagen sich. „Nazis …?“, bringe ich heraus. Mein Hals schmerzt, weil mir das Reden so schwerfällt, aber auch, weil es ausgerechnet dieses eine Wort ist, das ich aussprechen muss.
„Nein, die Nazis sind weg. Hitler ist tot, die Wehrmacht hat kapituliert. Der Krieg ist vorbei.“ Sie klingt so überzeugt und furchtlos. Während ich mir ihre Worte verinnerliche, greift sie über meinen Kopf hinweg zu einem Fenster, um die Vorhänge ein Stück zuzuziehen, damit nicht so viel Sonne in den Raum fällt. Nicht, möchte ich sagen. Immerhin habe ich zu lange in fast völliger Dunkelheit leben müssen. „So, das ist schon besser.“ Ich sehe sie an. Obwohl ihre Statur ihr etwas Gesetztes verleiht, verrät mir ihr Gesicht, dass sie höchstens dreißig ist. Eine braune Locke lugt unter ihrer Haube hervor.
Dava gießt aus einer blauen Kanne Wasser in ein Glas und stellt es auf den niedrigen Nachttisch neben meinem Bett. Ich will mich aufsetzen, doch sie hält mich zurück. „Warten Sie.“ Sie nimmt ein Kissen von dem freien Bett gleich nebenan und legt es auf das vorhandene Kissen in meinem Rücken. Dabei fällt mir auf, dass ich ein Krankenhausnachthemd aus grober, hellblauer Baumwolle trage. „Ihr Körper hat einiges aushalten müssen, machen Sie erst mal langsam.“ Ich hebe den Kopf an, als Dava mir das Glas Wasser reicht. „Nur kleine Schlucke“, ermahnt sie mich, und ich befolge ihre Anweisung. „So ist es richtig, Marta.“ Erstaunt darüber, dass sie meinen Namen kennt, sehe ich sie an. „Ihr Name stand auf Ihrer Stirn geschrieben, als man sie herbrachte“, erklärt sie. Angesichts meiner Ratlosigkeit fügt sie hinzu: „Die Soldaten, die die Menschen aus den Lagern holen, schreiben Namen oder andere Hinweise manchmal direkt auf den Patienten. Entweder weil sie kein Papier zur Hand haben, oder weil sie fürchten, dass die Notiz unterwegs verloren gehen könnte.“
Ich trinke noch einen Schluck und lasse mich nach hinten auf die Kissen sinken. Plötzlich fällt mir der Soldat ein, der mir in meiner Zelle etwas zu trinken gab. „Wie … wie bin ich hergekommen?“
Dava nimmt mir das Glas aus der Hand und stellt es zurück auf den Nachttisch. „Die Amerikaner entdeckten Sie bei der Befreiung vom KZ Dachau. Wir sind hier nur wenige Autostunden von Dachau entfernt, nicht weit von der Grenze zu Deutschland, deshalb werden viele Häftlinge zu uns gebracht. Sie waren bewusstlos, seit man Sie vor über einer Woche herbrachte. Ihre Schussverletzung hatte sich entzündet, und Sie hatten sehr hohes Fieber. Wir waren uns nicht sicher, ob Sie durchkommen würden. Aber jetzt sind Sie bei Bewusstsein, und das Fieber ist zurückgegangen.“ Dava sieht kurz über die Schulter, dann fährt sie fort: „Ruhen Sie sich noch ein paar Minuten aus. Ich werde dem Doktor Bescheid sagen, dass Sie aufgewacht sind.“
Während sie weggeht, schaue ich mich um. Zwar ist für mich nach wie vor alles verschwommen, doch ich erkenne jetzt mehrere Betten, die in gleichmäßigen Abständen in zwei Reihen an den Wänden dieses lang gestreckten Raums aufgestellt sind. Mein Bett steht in der äußersten Ecke, mit der Längsseite an der Wand. Alle Betten, bis auf das gleich neben meinem, scheinen belegt zu sein. Mehrere Frauen in weißer Kleidung eilen geschäftig umher.
Wenige Minuten später kehrt Dava zurück, sie trägt ein Tablett, ein älterer Mann mit dicken Brillengläsern folgt ihr. Er greift nach meinem Handgelenk, mit der anderen Hand berührt er meine Stirn. Dann hebt er die Decke an und zieht am Saum meines Nachthemds. Überrascht zucke ich zurück.
Dava stellt das Tablett ab und kommt zu mir. „Er muss die Wunde untersuchen, um Gewissheit zu haben, dass sie gut verheilt.“ Ich fühle, wie ich etwas ruhiger werde, und lasse den Arzt mein Nachthemd hochheben. Während seine kalten Hände meinen Bauch berühren, versuche ich nichts zu empfinden. Dann zieht er den Stoff weg, und ich sehe mit Erstaunen den sauber vernähten Schnitt an meiner Seite. „Sie mussten nach Ihrer Ankunft erneut operiert werden“, erklärt Dava. „Es steckten noch Splitter der Kugel im Gewebe, das hat die Entzündung verursacht.“ Ich nicke. In meiner Zelle habe ich mich oft gefragt, warum ich immer noch solche höllischen Schmerzen habe. Jetzt, nach dem zweiten Eingriff, fühlt es sich deutlich besser an.
Der Arzt zieht das Nachthemd wieder hinunter und wendet sich an Dava, dann redet er mit ihr auf Deutsch, spricht aber so schnell und in einem seltsamen Dialekt, dass ich ihn nicht verstehen kann. Schließlich geht er zügig weiter. „Er sagt, dass Sie wirklich gute Fortschritte machen. Sie müssen versuchen, etwas zu essen. Sind Sie hungrig?“ Ehe ich antworten kann, nimmt sie eine Schale von ihrem Tablett und hält sie mir hin. „Suppe“, verkündet sie gut gelaunt. Langsam setze ich mich auf, und diesmal hält sie mich nicht zurück, sondern hält mir die Suppe unter die Nase. Ein kräftiges Aroma schlägt mir entgegen, prompt wird mir übel, und kalter Schweiß tritt mir auf die Stirn. Als Dava das bemerkt, stellt sie die Schale weg und nimmt stattdessen eine Tasse vom Tablett. „Fangen wir lieber mit etwas Tee an.“
Ich schlucke, mein Magen hat sich wieder beruhigt. „Das ist besser.“
Sie gibt mir die Tasse, ich trinke einen Schluck. Der Tee ist lauwarm und tut meinem rauen Hals gut. Während ich die Tasse mit beiden Händen halte, wandert mein Blick nach oben. Die sehr hohe Decke ist mit reichen Verzierungen geschmückt, und ich blinzle, um sie genauer erkennen zu können.
„Das hier war mal ein vornehmer Speisesaal“, erläutert Dava, die meine Gedanken zu lesen scheint. „Das Lager wurde auf dem Gelände von Schloss Leopoldskron errichtet. Die Nazis nahmen das Schloss seinem Eigentümer weg, und wir haben es jetzt ihnen wieder weggenommen. Wenn Sie sich besser fühlen, sollten Sie sich ausgiebig umsehen.“
„Ja, das mache ich.“ Ich trinke noch einen Schluck.
Dava zeigt nach oben. „Wenn Sie genau hinsehen, können Sie Einflüsse des Barock erkennen. Sehen Sie diese prachtvolle Detailfülle?“
„Ich kann nicht …“, beginne ich zögerlich. „Ich kann es nicht sehen.“
„Wie meinen Sie das?“, fragt sie besorgt. „Haben diese Leute irgendwas mit Ihnen gemacht? Schlag auf den Kopf? Oder ein schlimmer Sturz?“
Ich schüttele den Kopf. „Nein, nein“, erwidere ich hastig, obwohl ich zugeben muss, dass ich sogar mehr als nur einen Schlag auf den Kopf bekommen habe. „Ich bin nur sehr kurzsichtig, und als sie mich einsperrten, nahmen sie mir auch meine Brille weg.“
„Ach du meine Güte, warum sagen Sie das nicht gleich? Wir haben einen ganzen Karton voller Brillen.“ Als ich das höre, frage ich mich, was aus den eigentlichen Besitzern dieser Brillen geworden sein mag. „Sobald Sie etwas gegessen haben“, spricht sie weiter, „bringe ich Ihnen ein paar, die Sie anprobieren können. So, und jetzt versuchen wir es noch einmal mit der Suppe.“ Sie tauscht die Tasse gegen die Suppenschale aus, und sofort beginnt mein Magen erwartungsvoll zu knurren. Ich nehme den ersten Löffel Suppe, den Dava mir hinhält, und genieße die warme, salzige Brühe, während sie in meine Kehle läuft. Es folgt ein zweiter, dann ein dritter Löffel, bis Dava eine Pause einlegt. „Jetzt warten wir erst einen Moment ab, wie Ihnen das bekommt“, sagt sie.
Ich will protestieren. Es ist die erste richtige Mahlzeit seit Monaten, und ich will jetzt nicht aufhören. Doch ich weiß, dass sie recht hat. Ich lehne mich zurück und lasse meinen Blick schweifen. „Es wundert mich, dass dieser Raum komplett belegt ist, aber niemand in dem Bett dort liegt.“ Ich deute auf das leere Bett neben mir.
„Sie wollen wissen, warum Sie von den anderen getrennt liegen?“
„Ja.“
Nach kurzem Zögern erwidert Dava: „Die anderen sind aus dem Lager.“
„Ich verstehe nicht. Sie sagten, man hätte mich aus Dachau geholt. War das kein Lager?“
„Doch, natürlich. Aber Sie waren allein in einer Zelle, nicht bei den anderen Frauen im Lager.“ Ich mustere Davas Gesicht. Weiß sie etwas darüber, warum ich gesondert untergebracht worden bin? „Die Bedingungen im übrigen Teil des Lagers waren sehr schlimm.“
„Schlimmer als das, was mir widerfahren ist?“ Ich frage mich, was in aller Welt schlimmer sein könnte als die Folter, der Hunger und die Isolation, die ich ertragen musste.
„Nun, nicht unbedingt schlimmer … eben anders. Es herrschten viele Krankheiten. Ruhr, Typhus …“ Typhus! Meine Mutter ist im Ghetto von Kraków an Typhus gestorben. Ich sehe ihren von offenen Wunden überzogenen Körper vor mir, höre die Schreie, die sie im Fieberwahn ausstieß. „Da Sie frisch operiert waren, wollten wir vermeiden, dass Sie sich anstecken. Darum haben wir Sie ein wenig abgeschieden von den anderen untergebracht. Aber das wird sich bald ändern. Wir erwarten einen weiteren Transport, und wahrscheinlich wird jedes verfügbare Bett gebraucht werden. Das heißt, Sie bekommen bald Gesellschaft. Aber genug davon. Essen Sie lieber noch etwas Suppe.“
Während Dava mich mit mehr Suppe füttert, blicke ich über ihre Schulter. Die meisten anderen Frauen liegen noch in ihren Betten. Plötzlich werden mir Geräusche bewusst, die mir zuvor nicht aufgefallen waren. Leises Stöhnen, das Surren medizinischer Geräte. Und da ist noch etwas anderes: der schwache metallische Geruch von Blut.
Ich wende mich wieder Dava zu und betrachte aufmerksam ihr Gesicht. „Woher kommen Sie?“
„Geboren bin ich in Russland, aber meine Familie zog nach Wien um, als ich ein Kind war. Meine Eltern starben in Buchenwald.“
„Sie sind Jüdin?“, frage ich überrascht, denn wenn ich mir ihre gut genährte Figur ansehe, dann erweckt Dava nicht den Eindruck, als sei sie ebenfalls in irgendeinem Lager gewesen.
Sie nickt. „Ich studierte Sprachen in Südfrankreich, als der Krieg ausbrach. Meine Familie wollte nicht, dass ich nach Hause komme, also blieb ich dort. Später meldete ich mich freiwillig als Krankenschwester bei den Alliierten und kehrte nach Österreich zurück, sobald das möglich war. Aber meine Eltern … unser … es war nichts mehr da.“
So wie bei mir, denke ich. Meine Augen brennen.
„Nichts mehr da“, wiederholt sie nach einer Weile, klingt aber erstaunlich gut gelaunt, und da wird mir erst bewusst, dass sie über die Suppe redet, die ich offenbar aufgegessen habe. Nichts mehr da. Plötzlich bin ich zurück in meiner Zelle, ohne etwas zu essen und ohne zu wissen, wann man mir wieder etwas bringen wird. Panik überkommt mich, aber Dava ist den Umgang mit Überlebenden offenbar so gewöhnt, dass sie weiß, was in mir vorgeht. „Keine Sorge.“ Sanft tätschelt sie meine Schulter. „Das Rote Kreuz beliefert unsere Küche. Es ist genug Suppe da, und es gibt auch viele andere Lebensmittel. Wenn Sie noch Hunger haben und wenn Sie die Suppe bei sich behalten, werde ich Ihnen in einer Stunde ein Stück Brot bringen. Aber für den Augenblick müssen Sie erst mal eine Pause einlegen.“
Erleichtert lehne ich mich zurück. „Danke.“
„Mit Vergnügen.“ Dava steht auf. „Jetzt muss ich nach den anderen Patientinnen sehen, und Sie ruhen sich erst mal eine Weile aus. Sie müssen schließlich wieder zu Kräften kommen.“
Mit einem Mal scheinen meine Augenlider schwer wie Blei zu sein. „Ich bin etwas müde“, gestehe ich ein.
„Das kommt vom Essen. Ruhen Sie sich aus. Schlafen Sie, das hilft.“ Dava nimmt das Tablett an sich und will gehen.
„Dava“, rufe ich ihr nach und versuche, mich wieder aufzusetzen.
Sie dreht sich zu mir um. „Ja?“
„Ich muss Sie noch etwas fragen.“ Ich halte inne und stelle mir den Soldaten vor, der sich in meiner Zelle über mich beugte. „Sie sagten, die Amerikaner hätten mich hergebracht. Wissen Sie irgendwelche Namen?“
Dava zieht die Brauen zusammen. „Bedaure, nein. Warum fragen Sie?“
„Ich erinnere mich an einen bestimmten Soldaten, der sich dort um mich gekümmert hat, bevor ich bewusstlos wurde. Paul hieß er, glaube ich.“ Mein Herz schlägt schneller, als ich seinen Namen laut ausspreche.
„Und sein Nachname?“
Ich versuche mich zu erinnern, welcher Name auf seiner Uniform zu lesen gestanden hat. Ich schließe die Augen und konzentriere mich mit aller Macht, aber mein Gedächtnis lässt mich im Stich. „Den weiß ich nicht.“
„Im Moment sind in ganz Europa Tausende von Soldaten unterwegs, um die Lager zu befreien“, gibt sie mit sanfter Stimme zurück, und ich verliere prompt den Mut. „Ich werde herumfragen, wenn die anderen Transporte eintreffen, aber Sie sollten sich keine allzu großen Hoffnungen machen. Und jetzt ruhen Sie sich aus. Wenn ich mit meiner Runde fertig bin, komme ich wieder zu Ihnen.“
Ich lasse mich zurück in meine Kissen sinken und sehe Dava nach. Dann schaue ich mich noch einmal um. Das hier ist kein Traum, ich wurde tatsächlich gerettet. Die Erschöpfung überkommt mich, und allmählich schlafe ich ein.
Irgendwann wache ich auf. Wie viel Zeit ist vergangen? Der Saal ist in Dunkelheit getaucht, nur der Mond sorgt für etwas Licht, das beharrlich durch die zugezogenen Vorhänge scheint. Ich höre den angestrengten Atem kranker Frauen, die zu schlafen versuchen. Vom anderen Ende des Raums dringt leises Schluchzen herüber.
Ich schlucke, weil mein Hals wie ausgedörrt ist. Dann setze ich mich auf und greife nach dem Glas, das Dava mir halb voll hingestellt hatte. Nach einem kleinen Schluck stelle ich es zurück und bemerke mehrere glänzende Gegenstände auf dem Nachttisch, die zuvor nicht dort gelegen haben. Brillen! Neugierig nehme ich eine von ihnen und setze sie auf, doch ich sehe weiterhin alles nur verschwommen. Diese Gläser sind viel zu schwach für mich. Schnell greife ich nach der nächsten Brille, aber sie entpuppt sich als noch schwächer. Enttäuschung kommt in mir auf, als ich sie wieder absetze. Was, wenn keine von ihnen passt? Die dritte ist so stark, dass ich sofort Kopfschmerzen bekomme. Ich schaue wieder zum Nachttisch. Zwei Brillen sind übrig. Ob sie weitere Brillen haben, falls ich mit den beiden auch nichts anfangen kann? Ich setze die nächste Brille auf und halte gebannt den Atem an, dann mache ich die Augen auf und … kann alles scharf sehen! Das sind ziemlich genau die richtigen Gläser. Ich kann wieder sehen!
Als ich mich zum Fenster drehe, geht ein Stich durch meine Seite, weil ich mich zu hastig bewegt habe. Ich ziehe die Vorhänge auf, und dann stockt mein Atem sekundenlang. Majestätische, schneebedeckte Berge säumen den Horizont, ihre schroffen Spitzen reichen fast bis zu den Sternen. Die Alpen. Eine Gänsehaut überläuft mich. Am Fuß der Berge kann ich einen großen See erkennen, dessen glatte Oberfläche wie ein Spiegel wirkt.
Wieder sehe ich hinauf zu den Bergen und kann kaum glauben, dass etwas so Schönes tatsächlich existiert. Wieso bin ausgerechnet ich hier? Wie kann ich ein solches Glück haben, während bei so vielen anderen nur der Tod am Ende der Höllenqualen stand? Tränen steigen mir in die Augen. Sollte ich beten und Gott danken? Ich zögere, zu deutlich ist mir der Tag in Erinnerung, an dem ich aufgehört habe zu glauben. Es war der Tag, an dem ich zusehen musste, wie die Nazis meinen Vater erhängten. Er hatte einem Jungen etwas zu essen gegeben, den die Deutschen verhungern lassen wollten, weil er einen Laib Brot gestohlen hatte. In jener Nacht auf der Brücke hätte auch ich sterben sollen. Oder später in meiner Gefängniszelle. Stattdessen lebe ich, bin an diesem schönen Ort und kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass eine höhere Macht für mein Überleben gesorgt hat.
Nach einem letzten Blick auf die Berge ziehe ich die Vorhänge wieder zu. Ich will mich hinlegen, da fällt mir auf, dass im Bett neben mir eine junge Frau liegt. Sie müssen sie hergebracht haben, während ich schlief.
„Hallo?“, flüstere ich, aber sie reagiert nicht. Ihr Atem geht flach, und ich überlege, ob sie wohl bewusstlos ist. Ich beuge mich vor und betrachte ihr Gesicht genauer. Sie könnte etwa so alt sein wie ich, doch ihr ausgemergelter Körper erschwert es mir, sie genauer zu schätzen. Über ihren hohen Wangenknochen spannt die Haut so sehr, als würde sie jeden Moment zerreißen. Die Augen zucken unter den Lidern hin und her, die so dünn wie Pergament wirken. Ihr Haar ist so kurz geschnitten, dass kahle Stellen durchscheinen.
Ich suche den Saal ab und hoffe, Dava oder eine der anderen Krankenschwestern zu entdecken, um sie nach der jungen Frau zu fragen. Doch es ist niemand da. Wieder sehe ich die Frau an, deren Finger sich so fest in das Kissen gekrallt haben, als fürchte sie, dass es ihr jemand wegnehmen könnte. Die Decke ist ihr von den Schultern gerutscht, darunter kommt fahle Haut zum Vorschein. Ich decke sie behutsam wieder zu und bemerke aus dem Augenwinkel, dass am Fußende ein Klemmbrett auf ihrem Bett liegt. Um sie nicht zu wecken, greife ich ganz vorsichtig danach und überfliege das erste Blatt. Es ist eine Art Krankenakte, darauf stehen viele lange, mir unbekannte englische Worte. Am oberen Blattrand entdecke ich ein Wort, das ich entziffern kann: Rose.
„Rose“, lese ich laut und lege das Klemmbrett weg. Als ich die junge Frau abermals ansehe, fällt mir auf, wie ihre Lider flattern. Ich wiederhole ihren Namen, und sie öffnet langsam die Augen, um mich kurz darauf reglos anzustarren. „Hallo“, begrüße ich sie auf Polnisch. Da sie keine Reaktion zeigt, lasse ich auf Jiddisch folgen: „Ich bin Marta.“ Sie rührt sich nach wie vor nicht, sondern starrt mich nur mit ihren großen, mandelförmigen Augen an. Dann fällt mir ein, wie verängstigt und verwirrt ich war, als ich hier aufwachte. Sie muss die gleiche Furcht spüren wie ich. „Du bist hier in Sicherheit“, flüstere ich ihr zu, um sie zu trösten. „Das hier ist ein Lager der Alliierten.“ Noch immer erwidert sie nichts, und ich beginne mich zu fragen, ob sie vielleicht einfach nur unfreundlich ist. Doch in diesem Moment streckt Rose eine Hand nach mir aus. Ich ergreife ihre dünnen, heißen Finger. „Du hast Schlimmes durchgemacht, so wie wir alle. Aber das ist jetzt vorbei.“ Sanft drücke ich ihre Hand. „Wir sind in Sicherheit. Wir sind hier an einem guten Ort, und von nun an wird alles wieder gut. Verstehst du, was ich sage?“ Rose antwortet nicht und macht die Augen zu.
Ich sehe sie eine Weile an und überlege, ob es ein Fehler war, sie zu wecken. Soll ich eine Krankenschwester rufen? Aber eigentlich scheint im Moment kein Notfall vorzuliegen, der das rechtfertigen würde. Ich lege mich wieder in mein Bett und halte Roses Hand weiter fest. Ich wünschte, es wäre Morgen, damit ich Dava fragen könnte, woher Rose gekommen und was ihr widerfahren ist.
Dann muss ich an die leuchtenden Sterne über den Bergen denken. Ich bin zu müde, um mich noch einmal aufzusetzen, also verdrehe ich meinen Hals, um sie sehen zu können. Durch die Ritze zwischen den Vorhängen kann ich einen Stern funkeln sehen. Soll ich mir etwas wünschen, so wie früher, als ich ein Kind war? Ich zögere, weil es mir habgierig vorkommt, noch mehr zu wünschen, wo ich doch gerade ein Leben geschenkt bekommen habe. Trotzdem beginne ich zu grübeln, was ich mir wünschen könnte und was das Schicksal wohl alles für mich bereithält, nachdem es mich gerettet hat.
Ich drehe mich zu Rose um, weil ich ihr von den Bergen erzählen will, doch sie hat die Augen geschlossen und atmet ruhig und gleichmäßig. Sie ist wieder eingeschlafen, und ich werde sie nicht noch einmal wecken. Morgen kann ich ihr die Berge immer noch zeigen. Ich halte weiter ihre Hand gedrückt, während mein Blick noch einmal zu meinem Stern zurückwandert.
3. KAPITEL
Wir sitzen auf der Terrasse hinter dem Schloss, Dava und ich auf einer Bank, Rose in ihrem Rollstuhl gleich neben uns. Rose liest laut aus der englischen Originalausgabe des Buchs Betty und ihre Schwestern vor, das auf ihrem Schoß liegt: „Ach, ich wäre viel lieber zu Hause, als den ganzen Tag diese schrecklichen Kinder zu unterrichten …“
„Als ob diese Schwestern irgendeinen Grund zur Klage haben“, unterbreche ich sie auf Jiddisch.
„Marta …“ Dava wirft mir einen tadelnden Blick zu.
„Ist doch wahr“, beharre ich. „Es soll Krieg sein, aber die Schwestern sitzen in ihrem sauberen Zuhause, sicher und geschützt. Und trotzdem muss die eine sich beklagen, nur weil sie Unterricht erteilen soll …“
„Meg“, stellt Rose klar.
„Und die andere ist verärgert, weil sie in einem schönen großen Haus Vorleserin für ihre Tante spielen darf.“
„Das ist Jo“, sagt Rose. „Aber, Marta, auf ihre Weise haben sie auch unter dem Krieg gelitten. Sie hatten kaum etwas zu essen, und ihr Vater war in den Kampf gezogen …“
„Ich glaube, der amerikanische Bürgerkrieg war für die Menschen, die nicht selbst auf dem Schlachtfeld waren, eine ganz andere Erfahrung als das, was wir hier erlebt haben“, erwidert Dava. Da hat sie recht, denn für uns war das ganze Leben ein Schlachtfeld. „Der Krieg berührt die Menschen auf vielfältige Weise“, ergänzt sie und presst die Lippen zusammen, während sie gedankenverloren dreinblickt.
Rose hält das Buch hoch. „Möchtest du, dass ich weiterlese?“
„Ja, bitte“, antwortet Dava und tätschelt Roses Hand. „Du machst das sehr gut.“
Sie liest weiter laut vor, aber ich versuche nicht, ihr zu folgen. Fast eine Stunde lang habe ich ihr zugehört, und jetzt schmerzt mein Kopf, weil ich unentwegt damit beschäftigt war, im Geiste jedes Wort aus dem Englischen zu übersetzen. Stattdessen sehe ich auf und stelle fest, dass es erst sieben Uhr ist. Normalerweise wäre der Himmel an diesem Tag im August immer noch strahlend hell, doch dicke, graue Wolken haben sich vor die Sonne geschoben, und es ist so diesig, dass ich kaum den leicht gekrümmten Gipfel des Untersbergs ausmachen kann.
Ich atme tief ein und erfreue mich des süßlichen Dufts nach Geißblatt aus dem Garten, der die Terrasse auf ganzer Länge säumt. Über zwei Monate sind vergangen, seit man mich aus dem Lager befreit hat. Meine Genesung macht erfreuliche Fortschritte, die laut Dava die Erwartungen der Ärzte übertreffen. Die Operationsnarbe ist gut verheilt, und Schmerzen spüre ich fast nur noch, wenn es regnet.
„Marta“, sagt Rose und hält mir das Buch hin. „Möchtest du auch ein oder zwei Absätze lesen?“
Ich zögere und streiche mit der Handfläche über die warme steinerne Bank. Schon zuvor hatte Dava Rose unterbrochen und mich einen kürzeren Abschnitt lesen lassen, aber während ich mich durch die ersten Worte quälte, wurde klar, dass der Text noch zu schwer für mich ist. „Nein, danke.“ Rose spricht beinahe fließend Englisch, allerdings hat sie als Kind auch mehrere Sommer bei ihrer Tante in London verbracht. Ich dagegen nehme zusammen mit einigen anderen jeden Tag für eine Stunde an einem Englischkurs teil, der in der Schlossbibliothek angeboten wird. Die gesprochene Sprache lerne ich recht schnell, aber es fällt mir immer noch schwer, Texte zu lesen, die über das Niveau eines Kinderbuchs hinausgehen. Dava hilft mir, wenn sie Zeit erübrigen kann. Ihre Fähigkeiten als Sprachlehrerin sind wirklich bemerkenswert, was sie der Tatsache verdankt, dass ihr Vater als Dolmetscher gearbeitet hat. Russisch und Jiddisch hat sie von Kindheit an beherrscht, in Österreich kam noch Deutsch hinzu, und schließlich wurde sie auch in Englisch und Französisch unterrichtet.
Während Rose weiterliest, drehe ich mich zum Schloss, dessen Anblick mich jedes Mal von Neuem mit Ehrfurcht erfüllt. Schloss Leopoldskron ist ein imposantes Gebäude, links und rechts präsentieren sich dem Betrachter zwei beeindruckende Flügel. Das Erdgeschoss beherbergt unsere Station, außerdem eine weitere Station für die Männer, die in einem ehemaligen Ballsaal untergebracht sind. Ein prächtiges Foyer, von dessen hoher Decke ein prunkvoller Kristallleuchter herabhängt, trennt beide Bereiche voneinander. Zwei geschwungene Marmortreppen führen hinauf in den ersten Stock, wo sich die Bibliothek und eine kleine Kapelle befinden. Im zweiten Stock, in dem die Verwaltung ist, haben wir Patienten nichts zu suchen.
Rose hält am Kapitelende inne. „Wir sollten für heute aufhören“, meint Dava. „Ich möchte nicht, dass du dich überanstrengst.“
Besorgt betrachte ich Roses Gesicht. Es ist blass, mit dunklen Ringen unter den Augen. Rose hat sich nicht so mühelos erholt wie ich. Am Morgen nach ihrer Ankunft war sie nicht aufgewacht. Als ich Dava auf sie ansprach, erklärte sie, Rose sei neunzehn Jahre alt und stamme aus Amsterdam. Obwohl sie nur Halbjüdin ist, hat man sie von einem Lager ins nächste verfrachtet, zuletzt nach Theresienstadt in der Tschechoslowakei. Ich merkte an, dass das ja ein schlimmes Lager gewesen sein muss, wenn Rose dort so krank geworden ist. Aber Dava hielt dagegen, dass es schlimmere Lager gegeben hat. Roses Problem sei eine Blutkrankheit, die sich durch die schrecklichen Bedingungen nur noch verschlechtert habe. Was für eine Blutkrankheit das sein könnte, ist mir nicht bekannt, doch es hörte sich sehr ernst an. Ich wachte über Rose, als sie in den folgenden Tagen gegen ihre Krankheit ankämpfte, und informierte die Schwestern, sobald sie für ein paar Minuten wach war, damit sie ihre Medizin und etwas zu Trinken bekam. Dava sagte zwar, ich solle mich lieber um meine eigene Genesung kümmern, aber ich wollte sichergehen, dass Rose gesund wurde. Schließlich hatte ich ihr am Abend ihrer Ankunft versprochen, dass alles wieder gut wird.
Dann, eines morgens, wachte ich auf, und sie lag auf der Seite und sah mich mit ihren leuchtenden, fast violetten Augen an. „Hallo“, sagte sie.
„Hallo.“ Ich setzte mich auf. „Ich bin Marta.“
„Ich weiß. Ich erinnere mich an dich.“
Rose war zwar die meiste Zeit des Tages wach, doch ihr Zustand verbesserte sich nur schleppend. An guten Tagen wie heute kann sie eine Weile im Rollstuhl sitzen, doch sie ermüdet sehr schnell, und sie kann sich nicht ohne fremde Hilfe von der Stelle bewegen. „Es geht mir gut“, beharrt sie inzwischen. Ihre Wangen haben etwas mehr Farbe bekommen, auch wenn es fast so wirkt, als würde sie sie zum Erröten zwingen.
„Es wird regnen“, stellt Dava fest, als sie zum Himmel schaut. „Und es ist frischer geworden.“ Sie reckt sich, um den Pullover zurechtzuziehen, den sie Rose über die Schulter gelegt hat, dann steht sie auf. „Wir sollten hineingehen.“
Rose legt eine Hand auf Davas Arm. „Nur noch ein paar Minuten“, bittet sie leise.
Dava zögert, ihr Blick wandert von Roses hoffnungsvoller Miene zu den düsteren Wolken. „Ein paar Minuten“, lenkt sie ein, dann schaut sie über die Schulter hinweg zum Schloss. „Allerdings muss ich so langsam mit meiner Runde beginnen.“
„Geh ruhig schon vor“, schlage ich vor. Rose und ich sind durchaus in der Lage, allein hier draußen zu bleiben. „Ich kümmere mich um Rose.“
„Zehn Minuten“, weist Dava mich noch einmal streng an.
„Zehn Minuten“, wiederhole ich ernst, wobei ich so zwinkere, dass nur Rose es bemerkt. Zufrieden macht sich Dava auf den Weg. Als sie außer Hörweite ist, sage ich laut: „Sie ist heute so mürrisch.“
„Sie ist doch nur besorgt um uns. Außerdem wirkt sie müde.“ Rose klingt so überzeugt, dass ich mich für meine Bemerkung schäme. Die Krankenstation ist personell unterbesetzt, und es kommt einem so vor, als würden die Schwestern rund um die Uhr arbeiten, damit auch alle Patienten versorgt werden. Dava widmet Rose und mir, den beiden Jüngsten, besonders viel Aufmerksamkeit. Sie besucht uns, so oft sie kann, und häufig bringt sie uns eine Extraportion zu essen oder etwas Süßes.
„Dava ist wirklich gut zu uns“, sage ich, und Rose nickt zustimmend. „Aber als wir über den Krieg sprachen, kam sie mir sehr traurig vor. Ich frage mich, was ihr zugestoßen ist.“
„Sie erwähnte einmal einen Mann“, erwidert Rose. „Aber ich weiß nicht, ob es ihr Ehemann war. Sie hat nicht gesagt, was aus ihm wurde.“
„Hm.“ Mit einem Anflug von Eifersucht frage ich mich, warum Dava Rose davon erzählt hat, aber nicht mir.
„Ich bin froh, dass wir noch ein bisschen länger hier draußen bleiben dürfen“, meint Rose und betrachtet das Bergpanorama.
Ich schaue hinab auf mein Kleid, eines von zweien, die ich bekam, als ich mich kräftig genug fühlte, das Bett zu verlassen. Meine Unterarme ragen aus den blassrosa Ärmeln heraus, sie sind von der Sommersonne leicht gebräunt. Sie wirken auch nicht mehr ganz so abgemagert, so wie ich am ganzen Körper mittlerweile zugenommen habe. Wenn ich mich umziehe, sehe ich jetzt nicht mehr die Rippen hervortreten. Ganz im Gegensatz zu Rose. Ich mustere sie aus dem Augenwinkel. Ihre Haare sind deutlich länger, sie sind blond und bilden einen Lockenkopf, aber nach wie vor wirkt Rose so schmal und bleich wie an dem Abend, als sie hier eintraf. Die wenigen Bisse, zu denen Dava und ich sie bei jeder Mahlzeit überreden müssen, kann sie oftmals gar nicht bei sich behalten. Auch wenn Dava es nicht ausgesprochen hat, weiß ich, dass Roses Zustand unverändert ernst ist.
Während ich Rose ansehe, erwacht mein Beschützerinstinkt. In der kurzen Zeit hier im Schloss sind wir uns nahegekommen. Früher, in der Heimat, hätte ich mich wohl kaum mit ihr angefreundet, weil sie mir zu mädchenhaft, zu schüchtern und zu langweilig vorgekommen wäre. Hier dagegen ist es eine fast natürliche Freundschaft, da alle anderen Frauen deutlich älter sind als wir.
So war es auch damals im Ghetto mit Emma gewesen, wird mir in diesem Moment bewusst. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ihr Gesicht. Als meine Mutter eines Tages von ihrer Arbeit im Waisenhaus heimkam und sagte, dass sie mich mit einer jungen Frau bekannt machen wollte, die ebenfalls dort arbeitete, war ich skeptisch. Emma war fast zwei Jahre älter als ich, und sie kam aus der Stadt, nicht wie ich vom Land. Welche Gemeinsamkeiten sollte es da schon geben? Außerdem hatte ich wenig Zeit, um Freundschaften zu pflegen, war ich doch voll mit meiner Arbeit für die Ghettoverwaltung beschäftigt. Und außerdem war ich ja auch noch für den Widerstand aktiv. Aber meine Mutter bestand darauf, weil die Neue ihr sehr einsam vorkam. Es sollte eine Mitzwa für mich sein, sie einigen meiner Freunde vorzustellen.
Schließlich gab ich nach, da ich wusste, wie sinnlos es war, sich gegen Mama aufzulehnen. Am nächsten Tag ging ich nach der Arbeit ins Waisenhaus, und als ich Emma gegenüberstand, bemühte ich mich, besonders freundlich zu sein, um meine Mutter zufriedenzustellen. Doch nachdem wir uns ein paar Minuten unterhalten hatten, fand ich Emma auf einmal wirklich sympathisch, und bald darauf lud ich sie zum Schabbes-Essen mit den anderen aus dem Widerstand ein. Es gefiel mir, jemanden zu haben, dem ich mich anvertrauen konnte. Es war so, als hätte ich in ihr die Freundin gefunden, die mir ein Leben lang gefehlt hatte. Wir verbrachten viel Zeit miteinander und unterhielten uns, wenn wir abends durch die Straßen des Ghettos nach Hause gingen.
Zwischen Rose und mir hat sich ein ähnliches Verhältnis entwickelt, auch wir sind Freundinnen geworden. Ich sehe an ihr vorbei zum weitläufigen Rasen vor der Westseite des Schlosses. Dutzende von weißen Zelten wurden hier errichtet. Dort hat man die Menschen untergebracht, die keine akute medizinische Versorgung brauchen. Von Dava weiß ich, dass ich bald dorthin werde umziehen müssen. Ich weiß, sie hat mich Rose zuliebe so lange auf der Station gelassen, wie es nur irgendwie ging. Aber sie wird nicht mehr lange rechtfertigen können, wieso ich dort noch immer ein Bett belege, während andere Kranke es so viel nötiger haben.
Ich drehe mich wieder zu Rose, die den Kopf so weit hat sinken lassen, dass das Kinn auf ihrer Brust ruht. Ihre Augen sind halb zugefallen. „Du siehst müde aus“, sage ich.
„Mag sein, aber lass uns noch ein paar Minuten bleiben.“ Ich nicke zustimmend. Zwar wird Dava mir böse sein, trotzdem kann ich Rose diesen bescheidenen Wunsch nicht abschlagen.
„Marta?“
„Ja?“
„Was wirst du machen, wenn du von hier weggehst? Aus dem Lager, meine ich?“
Ihre Frage trifft mich unvorbereitet. Ich weiß, dass das Lager nur eine Zwischenstation ist und dass es jeder hier früher oder später verlassen wird. Werde ich nach Polen zurückkehren? Gelegentlich spiele ich mit dem Gedanken. In mancher Nacht träume ich, wie ich in unser Dorf zurückkehre und meine Mutter in der Küche unseres Hauses am Herd steht, während mein Vater vor dem Kamin sitzt und die Zeitung liest. Aber ich weiß nur zu gut, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Von meiner Familie und meinen Freunden ist niemand mehr da. Ich sehe die Gesichter unserer Nachbarn vor mir, wie sie sich auf dem Dorfplatz versammelten und zusahen, wie die Deutschen uns in Zweierreihen zum Bahnhof marschieren ließen. Pani Klopacz, die alte Frau, die jeden Tag bei meinem Vater Milch kaufte, beobachtete uns mit ernstem Blick durch einen Spalt zwischen ihren Gardinen. Andere, die wir seit Jahren kannten, drehten uns einfach den Rücken zu. Nein, bei diesen Leuten kann ich nicht wieder leben. Und ich ertrage auch nicht den Gedanken, nach Kraków zurückzukehren, weil das nur die schmerzhaften Erinnerungen an Alek und die anderen wecken würde. Aber wohin soll ich sonst gehen? Einige Frauen in meinem Englischkurs reden davon, in die Vereinigten Staaten oder sogar nach Palästina auszuwandern. Dava will mich auf die Liste der Visa für diese Länder setzen, doch ich weiß, dass ich, da ich keine Verwandten dort habe, unter Umständen jahrelang warten muss. Und selbst wenn ich ein solches Visum bekäme, wie sollte ich ganz allein in einem völlig fremden Land zurechtkommen? „Ich weiß nicht“, antworte ich schließlich und komme mir etwas albern vor.
Rose setzt zu einer Erwiderung an, doch dann huscht ein schmerzhafter Ausdruck über ihr Gesicht.
Ich beuge mich vor. „Was ist los?“
„N-nichts.“ Doch ihre Stimme klingt angestrengt, und ihr Gesicht ist noch blasser geworden.
Sofort stehe ich auf. „Du musst jetzt hinein.“
„Eine Minute noch!“, fleht sie mich an. Ihre Stimme ist jetzt wieder kräftiger, als hätte der Schmerz nachgelassen. „Sag Dava nichts. Bitte.“
„Ihr beiden!“, ruft jemand hinter uns. Wir drehen uns gleichzeitig um, und wie aufs Stichwort stürmt Dava mit schnellen Schritten auf uns zu.
„O weh“, flüstert Rose. Ich schaue nach oben zum frühabendlichen Himmel und frage mich, wie viel Zeit wohl verstrichen ist.
„Zehn Minuten!“, sagt Dava und verschränkt die Arme vor der Brust. „Ich hatte ausdrücklich von zehn Minuten gesprochen.“
„Es tut mir leid“, entgegne ich. „Wir haben jedes Zeitgefühl verloren. Ich bringe Rose jetzt ins Haus.“
Dava schüttelt den Kopf. „Vermutlich würdet ihr beide noch einen Umweg über Wien machen, und dann würde ich euch tagelang suchen.“ Ich will protestieren, doch Dava hebt abwehrend die Hand. „Ich könnte deine Hilfe bei einer anderen Sache gebrauchen, wenn du dich dazu in der Lage fühlst.“
„Ich fühle mich gut. Um was geht es?“
„Heute Abend erwarten wir eine Gruppe Lagerhäftlinge aus Ungarn, und die Frau, die mir üblicherweise bei der Aufnahme hilft, ist krank geworden. Würdest du einspringen?“
„Natürlich“, erwidere ich freudig. Ich habe beobachtet, dass einige ehemalige Patienten in der Küche und in den Gärten mithelfen. Wiederholt habe ich auch meine Hilfe angeboten, aber Dava lehnte jedes Mal ab mit der Begründung, dass Patienten von der Station keine Arbeiten übernehmen dürfen. Das sei erst möglich, wenn ich in einem der Zelte leben würde. Sie scheinen wirklich jede Hilfe zu brauchen, wenn sie sich über diese Vorschrift hinwegsetzt.
„Gut. Die Transporte werden jeden Moment eintreffen. Geh einfach auf die hintere Seite des Schlosses, da, wo die Tische der Verwaltung sind. Dr. Verrier wird dir erklären, was du zu tun hast.“
„Kein Problem.“ Ich sehe Rose an. „Schlaf gut.“
Während Dava Rose ins Haus bringt, gehe ich um das Schloss herum. Mehrere Armeelastwagen sind mit dröhnenden Motoren von der Hauptstraße in die Einfahrt eingebogen und parken jetzt zu beiden Seiten des unbefestigten Weges auf der Rasenfläche. Soldaten klettern von den Ladeflächen, öffnen die Heckklappen und helfen den ehemaligen Häftlingen beim Absteigen. Einer nach dem anderen werden ausgemergelte Männer und Frauen zu Boden geleitet. Die meisten tragen noch ihre gestreifte Lagerkleidung, und viele müssen von den Soldaten gestützt werden, weil sie zu geschwächt sind, um aus eigener Kraft zu stehen oder gar zu gehen. Habe ich auch so ausgesehen, als ich vor ein paar Monaten herkam?
„Entschuldigen Sie“, ruft ein Mann auf Deutsch. Ich zwinge mich, den Blick von den Ankömmlingen abzuwenden. Ein dunkelhaariger Mann mit Brille und einem weißen Kittel steht ein paar Meter von mir entfernt an einem Klapptisch. Er ist keiner der Ärzte, die mich behandelt haben, aber ich kenne ihn von der Station. „Sie sind die Helferin?“
„Ja.“ Ich gehe auf ihn zu und setze mich auf den Klappstuhl, auf den er zeigt.
„Ihre Aufgabe ist es, die Angaben jeder Person bei deren Eintreffen zu überprüfen – Name, Nationalität, Geburtsdatum. Danach werde ich Ihnen sagen, wer von ihnen zur Krankenstation geschickt wird und wer ins allgemeine Auffanglager. Haben Sie das verstanden?“ Ich nicke und werfe einen Blick auf die lange Schlange ehemaliger KZ-Insassen, die sich dem Tisch nähert. Jeder von ihnen sieht so aus, als müsse er medizinisch behandelt werden, und ich frage mich, ob es überhaupt genügend Betten für die Hälfte von ihnen gibt.
Ich atme tief durch, dann wende ich mich dem ersten Neuankömmling zu. „Name?“, frage ich.
Der große, hagere Mann zögert, ein panischer Ausdruck huscht über sein Gesicht. Dann fällt mein Blick auf eine Zahlenfolge auf seinem Unterarm. Obwohl ich davon verschont geblieben bin, weiß ich, dass die Deutschen den KZ-Häftlingen Nummern eintätowiert haben. Dieser Mann hat sich so sehr daran gewöhnt, nur noch eine Nummer zu sein, dass er gar nicht weiß, wie er antworten soll. Ich beginne von vorn und lächle ihn an, während ich auf Jiddisch frage: „Hallo, ich bin Marta Nederman. Wie heißen Sie?“
Er wird etwas ruhiger. „Friedrich Masaryk.“
Ich hake ihn auf der Liste ab. „Ungar. Geboren 18. November 1901. Stimmt das?“ Der Mann nickt. Er ist erst Mitte vierzig, aber sein schütteres weißes Haar und die gebeugte Haltung lassen ihn wie mindestens sechzig aussehen.
Dr. Verrier untersucht ihn. „Herr Masaryk, Sie sind unterernährt, aber davon abgesehen gesund genug, um in den Zelten untergebracht zu werden.“ Ich mache eine Notiz auf meiner Liste, während ein Soldat den Mann wegbringt.
Als Nächstes ist eine Frau an der Reihe, die von zwei Soldaten auf einer Trage zu uns gebracht wird. Ich blicke zu Dr. Verrier, doch der zuckt nur mit den Schultern. „Vorschrift. Auch die Bewusstlosen müssen registriert werden.“
„Lebonski, Hannah“, liest ein Soldat von der Stirn der Frau ab.
Ich gehe die Liste durch. „Der Name ist hier nicht aufgeführt.“ Noch einmal überfliege ich das Papier. „Hier sind überhaupt keine Frauen aufgelistet …“
„Gibt es eine zweite Liste?“, fragt Dr. Verrier.
„Verdammt!“, flucht der andere Soldat. „Mattie hat vergessen, uns die Liste aus dem Frauentrakt mitzugeben. Jim!“, ruft er über die Schulter einem Kameraden zu, der etwas entfernt bei den Lastwagen steht. Hinter ihm sehe ich, wie mehrere befreite Häftlinge zusammenzucken. Sie versetzt es immer noch in Panik, wenn sie einen Soldaten brüllen hören, auch wenn der ein Amerikaner ist. „Wo ist Mattie?“
Der andere Mann deutet mit dem Kopf in Richtung Schloss. „Ich glaube, ich habe ihn da drüben gesehen.“
Dr. Verrier dreht sich zu mir. „Würden Sie bitte …?“
„Selbstverständlich.“ Ich eile um das Schloss herum. Hier ist alles ruhig, als wäre ich hier Welten von dem Chaos auf der anderen Gebäudeseite entfernt. Ich suche die Terrasse ab, doch die ist menschenleer. Vielleicht hat sich der Soldat ja geirrt, und sein Kamerad ist gar nicht hier. Ich überlege, was ich machen soll, dann beschließe ich, Dava um Hilfe zu bitten. Gerade gehe ich zur Tür, da bemerke ich aus dem Augenwinkel, dass sich etwas auf der Rasenfläche vor dem See bewegt. Ich sehe genauer hin und erkenne einen dunkelhaarigen Soldaten, der dort im Gras liegt. Das muss der Gesuchte sein. Zügig überquere ich den Rasen. „Entschuldigen Sie bitte“, sage ich laut, da er mich anscheinend nicht bemerkt hat. So langsam, als hätte ich ihn aus dem Schlaf geholt, dreht er sich zu mir um. Als ich sein Gesicht erkenne, verschlägt es mir den Atem.
Der Mann dort ist Paul, der Soldat, der mich gerettet hatte.
4. KAPITEL
Ich stehe reglos da und starre den Soldaten an. Ist das wirklich der Mann, der in meiner Zelle gewesen ist? Ja, die großen blauen Augen sind unverwechselbar. Mir stockt immer noch der Atem. „Kann ich etwas für Sie tun?“, fragt er und legt den Kopf schräg. Ich erkenne die tiefe, melodische Stimme wieder. Aber sein Tonfall ist förmlich, und das gilt auch für seine Miene. Er erkennt mich nicht.
Natürlich nicht. Wahrscheinlich hat er nach mir noch Hunderte Lagerinsassen befreit. Ich zögere, da ich ihm eigentlich sagen möchte, wer ich bin. Ich will ihm dafür danken, dass er mich gerettet hat. Aber dann fällt mir wieder die lange Schlange der Wartenden vor dem Schloss ein. Ich habe keine Zeit für private Unterhaltungen, also räuspere ich mich und setze zu meiner Frage an: „Ich … ich brauche …“ Schlagartig lässt mich mein Englisch im Stich. Ich stammele, atme einmal tief durch und versuche es noch einmal, langsamer diesmal. „Ich suche einen Soldaten … Mattie?“
„Das bin ich. Mattie. Eigentlich Paul Mattison.“ Paul Mattison, wiederhole ich seinen Namen im Stillen. Während ich ihn ansehe, überkommt mich ein eigenartiges Gefühl. In Gedanken habe ich diesen Augenblick so oft herbeigesehnt. Ich kann kaum glauben, dass er jetzt da ist. „Kommen Sie wegen der Liste?“, fragt er, und ich nicke. Er gähnt und streckt sich genüsslich, dann zieht er ein Dokument aus seiner Brusttasche und hält es mir hin. „Hier.“
Während ich einen Schritt auf ihn zumache, beginnt mein Herz laut zu klopfen. Er sieht sogar noch besser aus, als ich es in Erinnerung hatte. Aber aus der Nähe bemerke ich seine blutunterlaufenen Augen, er sieht aus, als habe er seit Tagen nicht geschlafen. Dunkle Bartstoppeln überziehen seine Wangen und das Kinn, seine Uniform ist schmutzig. Als ich mich vorbeuge, um das Papier an mich zu nehmen, erkenne ich den Geruch nach Erde und Kiefern wieder. Aber ich rieche noch etwas anderes, etwas Süßliches und zugleich Stechendes. Alkohol. Paul hat getrunken. Plötzlich will ich nur noch die Flucht ergreifen. „Danke.“ Ich nehme die Liste an mich und wende mich zum Gehen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ist dieser betrunkene Soldat tatsächlich der Mann, der mich gerettet hatte?
„Miss“, ruft er mir nach, und als ich mich umdrehe, sehe ich, wie er auf wackligen Beinen hinter mir herkommt. „Warten Sie.“ Beim Näherkommen fällt mir auf, dass seine Haare und sein Gesicht jetzt nass sind, so als hätte er den Kopf kurz unter Wasser getaucht. Nun mischt sich auch noch der Geruch von abgestandenem Wasser in seine Alkoholfahne. „Kenne ich Sie nicht von irgendwoher?“
Mein Herz rast. Er erinnert sich an mich, doch als ich seinen fahrigen Blick bemerke, wird mir klar, dass das nicht von Bedeutung ist. „Ich … ich glaube nicht“, bringe ich heraus.
Verdutzt sieht er mich an. „Aber …“
„Przeprasz…“, erwidere ich und merke erst dann, dass ich ins Polnische verfallen bin. „Entschuldigen Sie, aber ich werde gebraucht.“ Mit diesen Worten mache ich abermals kehrt und laufe um das Schloss herum.
Dr. Verrier steht noch immer neben dem Tisch und hat gereizt die Arme vor der Brust verschränkt. „Tut mir leid“, murmele ich und setze mich. Die beiden Soldaten heben die abgesetzte Trage wieder auf, unterdessen falte ich die zerknitterte Liste auseinander und suche nach dem Namen der Frau. „Lebonski, Hannah“, lese ich vor. Der Doktor schickt sie auf die Krankenstation, dann wendet er sich dem nächsten Patienten zu.
Beharrlich versuche ich, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Paul ist hier. Hätte ich ihm sagen sollen, wer ich bin? Ich sehe hoch und beobachte, wie die Soldaten sich um die Befreiten kümmern. Paul beteiligt sich nicht, und dann entdecke ich ihn, wie er etwas abseits unter einem Baum sitzt und die Hände vors Gesicht hält. Betrunken und faul, denke ich, während ich die Angaben einer älteren Frau überprüfe, die fast bis aufs Skelett abgemagert ist. Wie konnte ich mich nur so in diesem Mann täuschen? Doch trotz meiner Abscheu fühle ich noch etwas anderes, ein seltsam warmes Gefühl in der Magengegend. Plötzlich hebt Paul den Kopf und schaut zu mir. Unsere Blicke treffen sich für einen Sekundenbruchteil, dann sehe ich schnell wieder auf meine Liste. Meine Wangen werden rot, ich spüre, wie er mich weiter beobachtet. Vermutlich überlegt er noch immer, woher er mich kennt.
Zwanzig Minuten später sind die Neuankömmlinge so gut wie erfasst. Ich sehe wieder zu dem Baum, aber Paul sitzt nicht mehr dort, und ich sage mir, dass es besser ist. Ich sollte ihn so Erinnerung behalten, wie ich ihn am Tag meiner Rettung erlebt habe. Die letzten Häftlinge sind untersucht worden, und ich lege die nicht benutzten Vordrucke zurück in die Schachtel, dann stehe ich auf. „Ich kenne Sie sehr wohl!“, höre ich plötzlich eine Stimme hinter mir. Erschrocken fahre ich herum, die Schachtel gleitet mir aus den Händen, die Formulare verteilen sich auf dem Rasen. Paul steht mit verschränkten Armen vor mir.
Ich fühle mich, als habe mir jemand die Luft aus den Lungen gepresst. „Sie haben mich erschreckt!“, bekomme ich schließlich heraus. Ich bücke mich und beginne, die Zettel aufzusammeln.
„Tut mir leid.“ Er kniet sich neben mich und hilft mir beim Einsammeln. Der Alkoholgeruch ist verschwunden, stattdessen rieche ich jetzt Minze in seinem Atem. Seine Bewegungen sind präziser, als sei er inzwischen nüchtern geworden. „Mir ist wieder eingefallen, woher ich Sie kenne.“ Er greift nach einem Papier, das neben meinem Knöchel liegt, und auf einmal ist sein Gesicht ganz dicht an meinem. „Sie waren die Frau in der Zelle in Dachau. Mary? Maria?“
„Marta“, sage ich und sehe angestrengt auf den Rasen.
„Ja, genau. Marta. Entschuldigen Sie.“ Ich merke, wie er mein Gesicht mustert. „Sie sehen nur so ganz anders aus. Und ich wusste nicht, dass Sie Englisch sprechen“, fügt er hinzu.
„Das konnte ich da auch noch nicht.“ Meine Wangen beginnen zu glühen. „Ich meine, ich kann es noch immer nicht. Jedenfalls nicht gut. Aber ich lerne jeden Tag.“ Mir wird mein Akzent bewusst, der mein Englisch einfärbt, und ich merke, wie sehr ich mich anstrengen muss, um all die richtigen Worte zu finden.
„Dafür klingt es schon ausgezeichnet.“ Er hat das letzte Papier aufgehoben und legt es zurück in die Schachtel, dabei streift er leicht meine Hand. Es erinnert mich an seine sanfte Berührung in der Zelle. Plötzlich wird mir schwindlig, er richtet sich auf und will mir hochhelfen.





























