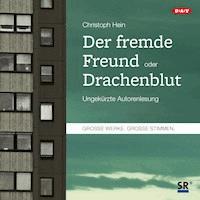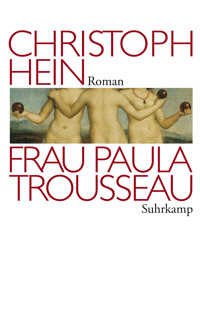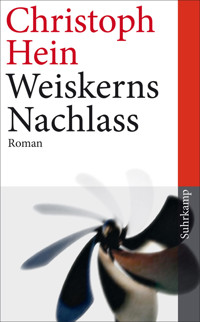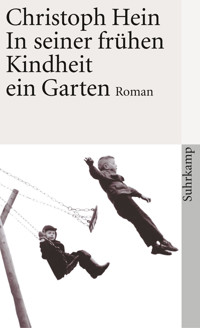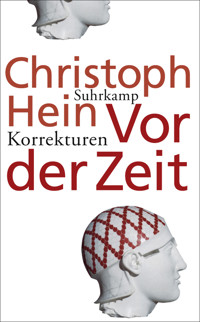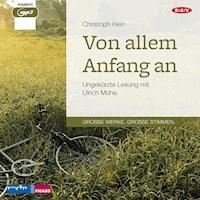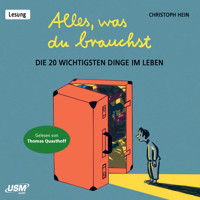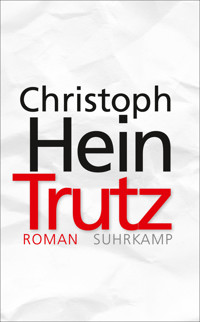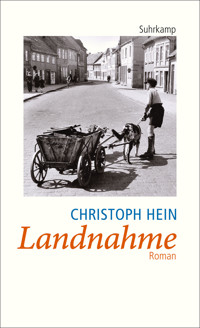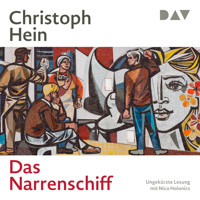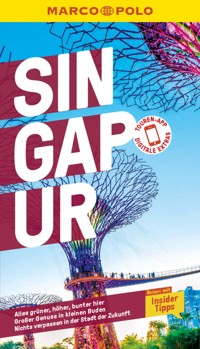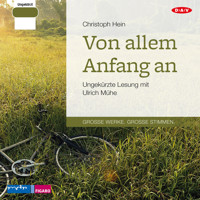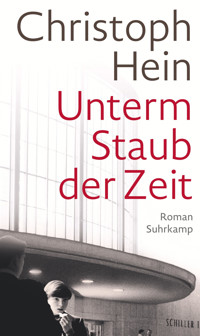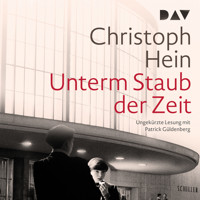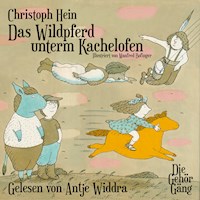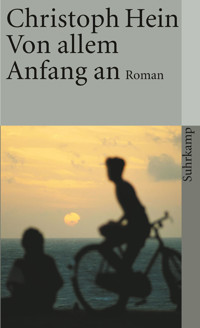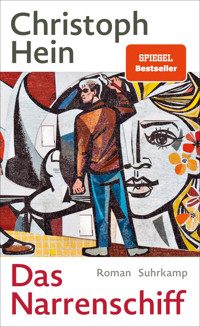
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Staat wird – wie alle Staaten – gegründet für alle Ewigkeit und verschwindet nach vierzig Jahren nahezu spurlos. Sind die Menschen, die dort einmal lebten, dem Vergessen anheimgefallen und ihre Träume nur ein kurzer Hauch im epochalen Wind der Zeitläufte?
In seinem fulminanten Gesellschaftsroman lässt Christoph Hein Frauen und Männer aufeinandertreffen, denen bei der Gründung der DDR unterschiedlichste Rollen zuteilwerden, begleitet sie durch die dramatischen Entwicklungen einer im Werden befindlichen Gesellschaft, die das bessere Deutschland zu repräsentieren vermeint und doch von einem Scheitern zum nächsten eilt.
Überzeugte Kommunisten, ehemals begeisterte Nazis, in Intrigen verstrickte Funktionäre, ihre Bürgerlichkeit in den Realsozialismus hinüberrettende Intellektuelle, Schuhverkäufer, Kellner, Fabrikarbeiter, Hausmeister und selbst ein hoher Stasi-Mann erkennen auf die eine oder andere Art ihre Zugehörigkeit zu einer unfreiwilligen Mannschaft an Bord eines Gemeinwesens, das sie zunehmend als Narrenschiff wahrnehmen und dessen Kurs auf immer bedrohlichere historische Klippen ausgerichtet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Christoph Hein
Das Narrenschiff
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.Korrigierte Fassung, 2025.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Walter Womacka, Mosaikfries Unser Leben am Haus des Lehrers, Berlin. Foto: mauritius images/Saturno dona'/Alamy/Alamy Stock Photos, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025
eISBN 978-3-518-78209-5
www.suhrkamp.de
Motto
Hartnäckig wird es Welt und Nachwelt leugnen:
Du schreib es treulich in dein Protokoll.
J. W. v. Goethe
Ein Frauenarzt weiß nur selten, was einer Frau fehlt.
Joseph Roth
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Erstes Buch
1. Der Präsident gesteht
2. Heimkehr
3. Eine Flucht
4. Kampf um ein Kind
5. Ein unlustiger Mann
6. Eine Versorgungsehe
7. Funktionärin wider Willen
8. Die Chefin
9. Von Liebe ist nicht die Rede
10. Ein Brüderchen
11. Ein Festtag
12. Verlorene Heimat
13. Ein befreiender Lehrgang
14. Eine gewichtige Freundin
15. Eine Maske fällt
16. Der Aufstand
17. Das große Schweigen
18. Modische und andere Seitensprünge
19. Ein Karriereknick
20. Einen Code entschlüsseln
21. Die Beförderung
22. Eine Karriere, ein Exil
23. Zwischen West und Ost
Zweites Buch
1. Scharwänzlä
2. Strandlektüre
3. Ein Parteiauftrag
4. Als Esel auf dem Eis
5. Eine Tischrunde
6. Papa steht in der Zeitung
7. Stigmata
8. Parteidisziplin
9. Krötenschlucken
10. Die Klippschule
11. Alles zweimal durchdenken
12. Vergnügliche Dienstreisen
13. Der Kalte Krieg
14. Der Traum ist aus
15. Eine Liebhaberei
16. Das Duroplastauto
17. Ein Dozent für Romanistik
18. Eine Tagung im Kongresspalast des Kremls
19. Die Geheimrede
20. Harmagedon
21. Abfahrt Kursker Bahnhof
22. Der Meteorstrom
23. Glücklich ist, wer vergisst
24. Die Schwiegermutter
25. Antifaschisten in Pullach
26. Unruhen und Panikmache
27. Der Knecht macht den Herrn
28. Die Telefonzentrale greift ein
29. In der Edo-Zeit
30. Aktion Blitz
31. Ein Mädchen namens Beate
32. Ein Student der Slawistik
Drittes Buch
1. Der Wall
2. Hinter den Kulissen
3. Libido, eingemauert
4. Eine neue Liebe
5. Ein Stacheldraht durchs Herz
6. Spartakisten
7. Kahlschlag
8. Die große Säuberung
9. Eine Gesprächsrunde stirbt
10. Aus und vorbei
11. Hinterlassenschaften zweifach
12. Ein Auge offen halten
13. … und sahen sich nie wieder
14. Die Kranfahrerin
15. Eine geheime Insel
16. Die Waschbären
17. Ein Brigadefest
18. Österreich lockt, die Bundesrepublik gleichfalls
19. Moderlieschen und Mühlkoppen
20. Ein Verhör an der Kaffeetafel
21. Hochzeit bei Schmalhans
22. Von einer Sechs- in eine Zwei-Zimmer-Wohnung
23. Ein ärztlicher Rat
24. Frühlingswinde
25. Ein Frühling erfriert
26. Eine Professur für den Pensionär
27. Zur Untermiete
Viertes Buch
1. Geräuschlose Abwahl
2. Der Dachdecker kommt
3. Schlangen und Kröten
4. Freund Markus
5. Sekretärinnenplausch
6. Das Duell der Personenschützer
7. Tempora mutantur
8. Die Erpressung
9. Mütter und Töchter
10. Ein Ausreiseantrag
11. Bewährungszeit bestanden
12. Wahllokal
13. Die Koffer packen
14. Korrosionsschäden
15. Abschiedsessen
16. Im Koma
17. Ein Verlag der Sonderklasse
18. Kein Platz auf dem Ehrenfriedhof
19. Das Fest-Epistolar
20. Die Möhre ist gekoch
t
21. Das Testament
22. Das alte Manuskript
23. Eins zu zehn
24. Eine staatsfeindliche Zusammenrottung
25. Ein Mann mit Witz und Scharfsinn, hilflos
26. Hahn im Korb
27. Der Schulverweis
28. Himmlischer Frieden?
29. Die Krankheit Alter Mann
30. … und zu allem fähig
31. Liebe über den Tod hinaus
32. Ein menschliches Wrack
33. Ein Staatsbegräbnis und eine Öffnung
34. Begrüßungsgeld und arbeitslos
35. Grundbuch und Bullenstrick
36. Teleshopping
37. Keine Beförderung
38. Abschied und Aufbruch
Informationen zum Buch
Das Narrenschiff
Erstes Buch
1.
Der Präsident gesteht
Dem eingeschüchterten Mädchen gegenüber war er sehr wohlwollend und freundlich, so gütig, wie in den Schulbüchern über ihn zu lesen war.
Die Lehrerin hatte ihr gesagt, sie werde bei der Feierstunde neben dem Präsidenten sitzen, weil sie die beste Schülerin der beiden ersten Klassen sei.
Sie wusste nicht ganz genau, was ein Präsident ist, aber ihre Schule trug seinen Namen. Sie würde heute neben dem Mann sitzen dürfen, nach dem man ihre Schule benannt hatte. Er war der Präsident des ganzen Landes und noch wichtiger und bedeutsamer als ihr Vater.
Der Mann, den sie mit »Herr Präsident« ansprechen sollte, beugte sich zu ihr und fragte: »Na, kleines Fräulein, wie heißt du denn?«
»Ich bin die Kathinka.«
»Ein schöner Name, Kathinka. Ein sehr schöner Name für ein sehr schönes Mädchen. Und du willst sicherlich wissen, warum dieser dicke, alte Mann neben dir sitzt?«
Sie schaute ihn ängstlich an, brachte aber kein Wort heraus.
»Du gehst in die erste Klasse, nicht wahr, Kathinka?«
Sie nickte heftig.
»Und ich vermute, du bist die Klassenbeste und deshalb darfst du neben mir sitzen.«
Ohne auch nur eine Miene zu verziehen oder zu lächeln, nickte sie wiederum, wobei sie zu ihm aufsah.
»Ich will dir etwas verraten, was du aber keinem erzählen darfst. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«
Das Mädchen nickte heftig.
»Weißt du, ich war nie der Beste in meiner Klasse. Da gab es immer ein paar Mädchen und Jungen, die viel besser waren als ich. Aber das darfst du keinem weitererzählen. Versprochen?«
Die Kleine nickte. Sie starrte ihn an und fragte so leise, dass man sie kaum verstehen konnte: »Warum sind Sie dann der Präsident geworden und nicht der Klassenbeste?«
»Ja, siehst du, das weiß ich auch nicht. Es hat sich so ergeben. Wahrscheinlich hat sich keiner meine Zeugnisse angesehen. Aber das darfst du keinem weitererzählen. Das wäre sehr peinlich für mich.«
Kathinka zögerte ein paar Sekunden. Dann flüsterte sie: »Versprochen. Pionierehrenwort, Herr Präsident.«
»Oh, Kathinka, dein Schuldirektor schaut schon immerfort zu uns. Jetzt sollten wir beide den Mund halten und ihm zuhören, sonst stellt er uns noch in die Ecke.«
2.
Heimkehr
Am ersten Mai neunzehnhundertfünfundvierzig flog Karsten Emser mit weiteren zwölf Genossen von Moskau nach Berlin. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Minsk landete die Maschine auf einem ehemaligen deutschen Feldflugplatz im Wald bei Calau, südwestlich von Frankfurt an der Oder, wo sie von Offizieren der Roten Armee empfangen wurden, die sie in einem Mannschaftswagen der Infanterie zum Hauptquartier des Obersten Kommandos brachten, dem Politischen Stab von Marschall Schukow, dem Oberkommandierenden der Ersten Weißrussischen Front.
Am Vortag war eine erste Gruppe von dem bei Moskau gelegenen Flugplatz Wnukowo mit einer Douglas-Maschine zum Feldflugplatz Calau geflogen worden, zehn deutsche Antifaschisten, die sogenannten Gruppe Ulbricht, die vier Tage zuvor den militärischen Befehl zu ihrer Rückkehr in die Heimat erhalten hatte.
Auch Karsten Emser war vier Tage zuvor die Anordnung des Verteidigungsministeriums übermittelt worden, dass er mit dieser ersten Gruppe nach Deutschland fliegen werde, und er wurde angewiesen, sich für den Heimflug vorzubereiten, der am dreißigsten April eine Stunde vor Sonnenaufgang starten würde. Allen wurde gesagt, dass nur ein einziges Gepäckstück erlaubt sei, nach Möglichkeit ein mittelgroßer Rucksack.
Am neunundzwanzigsten April wurde Emser unterrichtet, dass nicht er, sondern Richard Gyptner mit dem ersten Transport fliegen werde. Gründe für diesen Wechsel wurden nicht genannt, und er vermutete, dass Ulbricht darauf bestanden hatte, Gyptner mit an Bord zu nehmen und nicht ihn. Er hatte in den Moskauer Jahren gelegentlich bemerken müssen, dass der designierte Chef – wie auch andere Genossen in der Parteiführung – den Intellektuellen gegenüber misstrauisch und ablehnend war und sich demonstrativ gelangweilt gebärdete, wenn Emser sprach, und seine Antworten stets mit einem höhnischen der Herr Professor meint einleitete.
Nachdem sämtliche Bemühungen Moskaus, Ernst Thälmann aus dem deutschen Konzentrationslager freizubekommen, gescheitert waren, gelang es Ulbricht, die sowjetische Führung und selbst Stalin davon zu überzeugen, dass er und nur er an der Spitze des neuen, antifaschistischen deutschen Staates stehen sollte.
Der Offizier, der Emser über die neue Zusammenstellung der Heimkehrer informierte, unterrichtete ihn gleichzeitig, dass er einen Tag später, spätestens in den nächsten drei Tagen, rückgeführt werde.
Tatsächlich flog er dann mit den zwölf Genossen am ersten Mai. Das Flugzeug landete gleichfalls auf dem Feldflugplatz Calau, von dem aus man sie in ihr Quartier brachte, wo er jene Genossen antraf, die einen Tag zuvor ausgeflogen worden waren, jedenfalls neun von ihnen, denn Walter Ulbricht war am Vortag und unmittelbar nach der Landung des Flugzeugs zur sowjetischen Kommandostelle in Berlin gefahren worden.
Einen Tag später, am zweiten Mai, trafen noch zwei sowjetische Flugzeuge mit weiteren deutschen Genossen auf dem früheren Feldflugplatz der Wehrmacht ein und wurden umgehend zu den wartenden Vorauskommandos gebracht. Emser kannte sie, einige vom Sehen oder von einem kurzen Gespräch, mit anderen verband ihn der eine und andere Vorfall. Zumeist hatte er mit diesen Genossen problematische Entscheidungen zu besprechen, um eine Lösung zu finden oder auch nur um keinen Fehler zu begehen und um sich selbst abzusichern.
Als er den zwanzigjährigen Fuchs unter den neu angekommenen Heimgekehrten sah, ging er auf ihn zu: »Ah, der junge Fuchs, sei gegrüßt.«
Er hatte diese herzliche Anrede gewählt, da er seinen Vornamen nicht kannte. Er hatte mit dessen Vater viel zu tun gehabt, einem von ihm verehrten Freund, er hatte diesem vermutlich das Leben gerettet, als es ihm von Moskau aus gelang, ihn mit der Hilfe eines ukrainischen Genossen und eines gefälschten Passes aus dem Internierungslager Le Vernet zu befreien und wieder in das sichere sowjetische Exil bringen zu lassen. Und ein zweites Mal rettete er ihm vermutlich den Kopf oder doch die Freiheit, als er dafür sorgte, dass der Freund aus der gefährlichen Zentrale Moskau nach Krasnogorsk versetzt wurde, wo er deutsche Kriegsgefangene zu schulen hatte und nicht Gefahr lief, sich mit irgendeiner Entscheidung oder beiläufigen Äußerung als Diversant oder Hitlerist zu entlarven. Mit ihm und dessen Frau hatte er sich häufiger getroffen, die Kinder der beiden aber nur gelegentlich gesehen.
»Wofür bist du in Berlin vorgesehen?«
»Ich weiß es nicht. Ich werde es erst erfahren, wenn die provisorische Regierung ernannt ist. Oder die neue Stadtleitung von Berlin.«
»Wir brauchen jeden aufrechten Antifaschisten, mein Junge. Wir sind in ein Land gekommen, wo die Mehrheit wohl noch immer ihren geliebten Hitler verehrt und bewundert, in ihm den wahren Führer sieht. Und wir, wir sind für diese Leute verächtliche Verräter, die mit dem Feind paktieren. Also sei vorsichtig. Es wird in Deutschland noch viele geben, die lieber uns hängen sehen als solche Kriegsverbrecher wie Hitler und Göring.«
»Ich weiß. Es wird schwer. Und gefährlich.«
Emser klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter und wandte sich dem nächsten Neuankömmling zu.
Nach dem gemeinsamen Abendessen, der Koch hatte sich von zwei Bauern der Umgebung sechsunddreißig Schnitzel geben lassen und das Fleisch gegen drei Flaschen Wodka eingetauscht, saßen alle gemeinsam in der früheren Wartehalle des Flugplatzes und hörten sich an, was ihnen ein russischer Major über die militärische Lage mitteilte. Das sowjetische Oberkommando rechne damit, dass der letzte Widerstand der Wehrmacht in drei bis vier Tagen endgültig zusammenbreche und dass dann die Gruppe der deutschen Rückkehrer ins Berliner Zentrum gebracht werde, wo ein neu eingesetzter Bürgermeister die Arbeit verteilen werde. Fast eine Viertelstunde sprach er über die von Heinrich Himmler befohlene Organisation Werwolf, die er in der Nachkriegszeit als besonders gefährlich ansah. Es seien vor allem verführte Jugendliche, die einem verbrecherischen Führer und einem verlorenen Deutschland hinterhertrauern würden und sogar zu Selbstmord-Attentaten bereit wären. Der Major sagte, da die Rote Armee Berlin befreit habe, werde wohl von der Hauptstadt aus die Neuordnung Deutschlands erfolgen. Die Alliierten hätten zwar einen großen Anteil am Sieg über die Faschisten, aber die Rote Armee rechne damit, dass sie als Sieger in Berlin auch die weiteren Geschicke Deutschlands bestimmen werde und die Alliierten sich bei ihren Machtansprüchen zurückhalten müssten.
Alle hatten verstanden, dass sie in den nächsten Tagen auf dem Feldflugplatz Calau mit den behelfsmäßigen Betten – es waren übereinandergestapelte Matratzen ohne Kissen und ohne Bettwäsche – bleiben müssten. Sie würden vermutlich Tag für Tag Lageberichte erhalten oder auch Anweisungen der sowjetischen Offiziere, doch konnten sie gewiss ausschlafen und noch ein paar ruhige Tage genießen, bevor sie im Berliner Zentrum ein zwölf- oder gar fünfzehnstündiger Arbeitstag erwarten würde. Daher saßen sie an diesem Abend lange zusammen, rauchten, tranken und ergingen sich in Gesprächen über die Zukunft des Landes.
Die Ankunft in Deutschland, in einem Land, in dem sie zwölf Jahre zuvor mit Konzentrationslager oder Tod bedroht worden waren und nur mit Mühe ins Exil hatten entkommen können, erregte alle. Sie fieberten ihren neuen Aufgaben entgegen, begierig, aus der faschistischen Diktatur eine friedliebende Demokratie zu schaffen. Und sie waren glücklich, wieder in der Heimat zu sein.
»Ich liebe die russischen Wälder, die russkiye berozovye, aber ich liebe unsere Wälder noch mehr, die Tannen, den Mischwald. Ich freue mich jetzt schon darauf, durch unsere deutschen Wälder zu spazieren«, sagte ein fünfzigjähriger, schlohweißer Mann.
»Dann pass nur auf, dass du in deinen geliebten deutschen Wäldern nicht auf eine Mine trittst«, erwiderte sein Tischnachbar.
»Dort kannst du auf eine Tretmine treffen oder auf eine menschliche Mine. Du hast doch eben gehört, dass die fanatisierte Jugend nun zu Werwölfen wurde. Und schwer bewaffnet werden die alle sein, es liegen ja vermutlich genug Waffen und Uniformteile in den Wäldern herum, entsorgt von den Helden der Wehrmacht«, ergänzte ein anderer.
Trotz aller Sorgen und Ängste vor dem, was sie erwarten würde, waren alle freudig erregt, wieder in der Heimat zu sein, in dem Land ihrer Geburt, ihrer Sprache, ihrer Kultur.
Gegen Mitternacht begannen sie zu singen, gemeinsam stimmten sie die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs an und russische Partisanenlieder. Zwei Männer begannen in einer Pause zu singen: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, und augenblicklich fielen alle anderen ein und sie sangen, soweit es ihre Kenntnis des Textes erlaubte, das Lied von der traurigen Loreley.
Es war schon nach Mitternacht, als Frieder, der in Hamburg Gesang studiert hatte und in Moskau zu einem vorzüglichen Funker ausgebildet worden war, mit seiner klaren Baritonstimme drei Lieder aus der Winterreise a cappella sang. Alle hörten ihm ergriffen zu, allen standen Tränen in den Augen, die sie nicht wegwischten.
Als sie schlafen gingen, legte sich auch Emser halb ausgekleidet auf sein Matratzenlager. Er war über sich selbst verwundert, dass er an diesem Abend sogar mit zwei Leuten freundschaftlich gesprochen hatte, mit denen er in Moskau jeden Kontakt vermied, da er sie als Speichellecker und Feiglinge erlebt hatte. Das ist wohl die Heimat, sagte er sich, pass auf, dass du nicht noch rührselig wirst.
Zwei Wochen zuvor, Mitte April, hatte das Oberkommando der Roten Armee entschieden, mit einem Zangenangriff auf Berlin das Ende des Naziregimes einzuleiten. Die Erste Ukrainische Front unter Marschall Konew überrollte die deutschen Verteidigungsstellungen an der Lausitzer Neiße, während die Erste Weißrussische Front unter Marschall Schukow auf den Seelower Höhen in schwerste Kämpfe mit der 9. Armee von Generaloberst Gotthard Heinrici verwickelt wurde, den sowohl das Panzerkorps des Artilleriegenerals Weidling wie auch das gefürchtete 11. SS-Armee-Korps von SS-Obergruppenführer Kleinheisterkamp unterstützten. Diese Kämpfe waren so heftig und verlustreich, dass Marschall Schukow nach einigen Tagen entschied, die Stadt im Norden zu umgehen.
Am dreißigsten April, an jenem Tag, an dem Ulbricht, aus Moskau kommend, in Berlin eintraf, erschoss sich Adolf Hitler in seinem Bunker, nachdem er erfahren hatte, dass ein letzter Entsatzversuch der Zwölften Armee unter General Walther Wenck einen Tag zuvor bei Potsdam völlig erfolglos abgebrochen werden musste.
An diesem Tag hissten Rotarmisten auf der Spitze des Reichstags die rote Fahne mit Hammer und Sichel. Und am zweiten Mai neunzehnhundertfünfundvierzig streckten die letzten versprengten Wehrmachtsverbände in der Stadt ihre Waffen. Berlin kapitulierte, woraufhin die restlichen Mitglieder der eingeflogenen deutschen Kommunisten in die zerstörte Hauptstadt aufbrachen. Sie hatten Auftrag, die materiellen Lebensgrundlagen der Stadt zu retten oder wiederherzustellen, die Kräfte für den Wiederaufbau des alltäglichen Lebens zu sammeln und zu organisieren und eine neue, eine demokratische Stadtverwaltung für Berlin aufzubauen.
Karsten Emser, dem früheren Ökonomieprofessor, wurde in dem von der Sowjetischen Militäradministration eingesetzten antifaschistischen Magistrat von Groß-Berlin das Wirtschaftsressort zugewiesen mit der vordringlichen Aufgabe, den dringendsten Bedarf der Bevölkerung sicherzustellen.
3.
Eine Flucht
Im vorletzten Kriegsjahr wollte Jonathan Schwarz mit Jakub Silbergstein Berlin unbemerkt verlassen und eine Flucht über die Berge antreten. Sie hatten verabredet, zusammen über den voralpinen Schiener Berg zu klettern, um dann bis Stein am Rhein zu gelangen. Es war geplant, mit Bahn und Bus bis Iznang zu fahren, dort die Nacht abzuwarten und um vier Uhr in der Früh loszumarschieren. Dann könnten sie noch vor Sonnenaufgang die Grenze passieren, die um diese Uhrzeit und in dieser Jahreszeit, wie sie vermuteten oder vielmehr hofften, weniger kontrolliert wurde, und würden in der Morgendämmerung die Burg Hohenklingen erreichen und eine Stunde später die Rheinbrücke vor Stein am Rhein überqueren können.
Jonathan Schwarz und Jakub Silbergstein waren Arbeitskollegen im Ingenieurbüro Friedhelm Walter. Jonathan arbeitete in der Abteilung Turbopumpen für Flüssigkeitsraketentriebwerke, während Jakub im gleichen Unternehmen in dem Ressort für den Ausbau und die Vervollständigung elektromechanischer Raketenrelais beschäftigt war. Das gesamte Ingenieurbüro von Friedhelm Walter galt bereits in Friedenszeiten als unentbehrlich und wurde drei Monate nach Kriegsbeginn vom Reichskriegsministerium als kriegswichtig eingestuft, so dass auch die sechs dort beschäftigten Personen, die keinen Nachweis einer arischen Abstammung vorlegen konnten, nicht entlassen wurden, sondern als unersetzliche Fachkräfte vor einer fristlosen Aufkündigung ihres Arbeitsvertrags sowie jeglicher Verfolgung durch staatliche Beamte oder Parteiorganisationen geschützt waren.
Drei Jahre später jedoch erschienen die Ingenieure Goldberg und Zuckermann nicht mehr in der Firma. Nach zwei Tagen schickte der Bürochef eine Hilfskraft zu ihren Wohnungen, und diese konnte von Wohnungsnachbarn erfahren, dass beide Angestellten am Dienstagmorgen von Polizisten in ihren Wohnungen festgenommen worden waren.
Friedhelm Walter fuhr daraufhin persönlich zum Polizeipräsidium, um sich nach seinen für ihn unersetzbaren Ingenieuren zu erkundigen. Man teilte ihm mit, beide Männer sowie die Ehefrau des älteren seien im Rahmen einer Amtshilfe für das SS-Kommandoamt festgenommen und den Beauftragten der Schutzstaffel übergeben worden. Über den weiteren Verbleib der drei Verhafteten sei das Präsidium nicht unterrichtet.
Walter fuhr in seine Firma zurück, ließ sich von der Sekretärin die amtlichen Bescheinigungen aushändigen, wonach sein Ingenieurbüro und seine Angestellten als kriegswichtig klassifiziert waren, und legte diese Papiere des Reichskriegsministeriums im Kommandoamt der Neunten SS-Panzer-Division »Hohenstaufen« vor, die in seinem Stadtbezirk residierte und das Polizeipräsidium um Amtshilfe ersucht hatte. Er bat den Untersturmführer, seine beiden überaus qualifizierten Mitarbeiter freizulassen, da anderenfalls die Weiterentwicklung und Produktion der Raketenbrennkammern gefährdet sei, was eine nicht zu verantwortende Schädigung der Luftwaffe bedeute.
Der Sturmführer las die Schreiben, die vom General der Technischen Truppen unterzeichnet waren, und ging mit ihnen, nachdem er kurz angeklopft hatte, in das Nebenzimmer. Friedhelm Walter hörte kurz darauf ein höhnisches Lachen. Der Sturmführer erschien wieder, winkte mit dem Zeigefinger Walter zu sich und teilte ihm mit, die Festnahme dieser beiden Subjekte sei weisungsgemäß erfolgt. Der Standartenführer handele auf Grund einer Anordnung des Reichsführers SS, wonach Artfremde in keiner kriegswichtigen Produktion zu beschäftigen seien, um Sabotage zu verhindern. Mit dem Wisch vom Reichskriegsministerium, lasse ihm der Standartenführer ausrichten, möge er sich den Arsch wischen. Er könne aber mit diesem Wisch auch beim Reichsführer SS erscheinen, um sich höchstpersönlich für seine Juden einzusetzen.
Friedhelm Walter rief nach seiner Rückkehr die Leiter der Entwicklungsabteilungen ins Konferenzzimmer, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Kollegen Goldberg und Zuckermann verhaftet worden waren und nicht mehr in seiner Firma arbeiten können. Diese beiden Herren müssten umgehend ersetzt werden, was in Kriegszeiten allerdings nahezu unmöglich sei.
Die Herren vom SS-Kommandoamt interessiere ausschließlich die arische Herkunft seiner Mitarbeiter, über ihre erforderliche fachliche Qualifikation könne man mit ihnen nicht reden, allerdings werde er selbst, seine Firma und alle Mitarbeiter mit ärgsten Konsequenzen zu rechnen haben, falls die Reglermodelle für die Raketenbrennkammern nicht in der vereinbarten Zeit und in der erforderlichen Qualität geliefert werden. Im Kommandoamt habe man sogar von der Möglichkeit kriegswichtiger Enteignungen gesprochen.
Walter teilte seinen Angestellten mit, dass er keine Chance habe, über Nacht einen Chemiker und einen Physiker zu rekrutieren, die das erforderliche Fachwissen von Goldberg und Zuckermann hätten und ihre Arbeit umgehend übernehmen könnten. Er würde sich persönlich im ganzen Reich um Fachkräfte bemühen, die jedoch, auch wenn seine Bemühungen erfolgreich sein sollten, eine Einarbeitungszeit benötigten, eine Zeit, die seine Firma nicht habe. Vorläufig müsse er die Arbeit von Goldberg und Zuckermann auf alle Anwesenden verteilen. Dieses werde nicht ohne Überstunden möglich sein. Er werde daher mit ihnen zusammen und noch in dieser Stunde einen Ersatzplan für die nächsten drei Wochen aufstellen.
»Wir sind im Krieg, meine Herren«, sagte er, »und das Ingenieurbüro Friedhelm Walter ist kriegswichtig. Das erbringt uns einige Privilegien, wie das Kommandoamt mir erklärte, könnte uns jedoch, wenn wir versagen, wenn unsere Triebwerke oder Raketenrelais nicht perfekt und störungsfrei arbeiten oder wir nicht termingerecht liefern, vor ein Kriegsgericht bringen. Sowohl mich wie auch Sie.«
In seiner Firma wussten noch am gleichen Tag alle, was mit Goldberg und Zuckermann passiert war, und alle ahnten auch, warum die beiden vom SS-Kommandoamt festgenommen worden waren.
In der Mittagspause setzte sich Jonathan Schwarz zu Jakub Silbergstein, um sich mit ihm zu beraten. Beiden war klar, dass man sie jederzeit gleichfalls verhaften und in ein Lager verbringen könnte.
»Jederzeit, verstehst du«, meinte Jakub, »wir hatten bisher Glück, aber wir stehen auf einer ihrer Listen. Und kriegswichtig, das gilt offenbar nicht mehr, jedenfalls nicht für Leute wie dich und mich.«
Jonathan nickte.
»Das heißt, wir sollten verschwinden. Wir müssen verschwinden. Unverzüglich. Sofort. Wir sollten versuchen, über die Grenze zu gehen. Und zwar heute noch, Jonathan. Morgen ist es vielleicht zu spät.«
»Über welche Grenze?«
»Wir gehen in die Schweiz. Ein anderes Land gibt es für uns nicht.«
»Und wie?«
»Über die Berge, über die Alpen. Je schwieriger der Weg ist, umso sicherer ist er.«
Sein Arbeitskollege schlug vor, über die Voralpen zu klettern, wo seinen Erfahrungen nach in dem unwirtlichen und schwer begehbaren Gelände weniger Beamte an der Grenze zur Schweiz eingesetzt seien.
Er war ein erfahrener Bergsteiger und behauptete, er kenne die Alpen wie seine Westentasche. Er sei das gesamte Gebirgsmassiv von allen Seiten aus aufgestiegen. Der Schiener Berg sei voralpin, meinte er, böte also für einen Bergsteiger keine Probleme, sei vielmehr eher langweilig. Mit gutem Schuhwerk könne man das Gebiet rasch durchqueren, geradezu durcheilen, um in die Schweiz zu gelangen. Möglich wäre es auch, von Öhningen aus über den See zu schwimmen, sagte er, oder von Allensbach über Reichenau die Grenze zu queren. Da habe man jedoch durch den Gnadensee zu schwimmen, das seien zwei Kilometer Wasser, was zu schaffen sei, allerdings ohne jedes Gepäck oder nur mit einem wasserdichten Rucksack. Er sei Bergwanderer, er ziehe die Felsen dem Wasser vor, und der Schiener Berg sei auch einem Frischling am Berg wie Jonathan zuzumuten.
Sie verabredeten sich für den Zug nach Frankfurt, der zwanzig Minuten nach sechs abfahren würde.
»Pack nur das Nötigste ein. Geld und Ausweise. Und nur ein Rucksack, denn wir müssen klettern. Und noch eins, sag deinem Mädel, sie soll mit dem Baby irgendwo untertauchen. Bei Verwandten auf einem Dorf oder sonst wo. Da, wo sie sicher ist. Sie selbst ist nicht gefährdet, aber eure kleine Tochter.«
Eine Stunde nach dem Mittagessen und der Verabredung mit Jakub Silbergstein musste sich Jonathan erbrechen. Die beängstigende Vorstellung von seiner eigenen Gefährdung und der Gedanke, sich von seiner Frau Yvonne und der kleinen Tochter Kathinka trennen zu müssen – sie hatten ihre Tochter nach Kathinka Goethe benannt, dem vierten Kind des von ihnen verehrten Schriftstellers –, war ihm so unerträglich, dass plötzlich konvulsivische Zuckungen seinen Körper durchliefen. Die Kollegen in der Firma bemerkten seinen Krampfanfall, sahen die Zuckungen seiner Arme und Beine und den seltsam starren Blick. Der Leiter seiner Arbeitsgruppe entschied, dass er sich umgehend bei einem Arzt vorstellen müsse, und ließ ihn von einem Firmenwagen nach Hause bringen.
In seiner kleinen Wohnung begrüßte ihn Yvonne, die verwundert nach dem Grund seines frühen Feierabends fragte. Er berichtete, was er von der Verhaftung seiner beiden Kollegen erfahren hatte, und erzählte ihr dann von dem Plan, den er mit seinem Kollegen Jakub besprochen hatte.
»Und du willst noch heute Abend verschwinden? Aber was soll ich machen? Allein mit unserem Baby?«
»Du bist wahrscheinlich nicht gefährdet, aber unsere Kathinka, falls die Behörde herausbekommt, dass ich der Vater bin. Du solltest verschwinden. Vielleicht kannst du mit dem Baby bei deinen Großeltern untertauchen.«
Yvonne Lebinski und Jonathan Schwarz waren nicht verheiratet. Eine eheliche Verbindung untersagten die Verordnungen des Dritten Reiches. Die Nürnberger Rassegesetze verboten eine Ehe zwischen Juden und Nichtjuden, und um das deutsche Blut reinzuhalten, wie es im Ariergesetz hieß, wurde auch ein außerehelicher Geschlechtsverkehr als Rassenschande bezeichnet und mit Gefängnis und Zuchthaus bedroht, und daher hatte Yvonne auf dem Standesamt den Namen des Vaters verschwiegen. Verlegen und hochrot hatte sie der Standesbeamtin gesagt, sie kenne lediglich den Vornamen des Kindsvaters, was ihr ein verächtliches Kopfschütteln der Frau einbrachte. Da sie angab, der Kindsvater habe ihr erklärt, er sei, wie seine Uniform ausweise, Feldwebel im Luftgau-Kommando Rostow, wurde daraufhin von der Beamtin eine arische Abstammung der kleinen Kathinka amtlich vermerkt.
Mit Yvonnes Hilfe packte Jonathan seinen Rucksack und zog sich für die Flucht um. Da er bergiges Land zu durchqueren hatte, wählte er robuste Kleidung und ein Paar Schuhe, die ihm für eine Flucht über die Berge geeignet schienen. Eine halbe Stunde lang setzte er sich in den Sessel, Yvonne und sein Baby auf dem Schoß, und tränenreich nahmen sie Abschied.
»Sei tapfer, Liebste, du musst für unsere Kathinka sorgen.«
»Natürlich. Und wann werden wir uns wiedersehen?«
»Bald, Yvonne, sehr bald. Der Krieg ist bald zu Ende, die Alliierten sind auf dem Vormarsch. Bald ist Hitler besiegt, und wir können uns sehen, zusammenleben, heiraten.«
»Sei vorsichtig, Jonathan.«
»In meinen Rucksack habe ich viel Vorsicht gepackt, einen ganzen Zentner.«
Zum Bahnhof ging er allein, ihre Begleitung in der Öffentlichkeit konnte sie selbst wie ihn gefährden. Seine letzten Worte waren die mehrfach wiederholte Bitte, sich und ihre Tochter in Sicherheit zu bringen.
Das war das Letzte, was Yvonne von Jonathan gesehen und gehört hatte. Wo er verblieben war, in einem Gefängnis oder Lager, und ob er überhaupt noch am Leben war, wurde nie aufgeklärt. Weder seine Frau noch seine Eltern hörten je wieder etwas von ihm oder über ihn.
Jakub war wenige Tage später zurückgekommen und hatte seine Tätigkeit im Ingenieurbüro Friedhelm Walter wiederaufgenommen. Seinem Chef und den Kollegen erzählte er von einer heftigen Lebensmittelvergiftung, die es ihm unmöglich gemacht habe, in den letzten drei Tagen in der Firma anzurufen. Er konnte noch fünf Monate an den Raketenrelais arbeiten, bevor er trotz Kriegswichtigkeit in ein Arbeitslager bei Berlin verbracht wurde.
Yvonne hatte er nach seinem offensichtlich missglückten Fluchtversuch nur wenig über Jonathans Verbleib und Schicksal zu sagen. Sie hätten sich einen Kilometer vor der Grenze getrennt, da er, Jakub, von einer Grenzkontrolle aufgegriffen worden sei, während sich Jonathan in diesem Moment hinter einen Busch gehockt hatte, um eine Notdurft zu verrichten, und dadurch der Aufmerksamkeit der Grenzer und seiner Festnahme entgehen konnte. Ihn, Jakub, habe man zum Revier mitgenommen, ihn dort stundenlang befragt, sein Gepäck und seine Taschen durchsucht und ihn schließlich nach Berlin zurückgeschickt.
Er vermute, sagte er zu Yvonne, Jonathan sei unbemerkt über die Grenze gekommen, denn auf dem Revier der Grenzpolizei habe er nichts von einer Festnahme einer weiteren Person gehört.
Jonathans Eltern – seine Mutter Chana Schwarz war Augenärztin, der Vater Rubin Schwarz ein weltweit gerühmter Kenner der aramäischen Sprache sowie von dreizehn neuaramäischen Sprachen mit einem Lehrstuhl für Judaistik in London – beschlossen wenige Wochen nach der Ernennung von Adolf Hitler zum deutschen Reichskanzler, nicht mehr in ihre deutsche Heimat zurückzukehren. Sie hatten Jonathan, ihren einzigen Sohn, gebeten, nach seinem Physikstudium in Berlin und der erfolgreichen Promotion Deutschland zu verlassen und zu ihnen überzusiedeln. Sein Vater hatte für ihn bereits eine Stelle am IOP, der Physical Society of London, in Aussicht und eine hochdotierte Anstellung bei Vickers-Armstrongs Ltd. gefunden, dem wohl bedeutendsten britischen Maschinenbaukonzern, doch ihr Sohn lehnte ab. Jonathan hatte Yvonne kennengelernt und wollte daher in Berlin bleiben, zumal seine Arbeit im Ingenieurbüro vom Firmenchef Friedhelm Walter überaus geschätzt und sehr gut honoriert wurde und er selbst als kriegswichtiger Ingenieur vor jeglicher Verfolgung sicher war.
Ein Zusammenleben jedoch war für Yvonne und Jonathan schwierig und fast unmöglich. So blieben sie beide in ihren Wohnungen, Yvonne bei ihren Eltern, wo sie ein Zimmer für sich hatte, und Jonathan in einer winzigen Wohnung im vierten Stock in der Bismarckstraße.
In den folgenden fünf Monaten wurde Yvonne von einer Nachbarin zweimal denunziert, die auf der Polizeidienststelle des Stadtbezirks einen Fall von Rassenschande vermeldete. Die daraufhin erfolgenden Hausdurchsuchungen der Wohnung ihrer Eltern erbrachten jedoch keinen Nachweis für die Anzeige.
Bei der zweiten Durchsuchung war Yvonnes Vater in der Wohnung, ein leitender Ingenieur der Berliner Bergmann-Elektricitäts-Werke, der gegen den Polizeieinsatz heftig protestierte. Er erklärte den Beamten, dass der Kindsvater, ein Offizier des Luftgau-Kommandos, eine so schwerwiegende Beschuldigung, die in ihrer Ungeheuerlichkeit die gesamte deutsche Wehrmacht verunglimpfe, nicht schweigend hinnehmen werde. Das selbstbewusste und einschüchternde Auftreten des Ingenieurs und seine Drohung beunruhigten die beiden jungen Polizeibeamten. Sie brachen umgehend die Durchsuchung ab und verwarnten stattdessen die Nachbarin, jene ältere Frau, die Yvonne angezeigt hatte.
Eine Woche nach der Flucht von Jonathan verließ Yvonne mit dem Baby die Wohnung der Eltern. Ihr Vater hatte eine Parzelle in unmittelbarer Nähe der Gartenkolonie Eintracht Orania von einem Arbeitskollegen kaufen können, die Hälfte einer Streuobstwiese mit einem kleinen, einstöckigen Haus. Das Häuschen – ihr Palazzo, wie ihr Vater es nannte – hatte zwei Zimmer, eine winzige Küche und eine Toilette mit einem Badetrog und einem runden Ofen. Das Haus war an das Strom- und Wassernetz angeschlossen und daher uneingeschränkt bewohnbar. Da auf den Parzellen in der benachbarten Kleingartenanlage in Oranienburg nur einfache Holzhütten standen, in denen nicht übernachtet werden durfte, und die Pächter des Vereins Eintracht Orania im Spätherbst ihre Gartengrundstücke auch tagsüber nicht mehr aufsuchten – sie würden erst im Frühjahr zurückkehren –, war Yvonne zuversichtlich, dass sie in ihrer neuen Unterkunft im kommenden halben Jahr nicht bemerkt werden würde und sich vor allzu neugierigen und verleumderischen Nachbarn verbergen könne.
Sie hoffte noch immer, bald eine Nachricht von Jonathan zu erhalten, doch der Briefverkehr mit dem Ausland war erschwert und wurde genauestens überwacht. Beunruhigend für sie waren die Briefe ihrer Schwiegermutter in spe.
Ihr Schwiegervater, der berühmte Judaist, hatte sich nach einer Berufung an die Yale University in New Haven von seiner Frau scheiden lassen und war in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Sie selbst blieb in London und arbeitete weiterhin im ehemaligen Moorfields Eye Hospital, das heute Royal London Ophthalmic Hospital hieß, in dem sie und ihre Kollegen jedoch nur eingeschränkt praktizieren konnten, da das Gebäude bei der Bombardierung Londons teilweise zerstört worden war.
Jonathans Mutter hatte einen regen Briefverkehr mit der Mutter ihrer Enkeltochter. Sie hatte weder ihre Schwiegertochter noch die kleine Kathinka bisher sehen können und besaß lediglich Fotos von beiden. Ihre Briefe waren stets mehrere Wochen unterwegs, denn da Großbritannien mit Deutschland im Krieg war und sie zudem Yvonne und die Enkelin nicht in Verbindung mit einer exilierten Jüdin bringen wollte, schickte sie ihre Post über eine norwegische Freundin an Yvonne.
Chana Schwarz teilte der Lebensgefährtin ihres Sohnes mit, dass all ihre Bemühungen, in Palästina etwas über Jonathan zu erfahren, fruchtlos geblieben waren. Sowohl ihr geschiedener Mann wie auch Freunde von der Jewish Agency, der das Völkerbund-Mandat für die Vertretung der Juden in Palästina erteilt worden war, konnten nirgends eine Spur des jungen Mannes auffinden. Nach vier Monaten war Jonathans Mutter sich gewiss, dass ihr Sohn bei der Flucht aus Deutschland umgebracht oder in eins der deutschen Konzentrationslager verbracht worden sei. Sie war überzeugt, dass Jakub Silbergstein, jener Kollege ihres Sohnes, der mit ihm hatte fliehen wollen und nach dem misslungenen Versuch unbeschadet in das Ingenieurbüro Walter zurückkehren durfte, Jonathan verraten habe. Sie war sich sicher, dass er sich die freie Rückkehr erkauft habe, indem er ihren Sohn denunzierte hatte. Es gab nicht den geringsten Hinweis für diese Verdächtigung, zumal Silbergstein wenige Monate nach seiner Rückkehr in ein Arbeitslager verbracht wurde, aber es gelang der Mutter, auch Yvonne davon zu überzeugen, dass Jonathan von seinem Arbeitskollegen verraten worden war.
4.
Kampf um ein Kind
Nach Kriegsende wurde Jonathan Schwarz auf Betreiben seiner Mutter für tot erklärt, was Yvonne missbilligte und empörte, da sie weiterhin hoffte, ihr Lebensgefährte und Vater ihrer Tochter sei noch am Leben und würde eines Tages bei ihr und Kathinka auftauchen.
Im Dezember neunzehnhundertfünfundvierzig reiste Jonathans Mutter erstmals wieder nach Berlin, um ihr Enkelkind und dessen Mutter kennenzulernen.
Die Begegnungen der beiden Frauen endeten eine Woche nach ihrer Ankunft in der bombardierten Stadt mit Beschimpfungen und Beleidigungen. Yvonne hatte die Großmutter ihrer Tochter herzlich empfangen, die ihrerseits Jonathans Freundin sehr aufmerksam und etwas misstrauisch betrachtete. Sie widmete sich dann ganz dem kleinen Mädchen, dass seine Großmutter mit großen Augen und ebenso großer Zurückhaltung ansah. Das Streicheln und die ständigen Umarmungen der alten Frau, dazu ihre wiederholte Aufforderung, sie als Oma anzureden, waren dem Kind unangenehm.
Am zweiten Tag ihres Besuches unterbreitete Jonathans Mutter Yvonne den Vorschlag, die kleine Kathinka zu sich nach London zu holen. Sie habe dort eine große Wohnung mit vier Zimmern und einem Bad und könne die Kleine bestens versorgen. Sie würde auch eine Nanny für das Kind bezahlen, eine Kinderfrau, die das Mädchen betreuen würde, wenn sie selbst im Krankenhaus zu arbeiten hatte. Yvonne habe nur eine Ein-Zimmer-Wohnung, eine Situation, die sich in dem schwer bombardierten Berlin auf Jahre nicht ändern würde, zudem sie als einfache Bürohilfskraft in der Stadtverwaltung Mühe haben werde, allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Yvonne war empört und wies diese Idee als unverschämt und bösartig zurück, doch Jonathans Mutter sprach nun bei jedem weiteren Besuch über ihren Wunsch, die Enkelin mit sich zu nehmen. Sie sagte, Kathinka sei das Einzige, was sie noch von ihrem Sohn auf der Welt habe, während Yvonne jung genug sei, um sich noch mehrere Kinder anzuschaffen. Die beiden Frauen beschimpften sich so heftig, dass das kleine Mädchen in Tränen ausbrach und sich vor der Großmutter fürchtete und nicht mehr von ihr berühren ließ.
Nach einem weiteren Besuch von Jonathans Mutter brachte Yvonne ihre Tochter zu einer Freundin, die ein gleichaltriges Kind hatte. Der Großmutter gegenüber erklärte sie, ihre Tochter sei von einem Kinderhilfswerk zu einem Erholungsurlaub in ein Heim in den Alpen eingeladen worden, was schon vor Monaten vereinbart worden sei.
Yvonne hatte Angst vor einer Entführung, wusste sie doch nicht, wie sie sich gegen die beruflich erfolgreiche Großmutter durchsetzen könne, auch war ihr die rechtliche Situation unklar. Ihre Stadt war in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden, doch die drei westlichen Siegermächte einerseits und die Sowjetunion andererseits, einst vereint im Kampf gegen das Dritte Reich, beschuldigten sich inzwischen gegenseitig schwerer Verstöße gegen das Völkerrecht und sprachen von Menschenrechtsverletzungen auf der jeweils anderen Seite.
Da Yvonne im sowjetisch besetzten Teil Berlins lebte, befürchtete sie, dass – falls ihre Tochter nach London oder gar nach Palästina entführt werden würde – Großbritannien eine Rückführung ihrer Tochter verhindern würde. Sie ließ deshalb Kathinka nicht mehr allein hinausgehen und begleitete sie auch zum Spielplatz, zumal ihrer Tochter dort Wochen zuvor ein neu gekaufter roter Wintermantel gestohlen worden war.
An jenem Tag hatte sie die Tochter zum Spielplatz gebracht und ihr eingeschärft, keinesfalls den Platz zu verlassen. Sie würde nur rasch etwas einkaufen und sie dann abholen. Als sie nach einer halben Stunde zu Kathinka zurückkehrte, saß ihre Tochter heulend und ohne den neuen Mantel auf der Umrandung des Sandkastens. Yvonne verstand nur so viel: Eine Frau hatte Kathinka den Mantel weggenommen und war damit weggelaufen.
»Hat das denn keiner gesehen?«
»Doch. Alle haben es gesehen, aber keiner hat mir geholfen.«
»Diese Schweine. Diese verfluchten Nazischweine«, schrie ihre Mutter auf, »der Mantel war teuer genug. Wovon soll ich dir denn einen neuen kaufen? Ich werde den alten ausbessern, anders geht es nicht.«
In den wenigen Besuchstagen verzankten sich Yvonne und Jonathans Mutter so grundsätzlich, dass beide keinen einzigen Versuch mehr machten, sich zu versöhnen oder wiederzusehen. Yvonne bemühte sich vielmehr, nach der Abreise ihrer Schwiegermutter eine neue Unterkunft zu finden, ihre Wohnung zu tauschen, um in einem anderen Stadtbezirk zu leben mit einer Adresse, die Jonathans Mutter nicht kannte, um damit einen erneuten Besuch der verhassten Frau auszuschließen.
5.
Ein unlustiger Mann
Yvonne hatte zwei Jahre nach dem Krieg den aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Johannes Goretzka kennengelernt, einen Krüppel, dessen rechtes Bein durch Wundbrand zerstört und der als Fahnenjunker-Feldwebel zwei Jahre vor Kriegsende in das Lager Workuta im Norden der Autonomen Sowjetrepublik der Komi verbracht worden war.
Da er sich durch seine Beinverletzung für die erforderlichen Schachtarbeiten als untauglich erwies, wurde er bereits nach vier Monaten in ein Sammellager für deutsche Kriegskrüppel überstellt. In diesem Lager fiel er deutschen Emigranten auf, die der russischen Lagerleitung bei der Registrierung und den Verhören behilflich waren. Anders als fast alle anderen Kriegsgefangenen las Johannes die Schriften des Nationalkomitees Freies Deutschland interessiert und kam zu allen Vorträgen der kommunistischen deutschen Emigranten, in welchen diese Deutschen ihre Vorstellungen von dem neuen, dem ganz anderen Deutschland den Internierten vortrugen. Da der junge Mann sich für Stalin begeisterte, entschieden die kommunistischen deutschen Funktionäre, ihn in die Zentrale des deutschen Nationalkomitees zu schicken, das in einem Erholungsheim der Eisenbahnergewerkschaft in Lunjowo residierte. Ein bekannter Journalist, Rudolf Herrnstadt, der etwas jünger war, aber bereits eine leitende Position in der politischen Führung der Roten Armee innehatte, unterrichtete ihn dort und erreichte, dass aus dem glühenden Anhänger der Nationalsozialisten in wenigen Monaten ein begeisterter Bewunderer Stalins wurde, der zudem seine neugewonnene Überzeugung so offen und leidenschaftlich vertrat, dass Arthur Pieck, ein Deutscher und Hauptmann der Roten Armee sowie Leiter des Nationalkomitees, ihn zu seinem persönlichen Sekretär ernannte.
Nach dem überraschend erfolgreichen Großangriff der Fünften Stoßarmee, die unter Generaloberst Nikolai Bersarin im Kampf um Berlin die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges siegreich beendete, wurde Bersarin der erste Berliner Stadtkommandant. Bereits am fünften Mai wurde Arthur Pieck nach Berlin eingeflogen, um dem Stadtkommandanten als Dolmetscher und Berater beizustehen. Pieck bestand vor dem Abflug darauf, dass ihn sein Sekretär Johannes Goretzka begleitete, der auf einem Moskauer Bauernmarkt einen Krückstock erstanden hatte, der kunstvoll aus dem Ast einer Mooreiche geschnitzt war und einen so stabilen Eindruck machte, dass er notfalls auch als schlagkräftiger Knüppel geeignet schien.
Arthur Pieck und sein Sekretär Goretzka arbeiteten sechs Wochen als Helfer von Bersarin, bis der Generaloberst Mitte Juni bei einem Zusammenstoß mit einem LKW-Konvoi auf seinem Motorrad tödlich verunglückte und der daraufhin ernannte neue Stadtkommandant, General Alexander Gorbatow, seinen eigenen Assistenten und Dolmetscher ins Amt mitbrachte. Pieck wurde in den neu gegründeten Magistrat von Groß-Berlin versetzt, und er sorgte dafür, dass Johannes Goretzka für drei Monate in das sowjetische Zentrallazarett Beelitz kam, damit sein vom Wundbrand befallenes Bein von einem Spezialisten behandelt und die provisorische Prothese, die ihm noch während des Krieges in dem Sammellager für deutsche Kriegskrüppel angepasst worden war, durch ein orthopädisch korrektes Teil ausgewechselt werden würde. Anschließend delegierte ihn die Parteileitung zu einem eineinhalbjährigen Studium der marxistisch-leninistischen Wirtschaftswissenschaften.
Johannes Goretzka, der noch in der Sowjetunion Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands geworden war, ließ sich ein Jahr nach Kriegsende das Mitgliedsbuch der neu gegründete Einheitspartei geben, der SED. Ende neunzehnhundertsechsundvierzig wurde er Abteilungsleiter in dem in Gründung befindlichen Ministerium für Schwermaschinenbau. Noch nicht Mitte vierzig und versehen mit dem in Aachen erworbenen Titel Dr. Ing. für Hüttenwesen und Erzbergbau sowie dem Diplom eines verkürzten Zusatzstudiums der sogenannten Wirtschaftswissenschaften ML, hatte er nun Menschen anzuleiten, die bestens ausgebildet und erfahren waren und bereits seit Jahren und Jahrzehnten als Ökonomen gearbeitet hatten. Er lernte rasch, fehlende Fachkenntnisse durch einen Hinweis auf seine leitende Funktion auszugleichen oder durch einen Verweis auf seine Mitgliedschaft in der Einheitspartei.
Im Mai neunzehnhundertsiebenundvierzig lernte er Yvonne Lebinski kennen. Am dritten Sonntag des Monats, einem sonnigen, fast sommerlichen Tag, war Yvonne mit der dreijährigen Kathinka zum Müggelsee gefahren, um zu baden und mit ihr durch das kleine Wäldchen zu dem Ausflugslokal zu wandern. Als sie in der überfüllten Gaststätte Fassbrause für sich und das Mädchen bestellen wollte und nach freien Plätzen suchte, waren lediglich an einem Tisch, an dem ein einzelner Mann saß, noch zwei Klappstühle frei. Yvonne fragte, ob es erlaubt sei, Platz zu nehmen. Der Mann nickte freundlich und las weiter in einer Broschüre. Doch bald erheiterten ihn die spaßig altklugen Bemerkungen des kleinen Mädchens so sehr, dass er seine Broschüre zuklappte und mit dem Kind ein Gespräch begann. Er stellte sich dann sehr förmlich der Mutter der Kleinen vor, wobei er aufstand, aus seiner Brieftasche eine Visitenkarte entnahm und diese Yvonne überreichte.
Auf der goldumrandeten Karte stand unter seinem Namen Johannes Goretzka die private Adresse und die eines Ministeriums, was Yvonne überraschte. Mehr aber als der pompöse Titel beeindruckte sie, dass dieser Mann überhaupt Visitenkarten besaß und verteilte. Das hatte sie seit Kriegsbeginn nicht mehr erlebt und es schien ihr wie ein Zeichen aus einer anderen, einer versunkenen Welt. Einer unwiederbringlichen Welt. Einer Welt von gestern.
Der Mann erkundigte sich, ob er sie und ihre Tochter zu einem Mittagessen einladen dürfe. Als sie zögernd nickte, fragte er, wann sie am kommenden Samstag Arbeitsschluss habe, und verabredete sich mit ihr für diesen Tag um dreizehn Uhr. Er ließ sich seine Visitenkarte noch einmal von ihr geben und schrieb ihr die Adresse der Gaststätte auf, ein, wie er sich ausdrückte, sehr gutes Lokal in der Johannisstraße.
»Und du kommst auch mit, nicht wahr?«, sagte er zu dem kleinen Mädchen, als er aufstand und sich mit einer Verbeugung verabschiedete.
Am Sonnabend beendete Yvonne auf die Sekunde genau ihre Arbeit, holte ihre Tochter ab, die den Vormittag bei ihren Eltern verbracht hatte, und war pünktlich um ein Uhr Mittag an der angegebenen Adresse. Allerdings sah sie dort keine Gaststätte und nichts, was auf ein Lokal hinwies. Sie zog die Visitenkarte heraus, um noch einmal den Straßennamen und die Hausnummer zu vergleichen, und da sie genau vor dem angegebenen Haus stand, war sie ratlos und verwirrt. Sie öffnete die schwere Eingangstür zu dem vierstöckigen Haus und stand vor einer Pförtnerloge, in der ein älterer Mann saß, der sie fragend ansah. Yvonne sagte, dass sie eine Gaststätte suche, die sich genau hier in diesem Haus befinden solle.
Der Pförtner schüttelte den Kopf. »Nee, nee, junge Frau, da irren Sie sich. Hier gibt es keine Gaststätte. Oder haben Sie an dem Haus irgendein Schild für ein Lokal gesehen?«
»Entschuldigen Sie bitte. Dann wurde ich falsch informiert«, sagte sie verwirrt, griff nach der Hand ihrer Tochter und verließ das Haus.
»Nun weiß ich auch nicht weiter. Dieser Herr hat sich wohl einen Scherz mit uns beiden Dummerchens erlaubt«, sagte sie vor der Tür zu ihrer Tochter, »dann gehen wir mal nach Hause, damit ich uns was Feines koche.«
Schon den ganzen Tag war der Himmel über Berlin mit einem gleichmäßigen Grau überzogen, das sich zum Mittag hin verdüsterte. In dem Moment, als sie auf die Straße traten, begann es plötzlich so heftig zu regnen, dass sie ihre Tochter zurückzog und unter dem Türbogen stehen blieb, um den Schauer abzuwarten. Sekunden später hielt ein Auto vor dem Haus, Johannes Goretzka stieg aus, eilte auf sie zu und entschuldigte sich, dass er sich um zehn Minuten verspätet habe.
»In buchstäblich letzter Sekunde kamen noch zwei Telegramme an, die rasch beantwortet werden mussten. Doch nun wollen wir essen gehen. Und ich hoffe, Kathinka, du hast einen großen Hunger mitgebracht.«
»Aber hier ist keine Gaststätte. Der Pförtner hat mir gesagt …«
»Ach was. Kommen Sie.«
Er öffnete die Tür, ließ die beiden eintreten und ging vor ihnen an der Pförtnerloge vorbei, wobei er eine kleine Klappkarte aus der Tasche zog und sie kurz vorwies. Der Pförtner nickte grüßend.
Goretzka bat seine Gäste, ihm zu folgen. Er ging in den linken Flur und öffnete die letzte Tür und bat sie lächelnd und mit einer einladenden Handbewegung einzutreten.
Nun waren sie tatsächlich in einer Gaststätte. Es war ein großer Raum mit mehreren Tischen. Ein Durchgang führte zu einem weiteren Gastraum. Alle Tische waren weiß eingedeckt, mit Servietten, Besteck sowie Wasser- und Weingläsern. An fast allen Tischen saß nur eine Person, und nur an einem einzigen der Vierertische saßen drei Männer. An keinem der Tische saß eine Frau.
Ein Kellner kam sofort auf sie zu, begrüßte sie und führte sie dann zu einem Tisch, der offenbar für sie reserviert war. Er rückte ihnen die Stühle zurecht und fragte, ob er für das kleine Mädchen einen Kinderstuhl holen solle oder ein Sitzkissen. Dann nahm er die auf dem Tisch ausliegenden Speisekarten in die Hand, öffnete sie und überreichte sie ihnen.
»Was ist das für eine seltsame Gaststätte, Herr Goretzka? Etwas geheimnisvoll.«
»Nein, nein, kein Geheimnis. Es ist gewissermaßen eine Kantine der Ministerien. Zugegeben, eine Edelkantine, daher musste ich beizeiten vorbestellen.«
»Eine Kantine? Für alle Mitarbeiter der Ministerien?«
»Nun, nicht für alle. Diese beiden Räume wären dafür viel zu klein. Sagen wir, für die leitenden Funktionäre. Ab Staatssekretär aufwärts. Eine Ministerkantine sozusagen. – So, und nun wählen Sie bitte etwas. Für sich selbst und die Kleine.«
Auf der Speisekarte waren nur wenige Gerichte aufgeführt, zwei Suppen, drei Hauptgerichte und zwei Desserts. Yvonne war überrascht, wie preiswert alles war, so billig hatte sie noch nie in einer Gaststätte essen können. Sie wählte für sich eine Roulade, für Kathinka bestellte sie den Nudel-Teller, bat aber, ihrer Tochter eine fleischlose Soße statt des Gulaschs zu servieren.
»Und zu trinken?«, fragte Johannes Goretzka, »trinken Sie mit mir ein Glas Wein? Für Kathinka bestelle ich eine Brause. Einverstanden?«
»Ja, bitte. Aber nur ein Glas Wein.«
Sie mussten nicht lange auf das Essen warten, und der Kellner servierte ihnen die Teller und den Wein fast ehrerbietig.
Johannes Goretzka war bemüht, Yvonne zu unterhalten, und erzählte ihr von seiner Arbeit als Abteilungsleiter in dem staatlichen Komitee für Schwermaschinenbau, das in ein oder zwei Jahren zum Ministerium für Schwermaschinenbau in der Sowjetischen Besatzungszone hochgestuft werden sollte und in dem er dann wohl zum Staatssekretär ernannt werden würde. Mit besorgter Miene schilderte er ihr, mit welch brutalen und menschenverachtenden Anschlägen die Aufbauarbeit ihres Komitees von Agenten und Saboteuren behindert werde.
»Es ist ein neuer Krieg, Frau Yvonne, der da kommt, ein Krieg zwischen Ost und West«, sagte er eindringlich, »und wieder ein Krieg auf Gedeih und Verderben.«
Yvonne hörte ihm schweigend zu, sie konnte zu alldem nichts sagen. In ihrem Büro sprach man nie von der Politik, und weder sie noch eine der Sekretärinnen las eine Zeitung. Die Gesprächsthemen waren die Informationen über Geschäfte mit Sonderlieferungen, über Ladenbesitzer, die ein offenes Ohr für bedürftige junge Frauen hatten, und Adressen von Bauern der umliegenden Dörfer, die für Schmuckstücke und wertvolle Kleidung bereit waren, Mehl oder gar Fleisch abzugeben.
Ab und zu wandte sich Goretzka an Kathinka, versuchte sie mit einem Kindervers zu erheitern und zeigte ihr kleine Kunststücke, die ihm mit seiner Streichholzschachtel mit wechselndem Erfolg gelangen. Das kleine Mädchen schaute seinen Bemühungen interessiert zu, sah ihm immer wieder ins Gesicht, reagierte aber mit keiner Bemerkung, lächelte nicht und verzog keine Miene.
Nachdem sie gegessen hatten, bestellte Goretzka für die beiden den angebotenen Vanillepudding mit Früchten und bat um Entschuldigung, er müsse sich für fünf Minuten an einen anderen Tisch setzen. Er stand auf, grüßte einige der Gäste kurz, um sich dann an einen Tisch zu setzen, an dem ein älterer Mann saß, um mit ihm etwas zu besprechen.
Yvonne fragte ihre Tochter, wie ihr der Onkel gefalle.
»Er ist so streng«, sagte das kleine Mädchen, »auch wenn er lacht, ist er nicht lustig.«
»Es ist halt ein ernsthafter Mensch«, sagte ihre Mutter, »in einem so wichtigen Beruf, wie er ihn hat, darf man nicht herumalbern.«
Als Goretzka an den Tisch zurückkam, entschuldigte er sich nochmals für die Unterbrechung.
»Diese Gaststätte ist für uns wie ein zweites Büro, Frau Yvonne. Das ist auch der entscheidende Grund, warum hier nicht jedermann bewirtet werden kann. Hier hat man die Gelegenheit, Personen zu treffen, die ansonsten schwer erreichbar sind. Und wenn ich einen sehe, den ich unbedingt sprechen muss, kann ich mir die Chance nicht entgehen lassen. – Noch einen Kaffee?«
»Sehr gern.«
»Und du, Kathinka, was willst du noch zum Abschluss?«
»Danke«, sagte das Kind, »ich brauche nichts.«
Goretzka bezahlte und verließ mit ihnen die Gaststätte. Im Türbogen stehend, wedelte er mit der Hand in der Luft, und umgehend kam sein Auto herangefahren. Der Chauffeur stieg aus und öffnete die hinteren Türen des Wagens, damit sie einsteigen konnten.
»Wohin darf ich Sie bringen?«
»Ich wohne in der Ackerstraße, das ist nur zwei Straßen weiter. Wir könnten auch laufen.«
»Aber nicht bei diesem Wetter. Nein, nein. Machen Sie mir das Vergnügen, Sie dort hinzufahren.«
»Hat Ihr Chauffeur die ganze Zeit vor dem Haus auf uns gewartet?«
»Selbstverständlich. Das ist schließlich sein Beruf. Das muss sein, damit nichts von unserer kostbaren Arbeitszeit verloren geht. Stellen Sie sich vor, wir müssten jeden Tag zwei, drei Stunden durch die Stadt irren!«
Das Auto hielt vor der angegebenen Hausnummer in der Ackerstraße. Goretzka stieg mit ihnen aus und verabschiedete sich von Yvonne mit einem Handkuss.
»Ich darf mich in der nächsten Woche bei Ihnen melden?«
»Gern. Ich bin ab sechs Uhr abends eigentlich immer zu Hause. Hier, im zweiten Stock.«
»Schön. Ich melde mich. – Auf Wiedersehen, Kathinka, Wenn wir uns das nächste Mal sehen, will ich dir etwas mitbringen. Hast du einen Wunsch?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Nichts? Wirklich gar nichts?«
Da das Mädchen nichts sagte, meinte er, da müsse er sich wohl etwas einfallen lassen. Er wartete, bis die beiden ins Haus gegangen waren, und stieg in das Auto.
Am folgenden Dienstag klingelte er kurz nach achtzehn Uhr an ihrer Wohnungstür. Sie hatten sich für einen Kinobesuch verabredet, ihre Tochter war bereits bei Yvonnes Eltern, wo sie auch übernachten sollte.
Sie schauten sich den Film Der Schwur an, in dem Lenins Nachfolger Stalin, ein gottähnlicher und gütiger Mann, die Bauern mahnte, immer Lenins Regeln zu folgen, und nebenbei den Kolchos-Bauern auch fachgerecht dabei half, einen Traktor mit wenigen Handgriffen zu reparieren. Wann immer er auf der Leinwand zu sehen war, leuchteten seine Augen liebevoll, und mit väterlichem Wohlwollen plauderte er mit den Arbeitern und Bauern, leutselig ging er auf alle Menschen zu, sprach zu ihnen mit einem versteckten, tiefsinnigen Humor, kannte die Aufgaben, die die Zukunft seinem Land stellte, und arbeitete tatkräftig und kenntnisreich wie ein gelernter Mechaniker an der Errichtung eines Traktorenwerkes mit.
Nach dem Kinobesuch gingen sie in eine Gaststätte, um noch ein Glas Wein zu trinken. Goretzka war von dem Film sehr begeistert und meinte, Stalin sei einer der großartigsten Menschen.
»Ein Genie! Dieser Mann hat uns von Hitler befreit, hat Deutschland und Europa vor den Faschisten gerettet«, sagte er zu Yvonne, die ihm schweigend zuhörte. Der Film hatte sie wenig beeindruckt, vielmehr von Anfang bis Ende gelangweilt, was sie aber für sich behielt.
Beim letzten Schluck Wein bot er ihr das Du an, was sie überraschte und befremdete, dennoch nickte sie, da es ihr unhöflich erschien, bei all dem, was er bisher für sie getan hatte, das Angebot auszuschlagen.
Wenige Monate später, im Februar, sprach er zum ersten Mal davon, dass sie doch heiraten könnten. Yvonne war nicht überrascht, trafen sie sich doch jede Woche mehrmals und hatten auch miteinander geschlafen, was anfangs für sie etwas schwierig war, da sie auf sein kaputtes Bein Rücksicht nehmen musste.
Sie hatte mit seiner Frage gerechnet und bereits entschieden, einen solchen Antrag anzunehmen. Von Jonathan hatte sie mehr als drei Jahre nichts gehört und war nun, wie seine Mutter, auch davon überzeugt, dass er nicht mehr am Leben sei.
Johannes Goretzka war für sie nicht der Mann, von dem sie träumte, seine Behinderung störte sie nicht, aber dass er so humorlos war – so unlustig, wie es ihre kleine Tochter nannte –, dass er eigentlich nie unbeschwert und heiter war, sie stets über die Wichtigkeit seiner Arbeit belehrte und von der Sowjetunion redete, als sei sie das gelobte Land und Stalin der Statthalter Gottes auf Erden, irritierte sie. Ihre Freundinnen und Arbeitskolleginnen waren von der Sowjetzone und den sowjetischen Besatzungssoldaten – den Russen, wie sie sich ausdrückten – weniger begeistert und misstrauten den täglichen Lobeshymnen auf die Errungenschaften der ostdeutschen Zone. Yvonne vermied es, mit Goretzka darüber zu sprechen, sie hörte seinen Ausführungen schweigend oder kopfnickend zu, sie war politisch nicht so gebildet und so beredt wie er, in jedem Streitgespräch wäre sie ihm unterlegen gewesen.
Doch bei aller Skepsis, mit ihm zusammenzuleben, wäre er eine große Hilfe für sie. Als Bürohilfskraft verdiente sie wenig, ohne die Hilfe der Eltern hätte sie auf vieles verzichten müssen und ihrer Tochter nicht die Kleidung und Schuhe kaufen können, die diese sich wünschte. Zudem wohnte Goretzka nicht so beengt wie sie, sondern in einer schönen Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Dienstmädchenkammer, die ein geeignetes Kinderzimmer für Kathinka sein könnte.
Sie entschied für sich, zuzustimmen, falls er um ihre Hand anhalten würde. Ihren geliebten Jonathan würde sie auf dieser Erde nie wiedersehen, und ob noch einmal jemand sie umwerben würde, eine junge Frau mit einem Kind, war so aussichtsreich wie ein Lottogewinn, denn zu viele Männer ihrer Generation waren im Krieg geblieben, steckten für Jahre in der Kriegsgefangenschaft oder waren als hilflose, arbeitsunfähige Krüppel heimgekehrt. Viele ihrer Freundinnen und Kolleginnen lebten allein und hatten weder einen Mann noch einen Freund.
Daher lächelte sie, als Johannes Goretzka sie bat, ihn zu heiraten, und meinte lediglich, sie müsse zuvor noch ihre Tochter fragen, da dieser Schritt schließlich auch für ihre Kleine eine große Umstellung bedeute.
Am nächsten Tag setzte sie sich mit Kathinka auf ihr Sofa und erzählte ihr, dass der Onkel Johannes sie heiraten wolle.
»Du bekommst dann einen Papa, was du dir doch immer gewünscht hast«, sagte sie, »und wir würden in seine Wohnung einziehen, die viel schöner und größer ist als unsere. Dort hättest du ein eigenes Zimmer, ein Zimmer nur für dich.«
»Onkel Johannes soll mein Papa werden?«
»Dein Stiefvater, ja. Es würde sich ja kaum etwas ändern, da wir ja ohnehin mit ihm viel zusammen sind, fast jeden Tag.«
»Aber…«, sagte das Mädchen, brachte jedoch kein weiteres Wort heraus und verstummte.
»Was ist denn? Was hast du? Es wird dir an nichts fehlen, ganz im Gegenteil. Wir sind dann eine richtige Familie mit Mama, Papa und Kind. Und wir sind versorgt, wir müssen nicht mehr jeden Pfennig dreimal umdrehen.«
»Es ist auch schön nur mit uns beiden, Mama.«
»Ich weiß. Aber dein Vater lebt nicht mehr, und ich denke, wir beide brauchen einen Mann im Haus.«
»Aber warum Onkel Johannes?«
»Ja, wer denn sonst? Oder hast du jemanden, der dir lieber wäre? Backen können wir uns leider keinen Papa.«
6.
Eine Versorgungsehe
Die Hochzeit wurde für den Januar geplant, es sollte nur eine kleine Feier werden mit wenigen Gästen, Yvonnes Eltern, drei ihrer Freundinnen, zwei Freunde oder Kollegen von Goretzka und ein Mädchen aus der Nachbarschaft, eine gleichaltrige Freundin von Kathinka. Seine alten Eltern einzuladen, von denen sie nicht einmal wusste, wo sie lebten, lehnte Goretzka ab, er wollte ihnen nicht einmal mitteilen, dass er heiraten werde. Das Zerwürfnis mit ihnen, begriff Yvonne, war offenbar unheilbar, wenn sie auch nicht die Gründe dafür kannte und er es wiederholt abgelehnt hatte, mit ihr darüber zu sprechen.
Kathinka sollte ihn schon vor der Hochzeit nicht mehr mit Onkel anreden, er verlangte, dass sie Papa oder Vati zu ihm sage, da sie ja bald seinen Namen bekommen werde, und da auch ihre Mutter darum bat, fügte sich das Kind widerstrebend.
Da sie heiraten würde, stellte Yvonne ihren Bräutigam den Eltern und ihren Freundinnen vor.
Ihr Vater, Heinrich Lebinski, war einst bei den Bergmann-Elektricitäts-Werken als leitender Ingenieur verantwortlich für Entwurf und Konstruktion von Turbinen kleinerer Leistung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das zerstörte Wilhelmsruher Werk von der Sowjetischen Militäradministration beschlagnahmt, die den Wiederaufbau der Industrieansiedlung anordnete. Yvonnes Vater wurde mit anderen früheren Bergmann-Arbeitern eingestellt, um so bald wie möglich Waren des täglichen Bedarfs anzufertigen und die Bevölkerung mit Kochtöpfen, Herdplatten und Handkarren zu versorgen. Noch als Lehrling war Heinrich Lebinski Mitglied der sozialdemokratischen Partei geworden, hatte aber nach dem Krieg seine Mitgliedschaft nicht mehr erneuert, er wollte mit Politik nie mehr etwas zu schaffen haben.
Er war ein Sozialdemokrat, der die Vereinigung mit den Kommunisten äußerst erregt kritisiert hatte und der es deshalb abgelehnt hatte, das Mitgliedsbuch der neuen Einheitspartei anzunehmen. Im Elternhaus war Yvonne den atheistischen Überzeugungen des Vaters gefolgt, doch als sie Jonathan Schwarz kennenlernte, hatte sie sich mit der jüdischen Religion vertraut gemacht. Sie hatte sich von dem Freund die Glaubenssätze und Rituale dieser Religion erklären lassen, und sie war bereit, zu konvertieren, um ihren Jonathan, sobald dies möglich sein sollte, in Deutschland oder einem Land zu ehelichen, in dem auch die Existenz und das Leben eines Jonathan Schwarz akzeptiert wurde, wo sie ihn unter einer Chuppa, dem Hochzeitsbaldachin, zum Ehemann nehmen durfte.
Nachdem Jonathan Schwarz verschollen war, man nichts mehr von ihm hörte und annehmen musste, er sei umgebracht worden, hatte sie dann Jahre später Johannes Goretzka kennengelernt. Seine politischen Überzeugungen waren ihr fremd, doch im Unterschied zu ihren damaligen Freundinnen – für die dessen linientreue Ansichten und seine auch im engsten Kreis immer wieder geäußerte Bewunderung für den Stählernen, den genialen Generalissimus der Sowjetunion, lächerlich waren und die sich entsetzt zeigten, dass Yvonne sich mit diesem Kriegskrüppel einließ – hatte Yvonne keinerlei Mühe, nun den Ansichten ihres neuen Lebensgefährten zu folgen. Doch bröckelten die Beziehungen zu ihren bisherigen Freundinnen, man sah sich seltener, hatte sich wenig zu sagen und trennte sich gelegentlich sogar im Streit.
Die Ehe mit Johannes Goretzka betrachtete sie nüchtern und rational, es war eine von ihr wohldurchdachte, zweckmäßige und vernünftige Entscheidung. Sie hatte ihn nicht aus Liebe geheiratet, gestand sie sich ein, sondern aus rein ökonomischen Gründen. Es war in der schwierigen Nachkriegszeit notwendig, einen erfolgreichen Mann zu haben, der sie und die kleine Kathinka versorgen konnte. Seines offenen Beines wegen suchte er sie selten in ihrem Schlafzimmer auf, und bereits drei Jahre nach der Hochzeit schwand sein sexuelles Begehren vollkommen, was ihr recht war. Ihr Ehemann war kein warmherziger Partner, auch mangelte es ihm an Herzensgüte, an einer aufgeschlossenen Zuneigung und vor allem an Humor, er war, wie Kathinka gesagt hatte, unlustig. Er war überdies nicht fähig, über Sex und körperliches Verlangen mit Yvonne zu sprechen. Wie ein verklemmter Pennäler, dachte sie bei sich, und hatte sich darauf eingerichtet, mit ihm wie mit einem Bruder zu leben, wenn auch bei ihr die sexuelle Lust keineswegs geschwunden war und sie ihren Ehemann seiner Impotenz oder seines sexuellen Desinteresses wegen insgeheim verachtete.
Lieselotte Lebinski, ihre Mutter, war Köchin gewesen und hatte fünfundzwanzig Jahre in einer städtischen Garküche gearbeitet, bevor sie als Kochmamsell und Hausdame in der Dahlemer Villa eines Bauunternehmers angestellt wurde, wo sie als Hauswirtschafterin geschätzt wurde.
Die Eltern empfingen den künftigen Ehemann wohlwollend, sie waren erleichtert, dass ihre Tochter nun einen Partner gefunden hatte, wenn auch dieser Johannes Goretzka nicht das geistige Format und die herzlichen Umgangsformen eines Jonathan Schwarz hatte, wie sie sich eingestanden. In den Gesprächen mit ihm missfiel ihnen sein besserwisserisches Gehabe und die befremdliche Art, in der er seine politischen Ansichten verkündete, sein selbstgerechtes Auftreten, der Oberlehrer-Ton.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: