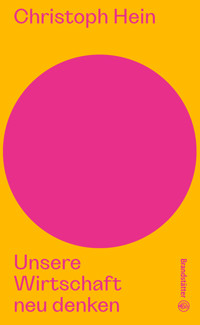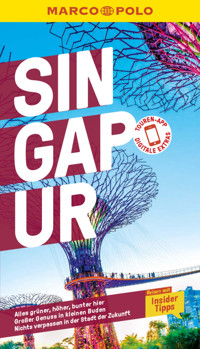11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas war damals noch fast ein Kind, aber an die Ereignisse im verschlafenen Bad Guldenberg, während des Sommers 1957, erinnert er sich genau. Aber auch andere erinnern sich: Bürgermeister Kruschkatz, Dr. Spodeck, der alteingesessene Arzt, und die sanfte Krämersfrau Gertrude Fischlinger. Und da ist auch Marlene, die nur durch den Opfertod ihrer Mutter den faschistischen Terror überlebt hat. Sie alle tragen ihren Teil bei zur Erinnerung an jenen Sommer, als eine Untersuchungskommission vom Bezirk kam und Horn sich das Leben nahm.
»Ein meisterhafter Roman«, urteilte Hans Ulrich Probst in seiner Laudatio zum Solothurner Literaturpreis 2000, »den ich für eines der wichtigsten Bücher aus 40 Jahren DDR-Literatur überhaupt halte.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christoph Hein
Horns Ende
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 3479.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2003
Erstveröffentlichung 1985, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlagfoto: Sven Paustian
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-78012-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
1. Kapitel
Erinnere dich.
Ich versuche es.
Du mußt dich erinnern.
Es ist lange her. Jahre sind vergangen.
Du kannst es nicht vergessen haben. Es war gestern.
Ich war so jung.
Du hast es gesehen. Alles hast du gesehen.
Ich war ein Kind.
Es war gestern.
Nein, es sind Jahre vergangen. Sehen Sie mich an, ich habe graue Haare.
Sieh mich an. Nur ein Tag ist vergangen. Du mußt dich erinnern.
Sie haben in der Burg gearbeitet . . .
Jaja, in der Burg. Und weiter?
Mein Vater verbot mir, auf die Burg zu gehen. Damals, als es vorbei war.
Weiter! Erinnere dich!
Dr. Spodeck
In jenem Jahr waren die Zigeuner spät gekommen. Ostern war vergangen und der April, und alle hofften schon, sie hätten sich eine andere Stadt ausgesucht. Aber Ende Mai, an einem Donnerstag, standen ihre Wohnwagen wieder auf der Bleicherwiese, mitten in der Stadt. Und auf der Leine, die zwischen den Linden gezogen war, flatterten die langen, schmuddligen Wäschestücke der Zigeuner.
Am Nachmittag erschien der Bürgermeister bei ihnen. Er kam mit Bachofen, seinem Stellvertreter, und einer Sekretärin. Um diese Zeit standen bereits die Schulkinder bei den Zigeunern. Zwei Stunden früher, und der Bürgermeister hätte seinen lächerlichen Auftritt in aller Stille hinter sich bringen können. Aber er war so verblödet, daß ihn diese armseligen Zigeunerweiber vor den Augen der Kinder wie ein nasses Handtuch auswringen und vom Platz schicken konnten. Ich hätte erwartet, daß der alte Zigeuner ihn mit der Hundepeitsche davonjagt. Jedenfalls hätte ich das an seiner Stelle getan. Aber der Alte ließ sich offenbar nicht einmal blicken. Er überließ die Stadtvertretung seinen Weibern, und nicht mit der Nasenspitze kümmerte er sich um den Dreck und Lärm vor seinem Wagen. Instinktiv tat er damit das Richtige. Schließlich suchte man einen Vorwand, um ihn und die ganze Gesellschaft aus der Stadt zu treiben. So blieb es bei etwas Geschrei, dem Lachen der Schulkinder und dem roten, verschwitzten Kalbskopf unseres Bürgermeisters.
Ich hatte ihm ein Jahr zuvor eine Apoplexie vorausgesagt. Er war danach nie mehr in meine Sprechstunde gekommen. Vermutlich ging er zu Ditzen in die Siedlung. Oder er hatte einen Arzt in Wildenberg, den er aufsuchte, wenn er beim Kreis erscheinen mußte. Doch damals hoffte ich, wenn es soweit ist, wenn er sabbernd auf dem Kopfkissen liegt, werden sie mich holen lassen. Ich hoffte, seine Augen werden dann ruhelos mich um Vergebung und Hilfe bitten, und ich werde so glücklich sein, ihm nicht mehr helfen zu können. Ich würde alles tun, was in meiner Macht steht, ihm das Leben zu erhalten. Unermüdlich wollte ich besorgt sein, daß das dürftige Flämmchen seines hilflosen Dahinvegetierens nicht zu früh erlischt und seine endgültigen Leiden vor der Zeit enden. Und ich hätte das vor meinem Gott zu verantworten gewußt, wie ich es dem Priester gebeichtet hätte, der keine Möglichkeit haben sollte, meiner sich endlich befriedigenden Verbitterung die Absolution zu verweigern. Und dabei wußte ich, daß ich keine Zufriedenheit spüren würde und die Kränkungen mich weiter anfüllen, bis sie mich, am Tage meines Todes, oder früher oder später, zerreißen. Denn nicht dieses aufgeblähte, erbärmliche Kalbsgesicht Kruschkatz drückt mir die Seele zu einem Häufchen Hundescheiße zusammen. Es ist diese Stadt, an der ich sterbe. Ich habe sie verabscheut, seit ich hier lebe, seit ich auf der Welt bin. Und ich hasse sie, seitdem mein Vater mir hier eine Praxis kaufte und mir sagte, daß er mich nur für diese Stadt hat ausbilden lassen. Daß er all das viele Geld nur darum für mich ausgab, damit ich dieser Stadt vergelte, was er zeit seines Lebens an ihr gesündigt hat.
Wenn ich heute noch immer hier wohne, obgleich mein Vater lange tot ist und ich die Widerlichkeiten und das klebrige Elend der Armut weit hinter mir gelassen habe und auf und davon gehen könnte, wohin immer ich wollte, so bleibe ich nun einer anderen Vergeltung wegen. Den Auftrag, den mir mein Vater erteilt hat, werde ich ausführen. Ich werde ihn zu Ende bringen, um meiner selbst willen. Um der Demütigungen willen, die mir mein Vater bereitet hat, er soll nicht in Frieden ruhen, und um der Kränkungen willen, die ich von dieser Stadt erfuhr, der Freitische und Mildtätigkeiten, die ich genötigt war, dankend anzunehmen. Damals. Und wenn ich auch dieses verzeihen und vergeben könnte, ich kann es nicht vergessen. Ich kann die Feigheit nicht vergessen, mit der diese Stadt fortwährend neues Unrecht geschehen läßt. Der Tod eines Mannes wie Horn sollte ausreichen, um diese Stadt wie ein biblisches Gomorrha auszutilgen.
Von den Zigeunern hörte ich durch meine Tochter.
Nach dem Mittagschlaf war ich in die Bibliothek gegangen. Seit ein paar Jahren sitze ich an jedem Nachmittag zwei Stunden in meiner Bibliothek und blättere in den angesammelten Büchern. Ich lese sie nicht mehr, dafür fehlt mir die Geduld. Ich bin es überdrüssig, erfundenen Figuren nachzugehen und den Gesprächen des Papiers zuzuhören, diesen angestrengten, künstlichen Gebärden vorgeblichen Lebens.
Ich gehe in die Bibliothek, um allein zu sein. Um dem ziellosen Fluß meiner Gedanken zu folgen, um Zigaretten zu rauchen und den menschlichen Stimmen zu entgehen. Dem Redeschwall meiner bigotten Frau und dem gezierten Gefasel meiner Tochter, die eine ebenso große Heuchlerin zu werden verspricht; dem geduckten Stimmchen von Christine und den bittenden und unverschämten Forderungen der Patienten. Nur hier, in der Einsamkeit meiner Bibliothek, bleibe ich von diesen Belästigungen verschont und kann meinen planlos umherschweifenden Gedanken lauschen. Ich habe mir diese Bibliotheksstunden vor vier Jahren angewöhnt und werde sie bis zu meinem Lebensende beibehalten. Und falls ich, wie ich es für mich bestimmt habe, an einem freundlichen und unauffälligen Herzversagen sterben werde, oder mich doch mein Überdruß zuvor schwachsinnig macht, ich wünschte, daß diese Veränderungen in meiner Bibliothek erfolgten, in den Stunden nach dem Mittagschlaf, bevor Christine zum Tee ruft und ich mich meiner Frau und der Tochter ausliefern muß. Ich wünschte, was immer mir zustoßen wird, es träfe mich in der Abgeschiedenheit dieses Zimmers an.
Damals ging ich schweigend an den Teetisch. Wir sahen Christine zu, die uns Tee eingoß und Kuchen anbot. Erst als sie sich setzte, erzählte meine Frau, daß die Zigeuner angekommen seien. Johanna, meine Tochter, war bei der Bleicherwiese gewesen und plapperte darüber, was sie mit ihren Schulfreundinnen dort gesehen hatte.
Die Ankunft der Zigeuner war ein jährlich wiederkehrendes Schauspiel. Und so sehr der Anblick der dunkelhäutigen Sippe mit ihren bunten Lumpen und ihrem grauen Kraushaar oder den schwarzen Strähnen die Stadt in ihrer mürben Rechtschaffenheit und dem unveränderbaren, wohlbehüteten Ablauf der Zeit verstörte, sie erlag doch immer erneut der Faszination und der Verärgerung, die dieses weitgereiste Elend ihr an unbegreiflicher Ferne, Fremdheit und unverständlichen, gutturalen Schreien darbot.
Ich war überzeugt, daß zu dieser Stunde in der ganzen Stadt über die Zigeuner gesprochen wurde. Worüber sonst hätte man sich in dieser Stadt zu unterhalten. Denn Horn lebte Ende Mai noch.
»Es sah aus, als hätte er sich verlaufen«, sagte meine Tochter über den Bürgermeister, »vielleicht hatte er aber auch nur Angst vor den Frauen.«
Sie nahm sich noch ein Stück Kuchen und leckte sich, nachdem sie es gegessen hatte, aufreizend langsam und gründlich ihre Finger ab.
»Unsinn«, unterbrach ich das endlich eingetretene Schweigen, »er kennt keine Angst. Ich habe ihn gründlich untersucht. Er ist nicht einmal zu diesem Gefühl fähig.«
Meine Tochter kicherte gespreizt. Ich fühlte mich elend und verächtlich bei dem Gedanken, so viele Stunden und Tage mit ihr und meiner Frau vertan zu haben und auch in Zukunft unnütz und einfältig zu vergeuden.
Thomas
Ich war mit Paul nach der Schule zur Bleicherwiese gegangen. Wir wollten uns die Zigeuner ansehen. Paul hatte von ihnen erzählt. Er hatte sie bereits am Morgen entdeckt, als er zur Schule ging.
Auf der Bleicherwiese waren schon einige Kinder, vielleicht zwanzig. Sie standen stumm da und starrten zum Lager der Zigeuner hinüber, zu ihren Wagen und den vielen Pferden. Es war ein heißer Tag, und die Zigeunerfrauen saßen vor den Wohnwagen und wuschen ihre Kleider, große, rechteckige Tücher, die wie verblichene Fahnen auf dem Gras zum Trocknen auslagen. Die Männer ließen sich selten sehen. Manchmal kam einer an die Tür und rief laut und grob einen Namen. Dann ging eine der Frauen hinein, kehrte aber bald wieder zurück.
Den Chef sahen wir erst, als der Bürgermeister erschien, um die Zigeuner von der Bleicherwiese zu jagen. Der Chef war ein sehr dicker Mann. Er war so dick, daß er sich die Schnürsenkel seiner Schuhe nicht selbst binden konnte. Er kam selten aus seinem Wagen heraus. In den vergangenen Jahren war er nie in die Stadt gegangen. Eingekauft haben immer nur die Frauen. Manchmal saß er am Abend zwischen den Wohnwagen und rauchte. Wir konnten dann seinen dicken, nackten Bauch bewundern, der über die rote Schärpe seiner Hose quoll. Und in jedem Jahr, bei jedem seiner Aufenthalte in unserer Stadt, besuchte er Herrn Gohl, den alten Maler von der Burg. Warum er ausgerechnet zu Gohl ging, wußte keiner. Vater sagte nur, da hätten sich die Richtigen gefunden.
Paul sagte, wir sollten die Zigeuner fragen, ob wir nicht für sie arbeiten könnten. Im vergangenen Jahr hatte Paul für den dicken Chef gearbeitet. Er hatte kleine Besorgungen für ihn erledigt. Dafür durfte er mit den Zigeunern zusammen essen und erhielt zum Abschied vier große fremdländische Münzen geschenkt. Türkische Münzen, sagte Paul. Er meinte, die Zigeuner hätten sie gestohlen, denn sie seien sehr wertvoll. Er zeige sie nur mir, und ich dürfe mit keinem darüber reden. Ich mußte schwören.
Paul und ich standen also vor dem Lager der Zigeuner und warteten, daß der riesige Wanst des Chefs in der Tür erscheinen und wir Gelegenheit haben würden, das Oberhaupt der Sippe um Arbeit zu bitten. Doch nur die Frauen waren zu sehen. Die jungen Frauen, die wild durcheinander schrien und sich bewegten, als würden sie immerzu tanzen, und die mürrisch schweigenden Großmütter, aus deren faltigen braunen Gesichtern Hexenblicke zu uns schossen.
Um drei Uhr erschien der Bürgermeister mit Herrn Bachofen und einer jungen Frau, die draußen in der Siedlung wohnte. Sie gingen zu den Zigeunerinnen und sprachen mit ihnen, aber wir standen zu weit entfernt, um sie zu verstehen. Dann ging eine junge Zigeunerin in einen der Wohnwagen, und der Bürgermeister wandte sich zu uns und sagte, wir sollten verschwinden. Da keins der Kinder sich vom Fleck rührte, rief er nochmals und drohte mit der Faust, kam jedoch nicht zu uns herüber. Ein paar größere Jungen lachten, und so blieb ich gleichfalls stehen. Ich tat, als kümmere ich mich nicht darum, was der Bürgermeister sagte, und hoffte, daß er mich nicht erkannte.
Die junge Zigeunerin trat in die Tür des Wohnwagens und schüttelte den Kopf. Der Bürgermeister ging zu ihr, gab ihr ein Papier und redete auf sie ein, obgleich er wissen mußte, daß die Frau ihn nicht verstand. Keins der Zigeunerweiber beherrschte unsere Sprache, nur der Chef sprach sie ein wenig und konnte uns verstehen. Und die alte Zigeunerin, die Hexe mit dem Schnurrbart. Die Zigeunerin rief fremde Worte, und auch die anderen Zigeunerinnen kreischten auf den Bürgermeister ein. Es war ein toller Spektakel auf der Wiese. Der Bürgermeister brüllte, die Frauen schrien schrill, und die Zigeunerhunde kläfften. Herr Bachofen, der den Bürgermeister begleitete, schwieg und zupfte an seinem Jackett. Dann sah er finster zu uns und wedelte mit der Hand, um uns zu verscheuchen.
Irgendwann erschien der Chef in der Tür. Er trug eine rote Weste über dem nackten Oberkörper und sah lange in den Himmel. Dann spuckte er aus, stieg bedächtig die kleine Treppe herunter, schritt um den Wohnwagen, spuckte nochmals aus und ging wieder hinein. Er tat dies alles, ohne den Bürgermeister eines einzigen Blickes zu würdigen.
»Vielleicht ersticht er ihn«, flüsterte Paul mir ins Ohr, während der dicke Zigeuner um seinen Wohnwagen schritt.
»Wer?« fragte ich.
»Der Zigeuner«, sagte Paul, »die sind mächtig fix mit dem Messer. Mein Vater hat es gesehen.«
»Dann kommt er ins Gefängnis«, erwiderte ich.
»Ach was«, Paul schnaubte verächtlich, »Zigeuner gehen nicht ins Gefängnis. Die sind schnell, die kriegt keiner.«
Ich wurde völlig steif bei dem Gedanken, gleich zu erleben, wie unser Bürgermeister von dem massigen alten Zigeuner aufgeschlitzt würde. Doch der war bereits wieder in seinen Wohnwagen gegangen.
Der Bürgermeister und seine Begleitung kehrten um. Sie mußten sich einen Weg durch die aufgeregten, schreienden Zigeunerinnen bahnen. Als er an uns vorbeikam, sah ich, daß Schweiß auf seiner roten Stirn stand. Die älteren Kinder erzählten, er habe verlangt, daß die Zigeuner ihr Lager vor der Stadt aufschlagen, auf den Flutwiesen. Ich habe es nicht gehört. Ich habe nichts von dem gehört, was er den Zigeunern sagte.
Eine Stunde später standen nur noch Paul und ich vor dem Lager. Die anderen Kinder waren verschwunden, da nichts passierte. Wir waren einige Schritte näher gegangen, hielten aber Abstand zu den Zigeunern, der beiden spitzschnauzigen Hunde wegen, die nun in der Sonne lagen und uns mit ihren aufmerksamen Augen unablässig betrachteten. Wir hofften, daß der Chef nochmals herauskommt und wir ihn bitten können, für ihn zu arbeiten.
Paul hatte ihm im Vorjahr jeden Morgen vor Schulbeginn die Schuhe zugebunden und dafür täglich ein Brot mit einer dicken Scheibe Speck erhalten. Das Speckbrot hatte er in der Pause auf dem Schulhof verkauft, jeder wollte einmal von dem Zigeunerspeck essen. Paul erzählte, der Speck sei von gemästeten Katzen. Die Zigeuner äßen Katzen, um ihre Knochen geschmeidig zu halten. Ich ekelte mich, aber ich kaufte damals auch ein Speckbrot und kaute es auf dem Schulhof würgend hinunter. Mir war danach zwei Tage lang schlecht, weil ich immer daran denken mußte, Katzenspeck gegessen zu haben.
Wir warteten schweigend und beobachteten die Zigeunerinnen. Dann kam Herr Gohl und stellte sich neben uns. Er strich mir über den Kopf und nickte mir zu.
Ich kannte Herrn Gohl vom Museum auf der Burg. Ich war nachmittags oft dort. Herr Horn hatte es mir erlaubt, ich half ihm, die neuen Ausstellungsräume einzurichten. Herr Gohl arbeitete auch dort. Er war Maler und sprach den ganzen Tag nichts. Er war nicht stumm, manchmal sagte er zwei, drei merkwürdige Worte, doch meistens schwieg er. Er wohnte mit seiner Tochter zusammen, die er versorgen mußte. Sie war schwachsinnig. Eigentlich sagten wir, sie ist blöd, aber Vater hatte mir das verboten. Sie sei sehr schwer krank, hatte er gesagt, und ich solle mir keine Gossenausdrücke angewöhnen. Ich hatte Herrn Gohl manchmal geholfen, wenn er in der Burg seine Gemälde auf die weißen Wände übertrug.
Er stand neben uns und sah zu den Zigeunern. Seinen Hut hatte er abgenommen und hielt ihn mit angewinkeltem Arm vor der Brust. Eine der Zigeunerinnen sah ihn. Sie stieß einen hellen Schrei aus. Der Chef erschien in der Tür, erblickte Herrn Gohl und breitete großspurig die Arme aus.
»Kamerad«, brüllte er.
Ich sah, wie Herrn Gohls Augen zu leuchten begannen. Der alte Zigeuner winkte ihn mit einer kurzen, befehlsgewohnten Geste zu sich und schritt dann selbst die wenigen Stufen des Wohnwagens herab. Als sie sich gegenüberstanden, ergriff der Zigeuner mit beiden Händen die Schultern von Herrn Gohl, schüttelte ihn und rief nochmals mit gleicher Herzlichkeit und ebenso dröhnend: »Kamerad.«
Er zog ihn an seine Brust und umarmte ihn. Herr Gohl hielt noch immer den Hut mit angewinkeltem Arm vor sich. Als ihn der massige Zigeuner aus seinen Armen entließ, klopfte er verlegen lächelnd den Filz zurecht. Eine der Zigeunerinnen brachte eine Flasche und Gläser, und der Chef und Herr Gohl tranken stehend einen Schluck des gelblichen Getränks. Dann reichte Herr Gohl dem Zigeuner die Hand. Sie verabschiedeten sich.
Als er an uns vorbeiging, setzte Herr Gohl den braunen, ausgebeulten Filzhut auf. Er wirkte abwesend, verträumt. Der kleine, eingefallene Mund war wie erhellt vom Schimmer eines unerhörten Glücks. Der Zigeuner stand auf der Treppe seines Wohnwagens und sah ihm nach. Dann ging er hinein. Wir würden ihn nicht mehr sprechen können. Es hatte keinen Sinn, länger auf ihn zu warten. Paul schlug vor, dem alten Maler heimlich nach Hause zu folgen. Ich war damit nicht einverstanden. Ich wollte es nicht, weil ich den Maler gut kannte. Aber da ich nicht wußte, was wir anfangen sollten, liefen wir ihm schließlich hinterher.
Erst zwei Tage später gelang es Paul und mir, den Chef der Zigeuner zu sprechen. Und wir mußten unseren Wunsch zweimal wiederholen, bevor er uns verstand. Seine behaarte Hand strich sanft über den gewaltigen Bauch, als er uns mit zusammengekniffenen Augen ansah und sagte: »Geht zu Frauen. Frauen geben Arbeit jungen Herrn.«
Und mit veränderter, grober Stimme rief er den Frauen etwas in seiner Sprache zu, worauf diese in kreischendes Gelächter ausbrachen und die Oberkörper hin und zurück wiegten. Wir gingen zu ihnen. Mein Gesicht war glutheiß, und ich wäre davongelaufen, hätte ich nicht gefürchtet, die Frauen würden dann noch gellender lachen. Wortlos fragte ich Paul mit einem Blick, was wir tun sollten, doch er starrte nur mit gerötetem Kopf auf die Erde, als sei er festgewachsen und versteinert.
Eins der alten Weiber streichelte mich und kniff mir in die Wange. Ihre Hand war braun und knochig und tat mir weh. Als ich den Kopf hob, sah ich ihre schlechten Zähne, schwarze Zahnstümpfe, und den dichten Bart auf der Oberlippe und am Kinn. Die Alte zeigte uns, was zu tun war. Ich mußte die Ziegen umpflocken, wenn die das Gras abgefressen hatten. Dazu hatte ich ein langes Eisen, an das der Strick der Ziege gebunden war, aus der Erde zu ziehen und mit einem Ziegelstein wieder einzuschlagen. Und während die Ziegen das Gras fraßen, hatte ich aufzupassen, daß sie nicht an die Wäsche gingen und an die großen schwarzen Töpfe der Zigeuner, die in der Sonne standen. Paul saß bei den Zigeunerinnen. Er mußte Eimer und Wasserkannen tragen, wenn es die Frauen verlangten, und nach den Pferden sehen. Aber meistens saß er nur zwischen den Zigeunerinnen und sah ihnen zu.
Beim Sechs-Uhr-Läuten verabschiedeten wir uns. Wir sagten, daß wir morgen wiederkämen, gleich nach der Schule. Die Zigeunerinnen nickten und lachten. Ich wußte nicht, ob sie uns verstanden.
»Wollen wir wirklich wieder hingehen?« fragte ich Paul.
Er nickte.
»Wir haben nichts bekommen«, wandte ich ein.
»Sie sind erst angekommen«, erwiderte Paul, »in ein paar Tagen haben sie genug zusammengestohlen. Dann bezahlen sie uns.«
Gertrude Fischlinger
Ich konnte meinen Sohn nicht anbinden.
Ich wußte, daß er zu den Zigeunern ging. Die Leute erzählten mir, daß er für sie arbeitet. Er und dieser Junge, der damals sein Freund war, der Sohn des Apothekers. Wenn ich mit Paul sprechen wollte, verließ er wortlos das Zimmer. Ich konnte ihn schließlich nicht anbinden. Ich hatte den Laden, und abends mußte ich den Haushalt versorgen. Und mit meinen geschwollenen Beinen konnte ich dem Jungen nicht in der Stadt hinterherlaufen. Es fehlte der Vater.
Paul hatte es sich in dem Jahr angewöhnt, spät nach Hause zu kommen. Nach dem Abendbrot verschwand er und kam erst gegen zehn, elf Uhr zurück. Ich lag im Bett und wartete darauf, daß er die Haustür aufschließt und die Treppe hochkommt. Ich fürchtete, eines Tages würde die Polizei ihn mir bringen. Er war doch erst vierzehn. Wenn er kam, ging er in sein Zimmer, ohne zu mir hereinzuschauen. Aber ich war beruhigt, und auch das Klopfen in meinen Beinen wurde leiser und regelmäßiger.
Ich wußte nicht, was er abends machte, wo er sich herumtrieb. Ich kannte seine Freunde nicht. Nur den Apothekerssohn, der zu dieser Zeit bestimmt längst zu Hause war.
Ich wußte, daß Paul trank. Ich hatte eine leere Flasche in seinem Zimmer gefunden, und ich betete zu Gott, er möge nicht wie sein Vater werden. Es war alles so schlimm, weil er mir nichts erzählte. Ich hatte Herrn Horn gebeten, mit ihm zu sprechen, doch der zuckte nur mit der Schulter und bat mit seinem müden, alles verstehenden Lächeln um Verzeihung. Er würde nicht mit ihm sprechen, nicht darüber. Dabei hatte ich ihm das Zimmer nur in der Hoffnung gegeben, er würde Paul gelegentlich ein Wort sagen. Ich konnte es nicht mehr. Was ich auch sagte, mein Sohn hörte mir nicht zu.
Herr Horn war vier oder fünf Jahre zuvor in die Stadt gekommen. Ich füllte gerade Mehl in Tüten ab, als er meinen Laden betrat. Er blieb mitten im Raum stehen und wartete geduldig darauf, daß ich mich zu ihm wandte. Er betrachtete weder die Regale noch die Glasschränke auf dem Tisch, und ich wußte, er würde nichts kaufen. Also füllte ich weiter das Mehl ein. Ich glaubte, er wollte eine Auskunft haben, doch er fragte nichts, stand ruhig im Laden und sah mir zu. Ich richtete mich auf und klopfte das Mehl von den Händen und der Schürze. Als ich ihn ansah, wußte ich, daß er auch keine Auskunft brauchte. Er war nicht der Mann, der zu den Bootsstegen gehen wollte oder die beste Gaststätte des Ortes suchte. Er hatte eine merkwürdige graue Haut und breite, fast schwarze Augenringe. Ich dachte damals, daß er wohl lange krank gewesen sein müßte. Gelbsucht oder Tbc, vermutete ich.
Er fragte, ob ich Frau Fischlinger sei, und fügte hinzu, ihn schicke die Sekretärin des Bürgermeisters. Er heiße Horn und suche ein Zimmer zur Untermiete. Dann schwieg er und sah mich ruhig und ausdruckslos an. Ich war überrascht. Ich hatte nie zuvor ein Zimmer vermietet. Seit mein Mann weggegangen war, hatte ich auch nie daran gedacht.
»Ich wohne mit meinem Sohn zusammen«, antwortete ich ihm damals, »er ist zehn Jahre alt. Ich habe ihn spät bekommen.«
»Ich werde Sie nicht stören«, entgegnete er, »alles, was ich benötige, ist ein Bett und eine sehr helle Lampe. Und frühmorgens etwas heißes Wasser.«
Ich betrachtete ihn und überlegte.
»Ich habe schlechte Augen«, fügte er entschuldigend hinzu.
Er bemühte sich auch jetzt nicht, verbindlich oder gar freundlich zu wirken.
»Sie mißverstehen mich«, sagte ich, »ich fürchte nicht, daß Sie uns stören, sondern daß Sie durch meinen Jungen belästigt werden. Er ist nicht gut erzogen. Ich mußte ihn zu oft sich selbst überlassen.«
»Ich habe keine Ansprüche«, erwiderte er.
Und damit und obgleich ich ihm nicht zugesagt hatte, schien für ihn und mich die Angelegenheit geregelt. In der Mittagspause zeigte ich ihm die Wohnung und sein Zimmer und gab ihm die Schlüssel. Am Abend stellte ich das Reformbett auf und trug den Plattenspieler und das Nähschränkchen ins Schlafzimmer. Den Glasschrank ließ ich ihm. Das Mokkageschirr und die Weingläser, die darin standen, brauchte ich einmal im Jahr, und nun, da ich mein Wohnzimmer vermietet hatte, würde ich noch seltener eine Gelegenheit haben, sie zu benutzen.
Herr Horn hatte mir erzählt, daß ihm die Stadt eine Wohnung versprochen habe. Er werde auf der Burg arbeiten, im Museum, und hoffe, nicht länger als ein Jahr bei mir zur Untermiete zu wohnen. Aber das Jahr verging, und er erhielt keine Wohnung, und ein zweites Jahr verging, und schließlich lebte er bis zu seinem überraschenden Tod bei mir.
Er war ein stiller Mieter. Manchmal lauschte ich, um ein Geräusch von ihm zu hören, den Schritt eines Mannes, ein Knarren des alten Ledersessels, ein Gurgeln im Bad. Ich lauschte, um das Gefühl zu verspüren, einen Mann in der Wohnung zu haben. Doch er schien sich geräuschlos zu bewegen. Es gab nicht einmal kleine Wasserspritzer neben der Badewanne, wenn ich nach ihm das Bad betrat. Ich machte ihm Frühstück und Abendbrot, er lehnte es jedoch ab, mit uns in der Küche zu essen. Er wollte uns in keiner Weise zur Last fallen, und seine Zurückhaltung war strikt und ausnahmslos. Wäre er nicht scheu und verletzbar gewesen, sondern schroff und hochmütig, sein Benehmen hätte nicht ablehnender sein können. Selbst in jenem halben Jahr, in dem ich fast glauben durfte, daß ich ihm etwas bedeute, war er mir unendlich fern.
Seinem Wunsch, in meiner Wohnung ein Zimmer zu mieten, hatte ich zugestimmt, weil ich hoffte, seine Anwesenheit würde Paul nötigen, freundlicher mit mir zu sprechen. Ich hoffte, daß Herr Horn als Fremder einen Zugang zu ihm fände, einen Zugang, den ich lange zuvor verloren hatte. Und nicht zuletzt war ich mit seinem Einzug einverstanden, weil ich so lange allein gelebt hatte und endlich wieder einen Mann in meinem Haus haben wollte. Es hätte mich nicht gestört, daß ich ihn selten sah, daß er allein aß, daß er sich nie dazu herabließ, mit mir einen Tee zu trinken und ein kurzes Gespräch zu fuhren. Alles, was ich für mich wünschte, war ein freundlicher Gruß am Morgen und ein kleines Lächeln, wenn wir uns im Flur der gemeinsamen Wohnung begegneten. Aber bereits nach einer Woche wußte ich, daß ich mehr Herzlichkeit erwarten könnte, hätte ich einen Sack Holz in das Zimmer gestellt.
Er blieb der zufällig in meinen Laden geratene Fremde, der mich unbeteiligt beobachtete, mir aus dem Weg ging und gelassen abwartete, um zu bekommen, was ihm zustand. Er wohnte über vier Jahre bei mir. Nie fiel ein lautes oder böses Wort zwischen uns, aber wann immer ich an ihn dachte, verwünschte ich den Tag, an dem ich ihm die Schlüssel zu meiner Wohnung gegeben hatte. Hinaussetzen konnte ich ihn nicht, dafür gab es keinen Anlaß. Er war korrekt und höflich zu mir, und ich konnte nicht auch noch von ihm fordern, daß er freundlich zu mir war, da er nicht einmal für sich selbst ein Gran von Zuneigung aufbrachte. Ich hatte ihn um Pauls willen bei mir aufgenommen, aber mein Sohn entfernte sich weiter von mir, und Herr Horn wollte mir keine Hilfe sein. Und ich konnte es nicht von ihm verlangen.
»Ich habe keine Ansprüche«, sagte er, als er das Zimmer mietete, seinen Koffer auspackte und alles, was sich im Zimmer befand, den Tisch, die Bilder, die schweren Ledersessel, widerspruchslos hinnahm; auch in den folgenden Jahren veränderte er kaum etwas daran. Es dauerte nur eine Woche, bis ich begriff, daß er mir mit diesem Satz lediglich hatte mitteilen wollen, daß ich keine Ansprüche an ihn habe.
Kruschkatz
Es ist unsinnig und unwürdig, nach so vielen Jahren ausgerechnet über diesen Mann Horn zu sprechen. Es ist gotteslästerlich. Ich kann es nicht besser bezeichnen als mit diesem altväterlichen Wort.
Ich bezweifle keineswegs, daß sich die Vorgänge jenes Jahres rekonstruieren lassen. Möglicherweise so vollständig, daß die dazugehörenden nichtssagenden Einzelheiten wie abgelegte Büroordner, verstaubt und vergilbt, unsere Träume aufblähen und unser Gedächtnis quälen.
Ich könnte mich jeder Minute erinnern. Ich erwähne das nicht, weil ich mein ungewöhnliches Erinnerungsvermögen hervorheben will. (Eine solche Fähigkeit ist kein beglückendes Geschenk der Natur. Denn es sind zwei sich ausschließende Dinge: gut zu schlafen und sich gut zu erinnern. Auch sind die Vorteile gering. Schließlich ist eine Fähigkeit um so nutzloser, je seltener es dazugehörige Entsprechungen gibt. Was würde es helfen, das Gras tatsächlich wachsen zu hören oder die Drehung der Erde zu verspüren, wenn ich damit jeden nur beunruhigte, mich selbst eingeschlossen. So schweige ich lieber. Diese verblödeten und geschwätzigen Greise, unter denen ich nun zu leben gezwungen bin, verstünden mich ohnehin nicht.)
Ich bezweifle also nicht den äußeren Erfolg, das nahezu vollständige Verzeichnis der Fakten. Vielmehr stelle ich das ganze Unternehmen in Frage. Die Entdeckung, daß es mehrere, zum Teil einander widersprechende Wahrheiten gibt, als endliches Ergebnis solcher Mühe wäre ein niederschmetternder Witz. Noch mehr aber beunruhigt mich der Gedanke, daß die so gefundene Wahrheit, beziehungsweise die verschiedenen, schlüssig, vollständig und widerspruchsfrei hergestellten Bilder keinen Adressaten haben. Das ist vorbei.
Ich bin heute dreiundsiebzig Jahre alt, und wenn ich die Erfahrungen meines Lebens für eine daran uninteressierte Nachwelt in einem Satz formulieren müßte, würde ich sagen: Es gibt keine Geschichte. Geschichte ist hilfreiche Metaphysik, um mit der eigenen Sterblichkeit auszukommen, der schöne Schleier um den leeren Schädel des Todes. Es gibt keine Geschichte, denn soviel wir auch an Bausteinchen um eine vergangene Zeit ansammeln, wir ordnen und beleben diese kleinen Tonscherben und schwärzlichen Fotos allein mit unserem Atem, verfälschen sie durch die Unvernunft unserer dünnen Köpfe und mißverstehen daher gründlich. Der Mensch schuf sich die Götter, um mit der Unerträglichkeit des Todes leben zu können, und er schuf sich die Fiktion der Geschichte, um dem Verlust der Zeit einen Sinn zu geben, der ihm das Sinnlose verstehbar und erträglich macht. Hinter uns die Geschichte und vor uns Gott, das ist das Korsett, das uns den aufrechten Gang erlaubt. Und ich glaube, das Röcheln der Sterbenden ist die aufdämmernde Erkenntnis der Wirklichkeit. Die Toten brauchen kein Korsett.
Ich will mich mit diesen Bemerkungen meinen Erinnerungen nicht entziehen. Ich schicke sie voraus, weil ich meinen Erinnerungen mißtraue, weil ich allen Erinnerungen mißtraue.
Weil ich den Ohren mißtraue, die meinen Erinnerungen zuhören. Die Leute werden nichts verstehen, und ihre Bemühungen, meinen Worten einen verstehbaren Sinn zu geben, werden sie dazu verleiten, meine Geschichte mit ihrem Leben zu beleben. Und statt die Unbegreiflichkeiten auszuhalten und zu akzeptieren, werden sie nichts begreifen.
Ich möchte noch vorausschicken, daß mich diese Gedanken erst jetzt bewegen. Damals war ich zu beschäftigt, um über irgend etwas auf eine andere Art nachzudenken als mit dem erklärten Ziel einer schnellen und klaren Entscheidung. Ich bedauere das nicht, es war erforderlich. Ich bin zudem überzeugt, daß ich damals nicht fähig war, etwas wirklich zu durchdenken. Ich bin der Meinung, daß man mindestens sechzig Jahre gelebt haben muß und von keiner zu qualvollen oder beeinträchtigenden Krankheit gequält sein darf, um über diese Welt einen kleinen, halbwegs vernünftigen Satz sagen zu können.
Bleibt noch hinzuzufügen, daß ich bei den unaufhörlich umherlaufenden Greisen, mit denen ich in einem Haus wohne, nicht beliebt bin. Ich gelte als verschroben und wohl auch als verrückt. Ich gebe diese Erklärung ab, um jedermann freizustellen, meinen weiteren Ausführungen mit tiefstem Mißtrauen zu begegnen. Ich werde mich nicht für die Glaubwürdigkeit meiner Erinnerungen einsetzen. Im Gegenteil. Schließlich erinnere ich mich nur, um etwas von dem zu begreifen, was man anmaßend als mein Leben bezeichnen könnte.
Die Zigeuner kamen am 23. Mai, es war ein Donnerstag. Und am 1. September, einem Sonntag, erhielt ich die Nachricht, daß man Horn gefunden hat. Kinder entdeckten ihn im Wald. Die Polizei sicherte das Gelände und benachrichtigte das Kreisamt. Man schloß in den Untersuchungen anfangs ein Gewaltverbrechen nicht aus. Diese Vermutung war eine formale Notwendigkeit der Behörde, es gab keinen Anlaß dafür, und ich erinnere mich, daß in der Stadt niemals der geringste Zweifel an der Art seines Todes bestand.
Unangebracht war die später erfolgte Verknüpfung dieser zwei Ereignisse, des Todes von Horn und der Anwesenheit der Zigeuner in meiner Stadt. Es wurde zu einer lächerlichen Gewohnheit, nie von dem einen zu sprechen, ohne das andere zu erwähnen. Dabei haben die Tatsachen nichts miteinander zu tun. Es war der letzte Sommer, den die Zigeuner in unserer Stadt verbrachten, und ich denke, die Erleichterung, mit der man das Ausbleiben der Sippe registrierte, und die Verwunderung über den merkwürdigen Mann Horn und seinen empörenden Tod brachten zwei Dinge zusammen, die in keinem Verhältnis standen. Horn starb, weil er für diesen Tod vorgesehen war, und die Zigeuner verließen die Stadt nicht anders als in jedem Herbst zuvor.
Nachdem mir im Mai ihr Erscheinen gemeldet worden war, ging ich wie in allen Jahren, und wie alle meine Vorgänger, zu ihnen, um sie aufzufordern, die Bleicherwiese zu verlassen. Ich bat sie, auf den Flutwiesen vor der Stadt ihr Quartier aufzuschlagen.
Die Bleicherwiese ist Eigentum der Stadt, und nach einem Ratsbeschluß dürfen weder Zelte noch Wohnwagen dort aufgestellt werden. Der Beschluß war zehn Jahre alt. Er wurde in jenem Jahr eingebracht, in dem die Zigeuner zum erstenmal wieder in Guldenberg erschienen waren und sich auf ebendieser Wiese niedergelassen hatten. Dem Beschluß entsprechend, setzte ich die Zigeuner auch in diesem Jahr von dem Verbot in Kenntnis, und ich wußte vorher, daß es ein vergeblicher Gang werden und die Zigeunerfamilie auch in diesem Sommer mitten in unserer Stadt leben würde. Ich war selbst zu ihnen gegangen, obwohl ich den Ratsdiener hätte beauftragen können. Ich war selbst gegangen, weil ich von der Vergeblichkeit überzeugt war, mir aber nichts vorwerfen lassen wollte.
»Beauftrage die Polizei. Sie wird die Sippschaft vor die Stadt jagen.«
Es war Bachofen, einer meiner Stadträte und mein Stellvertreter, der mir diesen Vorschlag machte, nachdem wir erfolglos ins Rathaus zurückgekehrt waren.
»Ich werde, wie du weißt, nichts dergleichen unternehmen«, erwiderte ich und wischte mir den Schweiß aus dem Nacken.
»Du machst dich lächerlich.«
»Das ist unmöglich, Genosse Bachofen.«
Er sah mich verwundert an und wartete auf eine Erklärung. Ein schlecht gebundener silberfarbener Schlips krümmte sich auf seinem durchschwitzten Hemd. Sein Mund war leicht geöffnet. Ich hörte die Atemzüge und sah die verwunderten mausgrauen Augen. Und ich antwortete ihm und glaubte dabei, seinen Schweißgeruch zu atmen, der mir unerträglich war, obgleich ich nicht weniger stinken mußte als er: »Es ist unmöglich, daß ich mich lächerlich mache, wenn ich die Dummheiten begehe, zu denen mich mein Amt nötigt.«
Sein Lächeln verschwand augenblicklich. Die Mausaugen wichen hinter zwei winzige Schlitze plötzlich erwachter Aufmerksamkeit zurück. Das leise Glitzern hinter den dicken Augenlidern und fast weißen Wimpern signalisierte mir, daß die kleinen eisernen Schreibgriffel seines Gehirns zu rotieren begannen und so unerbittlich wie unlöschbar meine Worte auf die Metallplatten seines Gedächtnisses gravierten.
»Dann schick die Polizei meinethalben von Amts wegen.«
Ich öffnete die Tür zu meinem Büro. Auf der Schwelle stehend, wandte ich mich zu ihm und erwiderte: »Du wirst es nicht begreifen, Bachofen, aber selbst für erforderliche Schäbigkeiten gibt es eine Grenze.«
Ich schloß die Tür. Ich war erleichtert, es überstanden zu haben, und ließ mich auf den Stuhl hinter meinem Schreibtisch fallen. Mein Herz schmerzte, und ich ließ meine Hand beruhigend auf der linken Brust kreisen. Im unteren Schubfach lag eine angerissene Zigarettenschachtel. Ich zündete mir eine Zigarette an. Ich wußte, es war Gift für mein Herz, aber es war ein Gift, das mir den Schmerz nahm.
Zu jener Zeit wohnte ich das dritte Jahr in Bad Guldenberg.
Als ich die Stadt zum erstenmal betrat, ein Fremder, dem man höflich, doch uninteressiert Auskunft und Quartier gab, wußte ich, den Auftrag in der Tasche, daß man sich wenige Monate später das Maul über mich zerreißen würde. Es konnte nicht anders sein in einer so kleinen Stadt, die sich auf imaginäre, dahinwelkende Traditionen berief und sich vornehmlich von Kurgästen ernährte, die einen verträumten, freundlichen Ort suchten und sich schließlich mit der Stille der Geranienvorgärten und dem geduldigen Schlaf der zerbröckelnden Häuser und der grasüberwucherten Gassen abfanden. Es konnte nicht anders sein in dieser Stadt, die es gewohnt war, von fernen, nie erblickten Obrigkeiten ihr unbegreifbare Beschlüsse entgegenzunehmen, um ihnen unwillig und mit stillem Grimm zu genügen.
Ich stellte mich damals im Rathaus vor und übergab Franz Schneeberger, dem Bürgermeister, meine Papiere und den Auftrag des Bezirks. Im März wurde ich zum Stadtrat ernannt, und im Juni bat Schneeberger um seine vorzeitige Pensionierung und schlug mich weisungsgemäß zu seinem Nachfolger vor. Die Ratsversammlung folgte ausnahmslos seiner Empfehlung, und damit war ich, der Fremde aus der Bezirksstadt, Bürgermeister eines mir kaum bekannten und nicht freundlich gesonnenen Provinzfleckens, dessen Honoratioren darauf lauerten, daß mir das Schicksal meiner vielen Vorgänger nicht erspart bliebe, nämlich mich bei dem Versuch, eine vage formulierte Instruktion den örtlichen Gegebenheiten anzupassen, zu irren und, das eine und das andere falsch einschätzend, als Sektierer oder Schädling irgendeiner Art zu entlarven.
Nach der Wahl saß ich in dem neuen Arbeitszimmer und wartete drei Stunden lang, daß sich meine Mitarbeiter bei mir einfinden würden, um mir zu gratulieren und die künftige Arbeit abzusprechen. Doch nur der Parteisekretär kam in mein Zimmer und gab mir die Hand, und ich wußte, er konnte mir wenig helfen, denn er war in dieser Stadt neu und fremd und so beliebt wie ich selbst.
Außer ihm erschien an diesem Tag keiner in meinem Büro. Gegen sechzehn Uhr klingelte das Telefon. Meine Frau erkundigte sich, wie es mir gehe und wie die Entscheidung gefallen sei.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich wahrheitsgemäß.
Sie war überrascht: »Bist du denn nicht ernannt worden?«
Ich sah mich in meinem kahlen Büro um, sah auf die leeren Besuchersessel und die ausgeräumten Schrankfächer, betrachtete die beiden Fotos hinter meinem Stuhl und den Schreibtisch, auf dem lediglich zwei Telefonapparate standen und ein Aschenbecher mit zerdrückten Zigaretten, und erwiderte: »Ich habe das Gefühl, hier ist jedermann sicher, daß ich soeben meinen Kopf in die Schlinge gesteckt habe.«
Ich schwieg und wartete auf ihre Stimme. Nach einer Pause begann meine Frau zu lachen und sagte: »Gut. Ich werde meine Koffer packen und in drei Tagen bei dir sein. Aber versprich mir, daß ich nicht in diesem Nest begraben werde.«
Ich blieb in meinem Büro untätig sitzen, bis die Dämmerung begann. Als ich ging, erkundigte ich mich bei meiner Sekretärin, ob sich Besucher angemeldet hätten.
»Haben Sie jemanden erwartet?« fragte sie mitleidsvoll und betrachtete mich neugierig. Ich schüttelte den Kopf.
Eine Woche später traf ich Horn in der Stadt. Wir begegneten uns auf dem Bürgersteig vor der Molkerei. Er lüftete kurz seinen Hut und wollte schweigend an mir vorbeigehen. Ich war so überrascht, ihn zu sehen, daß ich ihn ansprach. Er sagte, er wohne seit einem Jahr hier.
»Was für ein Zufall«, sagte ich und lächelte.