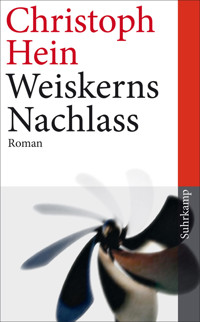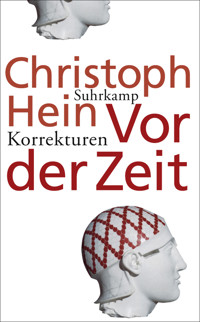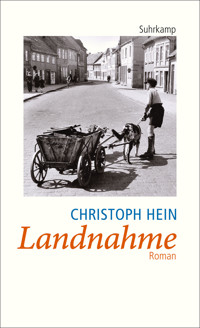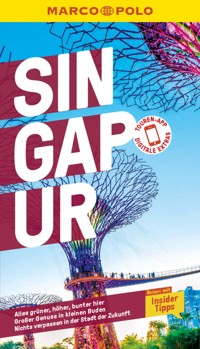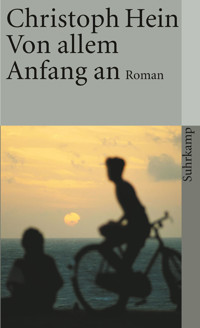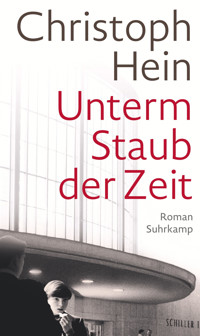
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Erwachsenwerden in einer geteilten Stadt
Der vierzehnjährige Daniel kommt 1958 aus seiner ostdeutschen Heimatstadt, wo ihm als Pfarrerssohn das Abitur verwehrt wird, nach Berlin. Er zieht in ein Schülerheim in Grunewald, wo er auch das Gymnasium besucht, und lebt sich in der neuen Umgebung rasch ein. Mit seinen Zimmergenossen – die alle, wie er, aus der DDR stammen – drückt er nicht nur die Schulbank, sondern sie erkunden gemeinsam die Stadt: Als Zeitungsverkäufer ziehen sie allabendlich durch die Kneipen, und wenn das Essen im Schülerheim allzu fade schmeckt, geht es auf eine Erbsensuppe in Aschingers »Stehbierhalle«. Sie erleben den Erweckungsprediger Billy Graham, der die Massen im Tiergarten in Verzückung versetzt, und Bill Haley, der den Sportpalast zum Kochen bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Christoph Hein
Unterm Staub der Zeit
Roman
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfotos: mauritius images/Trinity Mirror/Mirrorpix/Alamy/Alamy Stock Photos (Jugendliche), ullstein bild/ullstein bild (Gebäude)
eISBN 978-3-518-77543-1
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
I
Antío patrída
II
»Pack die Badehose ein«
III
Fluchtpunkt
Aschinger
IV
Dreieinhalb Pfennige
V
Mit Kranichen zweispännig pflügen
VI
Der Erweckungsprediger
VII
Das perfekte Verbrechen
VIII
Dodge Royal
IX
Unterricht bei Professor Bondi
X
Der Baron
XI
Sprung vom Zehnmeterbrett
XII
Eine schöne junge Dame
XIII
Der Affenschwein-Tag
XIV
CäLaGro
XV
Fulbricht riegelt ab
XVI
Eine Geschichte endet, eine Geschichte beginnt
Textnachweis
Informationen zum Buch
I Antío patrída
Ende August, am letzten Sonnabend des Monats, brachte Vater mich nach Berlin. Ich hatte einen Koffer und eine Schultasche mit meinen Sachen gepackt, neben ein paar Wörterbüchern waren es hauptsächlich Kleidungsstücke, Hosen und Hemden, etwas Unterwäsche und die noch einigermaßen brauchbaren Socken. Mutter hatte mich gedrängt, auch den dicken Pullover für den Winter einzupacken, sie würden mich zwar bald besuchen kommen, aber ich solle so viel wie möglich mitnehmen, um anständig gekleidet zu sein und nicht zu frieren.
Anständig – das war eins der wichtigsten Worte meiner Kindheit, meine Geschwister und ich bekamen nahezu täglich zu hören, wir sollten anständig sein und höflich. Wir hatten uns anständig aufzuführen, mussten anständig gekleidet sein und uns in der Öffentlichkeit und gegenüber den Erwachsenen anständig verhalten. Es gab feste Regeln beim Grüßen der Bekannten und unumstößliche Festlegungen für unseren Haarschnitt. Die Eltern ermahnten uns, uns nicht »wie die Zigeuner aufzuführen« und nicht »wie die Hottentotten« herumzulaufen. Bei einem Riss im Hemd oder gar in der Hose wurde man selbst von den Mitschülern und Freunden ausgelacht. Und in Westberlin sollte ich mich besonders anständig verhalten. Ich hatte den fertig gepackten Koffer für Mutter noch einmal zu öffnen, damit sie kontrollieren konnte, was ich mitnahm.
Als ich den Koffer und die neue Schultasche, die ich zur Konfirmation im letzten Jahr erhalten hatte, ins Auto stellte, beschwerten sich meine beiden jüngeren Geschwister, weil sie nicht mitkommen durften. Es seien schließlich Ferien, und da wollten sie gern einmal ihren Bruder David wiedersehen und sich Westberlin anschauen, aber Vater schüttelte den Kopf. Das sei keine Vergnügungsreise, sondern ein Abschied.
Mutter küsste mich, als ich in das Auto steigen wollte, und steckte mir eine Tafel Schokolade in die Jackentasche. Nach einer schroffen Aufforderung von ihr winkten mir meine Geschwister desinteressiert einen Abschiedsgruß zu. Sie waren noch immer verärgert, dass sie nicht mitfahren durften.
Da ich mit viel Gepäck nach Westberlin wollte, entschied Vater, nicht direkt nach Berlin zu fahren, sondern zuerst nach Potsdam und von dort aus weiter mit der S-Bahn. Noch bevor wir die Stadt erreichten, gab es eine Polizeikontrolle, Vater musste aussteigen und Fragen beantworten, den Kofferraum hatte er nicht zu öffnen. Am Potsdamer Bahnhof setzte er mich mit meinem Gepäck ab, er wolle das Auto auf dem Hof des Landesjugendpfarramts abstellen, wo es sicher sei. Er gab mir Geld und sagte, ich solle für uns Fahrkarten kaufen, eine einfache für mich und für ihn eine Rückfahrkarte, dann solle ich auf den Bahnsteig gehen und dort auf ihn warten.
Als Vater erschien, nahm er meinen Koffer auf, und wir stiegen in einen Waggon der bereitstehenden Stadtbahn. An der zweiten Station stiegen zwei Uniformierte ein und gingen durch den am späten Vormittag fast leeren Wagen. Sie ließen sich die Ausweise der Passagiere zeigen, an uns gingen sie vorbei, doch plötzlich kamen sie zurück, stellten sich vor uns und forderten barsch unsere Papiere. Mein Ausweis steckte in einer Schutzhülle, er war nigelnagelneu, ich hatte ihn erst vor vier Monaten bekommen.
Die Polizisten wollten wissen, wohin wir fuhren. Vater sagte, dass er mich nach Weißensee bringe, wo ich in den nächsten Jahren bei seiner Schwester wohnen werde, um in diesem Stadtbezirk die Oberschule zu besuchen. Daheim in Guldenberg, wo wir lebten, gebe es keine weiterführende Schule.
Der pockennarbige Polizist behielt unsere Personaldokumente in der Hand. Als der Zug die nächste Bahnstation erreichte, forderte er uns auf, das Gepäck aufzunehmen und ihn zwecks einer Personenkontrolle zu begleiten. Die Polizisten stiegen aus und warteten an der geöffneten Tür, bis Vater und ich mit Koffer und Tasche auf dem Bahnsteig standen. Aus jedem der Waggons waren Polizisten gekommen, die nun bis zur Weiterfahrt der Bahn an den Türen stehen blieben.
Außer uns mussten noch vier andere Leute aussteigen, auch sie hatten Gepäck bei sich. Nach der Abfahrt der Bahn führten die Grenzpolizisten uns in eine Baracke und forderten uns auf, Koffer und Tasche zu öffnen und den Inhalt auf dem Tisch auszubreiten. Vater und ich stapelten meine Kleidung und Wäsche sehr sorgsam auf die Metallplatte, um sie danach wieder mühelos einräumen zu können. Der Pockennarbige stand neben uns und betrachtete abschätzig meine Kleidungsstücke, die Wörterbücher nahm er in die Hand.
»Griechisch! Lateinisch!«, sagte er belustigt, »wer braucht denn das noch?«
»Wenn Sie Medizin studieren wollen, müssen Sie Latein lernen«, erwiderte Vater, »und Griechisch und Hebräisch, da gibt es auch noch Berufe, wo man diese alten Sprachen beherrschen muss.«
»Die Pfaffen vermutlich«, sagte er grinsend.
»Gewiss, Pfarrer, Historiker, Altertumsforscher, Linguisten. Es gibt einige Berufe, wo man die historischen Sprachen, die sogenannten toten Sprachen, benötigt.«
»Aha. Na, danke schön für die Belehrung, da bin ich jetzt richtig schlau geworden. Aber ich sehe, ein sowjetisches Wörterbuch haben Sie auch dabei. Mit der Sprache wird der Junge mehr anfangen können.«
»Ein sowjetisches Wörterbuch? Was soll das denn sein?«
»Na das hier. Oder was ist das?«
»Das ist ein russisches Wörterbuch. Russisch ist eine Sprache, aber von einer sowjetischen Sprache habe ich noch nie etwas gehört.«
Der Polizist starrte meinen Vater überrascht an, seine Pockennarben verfärbten sich rötlich. Er kniff die Augen leicht zusammen und schaute sekundenlang schweigend auf Vater. Mehrmals klopfte er mit unseren Ausweisen in der linken Hand auf den rechten Daumen.
Dann fragte er knapp nach der Adresse der Oberschule in Weißensee, die ich besuchen würde, und nach der Adresse meiner Tante, notierte sich aber nichts.
»Packen Sie alles ein und gehen Sie. Na los«, raunzte er uns schließlich an, gab uns die Ausweise zurück und ging zu seinen Kollegen.
Wir mussten auf dem Bahnsteig warten, bis der nächste Zug kam. Als eine Bahn aus der Gegenrichtung eintraf, die nach Potsdam fuhr, standen die Polizisten aufgereiht das ganze Gleis entlang und stiegen, wiederum immer zu zweit, in alle Waggons ein, um die aus Westberlin kommenden Reisenden zu überprüfen.
Als unsere Bahn kam und wir eingestiegen waren, sagte Vater: »Ein sowjetisches Wörterbuch! Was für ein Idiot!«
»Du hast ihn sehr wütend gemacht. Ich dachte schon, er würde uns verhaften.«
»Verhaften? Ach was, Junge, da hätte er sich noch lächerlicher gemacht.«
Dann lachte er laut auf und sagte: »Wir haben ihm was beigebracht, Daniel. Das war Volksaufklärung, also das, was der Staat will und was diejenigen, die dazu in der Lage sind, zu leisten haben. Jetzt hat dieser kleine Idiot etwas zum Nachdenken bekommen, nun weiß er, dass es eine russische Sprache, aber keine sowjetische gibt, so wie es russische Menschen gibt, aber keine sowjetischen. Denn der Sowjet, das ist lediglich die russische Staatsform, das Parlament. Also das, was in England das Unterhaus ist. Wir nennen darum die Engländer ja nicht Unterhäusler. Oder?«
»Holt David uns am Bahnhof ab?«
»Nein. Er weiß doch nicht, wann wir ankommen. Wir sehen ihn im Internat.«
Wir fuhren bis zur Station Grunewald, dann liefen wir die Hagenstraße bis zur Kronberger, wo das Schülerheim stand, in dem ich die nächsten fünf Jahre wohnen sollte. Auf dem Weg dorthin blieben wir ab und zu stehen, damit wir das Gepäck abstellen und die prächtigen Villen bewundern konnten. Es waren zwei- und dreistöckige Häuser, manchmal stand ein Name an der Gartentür, doch an den meisten Grundstücken war nur eine Hausnummer zu sehen.
»Hier wohnen nur reiche Leute«, sagte ich zu Vater, als wir vor einer Villa mit stuckverzierter Fassade eine Pause machten.
»Ja«, sagte er lächelnd, »und nun gehörst du auch dazu.«
Er legte seine rechte Hand auf meine Schulter.
»Ja, Daniel«, sagte er, »jetzt gehörst du dazu. Endlich. Im Schülerheim wirst du endlich unter deinesgleichen sein. Anders als daheim. Aus Schlesien wurden wir vertrieben, und in Guldenberg blieben wir bis heute die Fremden, die nicht dazugehören. Du hast es ja selbst erlebt, sie wollen uns dort nicht. Wir waren und sind die unerwünschten Flüchtlinge. Hinzu kam noch mein Beruf, weshalb man dir und David den Besuch einer Oberschule verweigerte. Wir gehörten nicht dazu. Und das ist für David und dich nun vorbei. Hier seid ihr keine Außenseiter mehr, hier seid ihr willkommen. Du hast großes Glück, dass du hier auf die Schule gehen darfst. Mutter und ich sind sehr erleichtert, euch zwei hier zu wissen.«
Ich nickte, war aber beklommen. Dazuzugehören, willkommen zu sein, das würde für mich überraschend und neu sein, und ich wusste nicht, wie ich damit zurechtkommen würde. Für Vater war das wichtig, er wollte nie klein beigeben, obwohl es uns, seinen Kindern, dann in der Schule vermutlich leichter gefallen wäre, wir vielleicht sogar akzeptiert worden wären. Aber nein, Vater wollte nie verschweigen, dass seine wahre Heimat Schlesien war und dass er, ob es dem Staat und den örtlichen Behörden passte oder nicht, die Aufgabe habe, Gottes Wort zu verkünden, auch und gerade in einem Staat, der den Atheismus als neues Glaubensbekenntnis predigte. Daheim beschimpften mich Schulkameraden als »Polacke«, weil Breslau und der ganze Landkreis inzwischen zu Polen gehörten. Und für andere war ich »der Pfaffe«, weil mein Vater Pfarrer war.
Und nun sollte das aufhören? Ich sollte dazugehören? Willkommen sein?
Ich wusste nicht, was ich meinem Vater antworten sollte und nickte daher nur.
Als wir am Internat ankamen, erschien David bereits im Eingang, er hatte uns wohl durch die großen Fenster der Diele gesehen. Er umarmte Vater, mich begrüßte er mit einem Schlag auf die Schulter, dann griff er nach dem Koffer und sagte, er bringe uns gleich in das Büro von Sybelius, dem Leiter des Internats.
Wir liefen ihm hinterher. In der großen Diele der Villa reihten sich mehrere Sitzbänke aneinander, auf denen einige Schüler saßen, und rund um den Billardtisch standen fünf mit Queues über die grün bespannte Spielfläche gebeugt. Sie sahen kurz auf, murmelten einen Gruß und beachteten uns nicht weiter.
Als wir das Büro von Pfarrer Sybelius betraten, stand dieser auf und kam uns entgegen. Er begrüßte Vater sehr herzlich, er sprach ihn als Amtsbruder an, mir gab er die Hand, dann bat er uns, Platz zu nehmen. Zu David sagte er, er möge Fräulein Rothermund bitten, zu ihm zu kommen.
»Nun, Daniel, seien Sie willkommen«, sagte er zu mir, »Sie werden die nächsten Jahre bei uns wohnen, und ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Sie werden hier das Gymnasium besuchen, das altsprachliche, wie ich gelesen habe. Es ist eins der besten Gymnasien von ganz Berlin, nein, natürlich nur von ganz Westberlin. Ich weiß gar nicht, ob es im Osten noch altsprachliche Gymnasien gibt. – Ah, da kommt Fräulein Rothermund, unsere Hausdame, der gute Geist und die Seele unseres Hauses. – Liebes Fräulein Rothermund, hier ist unser Neuzugang, der Daniel, der Bruder von unserem David. Bitte zeigen Sie ihm sein Zimmer, ich habe noch mit seinem Vater das eine und andere zu bereden. – Daniel, Ihr Gepäck können Sie gleich mitnehmen. Wir sehen uns beim Mittagessen.«
David griff nach dem Koffer, ich nahm die Tasche, und wir folgten der Wirtschafterin, die von einem der Tische im Flur einen Stapel Bettwäsche mitnahm.
»Komme ich in dein Zimmer?«, fragte ich meinen Bruder.
Er schüttelte den Kopf: »Nein, wir werden hier nach Jahrgängen untergebracht. Du bist vorläufig Untertertia, und ich bin schon Obersekunda.«
»Ich werde Sie im Schrankzimmer unterbringen, Daniel«, sagte die Wirtschafterin, die meine Frage gehört hatte, »das ist unser einziges Zimmer mit einem Balkon. Sie werden dort mit fünf anderen Schülern wohnen.«
»In einem Sechs-Mann-Zimmer?«, fragte ich. Der Raum, dachte ich ein wenig fassungslos, muss ja winzig sein, wenn er Schrankzimmer heißt.
»Ja. In einem Internat geht das nicht anders. Die jüngeren Schüler werden in den größeren Mehrbettzimmern untergebracht, die höheren Jahrgänge kommen in Zwei-Mann-Zimmer und für drei Abiturienten haben wir sogar Einzelzimmer. In drei, vier Jahren können Sie vielleicht auch ein Zimmer ganz für sich beziehen. – So, da wären wir. Das ist das Schrankzimmer.«
Sie klopfte kurz an, öffnete die Zimmertür und ging vor uns hinein. An drei der sechs Tische saßen Jungen meines Alters über Bücher und Hefte gebeugt. Als wir eintraten, sahen alle drei auf und musterten mich und mein Gepäck.
»Guten Tag, die Herren, das ist Daniel, euer neuer Zimmergenosse. Er kommt aus einer Kleinstadt in Sachsen, und er wird wie ihr hier das Abitur machen, weil ihm das daheim verwehrt wurde. Damit kennt ihr euch ja besser aus als ich.«
Sie wandte sich an mich: »Rechts, das ist Albert, neben ihm sitzt Friederich, und am hinteren Tisch, das ist Sebastian. Macht euch miteinander bekannt. Das untere Bett ist noch nicht belegt, das ist Ihres, Daniel. Ich lege Ihnen die Bettwäsche aufs Bett, Sie werden es selbst beziehen. Ihre Zimmerkameraden können Ihnen sagen, welcher Schrank und welcher Schreibtisch frei sind. Ich glaube, der Tisch rechts ist noch nicht belegt. Wir sehen uns beim Mittagessen.« Sie verließ den Raum, Sebastian sagte: »Ich habe dort nur ein paar Bücher abgelegt, aber die räume ich gleich weg.«
Der Junge stand auf und griff nach den Büchern auf der Tischfläche, die nun mein Schreibtisch sein sollte. Ich war mit meiner Tasche an der Tür stehen geblieben, wo David den Koffer abgestellt hatte und dann verschwunden war, und sah mir den Raum an, mein neues Zuhause. Ich verstand nun, warum dieser Raum Schrankzimmer genannt wurde, denn von der Fensterfront abgesehen, bestanden die Wände vollständig aus Wandschränken. Auch die Tür, durch die wir eben gekommen waren, war den Schranktüren angepasst und ließ sich nicht von diesen unterscheiden. Auf den ersten Blick wusste man nicht, wo es hinausging und welche Tür lediglich einen Schrank öffnete.
Zwei große Fenster und eine Balkontür gingen auf den Garten hinaus, beherrscht aber wurde das Zimmer von den sechs Tischen und den drei Doppelstockbetten. Der Raum war groß, sogar sehr groß, aber durch die Tische und Betten wirkte alles beengt, er erschien mir wie eine vollgestellte Kammer, in der man kaum drei Schritte geradeaus gehen konnte.
Ich sah zu meinen neuen Zimmergenossen.
»Guten Tag«, sagte ich.
Sie sahen kurz auf, nickten knapp und beugten sich wieder über ihre Schulbücher. Einer von ihnen, den die Wirtschafterin als Sebastian angesprochen hatte, hatte mich etwas länger betrachtet und dann freundlich gelächelt.
»Ja, dann werde ich mich mal hier einrichten. Welcher von den vielen Schränken ist noch nicht belegt?«
Ohne aufzusehen, sagte Albert: »Da, wo kein Schloss dranhängt, die sind alle noch frei.«
»Danke.«
Ich legte meinen Koffer aufs Bett, öffnete ihn und verstaute meine Sachen in einem der freien Schränke. Zwischendurch versuchte ich, mit den anderen ins Gespräch zu kommen.
»Ich gehe zum Gymnasium in der Salzbrunner, ich komme in die Obertertia. Seid ihr auch dort?«
»Ja«, sagte Sebastian. Er legte das Buch beiseite und sah zu mir.
»Ich bin seit diesem Jahr auch auf dieser Penne«, sagte er, »ich bin auch Tertia. Bis Ostern sind wir aber noch ein halbes Jahr Untertertia. Hier fängt das Schuljahr nämlich Ostern an, also machen wir bis Ostern eine verkürzte Untertertia, das ist in Wahrheit unser Probehalbjahr. Aber das geht in Ordnung, denn wir müssen in Latein und Griechisch zwei Jahre aufholen. Du kommst in meine Klasse, wie ich hörte. Allerdings hat die Schule schon vor einer Woche angefangen.«
»Ich weiß. Mein Bruder hatte uns das geschrieben, aber der Brief kam nicht rechtzeitig an. Mein Vater wusste es nicht, man hatte ihn falsch informiert.«
»Viel hast du nicht verpasst, nur die Stadtbesichtigung mit Sybelius. Am Samstag hat er uns Neue zu einer Fahrt in die Stadt eingeladen. Wir fuhren zum Zoo, sahen dort im Filmpalast Die Trappfamilie in Amerika, das ist so ein christlicher Hollywood-Schinken, und dann gab es für uns eine Erbsensuppe bei Aschinger. Dann ging es mit dem 19er-Bus zurück. Wir saßen auf dem Oberdeck des Busses und er zeigte uns ein paar Besonderheiten, also berühmte Gebäude und Kulturdenkmale. Unvergesslich von dem Tag ist mir nur ein Satz von ihm. Er sagte, wir sollten nicht denken, dass wir im Gymnasium und im Internat aufgenommen wurden, um Bananen zu essen.«
»Und was ist mit der Schule? Habe ich da viel verpasst, Sebastian?«
»Ach, alles machbar. Aber nenn mich Basti, das machen alle. Latein und Griechisch, da haben wir echt zu tun. Der A- und der B-Zweig haben das ja schon seit der Quinta und Quarta, die sind uns Jahre voraus, das haben wir bis zum Abi aufzuholen. Dafür ist Mathe kinderleicht, da hängen die hier hinterher.«
»Sind Griechisch und Latein die Hauptfächer?«
»Nein, das Hauptfach, das habe ich in der ersten Woche mitbekommen, das Hauptfach hier ist Beten. Hier wird im Heim vor dem Frühstück und zu jeder Mahlzeit gebetet, Tag für Tag, und sonntags sowieso. Im Gymnasium gibt's vor jedem Schulbeginn frühmorgens ein Gebet, auch dann, wenn wir in der ersten Stunde Russisch haben. Diese Penne gilt ja als außerordentlich, sie ist angeblich die beste von ganz Berlin, aber ich denke, wer an dieser Schule gut beten kann, kommt auch so durchs Abitur.«
»Wir haben also wirklich Russisch? Hier in Westberlin? Mein Bruder sagte es mir, darum habe ich mein russisches Wörterbuch mitgenommen.«
»Jaja, alle vom C-Zweig haben Russisch, weil wir damit drüben, in patrída, der Heimat, schon angefangen haben.«
»Und was ist mit den Büchern? Bekommen wir die von der Schule?«
»Ja, du bekommst sie morgen von unserer Klassenlehrerin, die heißt Marmarschke. Fräulein Marmarschke, und genauso ist sie. Die haben wir in Deutsch und Englisch.«
»Wie ist diese Marmarschke?«
»Marmarschke! Geht so. Etwas etepetete, aber ganz in Ordnung. Die Bücher bekommst du übrigens kostenlos, sind aber alle bereits benutzt. Alles Wichtige ist schon angestrichen, und bei den Latein- und Griechisch-Texten ist bei den schwierigen Vokabeln schon die Übersetzung hingekrakelt. Wie du siehst, hat alles seine Vor- und Nachteile.«
»Kann ich mir deine Bücher einmal ansehen?«
»Bitte. Das sind die hier«, sagte Sebastian und wies auf den kleinen Stapel auf seinem Schreibtisch.
Als ich mir das erste Buch nahm, schrillte eine Klingel.
»Mittag«, sagte er und stand auf, »komm, wir gehen essen.«
Der Speiseraum war im unteren Geschoss des Hauses, in dem ausgebauten Keller, wo sich auch die Küche und die Vorratskammern befanden. Fünf lange, blank gescheuerte Holztische, an denen mehr als vierzig Stühle standen, füllten den Raum. Auf jedem der Tische standen zwei große Schüsseln mit einem rötlichen Fruchtquark, zwei Stapel kleiner Glasschälchen und ein Keramiktopf mit Besteck, und vor jedem Sitzplatz lag eine einzelne Tomate. Aus allen Zimmern waren Jungen gekommen, Schüler der verschiedenen Schuljahrgänge von der Untertertia bis zur Oberprima. Wie ich kamen alle aus dem Osten, wo sie keine Oberschule besuchen durften, wie mir mein Vater erklärt hatte, weil sie aus Elternhäusern stammten, die der ostdeutsche Staat nicht fördern wollte, die Söhne von Ärzten und Pfarrern, die »Kinder der Intelligenz«, wie es in den Zeitungen hieß. Der Staat verweigerte ihnen den Zugang zum Abitur, und förderte stattdessen diejenigen, die bisher benachteiligt waren, die Kinder der Arbeiter, des Proletariats.
Ich stellte mich mit Sebastian in die Schlange vor der Essensausgabe, um einen Teller mit Kartoffeln und Königsberger Klopsen entgegenzunehmen. Die Frau, die die Teller auffüllte und durch die geöffnete Klappe reichte, war wohl die Köchin, sie war klein und sehr dünn und sicherlich schon sechzig Jahre alt. Sie schaute mich an und sagte sehr freundlich: »Ach, ein neues Gesicht. Du bist heute den ersten Tag bei uns, nicht wahr?«
»Ja. Ich heiße Daniel.«
»Schön, Daniel, dann lass es dir schmecken.«
Sie sprach einen unüberhörbaren ostpreußischen Dialekt und war, von den Mitschülern abgesehen, bisher die einzige der Erwachsenen im Internat, die mich duzte.
Als ich mich neben Sebastian setzen wollte, meinte er, ich würde mich heute gewiss zu Sybelius, den Internatsleiter, zu setzen haben.
»Er wird dich vorstellen, das macht er bei allen Neuen.«
Im selben Moment erschien Sybelius mit Fräulein Rothermund, meinem Vater und David. Sie gingen zu dem fünften Tisch, der quer zu den anderen stand. Vater rief mich zu sich. Ich ging mit meinem Teller zu ihm, und er sagte, wir beide würden heute mit David bei Pfarrer Sybelius sitzen, man würde mir später meinen Sitzplatz zuweisen.
Als wir uns setzten, kamen Fräulein Rothermund und David von der Küchenklappe mit vier Tellern zurück, von denen sie einen vor Vater auf den Tisch stellten, einen zweiten vor Herrn Sybelius, dann setzten auch sie sich.
Sybelius stand auf, räusperte sich zweimal, und als Ruhe eingekehrt war, sagte er: »Ich darf euch einen neuen Schüler vorstellen. Das hier ist Daniel, er wird das Evangelische Gymnasium besuchen, und ihr werdet ihm helfen, sich bei uns einzuleben. Sein Vater hat ihn begleitet, er ist ein Amtsbruder von mir, und ich bitte ihn, heute das Tischgebet zu sprechen.«
Er setzte sich, Vater stand auf und sprach den Mittagssegen. Als er sich wieder hinsetzte, konnten endlich alle essen. Das Besteck klirrte, und meine Mitschüler unterhielten sich leise.
Ich saß zwischen Vater und Herrn Sybelius. Sie sprachen über die aktuelle Situation in Ungarn und den Kardinal József Mindszenty, der seit zwei Jahren in der amerikanischen Botschaft in Budapest lebte, wo er Asyl erhalten hatte. Dann erzählte uns Sybelius, dass er fünf Jahre in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe, in Colorado Springs, als Seelsorger in einer großen Behinderteneinrichtung von World Vision, einer internationalen evangelikalen Hilfsorganisation.
»Es war fast ein eigenes Dorf«, erzählte er, »zwölf Häuser, eine eigene Bäckerei, Gärtnerei und Großküche.«
Sybelius wies auf das Abzeichen an seinem Revers, ein kleines silbernes Kreuz auf einer Kugel.
»Das ist das Zeichen der Organisation World Vision, und ich trage es seit der Zeit, als ich dort gearbeitet habe, da mich diese Einrichtung und das Engagement der Evangelikalen überaus beeindruckt hat. Seit meiner Rückkehr in die Heimat bemühe ich mich, auch hier bei uns eine vergleichbare Einrichtung aufzubauen.«
Dann wandte er sich an mich und fragte nach meinen Interessen und ob ich meinem Vater folgen und gleichfalls Pfarrer werden wolle.
»Das weiß ich nicht«, sagte ich, »am liebsten würde ich etwas mit Musik machen.«
»Spielen Sie ein Instrument?«
»Ja, Klavier und Flügelhorn, aber nicht sehr gut. Ich habe zu spät angefangen, sagte meine Klavierlehrerin.«
»Ja, das ist wie mit den Sprachen«, sagte Sybelius, »je später man damit anfängt, desto schwieriger wird es.«
An den anderen Tischen wurde die Unterhaltung lauter, alle Schüler waren mit dem Essen fertig, sie hatten den Quark gegessen und die Tomate und warteten darauf, dass Sybelius endlich die Mahlzeit beendete.
Nachdem auch er seine Nachspeise gegessen hatte, stand er auf und sprach ein kurzes Dankgebet. Im nächsten Moment setzte lautes Stühlerücken ein, sämtliche Jungen standen auf und eilten in ihre Zimmer, nur fünf von ihnen blieben zurück, sie waren offenbar zum Tischdienst eingeteilt und räumten das Geschirr und Besteck zusammen, um es in die Spülküche zu bringen.
Vater verabschiedete sich von Sybelius und bat mich, ihm vor seiner Heimreise mein Zimmer zu zeigen. Ich ging ihm voraus und öffnete die Tür, es waren vier meiner Mitbewohner im Zimmer. Sie saßen an ihren Tischen, zwei von ihnen standen auf, als sie uns sahen.
»Das ist mein Vater«, sagte ich, »und das ist das Zimmer. Das Bett dort hinten ist meins, das untere, ich muss es noch beziehen. Und das ist mein Schreibtisch.«
Vater warf nur einen kurzen Blick auf Bett und Tisch, dann wandte er sich an meine Mitschüler.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, Sie werden sich mit meinem Daniel verstehen. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Schuljahr und dass Sie sich in dieser großen und für Sie neuen Stadt bald und gut einleben.«
Alle lächelten etwas verlegen, aber keiner sagte etwas.
»Dann werde ich mich auf den Heimweg machen. Begleitest du mich mit David bis zur S-Bahn?«
»Natürlich.«
Vater bestand darauf, noch einmal in den Küchentrakt zu gehen, er wollte sich auch von Fräulein Rothermund verabschieden.
Ich ging in Davids Zimmer, um ihm Bescheid zu sagen. Er zog sich eine Jacke über und kam mit mir in die geräumige Diele des Internats, wo wir auf Vater warten sollten.
Auf der Straße legte Vater mir den Arm um die Schulter.
»Hier bist du gut aufgehoben. Ich habe einen guten Eindruck von deinen Kameraden. Herr Sybelius und Fräulein Rothermund werden acht auf dich geben, wir kennen sie ja schon von David. Du wirst aber natürlich mehr auf dich gestellt sein als daheim und schneller selbständig werden müssen. Das wird nicht immer einfach. Wenn du Heimweh bekommst, dann schreib Mutter und mir. Wenn man einen langen Brief an die Eltern schreibt, das kann bei Heimweh helfen.«
Ich lächelte beklommen, doch er sah mich aufmunternd an.
»Es sind nicht die Dümmsten, die hier gelandet sind, Daniel«, sagte er, »es sind ja vor allem Söhne von Pfarrern und Ärzten, aus gebildeten Familien. Da ist von vornherein ein ganz anderes Niveau da. Da bist du in eine Gemeinschaft gekommen, der ich dich sorglos anvertrauen kann. Und David wird dir auch beistehen. Nicht wahr, David?«
David nickte, er war wohl nicht allzu erfreut, dass sein jüngerer Bruder jetzt auch in das Internat gekommen war.
Wir begleiteten Vater noch bis zum Bahnsteig und warteten mit ihm, bis die S-Bahn nach Potsdam einfuhr.
Auf dem Rückweg ins Heim erklärte mir mein Bruder ein paar der Gepflogenheiten und Rituale im Heim und zählte die Schulgesetze im Gymnasium auf. Ich fragte ihn, wie die Schüler der Ostklassen, des C-Zweiges, mit den Westberliner Schülern auskommen. Er meinte gleichmütig, sie hätten mit denen keinen Kontakt.
»Man übersieht sich, verstehst du«, sagte er und grinste, »für die sind wir die Russen.«
»Dann gehören wir wieder einmal nicht dazu?«
»Wer will schon dazugehören!«
»Dann ist es wie daheim?«
»Nein, es gibt einen mächtigen Unterschied. Hier sind wir keine Einzelkämpfer, hier ist es der ganze C-Zweig.«
Er schwieg einen Moment und fuhr dann fort: »Aber was auch passiert, beschwer dich nicht. Über nichts! Niemals! Das ist eine feste Regel im C-Zweig, ein eherner Grundsatz. Und vor allem darfst du dich über nichts bei den Eltern beklagen, das bringt gar nichts. Die kommen dann aufgeregt nach Berlin gefahren, reden mit Sybelius oder mit Herrn Seeger, unserem Schuldirektor, und das war's dann. Ändern tut sich nichts.«
So überraschend und neu, wie Vater meinte, würde es wohl in Westberlin für mich nicht werden, aber hier gab es immerhin meine Klassenkameraden, die wie ich im Internat wohnten und aus dem Osten kamen.
Als wir unsere Straße erreichten, sagte er noch, dass alle Schüler nach Jahrgängen getrennt untergebracht seien und dass man auch in der Freizeit im Internat und in den Schulpausen im Gymnasium unter sich bliebe. Da er mir das schon zweimal gesagt hatte, grinste ich und sagte: »Ich hab verstanden, David. Abstand ist angesagt. Ich werde dir nicht auf die Nerven gehen.«
Die Schüler in meinem Zimmer kannte er nicht, sie seien alle erst vor ein paar Tagen eingetroffen, nur Sebastian sei schon ein paar Monate da, weil er Hals über Kopf fliehen musste, noch bevor er die achte Klasse in seiner Heimatstadt beenden konnte.
»Genaues weiß ich nicht. Da musst du ihn selbst fragen.«
»Und was macht ihr abends?«
»Jeder, was er will. Der eine paukt noch Vokabeln, andere lesen etwas. Billard wird viel gespielt. Ein paar von uns verdienen sich ein paar Mark dazu?«
»Du auch? Womit denn?«
»Am einfachsten ist es, bei der Zeitung unterzukommen, das mache ich auch. Da ziehst du mit den Abendblättern durch die Kneipen und versuchst, sie loszuwerden. Bei der Zeitung kann jeder anfangen, die zahlen aber nur ein paar Pfennige. – So, da wären wir wieder. Ich geh auf mein Zimmer. Wenn es etwas Wichtiges gibt, kannst du mich stören. Aber bitte nicht wegen jeder Kleinigkeit.«
»Verstehe.«
»Man sieht sich beim Abendessen. Antío!«
»Was meinst du?«
»Antío! Das ist griechisch. Heißt so viel wie tschüss, auf Wiedersehen, tschau.«
»Ah ja. Antío, David.«
II »Pack die Badehose ein«
Als ich vom S-Bahnhof zurückkam, saß in unserem Zimmer nur noch Sebastian. Albert, Helmuth und Friederich waren verschwunden und auch von dem sechsten Zimmergenossen war nichts zu sehen. Ich packte die restlichen Sachen aus meinem Koffer aus und verstaute alles im Schrank, den leeren Koffer wollte ich unter mein Bett schieben, doch Sebastian sagte, auf der obersten Etage des Hauses gebe es einen Abstellraum für Koffer und größere Taschen.
Ich bezog mein Bett, wobei ich mir schmerzhaft den Kopf am Lattenrost des oberen Bettes stieß. Dann setzte ich mich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch und packte meine Tasche aus. Die Wörterbücher stellte ich auf den hinteren Rand der Arbeitsplatte, die Romane, die Rilke-Gedichte und die vier Bände mit Theaterstücken legte ich in das unterste Schubfach. Und unter diesen Büchern versteckte ich meine eigenen Manuskripte, fünfzehn längere Gedichte, die mir gelungen erschienen, drei Erzählungen und die beiden Theaterstücke, an denen ich bis zum Sommer geschrieben hatte.
»Du bist schon länger hier?«, fragte ich Sebastian, als er sein Buch zuklappte und zu mir sah.
»Hier im Internat? Seit März.«
»Und wieso bist du so lange schon hier?«
»Ich bin im Januar abgehauen, wohnte erst zwei Monate bei einem Onkel, einem völlig Verrückten, bevor ich hier einen Platz bekam.«
»Und du bist auch schon seit Januar auf dem Gymnasium?«
»Ja. Ich kam gleich in eine Untertertia, allerdings im A-Zweig, weil es den C-Zweig, also die Klassen für die Ostdeutschen, erst ab Obertertia gibt. Ich hatte dort Unterricht in Latein und Griechisch mit Leuten, die das schon zwei und drei Jahre lernten. Ich musste also aus einer Sprache lesen und übersetzen, bei der ich das Abc kaum beherrschte. Und nun fange ich mit euch nochmal richtig von vorn an. In den vier Stunden Latein und Griechisch diese Woche habe ich mehr verstanden als im letzten halben Jahr.«
»Kannst du mir zeigen, was ich versäumt habe?«
»Sicher. Das war nicht viel, du bist ja nur eine Woche zu spät. Komm her und bring deinen Stuhl mit.«
»Wieso bist du schon seit Januar in Westberlin? Warum hast du daheim nicht noch die achte Klasse abgeschlossen?«
»Ach, im Grunde eine dumme Geschichte. Ich hatte bereits zwei Verweise, weil ich ein paar Mal Wandzeitungsartikel geschrieben und ans Schwarze Brett geheftet hatte, die als böswillig eingestuft wurden. Und nach den Weihnachtsferien gab es am zweiten Schultag für die siebenten und achten Klassen eine Filmvorführung in der Aula. Wir dachten alle, es wird so ein Naturfilm sein über Eichhörnchen oder Landwirtschaft, das Übliche, aber ich Esel hatte am Vortag in der Aula die Musikanlage präpariert. Als der Film anlief, schaltete sich zur gleichen Zeit das Tonbandgerät ein. Pack die Badehose ein, ertönte es, während uns ein Film gezeigt werden sollte, der Propaganda für die Kollektivierung macht. Stell dir vor, da erzählen LPG-Bauern, wie glücklich sie in der Genossenschaft sind, und die halbe Aula singt begeistert: Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, und dann nischt wie raus nach Wannsee. Jedenfalls sangen sie, solang es in der Aula noch dunkel war.«
»Muss sehr komisch gewesen sein.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: