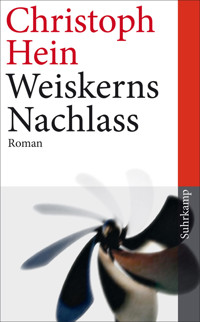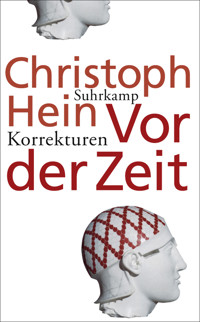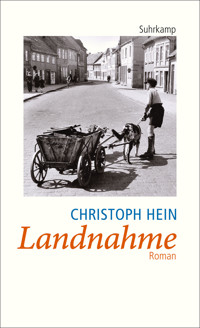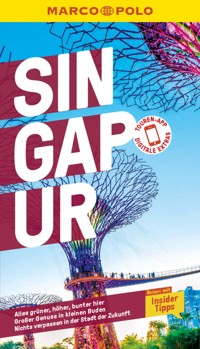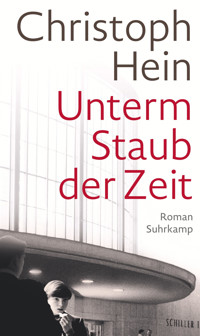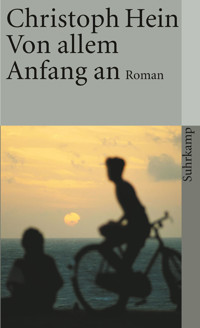
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keinem, auch nicht Lucie, der schönen Klassenbesten, darf der dreizehnjährige Daniel sagen, wohin sein Vater ihn gleich bringen wird: nach Westberlin. Dort soll er das Gymnasium besuchen, weil das zu Hause, in der mitteldeutschen Kleinstadt, nicht möglich ist. Der neue Schuldirektor und der Pfarrer warnen vor Besuchen in der Heimatstadt: »Es sei zu gefährlich, sagten sie, weil ich heimlich nach Westberlin gegangen sei. Ich hatte die Republik verraten und stand auf der Liste.« Mit den Mitteln einer fiktiven Autobiographie erzählt Christoph Hein von einer Jugend in der DDR der fünfziger Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christoph Hein Von allem Anfang an
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 7. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 3634.
© 2002, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Erstveröffentlichung 1997, Aufbau-Verlag, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
Umschlagfoto: Kangoro Nakagawa/Photonica
eISBN 978-3-518-77662-9
www.suhrkamp.de
Von allem Anfang an
Inhalt
Krieg zur See
Schöne Bescherung
Flüssige Luft
Großvater und die Bestimmer
Am Russensee
Der Evangelist Lukas
Ende der großen Ferien
Die schlummernde Venus und die Hausordnung
Glace surprise
Krieg zur See
An dem Tag, an dem ich mich von Tante Magdalena verabschieden musste, traf ich Lucie vor dem Tor in der Molkengasse. Sie hatte mich gesehen und war stehen geblieben, um auf mich zu warten. Sie trug ein dunkles Samtkleid, ihr Haar war mit einer schwarzen Schleife zusammengebunden, in der Hand hielt sie eine Rose. Anscheinend ging sie zur Frühmesse. Sie sah so schön aus, dass ich kein Wort herausbrachte. Ich lächelte verlegen.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie.
»Ich muss jemanden besuchen. Meine Tante«, sagte ich.
»So früh?«
»Ja, ich fahre weg.«
Ich hätte ihr beinahe erzählt, dass ich mich bei der Tante verabschieden müsse, weil ich die Stadt verlasse und für immer nach Westberlin ziehe, aber dann erinnerte ich mich noch rechtzeitig daran, wie sie mich bei Fräulein Kaczmarek verraten hatte.
»Ich wollte dir noch sagen, dass ich das mit der Oberschule gemein finde«, sagte Lucie, als habe sie etwas von meinen Gedanken erraten, »du hast viel bessere Zensuren als Bernd.«
»Wenn es geklappt hätte, wären wir jeden Tag zusammen mit der Bahn gefahren. Schade, aber das ist Schicksal.«
»Und was machst du? Hast du eine Lehrstelle?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Gehst du auch nach Westberlin? Wie dein Bruder?«
»Wie kommst du denn darauf?« Ich spürte, dass ich rot wurde, aber ich konnte ihr nicht sagen, dass ich ebendas vorhatte, und zwar in genau einer Stunde.
»Ich dachte nur. Ich würde es verstehen, Daniel.«
»Du?«
»Ja. Na, ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, man sieht sich gelegentlich.«
»Das hoffe ich auch, Lucie.«
Ich reichte ihr plötzlich die Hand. Sie war überrascht, weil wir uns noch nie die Hand gegeben hatten, aber dann nahm sie das Buch und die Blume in ihre Linke, und wir verabschiedeten uns förmlich und etwas verlegen. Sie lief in ihre Kirche, und ich sah ihr nach, bis sie verschwunden war.
Als ich die Treppe hochrannte, war ich so vergnügt, dass ich laut vor mich hin sang.
Tante Magdalena wohnte über der Bäckerei Theuring in der Mühlenstraße, wo wir unser Brot kauften und die Brötchen und manchmal auch ein paar Plunderstücke. Der Eingang zu ihrer Wohnung war aber nicht in der Mühlenstraße, man musste um die Ecke gehen, in die Molkengasse, zu dem großen Holztor, das im Unterschied zu allen anderen Toren in der Stadt nie offen stand und in das eine Tür eingeschnitten war. Wenn man diese öffnete, bewegten sich die beiden mächtigen Torflügel in den Angeln, und man musste einen Moment warten, bis sie wieder stillstanden und man über den Fußteil des eisernen Türrahmens treten konnte. Durch einen breiten Torgang gelangte man auf den Hof, dort waren die Karnickelställe des Bäckers und ein Drahtverschlag für die Hühner. Es gab auch einen winzigen, mit Draht geschützten Garten, in dem Tante Magdalena Kräuter anbaute.
»Kräuter muss man selber ziehen, Daniel«, sagte sie, »die Kartoffeln kann man sich kaufen und Brot und Milch und alles andere. Mit Kräutern hat es so seine eigene Bewandtnis, die will ich mir nicht von fremden Händen ziehen lassen. Sieh mal, den Dill hier, den braucht man nun alle Nase lang, in meiner Küche muss jedenfalls alles gut gedillt sein. Wenn man aber damit nicht umgehen kann, wenn man nicht weiß, dass der Dill auch Zauberkraft besitzt, da kann es das reinste Hexenkraut sein. Meinen Dill kann sich jede Braut unbesorgt in den Schuh tun.«
Die Fenster im Erdgeschoss gehörten zur Backstube und waren sommers wie winters leicht geöffnet. Man hörte die Geräusche der Maschinen, den Knetarm der Backmulde, das elektrische Sieb und die Schlagmaschine, das metallene Klicken der Türen und des Gestänges vom Backofen. Und natürlich die Stimmen von Bäcker Theuring und seinen beiden Gesellen.
Links schloss sich ein Hofgang an, von dem man zu den Hintertüren der anderen Häuser in der Molkengasse gelangte und der bis zum Anger reichte, wo die Garagen standen. Am Ende des Torgangs rechter Hand führten drei Steinstufen zu einer Tür, hinter der sich ein Treppenhaus und der Eingang zur Backstube von Herrn Theuring befanden.
Über eine gewundene, sehr schmale Treppe gelangte man in den ersten Stock zur Wohnung von Tante Magdalena. Wenn man die Wohnungstür öffnete, war man in ihrer Wohnküche, in der neben dem Eingang ein Gaskocher auf einem mit bunten Stoffgardinen verhängten Regal stand. Zwischen dem Fenster und der nächsten Tür waren der Eisschrank, ein Schränkchen, ein ausziehbarer Tisch vor dem hohen Küchensofa und zwei Stühle. An die Küche schloss sich das gute Zimmer an. Auf dem runden Tisch mit den Intarsien lag stets eine feine, durchbrochene Decke. Sie war so fein, dass sie eher wie ein kostbares Netz wirkte und die Einlegearbeiten der Tischplatte nicht verhüllte, sondern hervorhob. Um den Tisch standen sechs Stühle mit hohen geschnitzten Lehnen und dunklen Samtpolstern. Neben dem Fenster, das zum Hof ging, war eine Vitrine. Der obere Teil hatte Glastüren, hinter denen farbige Kelche zu sehen waren und Blumenvasen, in die Tante Magdalena aber nie Blumen stellte. Das seien Ziervasen, hatte sie mir erklärt, viel zu schön, um sie zu benutzen. Daneben befand sich die Kommode mit dem Musikwerk, einer alten Spieluhr. Eine schmale niedrige Tür führte zu ihrer Schlafkammer, einem winzigen Raum ohne Fenster. Tante Magdalena ließ uns nie hinein. Wenn sie etwas aus der Kammer benötigte, vergewisserte sie sich zuvor, dass wir beschäftigt waren. Sie huschte hinein und verschloss die Tür hinter sich, um dann, sorgsam um sich blickend, mit dem Gesuchten herauszukommen. Die Schlafkammer lag direkt über dem großen Ofen der Backstube, dadurch war es dort immer warm, und sie brauchte im Winter nicht zu heizen. Auch die beiden anderen Räume heizte sie selten, da die Backstube an sechs Tagen in der Woche ausreichend Wärme in die darüberliegende Wohnung abgab.
Im Sommer wurde es dort unerträglich heiß. Als ich Tante Magdalena einmal fragte, wie sie in einer so heißen Kammer schlafen könne, lachte sie auf und sagte: »Ich freue ich mich einfach auf den Winter, weil ich dann so viel Geld für Kohlen sparen kann. Und wenn ich aufwache, ist schon geheizt. Wie bei den vornehmen Herrschaften.«
Einmal, als die Tür nur angelehnt war und Tante Magdalena in der Küche beschäftigt, war meine Schwester einfach in die Kammer gehuscht. Tante Magdalena war sofort erschienen und hatte Dorle rasch herausgezogen und dann die Tür verschlossen. Sie war sehr aufgeregt und schimpfte mit ihr, und Dorle sagte, sie hätte nur die Tür richtig zumachen wollen, aber Tante Magdalena wirkte nervös und konnte sich gar nicht beruhigen. Als wir nach Hause gingen, fragte ich Dorle, was in der Kammer ist.
»Es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Verstehst du?«
Ich nickte. Vor ein paar Monaten hatte uns der Superintendent besucht, die Familie hatte mit ihm zusammen Mittag gegessen. Mitten in der Woche gab es Fleisch und jeder bekam eine dünne Scheibe. Als der Teller mit den beiden restlichen Stücken nochmals herumging, sagten wir alle, dass wir satt seien, wie Mutter es uns eingeschärft hatte. Der Superintendent hatte sich schließlich beide Bratenscheiben vom Teller genommen. »Es wäre doch schade, wenn die Gottesgabe verdirbt«, sagte er, als er das Fleisch vor unseren Augen auffraß. Später hatte er von seinen Besuchen in den anderen Pfarrhäusern erzählt und gesagt, dass es bei einem der Pfarrer ausgesehen habe wie bei Hempels unterm Sofa. Dorle hatte ihn gefragt, was er damit meinte, und er hatte erklärt, dass es in der Amtsstube dieses Pfarrers sehr unordentlich sei und ein fürchterliches Durcheinander herrsche.
»Was ist denn drin? Red schon«, drängte ich Dorle.
»Lauter Kisten. Und stapelweise Kartons. Man kann sich in der Kammer gar nicht bewegen, so voll ist sie. Wenn mein Zimmer so aussehen würde, dann bekäme ich Stubenarrest, und zwar eine ganze Woche.«
»Und was ist in den Kartons, hast du das gesehen?«
»Nein. Vielleicht hat sie Schätze dort gesammelt.«
»In Pappkartons? Du bist blöd. Woher soll Tante Magdalena denn Schätze haben.«
»Vielleicht hat sie geerbt und ist ganz reich.«
»Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Jedenfalls habe ich die Kammer gesehen und du nicht.«
Wir gingen regelmäßig nach der Schule zu Tante Magdalena, meine Geschwister und ich, um dort unsere Schularbeiten zu machen. Sie half sehr großzügig dabei. Das Schönschreiben, das ihr besonders wichtig war, mussten wir allein bewältigen. Sie ermahnte uns lediglich, langsam zu schreiben. Bei allen anderen Schularbeiten brauchten wir nur eine längere Pause zu machen und verzweifelt die Augen zu verdrehen, dann setzte sie sich neben uns und flüsterte das richtige Wort, die fehlende Zahl, erst tonlos und unhörbar, und wenn wir sie nicht erraten konnten, ein wenig lauter, bis wir die gesuchte Lösung verstanden hatten und sie rasch niederschrieben. Anschließend, als ob sie sich vor sich selber entschuldigen wollte, sagte Tante Magdalena: »Es ist nicht zu glauben, was man von euch verlangt. Ich hätte das nicht gewusst. Aber ihr seid ja so schlau.« Und dann lachte sie. Nach ihren Worten waren wir die begabtesten Kinder, die sie je in ihrem Leben gesehen hatte.
Sie war nicht unsere richtige Tante, sondern eine Nenntante, wie meine Mutter erklärte. Sie hatte keine Kinder, auch keinen Mann, sie war nie verheiratet gewesen. »Es gibt solche Frauen«, hatte Mutter gesagt, »dafür habt ihr Tante Magdalena ganz für euch.«
Von ihr und meiner Familie habe ich schon immer erzählen wollen, doch jedes Mal, wenn ich versuchte, darüber zu sprechen, musste ich feststellen, dass die Geschichten in meiner Erinnerung merkwürdige Lücken hatten, ein regelrechter Mottenfraß. Tante Magdalena kann ich nicht mehr fragen. Ich glaube auch nicht, dass sie meine Fragen beantwortet hätte, wenn ich sie früher gestellt hätte. Ich weiß nicht einmal, ob ich es damals überhaupt gewagt hätte, sie über die Dinge zu befragen, über die man früher nicht gern sprach, jedenfalls nicht vor einem Kind. Doch wenn ich noch länger warte, stirbt noch der eine oder andere, der mir dies und das berichten oder berichtigen kann. Deshalb habe ich einfach begonnen und werde versuchen, die Lücken zu füllen mit dem, was ich erlebt, und mit dem, was ich gesehen, aber nicht verstanden habe. Mit dem, was ich gehört habe, aber was mir nicht erzählt wurde. Und mit dem, was vor meinen Augen geschah und was ich dennoch nicht sah. Damals.
Ich versuche, die Geschichten zu vervollständigen, sie mit den Bruchstücken der Erinnerung anzufüllen, mit Bildern, die sich mir einprägten, mit Sätzen, die aus dem dunkel schimmernden Meer des Vergessenseins dann und wann aufsteigen und ins Bewusstsein dringen. Manche dieser Bruchstücke haben schartige Kanten, die in mir etwas aufreißen. Kleine Schnitte in der Haut, aus denen etwas hervorquillt. Oder wie Tante Magdalena damals sagte: »Wenn du mit dem nackten Hintern in einem Ameisenhaufen sitzt, kannst du keinen Faden in eine Nähnadel einfädeln. Probier das mal, mein Junge.«
Tante Magdalena hatte früher als Wirtschafterin bei einem Professor Buhrow gearbeitet. Sie sei eine Hausdame gewesen, sagte sie mir, und das sei etwas ganz anderes als ein Dienstmädchen oder eine Köchin. Sie habe sich um alles in der Villa des Professors gekümmert und den anderen Angestellten die Arbeit zugeteilt. Sie bestimmte, was gekocht wurde, sie besaß auch die Schlüssel für die Vorratskammer und die Vitrine mit den Schubläden, in denen das bessere Besteck und die Kandelaber aus Gold und Silber aufbewahrt wurden. Als meine Eltern nach dem Krieg hierher zogen, hatte sie die Stelle bereits aufgeben müssen. Der Professor hatte seine Häuser verloren und erhielt nur noch sein Gehalt, mit dem er keine Dienstboten und auch keine Hausdame bezahlen konnte. Sie hatte jetzt viel Zeit und ging häufig in die Kirche und zu den Frauenabenden, die mein Vater als Gemeindepfarrer leitete, und weil er sie darum gebeten hatte und sie ihn bewunderte, half sie manchmal meiner Mutter in der Küche und bei der Wäsche. Wir Kinder hatten sie gern, weil sie immer vergnügt war, und gingen sehr häufig zu ihr, fast jeden Tag.
Nach der Schule war ich mit Dorle, meiner jüngeren Schwester, oft allein bei Tante Magdalena. Mein älterer Bruder kam später oder gar nicht zu ihr, und die beiden jüngeren Brüder, die noch nicht in die Schule gingen, wurden nach Hause geschickt, sobald meine Schwester und ich mit den Schularbeiten begannen. Waren wir zu zweit, setzte sie einen an den Tisch in der Wohnküche, der andere durfte in der guten Stube sitzen, wo sie zuvor eine abwaschbare Decke über den Teil der Tischplatte gelegt hatte, auf dem ich oder Dorle zu schreiben hatte.
Waren wir mit den Schularbeiten fertig, nahm sie die Hefte in die Hand, schaute sich die Arbeit an und lobte uns. Danach setzten wir uns an den Küchentisch, und sie spielte mit uns »Krieg zur See«. Ich glaube, es war das einzige Spiel, was sie besaß. Es war ein Würfelspiel. Die Figuren wanderten über eine Pappe, auf die ein Hafen aufgemalt war und ein dunkelblaues, aufgewühltes Meer, auf dem verschiedene Kriegsschiffe, Fregatten, Korvetten, Briggs, Panzerschiffe und Segelkriegsschiffe, unterwegs waren. In der Mitte der Spielfläche kämpfte das Panzerschiff »Braunschweig« gegen die »Lord Nelson« von der britischen Kriegsflotte. Vor den Geschützen und Panzerdrehtürmen leuchtete es gelb und rot und der Himmel war mit schwarzem und grauem Rauch bedeckt. Winzige Figuren waren auf den Schiffen zu erkennen, Kapitäne, die mit einem Fernrohr auf dem Oberdeck standen, Matrosen, die Geschütze luden, mit Munitionskisten an der Reling entlangliefen oder über Bord fielen, schiffbrüchige Matrosen in Rettungsbooten mit weißen Flaggen. Die Spielsteine wanderten über das Schlachtengemälde, hatten Schiffe zu versenken und waren von Feinden bedroht. Sicherheit und Sieg versprachen nur die Aufenthalte auf einem Unterseekreuzer und einem Torpedoboot, die unzerstörbar am rechten und linken Rand des Spielfeldes die Stellung hielten und mit treffsicheren, tödlichen Torpedos den Krieg zur See beherrschten und entschieden. Tante Magdalena hatte uns gesagt, wir sollten von diesem Spiel in der Schule nichts erzählen, es sei schon sehr alt und stamme noch aus dem 1. Weltkrieg, einer Zeit, an die man sich heute nicht mehr erinnern wolle oder nur mit sehr bösen Worten. Es war also ein verbotenes Spiel, was seinen Reiz erhöhte. Und in der Schule hätten wir ohnehin nie davon erzählt, jedenfalls nicht den Lehrern.
Auch bei diesem Spiel lachte sie vergnügt und herzlich. Und sie ließ uns gewinnen, weshalb wir alle sehr gern mit ihr spielten.
Tante Magdalena lachte viel. Ihr Lachen begann stets mit einem lauten Juchzer und verlief sich in einem abschwellenden Gekicher. Den Juchzer stieß sie mit geöffnetem Mund hervor, sie hielt rasch die rechte Hand über die Lippen und nahm sie erst weg, wenn sie sich ausgelacht hatte. Sie lachte über die Scherze der Erwachsenen ebenso herzlich wie über die Späße der Kinder. Sie lachte auch, wenn es eigentlich überhaupt nichts gab, worüber man lachen konnte. Ich glaube, sie lachte, weil sie verlegen war. Sie lachte, weil sie nicht mehr weiterwusste und nichts mehr sagen konnte. Aber sogar wenn sie traurig und verzweifelt war, klang ihr Lachen unbeschwert und fröhlich. Auch der laute Juchzer, mit dem sie selbst dann zu lachen begann.
»Krieg zur See« wurde oft gespielt, zweimal, dreimal in der Woche, aber stets nur eine Partie. Am liebsten spielte ich allein mit Tante Magdalena. Wenn ich nur mit ihr würfelte, konnte es keinen Streit und keine Tränen geben.
Und außerdem legte Tante Magdalena nach dem Spiel eine der durchlöcherten Metallplatten mit den eingelassenen Stiften in die Spieluhr, klappte die Stange mit den Gummirollen darüber, mit der die Platte auf dem Teller befestigt wurde, und zog das Musikwerk mehrmals mit dem großen Hebel auf, der an der Vorderseite des Automaten herausragte. Ich durfte den Starthebel bewegen. Der Apparat keuchte und knirschte leise, die verschieden gestimmten Zähne eines Metallkammes wurden von den herausragenden Stiften der Platte angerissen, und die Musik setzte ein.
Tante Magdalena besaß zwanzig Musikplatten, die in grauen Papierhüllen steckten und unter der Spieluhr übereinander gestapelt lagerten. Man musste sie behutsam aus der Hülle ziehen, um sich nicht an den winzigen, scharfen Stiften zu verletzen, die über die Oberfläche verteilt waren. Alle Platten waren dunkelgrau, und um ihren Mittelpunkt war mit Goldfarbe in einer altertümlichen Schrift der Name des Musikstücks und des Komponisten aufgedruckt sowie die Adresse der Firma, die die Platten herstellte. Tante Magdalena hatte einige Volkslieder, mehrere Militärmärsche, zwei Walzer, ein Klavierkonzert, ein Kirchenlied und – und diese beiden Platten liebte sie besonders – das »Gebet einer Jungfrau« und die Melodie »Ich bete an die Macht der Liebe«. Wenn sie eine dieser Platten auflegte, wandte sich Tante Magdalena beim Zuhören etwas ab und betupfte mit einem Taschentuch ständig ihre Brille. Als ich sie einmal fragte, wieso sie die Brillengläser und nicht ihre Augen wischte, sagte sie: »Du hast Recht, das ist eine dumme Angewohnheit von mir.« War das Lied abgespielt, räusperte und schneuzte sie sich. Sie lachte auf, stellte das Spielwerk ab, öffnete die gläserne Abdeckung und nahm die Metallplatte heraus.
»Warum hast du keine Kinder, Tante Magdalena?«, fragte Dorle.
»Ach, mein Mädchen, für mich hat sich einfach kein Mann gefunden.«
»Wenn du willst, kann ich dich ja heiraten«, sagte Dorle.
»Würdest du das für mich tun?«
»Ja.«
»Bist du blöd. Du kannst Tante Magdalena nicht heiraten, du bist doch kein Mann«, sagte ich.
»Hast du denn nie einen Mann gehabt?«
»Ich hatte einen Bräutigam, aber das ist lange her. Viele, viele Jahre.«
»Und wo ist er? Warum hat er dich nicht geheiratet?«
»Er ist tot. Er ist gestorben. Drei Wochen vor unserer Hochzeit.«
»War er krank?«
»Er ist gefallen. Er ist im Krieg geblieben.«
»Als Soldat?«
»Er war Matrose. Ein Steuermann.«
»Ist das etwas Hohes?«
»Er gehörte zu den Offizieren.«
»Hast du ihn gesehen, als er tot war?«
»Nein. Er wurde vermisst. Man hat ihn nicht mehr gefunden.«
»Ist er das da? Auf der Fotografie?«
»Ja, das ist mein Bräutigam.«
»Und warum hast du keinen anderen genommen?«
»Ach Gottchen, ich habe mich wohl zu dumm angestellt. Mich wollte keiner.«
An dem Tag, an dem ich nach Westberlin übersiedelte, öffnete mir Tante Magdalena im Morgenmantel die Tür. Auf dem Küchentisch stand eine Tasse Kaffee und auf dem Teller lag ein angebissenes Hörnchen.
»Komm rein«, sagte sie. »Möchtest du ein Brötchen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann heißt es also Abschied nehmen.«
»Wir sehen uns ja bald. Berlin, das sind doch nur zweihundert Kilometer.«
»Ja, ich weiß. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, dich zu besuchen. Aber du weißt ja, ich bin in meinem Leben noch nie so weit gefahren. Und ob es mir jetzt gelingen wird, weiß ich nicht. Hast du Angst?«
»Nein, Angst habe ich nicht. Mir ist nur etwas mulmig.«
»Du wirst es schon schaffen. Aber mir wirst du fehlen, Daniel. Ach, ich hasse es, Abschied zu nehmen.«
»Aber Dorle bleibt doch hier. Und die Kleinen.«
»Ja, aber du fehlst. Und dich kann mir keiner ersetzen. Als sie damals den Doktor Mandelbaum abholten, haben sie auch gesagt, es seien genug Ärzte in der Stadt. Aber so gut wie er hat sich keiner auf mein Rheuma verstanden. Doktor Mandelbaum, der hatte heilende Hände. Aber sie haben ihn abgeholt und ich hatte den Schaden. Und nun gehst du und ich kann sehen, wie ich zurechtkomme.«
»Wir sehen uns, Tante Magdalena. Ich muss jetzt losgehen. Vater fährt mich nach Berlin.«
»Gute Reise, Junge.«
»Auf Wiedersehen. Und bis bald«, habe ich gesagt, als ich mich von Tante Magdalena verabschiedete.
Aber ich habe Tante Magdalena nie wieder gesehen. Ich ging nach Westberlin und durfte nicht mehr in meine Heimatstadt fahren. Tante Magdalena schrieb mir zwar wiederholt, dass sie mich in Westberlin besuchen wolle, aber sie verschob es immer wieder, und dann starb sie. Auch zu ihrer Beerdigung konnte ich nicht fahren. An dem Tag machten wir das kleine Latinum und keiner bekam frei. Doch ich wäre ohnehin nicht gefahren. Der Schuldirektor und Pfarrer Sybelius hatten mich dringend ermahnt. Es sei zu gefährlich, sagten sie, weil ich heimlich nach Westberlin gegangen sei. Ich hatte die Republik verraten und stand auf der Liste.
Tante Magdalena trug jahraus, jahrein lange Röcke, dunkelblaue oder schwarze mit kleinen Mustern, weißen Blümchen oder winzigen Schafen und Ziegen. Ihr Haar war grau und zu einem Dutt gesteckt. Einmal, als ich auch so früh zu ihr kam, hatte sie es noch nicht hochgebunden. Es fiel ihr bis zu den Hüften hinunter, und ich konnte ihr zusehen, wie sie es aufwickelte und mit Haarnadeln schnell und geschickt zusammensteckte. Sie stand dabei in der Wohnküche vor dem Spiegel, der neben dem Ausguss an einem Nagel hing. Als sich unsere Augen in dem Spiegel begegneten, sagte sie rasch: »Warum schaust du mich so an? Ich will das nicht. Geh ins Zimmer, bis ich fertig bin.«
Sie war ganz rot geworden, als sie das sagte.
Schöne Bescherung
Auch Weihnachten sprach Mutter nicht mit Vater.
Nach dem Kirchgang gab es in der Küche Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Großeltern waren zu Besuch gekommen. Für vier Tage hatten sie Holzwedel verlassen und ihr Gut den Landarbeitern anvertraut, was sie nur einmal im Jahr machten. Es war der einzige Urlaub, den sich die Großeltern erlaubten, und jeden Tag, den Großvater bei uns war, sprach er besorgt über das Gut und darüber, was dort in seiner Abwesenheit alles passieren könnte. Er verließ das Landgut, dessen Inspektor er war, ungern, aber zu Weihnachten besuchten sie uns jedes Jahr. Sie wohnten im Zimmer von David und mir, wir zogen für vier Tage in die alte Mädchenkammer.
Nach dem Essen verabschiedeten sich die Eltern geheimnisvoll. Wir wussten, dass sie nun ins gute Zimmer gingen, um nochmals nach den Geschenken zu sehen und die Kerzen am Baum anzuzünden, während wir mit den Großeltern am Tisch sitzen bleiben und Lieder singen, uns unterhalten oder ruhig sein, doch keinesfalls aufstehen und an der Tür lauschen sollten. Natürlich sangen wir nicht, auch Opa sang nicht, nur die Großmutter hielt mit heller, dünner Mädchenstimme ganz allein zwei Weihnachtslieder durch, worüber wir lachen mussten. Als sie uns fragte, was es zu lachen gäbe, sagte Dorle, wir lachten nur so, und ich sagte, wir lachen, weil wir uns auf die Bescherung freuen. Dann klingelte das Glöckchen auf dem Flur, wir rannten aus der Küche und stürmten ins gute Zimmer, ins Weihnachtszimmer.
Aufgeregt suchte jeder auf dem Gabentisch den Teil, auf dem die für ihn vorgesehenen Geschenke liegen mussten, und noch bevor er sich gründlicher mit den eigenen Geschenken befasste, wurde rasch kontrolliert, wie viel die anderen erhalten hatten. Vater rief uns zu sich. Wir mussten uns vor dem Weihnachtsbaum aufstellen, den er am Nachmittag allein geschmückt hatte, und ein Weihnachtslied singen. Zuerst hatten wir das Lied zu singen und dann den Bibeltext zu hören, da, wie Vater sagte, Weihnachten das Fest von Christi Geburt und das Schenken nicht die Hauptsache sei. Wir Großen schauten unverwandt in die Kerzen, nur die drei Kleinen hielten es nicht aus und blickten sich während des Liedes und beim Bibeltext immer wieder zu dem langen Tisch mit den Geschenken um; Vater legte ihnen dann die Hand auf den Kopf und drehte ihn sanft zurück. Und erst nachdem wir uns alle ein gesegnetes Weihnachten gewünscht hatten, durften wir zu den Geschenken gehen und mit ihnen spielen.
Etwas später verließ Großmutter das Zimmer und kam mit einem Sack zurück, in dem ihre Geschenke steckten. Wir mussten uns vor ihrem Stuhl aufstellen, und sie gab jedem von uns etwas, was sie selbst gemacht hatte, gestrickte Strümpfe, eine Mütze oder eine Hose. Und danach verteilten wir unsere Geschenke an die Eltern und Großeltern, die Zeichnungen oder die Topflappen und Holzsägearbeiten aus dem Werkunterricht.
Irgendwann sagte Vater, dass nun die Päckchen ausgepackt werden, die unter dem Weihnachtsbaum liegen, und jedes Kind konnte sich eins aussuchen. Das Auspacken dauerte sehr lange, denn wir durften die Verschnürung nicht durchschneiden, sondern mussten jeden Knoten aufknüpfen und die Schnur ordentlich aufrollen. Die Päckchen mussten vorsichtig ausgewickelt werden, damit das Packpapier nicht riß, das sorgsam geglättet und zusammengefaltet wurde. Vater sammelte die Verpackung und die Schnüre, um sie wieder zu verwenden. »Das ist eine ganz vorzügliche Schnur, mit der kann man noch große Pakete verschicken«, sagte er nur, wenn wir ihn darum baten, ein besonders stark verknotetes Päckchen aufschneiden zu dürfen.
»Vorzüglich« war alles, was aufgehoben oder weitergegeben werden sollte, das Packpapier und die Paketschnur ebenso wie die zu klein gewordenen Schuhe des Bruders oder die schon fadenscheinige Jacke, die zwei Flicken auf die Ellbogen bekam und vom nächsten Kind getragen werden musste.
War ein Päckchen geöffnet, wurde der Inhalt Stück für Stück herausgenommen und zuallererst nach Namensschildern gesucht. Wenn auf einem der in Weihnachtspapier eingepackten Geschenke ein Name stand, wurde es unausgewickelt überreicht, bei allen anderen Stücken bestimmten die Eltern, wer es erhielt. Die Lebensmittel kamen in die große Suppenterrine, die mitten auf dem Tisch stand. Vater schrieb alles auf, er notierte unter dem Namen der Absender den gesamten Inhalt und wer davon etwas bekommen hatte. Nach diesem Zettel wurde die Verteilung des nächsten Päckchens entschieden, vor allem aber wurde die Liste für den zweiten Weihnachtsfeiertag gebraucht, wenn die Familie Dankbriefe schreiben musste. Vater verlangte, dass sich jeder von uns für jedes Geschenk bedankte, und wir saßen einen ganzen Nachmittag am Tisch, schrieben lustlos die geforderten Danksagungen und lieferten sie bei Vater ab, der sie durchsah und mit seiner Liste verglich.
Mutter saß mit uns am Tisch, während wir die Päckchen auspackten, sie sprach mit uns und ihren Eltern, aber nicht mit Vater.
Sie sprach schon Wochen und Monate nicht mehr mit ihm, anfangs hatte ich es gar nicht bemerkt. Am Familientisch war es mir nicht aufgefallen und meinen Geschwistern wohl auch nicht, jedenfalls sagte keiner etwas darüber. Es war nicht so, dass Mutter schweigend am Tisch saß. Sie sprach mit uns, und wenn Vater etwas zu ihr sagte und eine Erwiderung unumgänglich war, antwortete sie ihm, aber dabei sah sie eins der Kinder an und äußerte sich sehr allgemein. »Ich denke, einer sollte morgen mal die Kartoffeln im Keller durchsehen«, sagte sie, oder sie erklärte: »Irgendjemand müsste mal die frisch gewaschenen Gardinen aufhängen.« Ich fand es eigenartig, wie Mutter sich ausdrückte, weil mir und allen anderen natürlich klar war, dass nur Vater gemeint sein konnte, aber ich dachte mir nichts weiter dabei. Doch Anfang Oktober fragte David meine Mutter, wann man in unserer Familie wieder normal miteinander umgehen würde und ob sie nicht endlich mit Vater reden wolle. Mutter sagte, dass er sich um seinen eigenen Kram kümmern möge, und begann zu heulen. Ich erkundigte mich bei meinem älteren Bruder, ob Mutter tatsächlich nicht mit Vater rede, aber er erwiderte nur, ich solle keine Märchen erzählen.
Beim Abendessen belauerte ich meine Eltern, um herauszufinden, ob sie sich wirklich nicht mehr miteinander unterhielten, doch sie redeten nur allgemein und sprachen sich nicht direkt an, und ich war mir nicht sicher. Fragen konnte ich sie nicht, das wäre unmöglich gewesen. Ich ahnte ohnehin, dass sie mir keine Antwort geben würden. Nur die Kleinen hätten sie fragen können, aber die hatten nichts bemerkt, und ich wollte ihnen nichts darüber sagen. So beobachtete ich sie weiter. Vater sprach Mutter ab und zu an, aber sie wich ihm aus und antwortete seltsam knapp und vage, ohne ihn dabei anzusehen. Wenn er überraschend in die Küche kam, wurde ihr Gesicht finster, und mit einer harten Bewegung stellte sie die Pfanne oder die Schüssel, die sie in der Hand hatte, auf dem Tisch ab.
Das ungewöhnliche Verhalten meiner Eltern beunruhigte mich, ich hatte Angst, sie würden sich trennen.
In meiner Klasse gab es drei Kinder, einen Jungen und zwei Mädchen, die nur noch mit ihrer Mutter zusammenlebten, da ihr Vater irgendwann bei ihnen zu Hause ausgezogen und die Ehe geschieden worden war. Vielleicht war es ein Zufall, aber alle drei hatten einen Tick. Einer musste sich immerzu irgendwo festhalten, um nicht zu stolpern. Wenn er durch die Klasse ging, strich er mit der Hand an den Bänken entlang, auf dem Schulhof fasste er stets nach dem den Hof umgrenzenden Zaun und beim Sportunterricht klammerte er sich so fest an die Geräte, dass es ihm unmöglich war, eine Übung auszuführen. Wenn er durch die Stadt lief, ging er dicht an den Häuserwänden entlang, mit den Fingern einer Hand das Mauerwerk streifend. Wir nannten ihn den Mauersegler. Eines der beiden Mädchen sah einem nie ins Gesicht. Wenn man sie ansprach, sah sie an einem vorbei oder auf ihre Schuhe, und wenn die Lehrerin sie aufrief, stand sie auf und starrte während ihrer Antwort angestrengt an die Zimmerdecke. Das andere Mädchen zuckte unaufhörlich mit einem Mundwinkel. Es war nur ein winziges Zucken, aber es machte einen nervös, und wenn ich mit ihr etwas zu besprechen hatte, musste ich mir Mühe geben, nicht ebenfalls mit irgendeinem Zucken anzufangen. Alle drei hatten keine Freunde in der Klasse und waren auch nicht miteinander befreundet, obgleich mir das einleuchtend erschienen wäre und sinnvoll. Die drei hatten wenig Geld. Es gab einige in der Klasse, deren Eltern nicht viel verdienten und die nur sehr selten etwas Neues vorzeigen konnten, und auch ich trug meistens ein paar der abgelegten Kleidungsstücke meines Bruders, aber diese drei waren richtig bedürftig, so wie die Kinder aus dem Heim, und wenn in der Klasse für einen Schulausflug oder eine Sonderveranstaltung gesammelt wurde, fragte unsere Klassenlehrerin diese drei Mitschüler noch extra, ob ihre Mütter das Geld bezahlen könnten oder ob sie bei der Schulleitung einen Antrag stellen solle. Besonders schrecklich schien mir aber, dass die drei Scheidungskinder nie etwas erlebten. Niemals unternahmen sie etwas, sie fuhren nie mit dem Bus in die Kreisstadt, sie machten keine Fahrradtouren, und in den Ferien blieben sie jedes Jahr daheim. Alle anderen in der Klasse waren schon einmal an der See gewesen oder fuhren in den Sommerferien zu entfernt wohnenden Verwandten, und an den Wochenenden veranstalteten die Familien ab und zu ein Fest, machten gelegentlich eine Gartenparty oder einen längeren Ausflug, für den man sich Tage zuvor mit einem Brief der Eltern vom Schulbesuch am Samstag befreien lassen konnte. Selbst für die Heimkinder wurde manchmal etwas organisiert, eine Busfahrt in den Zoo oder ein bunter Nachmittag im Heim. Nur die drei verreisten nicht und machten nie etwas, vom Schulbesuch waren sie nur befreit, wenn sie krank waren. Sie gingen nicht einmal zum Anger, wenn dort zweimal im Jahr Rummel war und ein Kettenkarussell, Losbuden und ein Schießstand aufgebaut waren. Ich wollte nicht, dass meine Eltern sich scheiden ließen, ich wollte nicht zu denen gehören. Ich wollte nicht in der ersten Woche des neuen Schuljahrs, wenn wir den üblichen Aufsatz über das schönste Ferienerlebnis zu schreiben hatten, wie sie dasitzen und auf dem Füllfederhalter herumkauen, weil es einfach nichts zu berichten gab.
Mit meinem älteren Bruder konnte ich nicht darüber sprechen, er sagte mir nur, dass ich den Mund halten und lieber Schularbeiten machen solle. Und Dorle hatte nichts bemerkt und würde nur wieder heulen, wenn ich ihr etwas davon sagte. Nur mit Tante Magdalena konnte ich mich darüber unterhalten.
»Mir ist schon aufgefallen, dass deine Mutter mit deinem Vater nicht viel redet«, sagte sie, als ich mich bei ihr erkundigte, »sie war schon immer eifersüchtig, deine Mutter. Und ist eine Frau eifersüchtig, dann wird das ganz schlimm, wenn sie schwanger ist.«
»Und wer ist es? Weißt du das?«
»Wer ist was?«
»Wer ist die Frau, wegen der Mutti eifersüchtig ist?«
»Die gibt es nicht, Junge. Wie kannst du nur so etwas denken! Natürlich gibt es keine andere Frau, nicht bei deinem Vater.«
»Aber wenn sie eifersüchtig ist?«