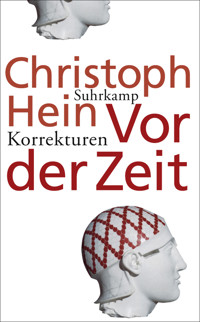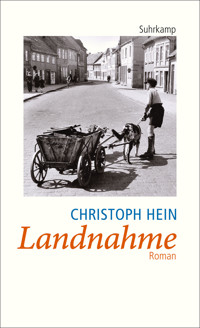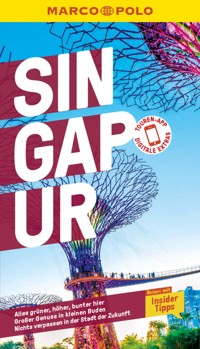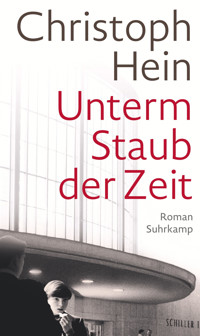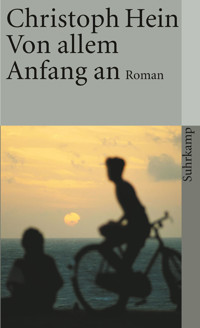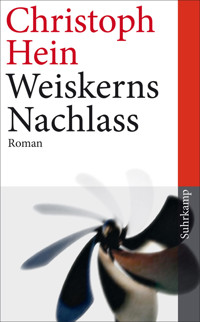
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, hat seit 15 Jahren eine halbe Stelle als Dozent an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null, mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Er ist ein prototypisches Mitglied des akademischen Prekariats. Dieser »Klasse« fehlt jede Zukunftshoffnung: Die selbst gesetzten Maßstäbe an die universitäre Lehre lassen sich nicht aufrecht erhalten; die eigene Forschung führt zu keinem greifbaren Resultat. Für das Spezialgebiet des Rüdiger Stolzenburg, den im 18. Jahrhundert in Wien lebenden Schauspieler, Librettisten und Kartografen Friedrich Wilhelm Weiskern, lassen sich weder Drittmittel noch Publikationsmöglichkeiten beschaffen. Und dann erweist sich das angeblich sensationelle neue Material aus dem Nachlaß von Weiskern auch noch als Fälschung. Seine Bemühungen, eine ihn ruinierende Steuernachforderung zu erfüllen, machen ihm endgültig deutlich: die Welt, die Wirtschaft, die Politik, die privaten Beziehungen – alles ist prekär. Sie zerbrechen, sie setzen Gewalt frei, geben in großem Ausmaß den Schein für Sein aus. Christoph Hein hat mit Rüdiger Stolzenburg eine Figur geschaffen, in der sich prototypisch die Gefährdungen unserer Gesellschaft und unserer Zivilisation am Ende des ersten Jahrzehnts des zweiten Jahrtausends spiegeln. Christoph Hein ist damit der aktuelle, realistische, literarisch durchgeformte Gesellschaftsroman gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rüdiger Stolzenburg, 59 Jahre alt, seit 15 Jahren Dozent mit halber Stelle an einem kulturwissenschaftlichen Institut. Seine Aufstiegschancen tendieren gegen null: Die selbst gesetzten Maßstäbe an die universitäre Lehre lassen sich nicht aufrechterhalten, seine Forschungsvorhaben führen zu keinem greifbaren Resultat. Mit seinem Gehalt kommt er eher schlecht als recht über die Runden. Doch sein ohnehin prekäres Leben droht vollständig aus den Fugen zu geraten, denn nicht nur das Finanzamt rückt ihm mit einer Steuernachforderung existenzgefährdend auf den Pelz, Rüdiger Stolzenburg wird auch noch unfreiwillig Köder in einem Kriminalfall.
Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien, lebt in Berlin. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Zuletzt sind von ihm im Suhrkamp Verlag erschienen: Landnahme (st 3729), In seiner frühen Kindheit ein Garten (st 3773) und Frau Paula Trousseau (st 4004).
Christoph Hein
Weiskerns Nachlass
Roman
Suhrkamp Verlag
Umschlagfoto: Bettina Blaß
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-76220-2
www.suhrkamp.de
Eins
Das kleine Flugzeug nach Basel startet verspätet, er wird fast zwei Stunden nach dem angekündigten Zeitpunkt bei Gotthardt ankommen. Alle Plätze in der Maschine sind besetzt, es ist unangenehm eng. Stolzenburg lässt seine Papiere in der Tasche, er will, bedrängt vom Ellbogen des Nachbarn, auf dem winzigen Klapptablett kein Manuskript aufschlagen. In dem Billigflieger werden keine Zeitungen angeboten, und er bedauert, sich nicht ein Blatt im Flughafen gekauft zu haben. Wenige Minuten nach dem Start schieben zwei locker gekleidete Stewards einen Wagen durch den schmalen Gang und verkaufen Getränke, Snacks und Uhren, doch lediglich der Mann neben ihm lässt sich einen Tomatensaft geben und bezahlt mit einer Kreditkarte, was ihn nötigt, aufzustehen und im oberen Gepäckfach nach seiner Brieftasche zu suchen.
Stolzenburg schaut aus dem Fenster, die Stirn an die Scheibe gelehnt, betrachtet er die sich unter ihm auftürmenden Wolken. Er denkt an Henriette und an Lilly, dann an seine Tochter. In der nächsten Woche will er sich in seiner Bank einen Termin geben lassen, er ist schon Jahrzehnte bei demselben Geldinstitut, und auch wenn man mit ihm wenig verdient hat, hofft er, dass man seine Treue zu schätzen weiß und ihm irgendeinen günstigen und bezahlbaren Überbrückungskredit gewährt. Die Chancen stehen schlecht, er macht sich keine Illusionen, aber den Versuch lohnt es. Ihm fällt Weiskern ein, Aberte. Ein weiterer Brief an Jürgen Richter ist fällig, den Verleger. Irgendwoher muss auch für mich mal Geld kommen, sagt er sich. Er schrickt zusammen und schaut zu dem Nachbarn, für einen Moment fürchtet er, laut gesprochen zu haben, doch der Mann beachtet ihn nicht, liest nur aufmerksam die Beschriftung auf der Saftbüchse. Stolzenburg lehnt den Kopf wieder ans Fenster und starrt in die Wolken. Er sieht die linke Tragfläche und zwei Propeller oder vielmehr die beiden schwirrenden Kreise, die die rotierenden Flügel vor der breiten Blechfläche bilden. Plötzlich zuckt einer der Propeller, für einen Moment sieht er einen der Flügel der Luftschraube, dann beginnt sie erneut zu rotieren, der gebogene Stahl wird durch die Geschwindigkeit unsichtbar. Für einen Augenblick setzte die Rotation aus, blieb die Schraube stehen, bewegten sich die Flügel nicht mehr um ihre Welle. War das ein einmaliger Vorgang, oder ist das normal, fragt sich Stolzenburg erstaunt und starrt auf den kreisenden Propeller. Sekunden später zittert die Schraube wiederum kurz und bleibt dann stehen, die Flügel bewegungslos. Atemlos wartet Stolzenburg darauf, dass der Propeller wieder anspringt, dass der Luftdruck die Schraube wie bei einem Windrad anwerfen wird, doch der Stahl steht aufrecht und still, nur der Propeller neben ihm zeichnet noch das rotierende Flirren in die Luft. Stolzenburg muss schlucken, sein Mund ist plötzlich wie ausgetrocknet. Er schaut zu den anderen Passagieren, aber keinem fällt etwas auf, das Flugzeug fliegt gerade und unbeirrt, die beiden Stewards stehen in der Nähe der Pilotentür und unterhalten sich, auch sie haben nichts bemerkt. Stolzenburg atmet heftig, er fühlt eine aufsteigende Panik und zwingt sich, ruhig zu bleiben, nicht zu schreien, nichts zu sagen. Da keiner unruhig wird, scheint alles normal zu sein. Er starrt weiter auf den stillstehenden Propeller und atmet noch heftiger, stoßartig, seine Hände umkrallen die Armlehnen, er schwitzt. Das ist das Ende, sagt er sich, auf einem banalen Flug zu einem banalen, schlecht honorierten Vortrag an der Baseler Kunsthochschule, aber er bezahlt es möglicherweise mit dem Leben. Vorsichtig schaut er zu den Passagieren, sie schwatzen miteinander, der Mann neben ihm würzt ausgiebig seinen noch immer nicht angerührten Tomatensaft, offenbar ist er, Stolzenburg, der Einzige, der die Anzeichen der drohenden, unmittelbar bevorstehenden Katastrophe bemerkt hat. Vielleicht haben die Piloten sie auch nicht registriert, obwohl im Cockpit die roten Lämpchen flackern, die Notaggregate aufheulen müssen, vorne tut sich jedoch nichts, wird nicht hektisch die Tür aufgerissen, gibt es keine Anweisungen, Befehle, Rufe. Er zwingt sich, ruhig zu bleiben, er räuspert sich mehrfach, auch sein Hals ist ausgetrocknet. Er starrt aus dem Fenster, der Propeller rührt sich nicht, diese Maschinen können offenbar auch mit drei Propellern fliegen. Möglicherweise ist der zweite ein nicht unbedingt notwendiger Ersatzpropeller, ein Propeller für den Notfall. Aber da er jetzt ausgefallen ist, hat die Maschine einen Notfall, nur dass es außer ihm keinem auffiel. Intensiv, fast gierig starrt er auf das starre Stahlstück vor der Tragfläche, als könne er mit seinem Blick den Propeller anwerfen, zum Rotieren bringen. Sich bekreuzigen, beten, das wäre jetzt angebracht, sagt er sich. Unwillkürlich krampft er die Hände zusammen, faltet sie aufgeregt und schließt die Augen für den Moment eines Stoßgebetes. Als er sie sofort wieder öffnet und auf den stillstehenden Propeller starrt, stottert der zweite Propeller, zuckt mehrmals, verharrt einen Augenblick bewegungslos, wackelt dann, setzt sich langsam wieder in Bewegung, kommt in Schwung, rotiert gleichmäßig, aber langsamer, wie ihm scheint, und bleibt schließlich endgültig stehen. Beide Propeller an der linken Tragfläche haben ausgesetzt, die Kreuze ihrer metallenen Flügel stehen starr vor der Tragfläche. Das Flugzeug gleitet weiterhin vollkommen ruhig und ohne jede Schräglage, Stolzenburg, den Blick starr auf die unbeweglichen Propeller gerichtet, erwartet jeden Moment, dass das Flugzeug sich zur Seite neigt, dass es kippt, dass es aufheulend wie ein alter Kampfbomber in die Tiefe rauscht. Schreckensbleich betrachtet er die Passagiere, keiner hat etwas bemerkt, man schwatzt noch immer munter, der Mann neben ihm trinkt in kleinen Schlucken seinen Tomatensaft, die Stewards räumen unbesorgt Prospekte in ein Gepäckfach und machen sich übereinander lustig. Stolzenburg will schreien, er öffnet den Mund, er stößt die Luft heraus, aber er ist so schreckensstarr, er bringt keinen Ton heraus. Er ergreift den Arm seines Sitznachbarn, versucht, ihn auf die stillstehenden Propeller aufmerksam zu machen, mit einem Finger deutet er auf sein Kabinenfenster und röchelt. Erschreckt schaut ihn der Nachbar an, stellt das Glas mit dem restlichen Tomatensaft auf dem Klapptisch ab, dann ruft er nach dem Steward. Das abgestellte Glas sichert er mit einer Hand, während er besorgt Stolzenburg anschaut, der sich mehrfach räuspert, er will die Stimme frei bekommen, um wieder sprechen zu können. Das Flugzeug gleitet weiterhin gleichmäßig und völlig waagerecht dahin, kein Vibrieren, keine Unregelmäßigkeit ist spürbar. Die Maschine muss über eine unglaubliche Kompensationsfähigkeit verfügen, die den einseitig vollständigen Ausfall aufzuheben oder auszugleichen vermag. Atemlos und irritiert registriert Stolzenburg den unverändert gleichmäßigen Flug, die weiterhin ruhige Lage seines Flugzeugs. Es gibt kein auffälliges, bemerkbares Manövrieren, kein Auf und Ab, keine unkontrolliert wirkenden Bewegungen des Fliegers. Vielleicht ist es möglich, die Maschine auch mit dem Ausfall zweier Propeller sicher zu landen. Er sieht den Steward auf sich zukommen, die Passagiere in dem Gang rechts und links anlächelnd.
»Sie wünschen?«, fragt der den Mann neben ihm, der auf Stolzenburg weist.
Stolzenburg deutet stumm auf das Kabinenfenster.
»Was wünschen Sie?«, fragt ihn der Steward erneut.
Stolzenburg hat Mühe, die Frage zu verstehen, ihm zu antworten. Er schaut den jungen Mann verständnislos an, er schüttelt den Kopf, er starrt aus dem kleinen Fenster zur Tragfläche des Flugzeugs.
Zwei
Ein Geräusch weckt ihn. Das vorsichtige Schließen einer Tür, dann die leisen, lärmvermeidenden Schritte eines Menschen. Noch bevor er die Augen öffnet, bemerkt er einen Lichtschein. Seine Freundin steht neben dem Bett. Sie hält irgendetwas in der Hand, was er nicht erkennen kann, und im Haar trägt sie einen Blätterkranz, auf dem eine brennende Kerze thront. Eine schwedische Festgestalt, erinnert er sich, eine Lichtergöttin oder eine Sommerschönheit, er will nicht darüber nachdenken. Er streckt die Hand aus, streichelt ihren nackten Schenkel, lächelt erschöpft.
»Patrizia«, flüstert er, »du.«
»Herzlichen Glückwunsch«, sagt sie. Sie geht vorsichtig in die Hocke, damit die brennende Kerze nicht umfällt, und küsst ihn auf die Wange.
»Alles Gute«, flüstert sie ihm ins Ohr, »ich freue mich, dass ich heute bei dir bin, Rüdiger. Und ich hoffe, du freust dich auch.«
»Es ist schön, sehr schön«, erwidert er und schließt die Augen.
»Unser Frühstück ist fertig. Komm auf den Balkon.«
»Gleich. Einen Moment noch.«
»Schau mal. Das ist für dich.«
Er öffnet ein wenig die Augen, er sieht etwas Dunkles, Schwarzes. Ein Pullover, vermutet er, oder ein Hemd.
»Schön«, sagt er, schließt die Augen wieder und wendet den Kopf ab, »nur einen Moment noch, fünf Minuten, bitte.«
Die junge Frau geht leise aus dem Zimmer.
Eine Viertelstunde später erscheint Stolzenburg im Bademantel auf dem Balkon. Er gähnt ausführlich, reckt die Arme in den Himmel, streckt sich. Schließlich küsst er die Frau auf die Stirn. Er betrachtet den gedeckten Tisch, den aus Zweigen und Kastanienblättern geflochtenen Kranz. Er nimmt das mit einer roten Schleife verzierte schwarze Leinen hoch und löst die Schleife. Es ist ein japanischer Morgenmantel, ein mit einem einzigen weißen Schriftzeichen bedruckter Kimono.
»Sehr schön«, sagt er, »danke.«
Er setzt sich und hält ihr seine Kaffeetasse hin.
»Neunundfünfzig«, sagt er, »stell dir vor, ich bin neunundfünfzig. Dabei wollte ich nie so alt werden.«
»Kein Fett, keine Falten, ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. Du siehst gut aus. Der bestaussehende Mann, den ich je hatte.«
»Du bist wirklich ein Schatz«, und nach einer kleinen, einer winzigen Pause fügt er ihren Namen hinzu: »Patrizia«.
»Entschuldige, dass ich dich geweckt habe, aber ich wollte noch mit dir frühstücken.«
»Nicht so schlimm«, knurrt er und greift nach einem Brötchen.
»Du warst schon beim Bäcker? In aller Frühe?«
»Ja, ich wollte dich überraschen. Zum Geburtstag muss es doch frische Brötchen geben.«
»Fein.«
»Aber jetzt muss ich gehen, ich komme sonst zu spät«, sagt sie und steht auf.
»Du bist ein Engel.«
Er greift mit beiden Händen nach ihrem Hintern, zieht sie zu sich und presst sein Gesicht gegen ihren Bauch.
»Schön, dass du da bist.«
»Sehen wir uns heute Abend?«
»Heute Abend?«, wiederholt er. Er streichelt ihren Hintern und fasst sie zwischen die Beine.
»Morgen habe ich eine Veranstaltung in Basel«, sagt er, »da muss ich vor Tau und Tag los.«
»Ich könnte dich zum Flughafen fahren.«
»Ich weiß noch nicht. Wir telefonieren, meine Kleine. Wenn ich aus der Uni zurück bin, rufe ich dich an.«
Als er die Wohnungstür ins Schloss fallen hört, lehnt er sich zurück.
»Ja, es ist schön«, sagt er laut, »und sie ist ein nettes Mädchen.«
Er dachte daran, dass er sie, als sie an sein Bett kam und ihn weckte, mit ihrem Namen angesprochen hatte. Noch im Halbschlaf und gleich den richtigen Namen, das ist schon eine gute Leistung. Gewöhnlich flüchtete er sich in eine unverbindlichere, allgemeine Anrede, meine Liebe, zum Beispiel, oder Schatz oder Spätzchen, das erspart Ärger. Ein einziger falscher Name kann leicht den ganzen Vormittag kosten, die Dame würde nicht aufhören, ihm die Verwechslung eines Vornamens unter die Nase zu reiben. Er gießt sich Kaffee nach, greift nach den zwei Zeitungen, die Patrizia für ihn gekauft hat, bleibt eine halbe Stunde auf dem Balkon sitzen, geht dann unter die Dusche.
Bevor er sich auf das Fahrrad schwingt, um ins Institut zu fahren, setzt er sich an seinen Schreibtisch, sieht die E-Mails durch, schaut sich sein Konto an in der unsinnigen Hoffnung, eine unerwartete Überweisung vorzufinden, vielleicht einen Bankirrtum zu seinen Gunsten als Geburtstagsgruß, und geht danach die Papiere durch, die er für das Seminar benötigt. Als es Zeit wird, sich auf den Weg zu machen, steckt er die Unterlagen, sein Laptop und das Handy in den Rucksack und kämmt sich ein zweites Mal die Haare. An der Wohnungstür blickt er in den Spiegel, studiert sorgfältig sein Gesicht, tritt einen Schritt zurück und dreht sich ins Profil, um einen prüfenden Blick auf seinen Bauch zu werfen.
»Neunundfünfzig«, murmelt er und schüttelt den Kopf.
Er ist nicht unzufrieden mit seinem Aussehen, er hält sich für durchaus attraktiv, gutaussehend, ein junger Mann jedoch ist er nicht mehr. Der bestaussehende Mann, den ich je hatte. Nun ja, nett gesagt, aber ein zweifelhaftes Kompliment. Er weiß nicht, mit wem sie vor ihm zusammen war.
Noch in der Wohnung setzt er sich den Fahrradhelm auf, ein Monstrum, ein lächerliches Teil. Fritz von der Billardrunde meinte, er sehe damit aus wie ein Sternenkrieger oder die Monster aus einem Fantasyfilm. Mit dem Helm empfindet er sich kostümiert, kommt sich vor wie eine grotesk entstellte Figur, und jedes Mal und noch bevor er vom Rad steigt, nimmt er rasch den Helm ab, doch er ist so vernünftig, ihn trotzdem aufzusetzen, er weiß, er ist in einem Alter, in dem man selbst den kleinsten Sturz nicht folgenlos übersteht. Er fürchtet körperliche Gebrechen und ist daher vorsichtig geworden, viel vorsichtiger als noch vor wenigen Jahren.
Zwanzig vor zehn ist er am Institut und schließt sein Rad sorgsam an ein Verkehrsschild. Im Gang des ersten Stocks stehen Studenten, die ihm zunicken. Er geht ins Sekretariat, um die Briefe und Nachrichten aus seinem Postfach zu holen, doch als er das Zimmer betritt und Sylvia grüßt, steht sie auf, kommt um den Tisch herum, reicht ihm fast förmlich die Hand und gratuliert ihm.
»Ja, schon wieder einmal«, sagt er verlegen, »schon wieder ein Jahr herum. Dank für deine Wünsche, ich kann sie gebrauchen.«
Er blättert mit dem Daumen das kleine Bündel von Papieren durch, zieht den einzigen Brief, der handschriftlich adressiert ist, heraus und öffnet ihn.
»Dann wird es heute Abend eine kleine Feier geben?«, fragt Sylvia.
Er sieht sie überrascht an. In ihrer Stimme klingt etwas mit, das er nicht entschlüsseln kann. Vielleicht weiß sie etwas, eine unangenehme Nachricht, schließlich sitzt sie im Vorzimmer des Institutsleiters und bekommt dadurch auch jene Sachen mit, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Oder sie erwartet eine Einladung, zu einem Glas Sekt oder gar zu einer Geburtstagsfeier, er weiß es nicht. Er hat sich nie mit den Kollegen des Instituts privat getroffen, er lehnt es grundsätzlich ab, das Berufliche mit dem Privaten zu mischen. Schließlich sagt er beiläufig: »Nein, ich glaube nicht. Was gibt es da zu feiern? Ich bin ein Jahr älter geworden, das ist kein Verdienst, keine Leistung. Ein Jahr älter, da solltest du mir kondolieren, Sylvia.«
»Kokettiere nicht, Rüdiger. Männer in deinem Alter sind in den besten Jahren. Da geht es euch besser als uns Frauen. Wir werden alt, ihr dagegen werdet reif.«
Schlösser, der Chef, tritt aus seinem Zimmer und enthebt ihn der misslichen Verpflichtung, der Sekretärin mit einer charmanten Floskel zu antworten.
Schlösser sieht ihn kurz an und nickt, dann legt er einen Brief vor Sylvia auf den Tisch und bittet sie, ihn zu beantworten.
»Ich möchte eine ebenso freundliche wie klare Ablehnung«, sagt er, »Das kriegst du schon hin.«
Die Sekretärin flüstert ihm etwas zu, Schlösser versteht nicht und fragt nach, sie flüstert wiederum etwas und lenkt den Blick Richtung Rüdiger.
»Danke, ach ja«, sagt Schlösser. Er kommt mit ausgestreckter Hand auf ihn zu, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren.
Rüdiger Stolzenburg bedankt sich nicht, er schweigt und sieht ihn erwartungsvoll an. Schließlich fragt er: »Und? Nichts weiter?«
»Was meinst du? Ich weiß nicht, wovon du jetzt sprichst.«
»Oh, früher hast du immer noch etwas angefügt, einen winzigen Satz, eine nette, völlig folgenlose Bemerkung. Schon vergessen? Noch vor einem Jahr konnte ich diesen hübschen Satz hören.«
Schlösser schaut ihn verstört an.
»Nun, dass ich nicht ewig auf dieser halben Stelle sitzen werde. Dass du dich zumindest darum bemühen willst. Das war bislang dein Geburtstagsgeschenk, Jahr für Jahr. Fünfzehn Jahre lang, zu jedem Geburtstag. Und heute? Da fehlt mir etwas, Frieder. Oder ist der Akademische Rat für mich endgültig gestrichen? Hat sich eine Verbeamtung für mich erledigt?«
Schlösser lächelt gequält. »Komm bitte für einen Moment in mein Zimmer, Rüdiger«, sagt er, legt einen Arm um dessen Schulter und führt ihn in sein Büro.
»Setz dich. Möchtest du etwas trinken?«
»Danke, nein. Ich muss ins Seminar.«
»Dann wollen wir uns kurz fassen. Ich habe keine volle Stelle für dich, und das ist dir bekannt. Ich habe mich immer darum bemüht. Du weißt selbst, was ich alles unternommen habe. Und heute, und das ist leider die Wahrheit, heute kämpfe ich darum, dass mir die Mitarbeiterstellen nicht gestrichen werden. Heute muss ich froh sein, dass für dich und Veronika wenigstens die festen halben Stellen bleiben. Ich brauche dich. Ich bräuchte eigentlich eine ganze Kraft, zwei ganze Kräfte, ich bekomme sie nicht. Das ist die Wahrheit, und das wird allem Anschein nach so bleiben.«
»Ich bin neunundfünfzig, Frieder.«
»Im Rektorat kennt man dein Alter. Über fünfzig, über fünfundfünfzig, da verbietet es das Beamtenrecht, da wird es zu einer Belastung der Pensionskasse.«
»Neunundfünfzig! Hier eine halbe Stelle, und da und dort ein paar Vorträge, Aufsätze und Rezensionen, um sich über Wasser zu halten, das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Ich bin seit fünfzehn Jahren hier, und seit fünfzehn Jahren höre ich, dass du diese halbe Stelle zumindest in einen Akademischen Rat überführen willst. Nein, entschuldige, nur vierzehn Jahre lang habe ich das von dir gehört, denn heute hast du diesen Satz nicht mehr gesagt.«
»Und du wirst ihn auch nicht mehr hören. Unter uns, im Rat gibt es Stimmen, die die Schließung unseres Instituts verlangen. So weit sind wir. Die Kulturwissenschaft bringt kein Geld, wir haben keine Sponsoren, treiben viel zu wenig Drittmittel auf, wir gelten als Belastung. Wir sind eine Belastung. Der Studiengang Ethik brachte nicht die erforderlichen Studenten, und wir hatten ihn sogar wie gewünscht als Bachelor eingerichtet, der Magisterstudiengang Philosophie läuft aus, Ethnologie mussten wir einstellen, ich bin froh, dass die Medienfächer angenommen werden. Obwohl, unser Videostudio spielt nicht das notwendige Geld ein, wie uns Veronika zusicherte. Es finanziert sich nicht einmal selbst. Wir müssen tricksen, damit es nicht geschlossen wird, denn wir brauchen das Studio, es zieht die Studenten an. Und wenn mich dann der Teufel reiten sollte und ich von der mir einmal versprochenen vollen Professur für dich rede, wenn ich statt dieser halben Stellen endlich die für dich benötigte Ratsstelle anspreche, eine für dich und eine für Veronika, für das Institut, dann schlage ich lediglich einen Sargnagel ein. Einen weiteren Sargnagel. Denn dann kann es leicht passieren, dass wir alle nichts mehr haben, und du nicht einmal mehr die halbe Stelle.«
»Kannst du dir vorstellen, wie mich dieses jahrzehntelange Vertrösten ankotzt? Es geht mir auf die Eier, Frieder. Du darfst ruhig grinsen, es ist so, wie ich sage. Es ist nicht sehr angenehm, ein alter Mann zu werden und nichts erreicht zu haben.«
Schlösser hält die Augen geschlossen und massiert seine Schläfen.
»Dass du nichts erreicht hast, stimmt nicht. Du bist mein bester Mann. Du hast Erfahrung, kannst mit den Studenten umgehen, veröffentlichst mehr als alle anderen, mich eingeschlossen, und deine Aufsätze sind nach wie vor lesbar. Und falls du kündigst, was ich nicht hoffe, was ich mir nicht vorzustellen wage, bin ich aufgeschmissen. Denn dann wirst du mir doppelt fehlen. Die Wahrheit ist nämlich, deine Stelle, Rüdiger, diese verfluchte halbe Stelle, wird nicht mehr neu besetzt, sie wird gestrichen. Sie hat die letzte Evaluierung nicht überlebt, wird derzeit nur noch als kw geführt, kann wegfallen. Das ist meine Lage. Unsere Lage.«
Schlösser lässt die Hände sinken und öffnet die Augen.
»Und was in einem Jahr sein wird, darüber wage ich nicht nachzudenken. Als ich damals berufen wurde, da glaubte ich, ich hätte es geschafft. Mein Ehrgeiz war gestillt, ich war unkündbar, hatte ausgesorgt, war am Ziel meiner Wünsche. Fünf Jahre später kam für uns das Ende bei den Germanisten, und ich setzte Himmel und Hölle in Bewegung, dass wir nahezu vollständig, ohne allzu große Verluste, bei der Theaterwissenschaft unterkamen. Und heute bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich es hier bis zur Pension durchhalten kann. Seit sechs Monaten geht im Senat die Rede über eine erneute Evaluierung, die Uni muss weiter einsparen, noch mehr und noch mehr, koste es, was es wolle, und du weißt genauso gut wie ich, was das für uns bedeuten würde. Auf so etwas wie Solidarität kann ich nicht mehr hoffen, in den Rektoratssitzungen ist sich jeder selbst der Nächste, und wir gelten ohnehin als Exoten, als ein Orchideenfach. Wir bekommen keine Fördermittel, aus keinem Topf. Wir haben von der Cobac keine Stiftungsprofessur bekommen, die Zusage war heiße Luft, oder die Gesellschaft hat tatsächlich Zahlungsschwierigkeiten. Kurzum, wir kosten die Uni nur Geld. Die Folgen kennst du. Wir sind nicht mehr im Senat vertreten, wir sind nicht mehr stimmberechtigte Mitglieder, unser Stellenplan wird geradezu nach Belieben zusammengestrichen. Und ich kann nichts tun. Inzwischen kann ich nichts für mich tun, ich kann nichts für dich tun. Und all das weißt du genauso gut wie ich.«
»Sind wir eine Universität oder ein Dienstleistungsunternehmen, das sich nach Kundenwünschen zu richten hat?«
»Wenn die Bewerbungszahlen nach unten gehen, werden wir ersatzlos eingestellt.«
»Und so etwas nannte sich mal Alma Mater, Bildung und Wissen, nährende Mutter.«
»Sie nährt nicht mehr, jedenfalls nicht mehr ihre Professoren und Dozenten.«
»Tja, dann werd ich mal«, sagt Stolzenburg und erhebt sich umständlich aus dem Sessel, »meine wissbegierigen Studenten warten. Und wir wollen sie ja gut ausgebildet in die Arbeitslosigkeit entlassen. Das ist ja unsere pädagogische Pflicht, nicht wahr?«
Schlösser sieht ihn missbilligend an. »Drücken wir uns die Daumen, Rüdiger. Bist du nicht morgen in Basel? Dann grüß Gotthardt von mir.«
Drei
Das Seminar verläuft ohne Vorfälle. Es gibt kein Leuchten und kein Licht, keine Offenbarung, keine Idee, keinen Geistesblitz, keine Erkenntnis, weder bei ihm noch bei den Studenten. In den zwei Stunden taucht kein einziger Gedanke auf, der, wie unausgegoren auch immer, es wert wäre, entfaltet oder gar aufgeschrieben zu werden.
Sebastian Hollert hält ein Referat über Juden im London zur Shakespearezeit. Hollert ist der dümmste und gelangweilteste all seiner Studenten, und Stolzenburg musste ihn mehrfach mahnen, das übernommene Referat endlich auszuarbeiten und vorzutragen. Und nun spricht dieser Junge geschlagene dreißig Minuten, doppelt so lang, als es üblich und erforderlich ist, zumal über ein Thema, das ihn nicht interessiert und zu dem er vermutlich keine zehn Sekunden etwas zu sagen hätte. Er weiß, er ist ihm gegenüber ungerecht. Aber er kann und will es nicht ändern. Er hasst Hollert. Er hasst ihn aus einem, wie er sich eingesteht, dummen und banalen Grund. Hollert bekommt von seinen Eltern ein monatliches Salär, denn ein Stipendium will er eine Summe nicht nennen, die über seinem eigenen Monatsgehalt liegt. Und Hollert weiß das, und er weiß, dass er es weiß. Über die finanzielle Situation des Instituts und der Lehrkräfte sind die Studenten gut unterrichtet, und sie sprechen auch über das ihnen zur Verfügung stehende Geld, jedenfalls Hollert und jene zwei Studenten, die ebenfalls größere Einnahmen haben, wenn auch wesentlich weniger als dieser junge Krösus. Sie sprechen gern darüber, um die anderen zu demütigen, die anderen Studenten und auch die schlecht bezahlten Dozenten, wie er selbst einer ist. Hollert hat als Student mehr Geld zur Verfügung als er, und er wird nach seinem sinnlosen Studium in den väterlichen Betrieb einsteigen oder als Rentier dem Nichtstun huldigen und dabei durch sein Erbe noch weit mehr Geld erhalten. Und Stolzenburg weiß auch, dass Hollert ihn und seine Arbeit verachtet. Verachten muss. Studenten mit solch hohen monatlichen Schecks kann man nicht unterrichten, davon ist Stolzenburg überzeugt. Man kann einem Menschen, dem mehr, viel mehr, möglicherweise ein Mehrfaches an Geld zur Verfügung steht als einem selbst, nichts von der Welt erzählen. Es wäre vernünftiger, das Verhältnis umzudrehen, sein Schüler zu werden statt seinen Lehrer zu spielen, und sich von ihm die Welt und die Gesellschaft erklären zu lassen, und sei es nur, damit er zeigt, wo Barthel den Most holt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!