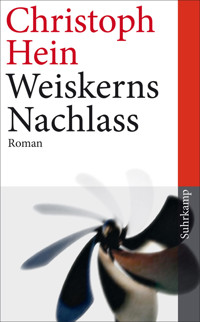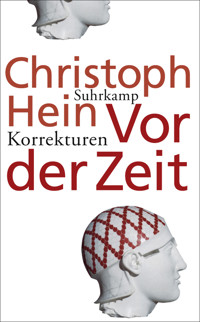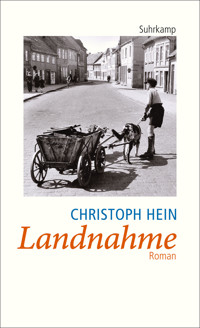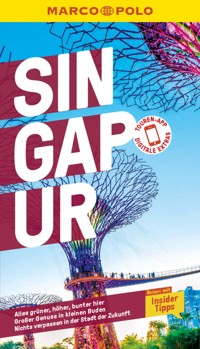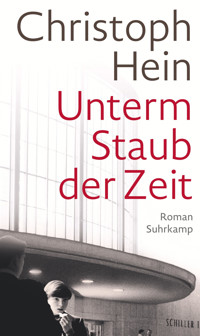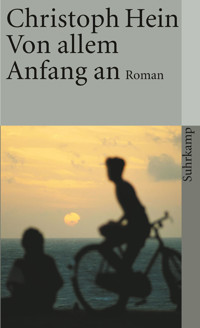11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seiner Chronik der Lebensläufe zweier Familien bündelt Christoph Hein die vergebliche Hoffnung auf eine Existenz in Freiheit. Ihm ist ein Jahrhundertroman gelungen: ein Jahrhundert umgreifend, ein Jahrhundert widerspiegelnd, ein Jahrhundert verstehbar zu machen und nachzuerleben.
»In diesen Roman geriet ich aus Versehen oder vielmehr durch eine Bequemlichkeit.« Mit diesem Satz beginnt eine Recherche über zwei Männer, über den Schriftstellers Rainer Trutz und Waldemar Gejm, einen Professor für Mathematik und Linguistik an der Lomonossow-Universität, der seit Jahren ein neues Forschungsgebiet entwickelt: die Mnemotechnik, die Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung. Doch der Nationalsozialismus in gleicher Weise wie der Stalinismus werden Trutz wie Gejm sehr bald zum Verhängnis: Der Deutsche, aus Nazideutschland geflohen, wird in einem sowjetischen Arbeitslager erschlagen. Die Umschwünge der Politik des Genossen Stalin führen im Falle Gejm zur Deportation mit anschließendem Tod. Nur die beiden Söhne, Maykl Trutz und Rem Gejm, überleben und begegnen sich Jahrzehnte später, im wiederhergestellten Deutschland und machen fast dieselben Erfahrungen wie ihre Väter …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
»In diesen Roman geriet ich aus Versehen oder vielmehr durch eine Bequemlichkeit.« Die Folge: Der Erzähler hat sich auf eine Reise durch die Archive zu begeben. Das Aktenstudium zwingt ihn zu einem Höllenritt durch das 20. Jahrhundert, das sich im 21. Jahrhundert bruchlos fortsetzt.Die in den Archiven lagernden Akten öffnen den Blick auf zwei Familien und ergeben ein Gesamtpanorama dieser extremistischen Jahrzehnte. In dessen Mittelpunkt bewegen sich das deutsche Ehepaar Trutz (mit Sohn Maykl) und der Sowjetbürger Waldemar Gejm mit Frau und seinen zwei Kindern. Der Schriftsteller Rainer Trutz flieht 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Moskau. Dort begegnet er Waldemar Gejm, einem Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonossow-Universität, der gerade ein neues Forschungsgebiet entwickelt: die Mnemotechnik, die Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung.Die Schwankungen in den weltpolitischen Konstellationen sowie die Kurswechsel der Partei in der Sowjetunion werden seit dem Ende der dreißiger Jahre Trutz wie Gejm zum Verhängnis. Die beiden Söhne, Maykl Trutz und Rem Gejm, begegnen sich Jahrzehnte später, im wiederhergestellten Deutschland und machen fast dieselben Erfahrungen wie ihre Väter.In seiner objektiven und zugleich sich einfühlenden Chronik der Lebensläufe zweier Familien hat Christoph Hein einen Jahrhundertroman im zweifachen Sinn geschrieben: ein Jahrhundert umgreifend, ein Jahrhundert widerspiegelnd, ein Jahrhundert verstehbar zu machen und nachzuerleben.
Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien, aufgewachsen in Bad Düben bei Leipzig, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Christoph Hein
Trutz
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Erstausgabe, 2017© Suhrkamp Verlag Berlin 2017Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil desWerkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-75092-6
www.suhrkamp.de
Trutz
In diesen Roman geriet ich aus Versehen oder vielmehr durch eine Bequemlichkeit. Ich wollte mir eine längere Fahrt mit der S-Bahn ersparen, gleichzeitig die Chance nutzen, eine der Direktorinnen des Bundesarchivs Lichterfelde in einem kleinen Kreis ansprechen zu können, ohne in ihrem Archiv offiziell um einen Gesprächstermin zu bitten, eine Bitte, die man mir dort möglicherweise abschlagen würde.
Im Gebäude der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur war eine Veranstaltung zur wechselvollen Geschichte der deutsch-russischen Verhältnisse im letzten Jahrhundert unter dem Titel Feindliche Freunde für den zwölften Februar angekündigt. Eine stellvertretende Direktorin des Bundesarchivs wollte über neue, in ihren Besitz gelangte Dokumente zu dieser leidvollen Beziehung sprechen. Das Thema interessierte mich nur am Rande, ich war mit anderen Dingen beschäftigt, aber die Möglichkeit, eine leitende Dame des Bundesarchivs in einer, wie ich hoffte, kleinen Runde zu treffen, verlockte mich, an jenem Montagnachmittag in die Kronenstraße zu gehen, mir ihre Ausführungen scheinbar interessiert anzuhören, um sie dann mit einem Anliegen zu belästigen, mit einer Anfrage, worüber nur eine Person der oberen Etage des Bundesarchivs eine Entscheidung fällen konnte.
Ich war seit mehr als einem Jahr dabei, die seltsamen Umstände des Todes eines Terroristen zu erhellen, der von einer Hundertschaft Grenzpolizisten ergriffen werden sollte, dabei durch eine Kugel ums Leben kam, doch war trotz mehrerer Prozesse nie aufzuklären, wer den tödlichen Schuss abgegeben hatte, der Gesuchte selbst oder einer der Beamten. Die Staatsanwälte und Richter mussten eine Hundertschaft von Grenzpolizisten befragen sowie, ungeachtet ihrer Amtsgewalt und der Befugnis, von allen Behörden Auskunft notfalls zu erzwingen, und trotz ihrer Unabhängigkeit, die Aussagen der einhundert Grenzpolizisten, die den Auftrag hatten, einen des Terrorismus Verdächtigen festzunehmen, hinnehmen, dass von diesen einhundert Beamten in dem Augenblick, wo der Verdächtige durch eine Pistolenkugel starb, nicht ein einziger zu dem Festzunehmenden blickte, sondern alle abgelenkt waren und daher nichts bezeugen konnten. Vor Gericht konnte sich keiner der Grenzpolizisten an den genauen Ablauf erinnern, und die Beteiligten sagten aus, sie hätten in dem Moment, als der Schuss fiel, woanders hingeschaut. Alle mit dem Fall befassten Gerichte mussten sich trotz erheblicher Bedenken mit diesen Auskünften und einem non-liquet, der Feststellung der Beweislosigkeit, zufriedengeben. Einen Tag nach dem tödlichen Schuss trat der Innenminister zurück, zwei Tage später wurde der Generalbundesanwalt entlassen. Der Rücktritt, so wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, erfolge aus persönlichen Gründen, die Entlassung stehe in keinem Zusammenhang mit dem vom Gericht aufzuklärenden Geschehen. Eine vom Gericht beantragte Vernehmung des zurückgetretenen Ministers wie des entlassenen Bundesanwalts unterblieb, da beiden Personen die Aussagegenehmigung verweigert wurde.
Gern wäre ich im Amtszimmer des Richters dabei gewesen, als er in der Gerichtsakte die Einstellung des Verfahrens gegen die Beschuldigten wegen Nichterweislichkeit einer Beweisbehauptung notierte, als er sein non-liquet eintrug, es ist nicht klar. Zwei der mit diesem Fall befassten Richter waren bereit, mit mir zu sprechen, beide waren mittlerweile pensioniert, doch sie vermochten keine zusätzlichen Fakten und Hintergründe zu benennen, die über die in den Gerichtsakten festgehaltenen hinausgingen. Einer der Ruheständler sagte, in keinem seiner Prozesse sei er entwürdigender vorgeführt worden, der Staat habe zugelassen, dass seine garantierte Unabhängigkeit gegenüber der Exekutive zur Farce verkam.
Ich war als Mann ohne jede Amtsgewalt chancenlos und hatte keinerlei Aussicht, mehr Licht als die Staatsanwälte und Richter in dieses Dunkel zu bringen, hoffte jedoch, im Bundesarchiv in der Finckensteinallee ein paar Akten zu finden, die weiterhelfen könnten, aber gleichzeitig wusste ich, dass ich dort sehr gute, sehr gewichtige Gründe vorbringen musste, damit man mir eine solche Akteneinsicht gewährte. Ein freundliches Gespräch und viel Charme würde mir eventuell die so sorgsam verschlossene Tür öffnen. Da der Schlüssel für diese Tür in der Direktionsetage lag, musste ich dahin vordringen, und nur deswegen ging ich an jenem Montag zu diesem mich wenig interessierenden Vortrag. Ich war sogar eine halbe Stunde früher in dem prachtvollen Gebäude in der Hoffnung, die hohe Dame vielleicht vor ihrem Referat sprechen zu können.
Tatsächlich sah ich sie im Foyer der Stiftung, einen Prosecco in der Hand, plauderte sie mit der Gastgeberin. Als diese ihr das leere Glas abnahm, um es zum Tresen zu bringen, stellte ich mich vor und sprach kurz mein Anliegen an. Die Gastgeberin kam zurück, die Archivchefin entschuldigte sich und bat darum, bis nach der Veranstaltung zu warten, um ihr dann meinen Wunsch zu erläutern. Beide Damen verschwanden hinter einer Tür.
Die neuen Dokumente, die die Archivarin dem Publikum mit Overheadfolien präsentierte, erschienen mir belanglos. Es waren keine sensationellen Erkenntnisse, die eine Neubewertung der geschichtswissenschaftlichen Sicht auf das letzte Jahrhundert erforderlich machten, und was daran unbekannt war, überraschte nicht, sondern blieb im Rahmen des Erwartbaren.
Die Zuhörer folgten den Ausführungen mäßig interessiert. Ein älterer Herr, er saß eine Reihe vor mir, zwei Stühle weiter, schien der Einzige zu sein, der genau zuhörte und von ihrer Rede gefesselt war, jedenfalls schrieb er ununterbrochen mit und füllte die Seiten eines Schreibblocks für Stenotypisten. Die Gastgeberin, die Hausherrin der Stiftung, erhob sich nach dem Vortrag, applaudierte stehend, dankte der Archivarin und fragte, ob es Fragen oder Wortmeldungen gäbe. Da sich niemand meldete, wollte sie die Veranstaltung mit einer Einladung für alle Anwesenden zu einem Glas Prosecco, Saft oder Wasser beenden, als der ältere Herr aufstand und um das Wort bat.
Die beiden Damen am Podium nickten erfreut und forderten ihn auf zu sprechen.
»Verzeihung, aber es waren einfach zu viele Fehler in Ihrem Vortrag, verehrte Dame«, begann er und listete dann acht oder neun gravierende Unstimmigkeiten auf.
Die Referentin wurde abwechselnd blass und rot während seiner Bemerkungen, dann fasste sie sich und sagte, als der Mann zum Schluss kam und sich wieder hinsetzte, erkennbar erregt, der Herr würde sich irren, alle Daten und Fakten wären kontrolliert worden, Archivare würden, bevor sie die kleinste Kleinigkeit herausgeben, alles wieder und wieder überprüfen.
Die Frau neben mir murmelte etwas von einem Klugscheißer, der sich wichtig machen wolle, und die Hausherrin sagte, um die Referentin zu beruhigen, lächelnd, es sei bei ihrer Stiftung an der Tagesordnung, dass nicht alle Besucher mit den Ausstellungsexponaten oder den wissenschaftlichen Referaten einverstanden seien. Es gebe halt die Ewiggestrigen, die einem untergegangenen Staat nachtrauerten und sich daher gegen die ihnen unangenehme Wahrheit sperren.
»Ich trauere einigen Menschen nach, ja, einigen von ihnen sogar sehr«, widersprach ihr der ältere Herr, der sich erneut erhoben hatte, »jedoch gewiss keinem untergegangenen Staat, keinem einzigen. Aber die Wahrheit muss bleiben, und für Sie, eine Archivarin, sollte nichts als die Wahrheit zählen. Sie können meine Korrekturen überprüfen, alle. Einige sogar hier, auf der Stelle. Ich sehe, Sie haben den großen Schmitz auf Ihrem Tisch liegen, diesem Standardwerk werden Sie wohl keine Schnitzer unterstellen. Lesen Sie dort die Ausführungen zum Militärgeld. In der DDR wurde es erst 1980 gedruckt, aber nie verwandt, das vergleichbare Geheimgeld der Bundesrepublik druckte man Anfang der sechziger Jahre und stellte diese Aktion 1981 ein.«
Die Gastgeberin versuchte ihn zu unterbrechen: »Sehr geehrter Herr, ich hatte die Veranstaltung bereits beendet. Wir können das ja alles bei einem Glas besprechen.«
»Nein, bitte schlagen Sie den Schmitz auf. Seite vierhundertzweiunddreißig, der letzte Absatz, schauen Sie es sich an. Lesen Sie es bitte vor.«
Verärgert und irritiert schlug die Referentin das vor ihr liegende Buch auf und blätterte darin.
»Seite vierhundertzweiunddreißig«, wiederholte der Mann, »unten, der letzte Absatz. Lesen Sie bitte die Zeilen vor.«
Hochrot gestand die Archivarin, wohl einen Fehler gemacht zu haben, doch der ältere Herr gab keine Ruhe und sagte, mit Hilfe des großen Schmitz könnte sie gleich noch einen weiteren Irrtum korrigieren, denn nach dem Geheimen Zusatzprotokoll im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 24. August 1939, der wegen Ribbentrops Ankunft auf den 23. August vordatiert wurde, sollten nicht Tausende von Flüchtlingen auf Verlangen gegenseitig ausgeliefert werden, die Zahl wurde damals genau angegeben. Jede Seite hatte laut Protokoll Anspruch auf Rückführung von eintausendfünfhundert Emigranten, und beide Seiten hätten Flüchtlinge ausgeliefert, am 22. Juni 1941, als die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschierte und der Pakt damit hinfällig war, hatten beide Seiten erst achtzig Prozent der Gegenseite übergeben.
Im Saal wuchs der Unmut, man wollte zum Buffet und keine weitere Diskussion, und als die Hausherrin eine einladende Bewegung in Richtung des Tisches mit den gefüllten Gläsern machte, standen alle Besucher auf und begaben sich dorthin. Der Mann angelte nach seiner Unterarmstütze und steckte seinen Schreibblock ein, ich ging nach vorn zum Podium, um die Archivarin zu sprechen, doch die Dame vom Bundesarchiv war noch immer hochgradig erregt, sagte, als ich vor ihr erschien, sie habe keine Zeit mehr, ich möge mich an den archivfachlichen Dienst wenden, die würden mir weiterhelfen. Sie nahm ihr Manuskript und die Bücher, auch den großen Schmitz, und verschwand zusammen mit der Hausherrin in den hinteren Räumen.
Bei den Garderobenhaken stand nur der ältere Herr, die anderen Besucher versammelten sich um den Tisch mit den Gläsern, einige von ihnen schauten verachtungsvoll zu dem Mann hinüber, der es gewagt hatte, die Referentin, eine stellvertretende Direktorin des Bundesarchivs, in Verlegenheit zu bringen. Ich nahm meinen Mantel vom Haken und fragte den Mann, ob ich ihm behilflich sein könne, die Krücke störte ihn beim Überziehen seines Mantels. Obwohl er es war, der meine Hoffnung, mit der stellvertretenden Direktorin des Bundesarchivs unter vier Augen zu reden, durch seine Kritik zerstört hatte, ich also in die Finckensteinallee hinausfahren müsste und dort gewiss keine der Direktorinnen des Bundesarchivs zu sprechen bekam, die allein über mein Ersuchen entscheiden könnten, sondern lediglich einen der Archivsklaven, bot ich ihm meine Hilfe an, denn es hatte mir gefallen, wie unverfroren er sie kritisierte, wie er ihr Fakten und Daten um die Ohren haute, die er offenbar alle im Kopf hatte. Selbst als er die Fehler und Irrtümer wiederholte, die ihr im Vortrag unterlaufen waren, schaute er nicht einen Moment auf die Notizen in seinem Schreibblock.
»Gern«, sagte er, »vielen Dank. Ja, dieses verfluchte Bein, erst eine Knieoperation, dann eine Thrombose, sehr schmerzhaft, sehr langwierig.«
Ich hielt ihm die Tür auf und ging weiter langsam neben ihm her, da er ebenfalls zum U-Bahnhof lief. Dabei erkundigte ich mich, wieso er gewusst habe, worüber die Archivarin sprechen werde.
Er schüttelte den Kopf: »Nein, ich wusste es nicht. Ich wollte hören, was sie zu sagen hat.«
»Aber wieso konnten Sie ihr die Fehler nachweisen? Wieso kennen Sie diese Einzelheiten so genau?«
»Ich habe es irgendwann einmal gelesen. Und was ich gelesen habe, weiß ich. Und wenn ich es aufgeschrieben habe, weiß ich es für alle Zeiten.«
Ich lächelte, mir schien er nun etwas verwirrt und skurril zu sein. Oder ein Klugscheißer, wie die Frau neben mir gesagt hatte.
»Nur ein wenig Training, junger Mann«, sagte er, »nur etwas Gehirntraining. Mnemonik, sagt Ihnen das was?«
»Nein, tut mir leid. Nie gehört. Hat es etwas mit Mnemotechnik zu tun?«
»Sie sind auf dem richtigen Weg. Mnemonik ist eine Wissenschaft, und diese Technik, von der Sie sprechen, wurde nach ihren Forschungsergebnissen entwickelt.«
»Von einer Wissenschaft Mnemonik habe ich nie etwas gehört. Gibt es Hochschulen, an denen sie gelehrt wird?«
»Hierzulande nicht. Aber es gab sie auch hier. Heute müssen Sie in die USA fahren oder nach Frankreich. Auch Russland hat die Forschungen wiederaufgenommen, wie ich erfuhr.«
»Und Sie, Sie sind einer dieser Mnemoniker?«
»Nein, leider nicht. In Deutschland ist diese Wissenschaft weniger bekannt. Aber ich wurde von einem Mnemoniker trainiert, von Kindesbeinen an. Vermutlich war er seinerzeit der weltweit beste und berühmteste dieser Zunft. Gejm hieß er.«
»Dieser Name sagt mir auch nichts, leider.«
»Ja, es ist alles vergessen. Ausgelöscht. Blutig ausgelöscht. Die Mnemonik zieht eine Blutspur hinter sich her, bis heute. Bereits zu Beginn war das so, diese Wissenschaft begann mit einem Massaker. Ein gutes Gedächtnis war in der Geschichte der Menschheit stets eine tödliche Gefahr. Das Vergessen wird belohnt, nicht das Gedächtnis. Wenn Sie schnell und rasch vergessen, werden Sie glücklich auf Erden und können in Ruhe alt werden. Doch wenn Sie sich an alles erinnern, bekommen Sie Schwierigkeiten, und die können tödlich sein. So geht es bis in unsere Zeit, bis zu mir. Heute, genau vor einem Jahr, gab es das vorerst letzte Verbrechen. Ein Mord, ein grauenvoller Mord, der einem Gedächtnis galt.«
Ich wusste nicht, ob ich diesem Mann auch nur ein Wort glauben konnte, ob ich einem Kerl mit einem besonders schrulligen Spleen begegnet war, einem jener Irren, die mit Verschwörungstheorien durchs Land ziehen und von Plänen zur Eroberung der Welt oder eines Kontinents schwätzen, um vor einer absonderlichen, irdischen oder extraterrestrischen Gefahr zu warnen, oder ob an seinem Gerede von einer Wissenschaft mit Blutspur und Massaker etwas dran war.
»Ich weiß nicht, Herr …«
»Trutz heiß ich, Maykl Trutz«, sagte er.
Ich gab ihm die Hand, stellte mich ebenfalls vor und fragte, wo man mehr über diese Wissenschaft erfahren könne, von der ich noch nie gehört hatte.
»Kommen Sie zu mir, besuchen Sie mich, dann will ich Ihnen gern etwas darüber erzählen. Aber in einer halben Stunde ist das nicht abgetan. Ich muss dann von dem großen Gejm berichten, von Waldemar Gejm und seinem Sohn Rem. Von meinem Vater Rainer Trutz, von meiner Mutter, von Lilija und noch von einigen anderen, wenn Sie etwas von der Mnemonik verstehen wollen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Zeit haben.«
Er blieb stehen, klemmte die Krücke unter einen Arm, zog sein Portemonnaie heraus, entnahm ihm eine Visitenkarte und gab sie mir.
Ich bedankte mich und versprach nach kurzem Zögern, mich bei ihm zu melden. Zusammen stiegen wir langsam die Treppen zum U-Bahn-Schacht hinunter, auf dem Bahnsteig fragte ich, was ich mitbringen dürfe.
»Einen ausgeschlafenen Kopf und ein gutes Gedächtnis, das reicht«, sagte er und fügte dann noch hinzu: »Und Sie könnten einen Wodka mitbringen, einen Gorbatschow möglichst.«
»Mach ich. Ist das ein guter Wodka?«
»Keine Ahnung, ich trinke nicht. Höchstens einmal im Jahr ist mir danach, und heute ist so ein Tag, heute würde ich sehr gern einen Gorbatschow trinken.«
Er wies auf die einfahrende Bahn: »Melden Sie sich. Oder lassen Sie es bleiben. Auf Wiedersehen.«
Er humpelte in den Waggon und setzte sich auf eine Bank, ich sah ihm nach, bis die Bahn abfuhr, er schaute sich nicht nach mir um. Ich blickte auf die Visitenkarte, Maykl Trutz, Fischerinsel, und steckte sie in die Reverstasche. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn tatsächlich aufsuchen wollte.
In den nächsten Wochen arbeitete ich Tag für Tag an meinem Manuskript. Ich fuhr auch ins Bundesarchiv hinaus, in die Finckensteinallee, aber dieser Besuch war überflüssig. So viel Charme ich auch aufwandte, man wollte mir nicht einmal sagen, ob zu jenem Fall Akten bei ihnen liegen, noch nicht einmal diese Auskunft dürfe erteilt werden. Die ältere Archivarin, mit der ich sprach und der ich um den Bart ging, von dem tatsächlich etwas zu sehen war, meinte, ich würde ohne eine Genehmigung keine Einsicht bekommen, selbst wenn ich der Bundeskanzler wäre, auch bei dem hätte entweder der Bundestag oder der Generalbundesanwalt zuzustimmen. Wer in diesem Fall eine Genehmigung erteilen darf, wisse sie nicht, da müsse sie sich erst in der Benutzungsverordnung des Bundesarchivs kundig machen. Ich erwiderte, diese Mühe könne sie sich sparen, ich sei derzeit in einem anderen Beruf tätig. Nach einer längeren Plauderei, ich versuchte vergeblich, sie aufzutauen, fragte ich sie ganz direkt, ob es nicht andere Wege, nichtoffizielle Zugänge, also ein Hintertürchen zu diesen Akten gebe.
Sie war nicht verärgert, lächelte freundlich und sagte. »Und Ihre nächste Frage ist, ob ich Ihnen Haschisch beschaffen kann oder andere Drogen?«
Ich nickte und erwiderte: »So direkt hätte ich Sie das nicht zu fragen gewagt.«
Wir lachten herzlich, sie offenherzig, ich eher verzweifelt, dann verabschiedete ich mich.
Anfang März, an einem Samstag, rief ich Trutz an. Herr Trutz erinnerte sich augenblicklich an mich, wir verabredeten uns für den kommenden Freitag fünfzehn Uhr. Er wohnte in einem der neueren Hochhäuser der Fischerinsel, im sechsten Stockwerk. Seine Frau öffnete mir die Tür, brachte mich in sein Zimmer und fragte, ob ich Kaffee oder Tee wünschte. Herr Trutz blieb in seinem Sessel sitzen, als ich eintrat, ich erkundigte mich nach seinem Bein, er wischte die Frage mit einer Handbewegung weg und sagte, ich solle mich setzen und zuhören. Ich reichte ihm die gewünschte Wodkaflasche, er dankte und stellte sie achtlos neben seinen Schreibtisch, der in dem riesigen, alle drei Zimmerwände bedeckenden Bücherregal eingebaut war. Er bat mich, ihm zwei Broschüren von seinem Schreibtisch zu holen. Als ich sie ihm reichte, sagte er, diese beiden dünnen Büchlein könne er mir, so ich wolle, ausleihen, da würde ich das eine und andere zur Mnemonik finden, mehr gäbe es leider nicht. Ich dankte und versprach, sorgsam mit den Broschüren umzugehen. Seine Frau kam ins Zimmer und brachte eine riesige Thermosflasche mit Tee, sie habe die große Flasche genommen, um uns später nicht stören zu müssen. Sie goss mir und ihrem Mann Tee ein und verabschiedete sich mit einem Lächeln.
»So«, sagte Maykl Trutz, »fangen wir an. Ich will nicht bis in die Antike zurückgehen, vorerst nicht. Ich fange mit meinem Vater an.«
Er redete vier Stunden ohne Unterlass, ich hörte ihm zunehmend gebannt zu und schrieb in Stichpunkten mit, was er sagte. Während er erzählte, schaute er aus dem Fenster auf die Spree und das Rolandufer, nur selten sah er einmal zu mir. Um neunzehn Uhr, genau nach vier Stunden, beendete er seinen Bericht und sagte, er sei jetzt müde und nicht mehr ausreichend konzentriert. Wenn ich mehr erfahren wolle, müsse ich wiederkommen. Ich erkundigte mich, wann es ihm recht sei, und er entgegnete, er sei Rentner, Pensionist, ihm sei jeder Tag recht. Wir verabredeten uns für den sechsten März, wiederum um fünfzehn Uhr. Ich fragte, ob ich ein kleines Aufzeichnungsgerät mitbringen dürfe, einen Recorder, ich hätte nicht sein fabelhaftes Gedächtnis und beim Mitschreiben entgehe mir vieles.
»Wie Sie wollen«, sagte er.
Ich besuchte Maykl Trutz acht Mal. Bei jedem Besuch sprach er vier Stunden lang, genau vier Stunden, um dann plötzlich und ohne auf die Uhr zu schauen seinen Bericht abzubrechen, da er erschöpft sei und verbraucht, und mich rasch zu verabschieden.
Ende April sah ich ihn zum letzten Mal. Wir telefonierten danach gelegentlich, alle zwei, drei Monate meldete ich mich bei ihm, da ich noch Fragen hatte, hauptsächlich aber war ich mit jenen Vorgängen beschäftigt, zu denen nicht nur mir, sondern auch drei deutschen Gerichten vollständige Akteneinsicht verwehrt worden war. Ähnlich den damaligen Richtern würde auch ich wohl meine geplante Publikation mit einem non-liquet beenden müssen. Die Aktenlage gab keine andere Möglichkeit her oder vielmehr die Archive gaben die Akten nicht her.
Meine Zweifel gegenüber Trutz, die anfängliche Vermutung, es bei ihm mit einem jener Verwirrten zu tun zu haben, die eine fixe Idee beherrschte, die unter Zwangsvorstellungen litten und Verschwörungstheorien nachjagten, hatten sich bei meinem allerersten Besuch in Luft aufgelöst, dieser Mann hatte mein volles Vertrauen.
Im Mai 2003 rief ich Maykl Trutz an und sagte, nun würde ich mich vollständig und ausschließlich mit seinem Fall befassen und deshalb in vier Tagen nach Moskau fliegen, ich hätte mit einem Militärarchiv im Stadtteil Sewerny Verbindung aufnehmen können und hoffe, dort fündig zu werden und weitere Dokumente aufzuspüren. Ich benötigte für die neue Recherche so viele der irgendwo gesammelten Aktenstücke wie nur möglich, ich erwartete weitere Aufklärung, um alles besser zu verstehen, um die Zusammenhänge zu begreifen und verstehbar zu machen.
Für diesen Fall gab es in den deutschen Archiven keinerlei Beschränkungen, ich bekam alles, um was ich bat. Die Ausbeute war jedoch gering, weshalb ich mich auf russische Archive konzentrierte, bei denen ich jedoch auf größeren Widerstand stieß, bei fast jeder zweiten angeforderten Akte in den Archiven der sowjetischen Armee wie auch der Zweiten und Dritten Hauptverwaltung des KGB wurde mir Einsicht verweigert. Die Suche war mühsam, zweimal unterbrach ich diese Arbeit und war schon fast entschlossen, sie für immer einzustellen. Doch bei der Durchsicht meiner Gesprächsnotizen und einem wiederholten Anhören der Tonaufzeichnungen von Maykl Trutz wurde ich wieder verführt weiterzumachen.
Im Mai 2007 starb Maykl Trutz, er wurde dreiundsiebzig Jahre alt. Drei Monate zuvor hatte man einen inoperablen Gehirntumor bei ihm diagnostiziert. Im März noch hatte ich mit ihm telefoniert, am Telefon bemerkte ich, dass er Schwierigkeiten beim Sprechen hatte, doch von dem Tumor sagte er mir nichts. Auf die Traueranzeige von Annika Trutz war ich nicht vorbereitet.
Am Tage seiner Beerdigung wollte ich am Morgen mit Aeroflot über Moskau nach Tscheljabinsk fliegen, da ich endlich eine Besuchserlaubnis für das Archiv ITL erhalten hatte, in dem sich die Akten des Tscheljabinsker Besserungsarbeitslager befanden. Ich rief in dem Archiv an, konnte den vereinbarten Termin um drei Tage verschieben und auch die beiden Flüge umbuchen, um bei der Beisetzung auf dem Sophienfriedhof dabei zu sein.
Etwa fünfundzwanzig Leute versammelten sich in der kleinen Friedhofskapelle, Annika Trutz erkannte mich sofort wieder, wir hatten uns jahrelang nicht gesehen, und dankte für mein Kommen. Mit dem Requiem von Mozart wurde die Feier eröffnet, ein Mann vom Beerdigungsinstitut oder von der Friedhofsverwaltung stand an dem CD-Spieler, regelte die Lautstärke und unterbrach die Musik an einer geeigneten Stelle, damit einer der Freunde von Maykl Trutz sprechen konnte.
Zum Ende der kurzen Feierlichkeit gab es einen befremdlichen Vorgang. Vier Träger hatten den Sarg aufgenommen und schritten gemessenen Schrittes aus der Kapelle, Annika Trutz folgte ihnen, und alle anderen standen auf, um sich ihr anzuschließen. Plötzlich setzte ein Walzer ein, ein fröhlicher, beschwingter Walzer. Alle Gäste erstarrten, ich auch, und blickten erschrocken auf den Mann an dem CD-Spieler, dem offensichtlich oder vielmehr unüberhörbar ein dummer, ein höchst peinlicher Missgriff unterlaufen war, er jedoch stand seelenruhig neben dem Gerät und grinste verlegen, und da Annika Trutz sich nicht entsetzt umgewandt hatte, sondern weiter mit kleinen Schritten dem Sarg folgte, war diese Musik, dieses unpassende Operettencouplet, offenbar von ihr bestellt worden. Noch bevor die Träger mit dem Sarg die Ausgangstür erreicht hatten, ertönte die dunkle Stimme eines Tenors, in die ein heller, ein jubilierender Sopran einfiel, und während die kleine Trauergemeinde die Kapelle verließ, sangen die beiden, es sei nur der glücklich, der vergessen könne, was nicht zu ändern ist.
Am offenen Grab nahm ich eine Handvoll Erde auf und warf sie auf den Sarg von Maykl Trutz. Diesem Mann verdanke ich diesen Roman, für den ich die Archive dreier Länder aufsuchte, um seinen Bericht zu vervollständigen und um weitere Details aufzuspüren.
Ihm, Maykl Trutz, sei daher dieses Buch gewidmet.
Tatsächlich aber werde ich diesen Roman erst an dem Tag vervollständigen und wirklich beenden können, wenn, wie Rem seinem Freund Maykl schrieb, sich die Gräber auftun und die Archive geöffnet werden.
Erster Teil
1. Kapitel
Rainer Trutz, Maykls Vater, hatte als Neunzehnjähriger sein Heimatdorf Busow verlassen, eine kleine Siedlung an der Bahnstrecke, die von Ducherow und Kamp über eine eingleisige, handbetriebene Drehbrücke nach Swinemünde führte, und war nach Berlin gegangen, da der väterliche Bauernhof seinem zwei Jahre älteren Bruder Frieder übereignet worden war und ihm der Sinn nicht danach stand, sein Leben mit Feldarbeit und Viehzucht zu verbringen. In seinem Dorf und in der weiteren Umgebung gab es keine Arbeit, die ihn lockte, zumal in der gesamten nördlichen Region die Arbeitslosigkeit höher war als im restlichen Deutschen Reich.
Das einzige größere Projekt in diesem deutschen Randbezirk war ein in Planung befindliches Brückenbauwerk, eine zweigleisige Hubbrücke nach dem Vorbild der Marstallbrücke, die aber anders als die Lübecker Konstruktion nicht dem Autoverkehr und den Fußgängern dienen, sondern ausschließlich Zügen der Reichsbahn vorbehalten sein sollte. Die neue Brücke war seit längerer Zeit ein beständiges Thema der regionalen Zeitung, die Bevölkerung beteiligte sich mit teilweise deftigen Leserbriefen lebhaft an der Diskussion, die einen erwarteten von der Brücke Arbeitsplätze und eine steigende Zahl von Feriengästen, andere befürchteten, das Bauwerk würde die Küstenlandschaft verschandeln und ein in schwindelerregender Höhe dahinrasender D-Zug sei eine fortwährende Gefahr für Leib und Leben nicht allein der Reisenden, sondern auch der unter der Bahnstrecke ansässigen Mitbürger.
Der jungen Trutz sah in diesem Projekt keine zukunftsträchtige Chance für sich, denn es würden gewiss viele Arbeitsplätze entstehen, aber allein für Bauarbeiter, Schmiede, Schweißer und Eisenleger, für Berufe, die allesamt mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden waren, wozu er nach den Jahren auf dem väterlichen Bauernhof nicht die geringste Neigung verspürte.
Er war, verbunden mit alltäglichen, halbstündigen Busfahrten, in Anklam aufs Gymnasium gegangen, und die Lesezeit im Bus wie der Schulbesuch waren für ihn die schönen Stunden des Tages. Daheim gab es immerfort etwas für ihn zu tun, er hatte kaum Zeit für die Schularbeiten, musste dem Vater im Stall und auf dem Feld helfen. Sich mit einem Buch zurückzuziehen galt als Faulenzerei und wurde gerüffelt, selbst die erforderliche Lektüre für die Schule und das Lernen der englischen und französischen Vokabeln wurde daheim ungern gesehen. Da sein älterer Bruder bereits nach der achten Klasse von der Schule abgegangen war und keinerlei Interesse an Büchern oder Musik aufbrachte, sondern von früh an sich auf dem Hof nützlich machte und dem Vater zur Seite stand, wirkten Rainers Vorlieben für Literatur und die Künste auf seine Eltern besonders befremdlich, ihr jüngerer Sohn war in ihren Augen lebensuntauglich.
Der Deutschlehrer seiner letzten drei Schuljahre war es, der die Neigungen und Begabungen des jungen Trutz erkannte und förderte, und er war es auch, der dem siebzehnjährigen Rainer zusammen mit drei anderen Schülern die Möglichkeit verschaffte, erstmals in ihrem Leben eine Theateraufführung zu besuchen. Rainers Eltern wollten ihrem Sohn diesen Theaterbesuch nicht erlauben, sie waren nicht bereit, auch nur einen Pfennig dafür zu bezahlen, so dass sein Deutschlehrer sich entschloss, die Theaterkarte wie auch das Busticket nach Stralsund für seinen begabtesten Schüler aus der eigenen Tasche zu bezahlen.
An einem Sonntagmittag fuhr er mit den vier Schülern zum Neuen Theater, wo sie Schillers Wilhelm Tell sehen konnten, eine Aufführung in einer bombastischen Bühnenlandschaft, die einen Teil des Mont-Blanc-Massivs darstellen sollte, in der es offenbar auch tätige Vulkane gab, da im Hintergrund der Berggruppe beständig Feuer und Rauch zu sehen waren. Rainer war hingerissen, und wochen- und monatelang war für ihn entschieden, Schauspieler zu werden. Er las nun vor allem Theaterstücke, suchte sich Rollen heraus, die er auswendig lernte und bei der Feldarbeit halblaut vor sich hin sprach.
Rainer beendete die Schule mit einem der besten Abiturzeugnisse, die das Anklamer Gymnasium je vergeben hatte. Nun stünde ihm jede Universität offen, versicherten ihm seine Lehrer, doch sein Vater und der ältere Bruder, der mittlerweile den Hof übernommen hatte, erklärten, ihn in dieser Zeit und bei der wirtschaftlichen Situation des Hofes mit keinem Pfennig bei einem lustigen Studentenleben unterstützen zu können. Den Eltern wie seinem Bruder schienen alle Berufswünsche von Rainer nur Tagträumereien eines Menschen zu sein, der der Arbeit aus dem Wege zu gehen suchte und seine Zeit stattdessen mit Büchern verbringen wollte. Rainer entschied sich daraufhin, das Elternhaus zu verlassen und für immer nach Berlin zu gehen.
In dieser gerühmten und aufregenden Weltstadt, in der so viele ihren Weg und ihr Glück gefunden hatten, könnte er sich wohl leichter und schneller in einem Beruf beweisen, der einer seiner Neigungen entsprach, wobei er hoffte, in der großen Stadt die nötigen Anregungen zu bekommen, um sich für eine seiner Veranlagungen und Begabungen zu entscheiden, denn noch trieb es den jungen Mann in alle möglichen Richtungen. Immer noch träumte er von einer Karriere als Schauspieler, aber er begeisterte sich tagtäglich auch für andere Berufe, sei es in einem Kunstgenre oder in einer wissenschaftlichen Disziplin, sei es die Idee, als Forschungsreisender entlegene, unerschlossene Gebiete zu betreten und fremde Kulturen und unbekannte Sprachen zu studieren oder auch nur von ihm bewunderte handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen. Berlin, davon war er überzeugt, als er sich auf den Weg in die Hauptstadt machte, würde ihm den richtigen Weg weisen, den Weg, der ihm bestimmt war, auf dem er Erfolg, Geld und Ruhm erlangen würde.
In den ersten Wochen zeigte ihm Berlin die kalte Schulter, eine eiskalte Schulter. Mittellos wie er war, musste er die ersten Nächte in einem Obdachlosenquartier im Gewerkschaftshaus am Engeldamm zubringen. Da er nie Mitglied einer Gewerkschaft war und das Quartier den in Not geratenen und arbeitslosen Gewerkschaftlern vorbehalten war, wurde er nach acht Tagen von seinem Schlafplatz verjagt und musste notgedrungen in einem Asyl in der Krausnickstraße um einen Platz bitten. Dieses Obdachlosenquartier bestand aus zwei miteinander verbundenen Wohnkellern, in denen es keine Bettgestelle aus ungehobelten Holzlatten gab wie im Gewerkschaftshaus, hier lagen die alten und modrig riechenden Matratzen direkt auf der gestampften Erde des Kellers, eine Matratze dicht an der anderen. In der Nacht war für den jungen Trutz kaum an Schlaf zu denken, denn immerfort schrie oder fluchte einer, weil andere sich die Seele aus dem Leib husteten oder sich geräuschvoll schnäuzten. In der dritten Nacht hatte er eine heftige Auseinandersetzung mit einem Polen und einem Rumänen, die ihm die wenigen Habseligkeiten aus seinem Rucksack zu stehlen suchten, den er sich unter seinen Kopf gelegt hatte. Die beiden schlugen heftig auf ihn ein, da er den Rucksack mit beiden Armen fest umklammert hielt und sich nicht entreißen ließ. Die anderen Asylbewohner schauten dem Kampf gelangweilt zu oder brüllten ihn an, den Rucksack herauszurücken, damit endlich Ruhe einziehen könne.
In den nächsten vier Nächten schlief er auf Parkbänken, wobei er häufig von anderen Bankschläfern geweckt und verjagt wurde, die ihm versicherten, einen alten und von allen respektierten Anspruch auf den von ihm belegten Platz zu haben. In einer Nacht wurde er von zwei Polizisten, die zu Pferd den Park durchstreiften, grob von der Bank gestoßen und aufgefordert zu verschwinden, da er anderenfalls in ein Quartier komme, das sie, die Polizisten, für Leute wie ihn bereithielten.
Bereits am Tag nach seiner Ankunft hatte er eine Arbeit gefunden, zumindest glaubte er es. Eine Agentur in der Großen Hamburger Straße, deren Niederlassung den Namen »Vermittlungsinstitut und Annoncen-Expedition Chipper« trug, suchte in einem Aushang nach jungen, begeisterungsfähigen Männern mit Interesse an ungewöhnlich hohen Verdienstmöglichkeiten. Der junge Trutz betrat das Büro der Agentur und wies auf den Aushang im Fenster. Man bot ihm an, als Vertreter und Werbefachmann für sie zu arbeiten und Lose einer Lotterie und Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften zu verkaufen. Er würde zwei bis acht Mark pro abgeschlossenen Vertrag erhalten, und er wäre ein gemachter Mann, wenn er jeden Tag auch nur zwanzig unterschriebene Verträge vorlegte, was spielend zu erreichen sei, die meisten anderen Werbefachleute, wie die Agentur ihre Türklingeldrücker nannte, schafften das Tag für Tag und es gäbe ausgefuchste Spezialisten, die vierzig und manchmal fünfzig Verträge vorweisen könnten. Jeden Vormittag müsse er zwischen zehn und elf in der Agentur erscheinen, um den Vortag abzurechnen, und dann könne er sich auf den Weg machen, um so viel Geld zu verdienen, wie er wolle. Man riet ihm, nie vor elf Uhr mit dem Abklappern der Häuser zu beginnen und nach sieben Uhr abends nicht mehr an Wohnungstüren zu klingeln, stattdessen solle er dann die Kneipen seines ihm zugewiesenen Sektors aufsuchen, bierselige Kunden wären leicht für einen der Verträge zu gewinnen.
Die in Aussicht gestellten prächtigen Verdienstmöglichkeiten lockten ihn, und er ließ sich die Mappe mit den Ansichtsexemplaren der Zeitungen und Zeitschriften sowie einen dicken Stapel von Vertragsformularen für Abonnements der Blätter und Lotterieverträge aushändigen. Auf dem im Büro aushängenden Stadtplan wurde ihm sein Sektor zugewiesen. Der Angestellte der Agentur sagte, diese Straßen seien eine reine Goldader, er müsse das Gold nur schürfen, und da er jung sei und gut aussehe, wäre das für ihn gewiss kein Problem. Allerdings gäbe es Vorgaben, die Agentur könne einen solchen Goldclaim nur erfolgreichen Verkäufern im Außendienst überlassen. Wenn er zu wenige Verträge abschließe, sei man gezwungen, diese Goldader einem anderen zuzuweisen. Er ermahnte ihn, bei seinen Werbetouren sich sauber und ordentlich zu kleiden, die Kunden höflich zu behandeln, denn er vertrete gewissermaßen die Agentur nach außen, ein falsches und unkorrektes Auftreten von ihm oder gar ein Skandal würden dem Vermittlungsinstitut angelastet werden, was die Agentur Chipper keinesfalls hinnehmen könne.
»Und jetzt viel Erfolg, Herr Trutz. Scheuen Sie nicht davor zurück, schnell reich zu werden«, sagte er zum Abschied.
Als er fünf Tage später um zehn in der Agentur Chipper erschien, teilte er dem nicht sonderlich überraschten Angestellten mit, dass er die Arbeit aufgebe. An den zurückliegenden Tagen hatte er, obwohl er von zehn Uhr früh bis in den späten Abend hinein mit der Mappe der Annoncen-Expedition unterwegs war, nicht einen einzigen Vertrag abschließen können. Er habe keine einzige Zeitung und kein einziges Lotterieabonnement an den Mann gebracht, er habe folglich nicht einen Pfennig verdient, entweder sei er für diese Arbeit nicht geeignet oder was er anzubieten habe, locke keinen hinter dem Ofen hervor. Tatsächlich war er täglich acht Stunden die Treppen hoch- und runtergelaufen, hatte sich die Tür vor der Nase zuschlagen und sich beschimpfen lassen, dreimal war ihm angedroht worden, den Hund auf ihn zu hetzen, und das Freundlichste, was er bei diesen Klingeltouren erlebte, war, dass ein älterer Mann ihm aufmerksam zuhörte, als er seine Anpreisungen vortrug, die er mit einer immer gleichen Suada beendete. Der Mann lauschte ihm offensichtlich interessiert und zustimmend, um schließlich, bevor er überraschend die Wohnungstür ins Schloss warf, überaus freundlich und mitfühlend zu ihm zu sagen: »Ach, du armes Hascherl, du!«
In den Kneipen waren die Gäste, an deren Tisch er sich setzen wollte, um ihnen eine Zeitung oder ein Los aufzuschwatzen, über ihn verärgert. Mehrmals riefen sie laut und empört nach dem Gastwirt, der, einer wie der andere, mit grimmiger Miene von der Theke herbeieilte, ihn am Kragen packte und mit dem Hinweis, sich hier nie wieder blicken zu lassen, zur Tür hinausstieß.
Der Angestellte der Agentur Chipper hörte sich schweigend die Klage von Trutz an, nahm die Mappe entgegen und ließ ihn wort- und grußlos stehen, womit dieser Traum vom leicht zu verdienenden, vielen Geld für ihn ausgeträumt war und er sich erneut nach einer Arbeit umschauen musste.
Rainer Trutz wurde immer verzweifelter, denn er sah die vielen Arbeitslosen auf der Straße, die ebenso gierig wie er händeringend eine Arbeit suchten, sich jedoch viel besser als er in der Stadt auskannten. Wie sollte er hier eine Beschäftigung finden, wenn selbst diejenigen, die seit ihrer Geburt oder seit Jahren in Berlin lebten, nichts für sich ergattern konnten. Er sah, an den Kiosken wurden die Zigaretten einzeln verkauft, und auch der Schnaps war dort glasweise zu erstehen. Die Armut war in der Großstadt deutlicher sichtbar als in seinem Dorf, wo die Arbeitslosen nicht auf der Straße standen, sondern sich in ihrem Vorgarten betätigten oder einen Feldstreifen bewirtschafteten, den sie seit Generationen besaßen und von dem sie sich halbwegs ernähren konnten. Das Elend dort war nicht geringer, aber auch in der ärmlichsten Bauernkate gab es immer etwas zu tun und ringsherum wuchsen Pflanzen und Kräuter, von denen man sich ernähren konnte, und wer von ihnen das Fallenstellen beherrschte, hatte auch jede Woche einen Braten auf dem Tisch. Der Mangel in der Stadt war bedrückender, die bedürftigen und bettelnden Menschen erschienen ihm verloren und wirkten stumpfsinnig in ihrer trüben Hoffnungslosigkeit. Wie erstarrt standen sie an den Straßenecken oder saßen in Türeingängen, eine Hand reglos vorgestreckt, warteten sie auf ein Almosen oder bückten sich rasch, um eine weggeworfene Kippe aufzulesen und dann rasch und gierig an ihr zu nuckeln.
Dennoch wollte er keinesfalls zurück. Nicht nur den Hohn und Spott des Bruders fürchtete er oder die Verachtung des Vaters, er hatte den ungeliebten, den verhassten Kleinbauernhof mit den Mistforken und dem Stall für zwei Schweine und drei Ziegen, den mit Hühnerkot gepflasterten Vorgarten und den penetranten säuerlichen Gestank, der über dem Hof lag und die Küche und alle Zimmer durchdrang, verlassen, um sich nie wieder in das Joch einer stumpfsinnigen und bedrückenden Arbeit im Stall und auf dem Feld einschirren zu lassen. Er brauchte die Stadt, die Großstadt mit ihrem wilden und anregenden Leben, die beständige Erregung, die Hast und Eile der Großstädter, die sprunghafte, pulsierende Betriebsamkeit, die Lust am Überschreiten von Grenzen, Grenzen der Moral, des Anstands, der bürgerlichen Sitten. Der rauhe Umgangston, der scharfe Witz, dem man auf der Straße und in der Kneipe ausgesetzt war, mit dem ihn selbst die Metzgerfrau und die Verkäuferin im Bäckerladen für Momente sprachlos machten, diese Weltbürger, bei denen das allerhöchste Lob, das man von ihnen hören konnte, nur in einem Da kann man nich meckern bestand, die vielen Kinos und Theater, in die man mit verbilligten Restkarten oder Billetts für Stehplätze hineinkam, und die Cabarets, Revuebühnen und Nachtbars, vor denen er minutenlang stand, um die Bilder der halbnackten Frauen anzustarren, die Fotos von Tänzerinnen, bei deren Anblick man daheim wohl in Ohnmacht gefallen wäre, all dies begeisterte ihn.
Nein, ins Dorf zurückzugehen, das kam für ihn nicht in Frage, und wenn Berlin und die deutschen Großstädte ihn verschmähten, würde er nach Amerika auswandern, nach New York, um dort sein Glück zu machen. Er könnte als Schiffsjunge oder Küchenkraft auf einem Überseedampfer anheuern, und in Amerika würde es ihm irgendwie gelingen, unbemerkt von Bord zu kommen und, legal oder illegal, amerikanischen Boden zu betreten. Eine Woche gab er sich noch, in Berlin einen Fuß auf die Erde zu bekommen, anderenfalls würde er per Anhalter nach Hamburg reisen, im Hafen nach einem Überseedampfer, einem Passagierschiff oder einem Frachtschiff, das nach Amerika ausläuft, Ausschau halten und sich anheuern lassen. So oder so, er würde es schaffen, er würde in einer großen deutschen Stadt oder im Ausland seinen Weg finden, und dann würden seine Eltern und der Bruder eine bunte Ansichtskarte von ihm bekommen, über die sie nur staunen konnten.
2. Kapitel
An seinem zehnten Tage in Berlin wurde er auf dem Bürgersteig in der Mohrenstraße von einem Auto angefahren, das aus einer Hofeinfahrt schoss. Der rechte Kotflügel einer großen Limousine riss ihn zu Boden, er schlug mit einer Schulter hart auf dem Kopfsteinpflaster auf, sein Kopf prallte auf den Bürgersteig und er blieb für Sekunden benommen und nahezu ohnmächtig liegen.
Die Fahrerin des Wagens, eine Frau Mitte dreißig mit einer modischen Bubikopffrisur, sprang erschrocken aus dem Auto, das nun den gesamten Gehweg blockierte, und half ihm aufzustehen. Aufgeregt fragte sie den jungen Mann mehrmals, ob ihm schwindlig sei oder übel, woraufhin er zu ihrer Verwunderung nur über die zerrissene Jacke klagte, die Hautabschürfungen an seiner Schulter und die stark blutende Kopfwunde aber nicht zu bemerken schien. Die Frau wollte ihn umgehend in ein Krankenhaus fahren und wurde, da er sich sträubte, weil er keinesfalls einen halben Tag in einem Krankenhaus verlieren, sondern so bald wie möglich seine Suche nach einem Arbeitsplatz fortsetzen wollte, energisch und nötigte ihn, in ihr Auto einzusteigen. Sie brachte ihn in die Notaufnahme des Krankenhauses im Friedrichshain und setzte sich ins Wartezimmer, bis eine Krankenschwester ihr einen ersten und vorläufigen Bericht über sein Befinden und die Schwere der Verletzungen gab. Der Unfall sei vermutlich glimpflich abgelaufen, es sei nur eine Bagatellverletzung, aber der Kopfwunde wegen und um eine mögliche Gehirnerschütterung auszuschließen, würde man ihn über Nacht dabehalten und ihn bis zum Morgen beobachten. Die junge Frau erkundigte sich, um welche Uhrzeit der Patient das Krankenhaus verlassen werde, denn sie wolle ihn unbedingt zuvor noch sehen.
»Nicht vor elf«, sagte die Schwester, »Entlassungen immer erst nach der Visite.«
Am nächsten Tag erschien die Frau kurz nach acht mit einem Blumenstrauß im Krankenhaus, fragte in der Notaufnahme nach dem Verunfallten, man sagte ihr seinen Namen und nannte ihr die Nummer des Zimmers, in dem er lag. In diesem Zimmer standen sechs Betten, alle belegt, die Männer wandten die Köpfe zu der jungen Frau, als diese nach einem kurzen Anklopfen eintrat, alle grüßte und dann zu Rainer Trutz ging, der in einem Bett am Fenster lag. Sie erkundigte sich nach seinem Befinden, er antwortete, es sei alles in Ordnung, und wollte, als sie ihm die Nelken überreichte, verwundert wissen, wieso sie ihm Blumen schenke. Sie musste ihm erst erklären, sie sei jene Person, die ihn gestern angefahren und dann ins Krankenhaus gebracht habe, da er sich nicht an sie erinnerte. Sie wollte ihn allein sprechen, und er meinte, das sei kein Problem, er könne aufstehen und habe sich ohnehin angezogen, da er nach der Visite verschwinde.
Die beiden gingen auf den Flur hinaus und setzten sich in die Besucherecke. Sie fragte ihn, ob er den Unfall bereits bei der Polizei angezeigt habe, und er erwiderte, er habe nicht vor, wegen einer Lappalie bei der Polizei Stunden zu vertrödeln, ihm gehe es gut, das Schlimmste sei das zerrissene Hemd und die unbrauchbar gewordene Hose. Die Frau nahm aus ihrer Handtasche fünf Zehnerscheine der neuen Reichsmark und drückte sie ihm in die Hand. Er starrte überrascht auf das Geld und sagte, für eine solche Summe würde er sich gern jeden Tag einmal von ihr anfahren lassen, das wäre ein gutes Geschäft für ihn.
Die Frau stellte sich ihm vor, ihr Name sei Lilija Simonaitis, sie arbeite im Filmressort der Handelsabteilung bei der sowjetischen Botschaft und sei erleichtert, dass er sie nicht anzeigen werde, denn sie würde nicht nur eine Geldstrafe bekommen, die Behörden würden die Botschaft verständigen und möglicherweise die Presse, und bei den angespannten Beziehungen der beiden Staaten könne der unglückselige Unfall zu einer politischen Affäre hochgespielt werden, zumal sehr viele russische Emigranten in Berlin lebten, die gleichfalls die Chance nutzen könnten, dieses unglückliche Missgeschick zu einer Diffamierung nicht allein ihrer Person, sondern auch der Botschaft und ihres Landes zu nutzen. In dem Fall könne es sein, meinte sie, dass ihre Botschaft sie nach Moskau zurückschicke.
»Sind Sie eine Russin?«, fragte Rainer Trutz.
»Nein, ich bin Lettin. Aber seit sechs Jahren bin ich Sowjetbürgerin, weil ich aus Lettland emigrieren musste. Ein Onkel von mir war Pjotr Stutschka. Der Name wird Ihnen nichts sagen, er war nach dem Krieg für kurze Zeit Ministerpräsident der Lettischen Sowjetrepublik, bis er nach Moskau fliehen und ich ihm folgen musste. Ich studierte in Petersburg, arbeitete am Theater, und nun bin ich hier bei unserer Handelsvertretung, weil ich unbedingt nach Berlin wollte. – Und Sie? Was machen Sie?«
Trutz erzählte ihr, dass er aus einem Dorf in Norddeutschland stamme, erst vor wenigen Tagen nach Berlin gekommen sei und eine Arbeit suche. Sie fragte ihn nach seiner Ausbildung und den Berufswünschen, und der junge Mann gestand ihr, seine Vorstellungen seien noch unklar, ihn interessiere vieles und er wisse nicht, was er einmal machen wolle. Sie lachte und meinte, er sei so jung, es würde sich alles finden.
»Rufen Sie mich an, wenn man Sie hier entlassen hat, Herr Trutz. Ach was, ich nenne Sie einfach Rainer, und Sie sagen Lilija zu mir. Einverstanden? – Sie rufen mich an, Rainer, und dann lade ich Sie zum Essen ein.«
»Danke, Lilija. Und Dank für das viele Geld. Kommt mir momentan sehr gelegen.«
»Ich bin froh, dass meine Unvorsichtigkeit keine schlimmeren Folgen hatte. Und nicht Sie haben mir, ich habe Ihnen zu danken, Rainer. Eine Anzeige könnte für mich fatale Konsequenzen haben. Sehr fatale. – Leben Sie wohl. Und nicht vergessen, Sie rufen mich an.«
Rainer Trutz sagte noch Jahre später, in seinem Leben sei ihm nie etwas Besseres zugestoßen als der Zusammenstoß mit Lilijas Auto. Drei Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus trafen sie sich abends in einem kleinen Lokal in Wilmersdorf. Rainer erschien mit einem neuen Hemd, einem braunen Jackett und einer khakifarbenen Hose, die er sich von ihrem Geld gekauft hatte und ihr glückstrahlend präsentierte. Lilija Simonaitis gefiel der junge Mann, da er lebendig und aufgeschlossen, vielseitig interessiert und doch ernsthaft war.
Sie trafen sich danach häufiger, er begleitete sie bei einigen ihrer vielen Theaterbesuche und sie nahm ihn ins Romanische Café mit, einen beliebten Treffpunkt von Künstlern an der Gedächtniskirche. Dank ihrer Protektion durfte er sogar das Schwimmerbassin betreten, wie der zweite Raum des Cafés genannt wurde, zu dem nur Schauspieler und Regisseure, Maler und Schriftsteller sowie berühmte Journalisten und gefürchtete Kritiker Zugang hatten, die früheren Stammgäste vom Café Größenwahn, während alle gewöhnlichen Gäste in dem Bassin für Nichtschwimmer zu bleiben hatten, dem großen Saal des Romanischen Cafés.
Lilija Simonaitis kannte fast alle der anwesenden Künstler und Autoren und stellte ihnen Rainer als ihre Entdeckung vor. Sie sagte, den Namen Trutz solle man sich merken, denn von ihm werde man noch hören. Ihre Worte, ihre aus der Luft gegriffenen Vorschusslorbeeren machten Rainer verlegen, aber dadurch wurden einige der Gäste auf ihn aufmerksam und er lernte Spannhake, den Feuilletonchef des Berliner Lokal-Anzeigers, kennen, einer Zeitung, die zweimal am Tag erschien, dem morgendlichen Hauptblatt folgte noch eine Abendausgabe. Dieser Journalist wollte ausprobieren, wozu der junge Mann in der Lage war, und nach einigen Aufträgen, die er ihm versuchsweise gab, bot er ihm an, regelmäßig für den Lokal-Anzeiger zu schreiben.
Vierzehn Tage nach dem Zusammenprall mit Lilijas Auto war Rainer Trutz freier, aber ständiger Mitarbeiter der Zeitung, er schrieb Rezensionen und Kritiken von Theateraufführungen, für die sich die hauptamtlichen und das Blatt prägenden Kritiker weniger interessierten, die Honorare waren bescheiden, aber er konnte sich ernähren und ein Zimmer zur Untermiete leisten. Für den Besuch der Theater und Revuen musste er kein Geld mehr ausgeben, sein Presseausweis öffnete ihm viele Türen, und da er mehrmals in der Woche zu Premieren und Ausstellungseröffnungen ging, lernte er tout Berlin kennen oder vielmehr jene Damen und Herren der Gesellschaft, die den Ton angaben oder der Ansicht waren, dass die Moden und der Geschmack der Stadt allein ihren Vorgaben und ihrem Beispiel folgten. Er schrieb auch für andere Zeitungen, für Wochenmagazine und sporadisch erscheinende Journale, sogar Die literarische Welt druckte wiederholt Artikel von ihm, was für ihn außerordentlich schmeichelhaft war.
Besonders lukrativ war eine gelegentliche Betätigung als Werbetexter, und auch diese Möglichkeit hatte sich durch eine Bekanntschaft im Romanischen Café ergeben, durch ein zufälliges Gespräch mit einem Mann aus diesem Klüngel, der überallhin Beziehungen unterhielt und sehr offen und gern und belustigt über seine eigene Cliquenwirtschaft und Patronage zu sprechen pflegte.
Im Schwimmerbassin war man allgemein der Meinung, er sei der Lover von Lilija, ihr jugendlicher Liebhaber, den sich die Russin, wie man sie im Café nannte, als kleinen bürgerlichen Luxus in ihrer prüden, rotgardistischen Botschaft leiste. Lilija lachte darüber, und da sie die Vermutung nie zurückwies, bestärkte sie sie damit noch. Tatsächlich war ihre Beziehung zu dem jungen Trutz rein platonisch oder vielmehr hatte er in ihr mütterliche Gefühle geweckt und den Ehrgeiz, ihm zu helfen und Wege zu ebnen.
Rainer dagegen war über dieses Gerücht empört. Lilija war mindestens fünfzehn Jahre älter als er, und er glaubte, die Anspielungen der Freunde und Bekannten würden sie kränken. Auch hatte er bei einem seiner Interviews, mit denen ihn der Feuilletonchef beauftragt hatte, Gudrun Becker kennengelernt, ein Mädchen, das für die Gewerkschaft arbeitete und bei dem Streik der Textilarbeiterinnen sich einen Namen gemacht hatte. Er hatte sie einen Tag nach ihrem Gespräch um einen weiteren Termin gebeten, da er mit ihr noch einiges klären wollte. Gudrun Becker war über das Interesse des Journalisten an ihrer Arbeit hoch erfreut und man verabredete noch für denselben Tag einen weiteren Termin. Als er in ihrem Zimmer erschien und sie sich nach seinen Fragen erkundigte, blätterte er seine Notizen durch und sagte schließlich: »Wie ich sehe, habe ich eigentlich nur noch eine einzige Frage, Fräulein Becker. Kann ich Sie für heute oder morgen Abend zum Essen einladen?«
Gudrun sah ihn überrascht an und griff lächelnd und ohne zu zögern nach ihrem Terminkalender: »Heute oder morgen? Heute können Sie mich um neun Uhr hier abholen. Und morgen können wir uns um acht treffen, aber dann revanchiere ich mich und lade Sie ein.«
Seit diesem Tag sahen sie sich regelmäßig. Sie gingen zusammen ins Kino, ins Theater, fuhren zum Müggelsee oder Wannsee hinaus, sie hatten gleiche Ansichten zur Kunst und zur politischen Lage in Deutschland und Europa, sie verstanden sich fast wortlos. Gudrun Becker begriff sich als sozialistische Christin, sie gehörte zum Tillich-Kreis, der im Evangelium Jesu und seiner Bergpredigt eine Verpflichtung für jeden Christen sah, die vom Mammon und Kapitalismus beherrschte Gesellschaftsordnung mit friedlichen Mitteln zu überwinden.
»Wir religiösen Sozialisten verstehen den Sozialismus als eine weltliche Übersetzung der Forderungen der Bibel«, erklärte sie Rainer, »alle Arbeitsauseinandersetzungen können im Geist christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit geführt werden, also kämpfen wir gewaltfrei und unter Beachtung aller christlichen Gebote für eine sozialistische Gesellschaft.«
Rainer hörte ihr interessiert zu. Politik, Religion und Zeitgeschehen waren ihm bisher nicht wichtig, er begeisterte sich allein für das Theater und die Literatur, für die Musik und die bildende Kunst, und obwohl er bei einer Zeitung arbeitete, las er nie die politischen Nachrichten, sondern ausschließlich, sehr gründlich und fast begierig die Kulturseiten, ganz so wie seine neuen Bekannten, die Künstler aus dem Schwimmerbassin, die gleichfalls ausschließlich über Kunst sprachen, sich dabei erregten und stritten, aber kein Auge für die politischen Zustände im Land und in der Stadt hatten und nur spöttische Bemerkungen und zynische Kommentare zu den Streikaufrufen, den Demonstrationen der Arbeitslosen und zu den Straßenkämpfen zwischen Anhängern der rechten und linken Parteien äußerten, die in Berlin Monat für Monat zunahmen.
Lilija sprach viel mit ihm über ihre Heimat und die Revolution und verschaffte ihm Einladungen zu den Gesellschaftsabenden im Botschaftsgebäude, wenn dort neue Filme von Dsiga Wertow und Eisenstein gezeigt wurden. Sie kannte beide Regisseure durch ihre Arbeit im Filmressort der Botschaft persönlich, und Eisenstein traf sie gelegentlich auch in Moskau bei einem Freund, dem Regisseur Meyerhold, mit dem sie einmal im Monat in einem Arbeitskreis zusammensaß, der von einem Professor der Moskauer Staatlichen Universität, einem merkwürdigen und skurrilen Mann mit genialen Ideen, wie sie sagte, geleitet wurde. Die Filme gefielen Rainer, aber die politischen Ausführungen zuvor hörte er sich nur ungern an, und die ausführlichen Darlegungen zur Ökonomie und über NÖP, die Neue Ökonomische Politik der Sowjetunion, langweilten ihn, da er von Volkswirtschaft nichts verstand und auch nichts verstehen wollte.
Gudrun zuliebe aber las er die Schriften, die sie ihm zeigte, schlicht geheftete Broschüren von Paul Tillich und hektographierte Reden, die in ihrem Kreis gehalten wurden, und als Tillich von Dresden, wo er Dozent an einer Hochschule war, nach Berlin kam und vor ihrem Kreis sprach, begleitete er sie zu der Veranstaltung und war von der Atmosphäre und dem geistigen Klima so angetan, dass er fortan regelmäßig mit seiner Freundin zu den Veranstaltungen und Gesprächsrunden des Paul-Tillich-Kreises ging. Ein religiöser Sozialismus erschien ihm als eine verständliche und auch ihm gemäße Art der Weltverbesserung, selbst wenn Lilija sich heftig darüber belustigte und die Tillich-Leute einen Kreis frömmelnder Sektierer und Betschwestern nannte.
Es war Gudrun, die ihm nach zwei Jahren den Vorschlag machte, gemeinsam eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer zusätzlichen Mädchenkammer mit kleinem Fenster im Dachgeschoss über der Wohnung zu beziehen. Eine ältere Kollegin von ihr wollte zu ihrer Tochter ins Rheinland ziehen, um ihr bei der Betreuung der Kinder zu helfen, und hatte ihr die Übernahme der preiswerten Wohnung in der Charlottenburger Gervinusstraße in der Nähe des Stuttgarter Platzes angeboten. Die Kollegin wollte die ungewöhnlich billige Wohnung, Hinterhof, vierter Stock, nicht aufgeben, sie wollte sie für drei, vier Jahre untervermieten, um die Möglichkeit zu haben, irgendwann wieder in der Hauptstadt zu wohnen.
Das Angebot überraschte Rainer. Ein halbes Jahr zuvor hatte er sie zu überreden versucht, zusammenzuwohnen, um Geld zu sparen, wie er sagte, aber damals hatte sie sich heftig geweigert und war sogar empört. Ihr Sinneswandel verblüffte ihn, doch ging er augenblicklich auf ihr Angebot ein. Die Aussicht, mit der Kammer einen eigenen und abgetrennten Arbeitsraum im teilweise ausgebauten Dachboden zu bekommen, war verlockend genug, aber der Gedanke, mit Gudrun nun wie ein Ehepaar zu leben und nicht nur ein oder zwei Nächte in der Woche zusammen zu sein, täglich mit Gudrun aufzustehen, mit ihr gemeinsam zu frühstücken, sie allmorgendlich zu verabschieden, um sie am Abend wieder begrüßen zu können, machte ihn glücklich.
Noch am selben Abend besuchten sie zusammen Gudruns Kollegin in Charlottenburg, ließen sich die Wohnung zeigen. Die Dachkammer, zu der man über die Bodentreppe gelangte, hatte für einen Schreibtisch, eine Liege und Regale ausreichend Platz, das Fenster war freilich nur ein schräges Dachfenster, von dem aus man lediglich in den Himmel starren konnte. Gudrun und Rainer waren von der Wohnung begeistert, die vier Treppen zu ihrem neuen Domizil schreckten sie nicht und auf der Stelle machten sie mit Gudruns Kollegin einen Untermietsvertrag für vier Jahre, über eine mögliche Verlängerung könne noch gesprochen werden. Den kleinen Eisschrank wollte die ältere Frau den jungen Leuten kostenlos überlassen, ebenso die aufgestellte Spüle. Sämtliche Lampen, der Kleiderschrank und das Küchenregal sollten in der Wohnung verbleiben, sie bot den beiden auch an, das vorhandene Geschirr und Besteck zu nutzen, die sie nach Ablauf der Untermietszeit möglichst gut erhalten wieder übernehmen wolle. Ihre eigenen Habseligkeiten sollten sie mit einem Fahrradanhänger nach Charlottenburg bringen, der Umzug würde den beiden dann weniger Kosten verursachen, und bereits im übernächsten Monat sei die Wohnung für sie frei. Zu dritt gingen sie in die Kneipe am Bahnhof Charlottenburg, um mit einem Bier den Vertragsabschluss zu feiern.
Den Umzug musste Rainer allein bewerkstelligen. Gudrun hatte jeden Tag bis in den späten Abend hinein zu tun, sie musste in die Betriebe fahren und mit Gewerkschaftlerinnen sprechen, da der Polizeipräsident ein Demonstrationsverbot für Berlin erlassen und damit die Maikundgebungen verboten hatte. Ihre eigene Gewerkschaftsleitung hatte das Verbot ausdrücklich begrüßt, da auch sie Auseinandersetzungen mit der erstarkten Nazipartei an diesem Tag befürchtete, aber die Mitglieder waren empört, sie wollten sich ihr Recht, am ersten Mai für Arbeiterrechte zu demonstrieren, nicht nehmen lassen und beschimpften den Polizeipräsidenten, seine Partei und die Gewerkschaftsleitung als verlogen und ängstlich und nannten sie Sozialfaschisten. Gudrun verstand die Verärgerung der Gewerkschaftlerinnen, hatte ihnen aber dessen ungeachtet die Haltung ihrer Vorsitzenden zu vermitteln und musste es hinnehmen, selber beschimpft und angebrüllt zu werden.
Einen Tag vor dem ersten Mai wurden in Berlin Flugblätter verteilt, denen zufolge das Demonstrationsverbot aufgehoben worden sei, was das Polizeipräsidium umgehend bestritt. Am nächsten Tag, dem traditionellen Kampftag der Werktätigen, demonstrierten Tausende von Arbeitern. Die Polizei setzte am Nachmittag und bis in die späte Nacht gepanzerte Fahrzeuge mit Maschinengewehren ein, gab Warnschüsse ab und beschoss verbarrikadierte Häuser, an denen rote Fahnen hingen. Am Abend gab es die ersten Toten, woraufhin am zweiten Mai Zehntausende demonstrierten und die Polizei rabiater durchgriff, scheinbar wahllos Passanten verhaftete und immer häufiger Schüsse abgab, gezielt oder in die Luft.
Gudrun bemühte sich, die Versammlungsplätze ihrer Gewerkschaftlerinnen zu erkunden, um sie von unüberlegten Aktionen abzuhalten. Auch am dritten Tag war die Lage unverändert, die aufgebrachten Arbeiter demonstrierten, der Polizeipräsident verlangte von seinen Beamten ein hartes Durchgreifen, und den Gerüchten nach waren mehr als hundert Arbeiter erschossen und Tausende verhaftet worden.
Gudrun war an diesem dritten Mai für den späten Abend mit einem Journalisten verabredet, einem Neuseeländer, der kein Wort Deutsch sprach, weshalb die Gewerkschaftsleitung Gudrun Becker gebeten hatte, sich mit ihm zu treffen, da ihr Englisch als perfekt galt. Rainer verbot ihr, zu diesem späten Treffen zu gehen, da Ausgangssperre herrsche und es überall in der Stadt rumore, selbst in entlegenen, stillen Gegenden fielen Schüsse, er bat sie dringend, zu Hause zu bleiben. Da sie sich weigerte, bestand er darauf, sie zu begleiten. Er hatte die ersten Maitage daheim verbracht, war nicht auf die Straße gegangen, weil er arbeiten wollte, jedoch gelang es ihm nicht, auch nur eine Zeile zu schreiben, da er zu besorgt um Gudrun war. In der Stadt war es noch immer gefährlich, und so beharrte er darauf, bei dem Treffen mit dem Journalisten dabei zu sein, um ihr notfalls beistehen zu können.
Nachdem der Neuseeländer zwei Stunden später noch immer nicht in dem Bezirksbüro der Gewerkschaft in der Ackerstraße erschienen war, entschied Gudrun, nach Hause zu gehen.
Da immer wieder neue Barrikaden errichtet wurden und der Polizeipräsident ein Verkehrs- und Lichtverbot über die Stadt verhängt hatte, waren die Straßen menschenleer und völlig dunkel. Die Straßenbeleuchtung war nicht eingeschaltet, die straßenseitigen Fenster hatten geschlossen zu bleiben und durften nicht beleuchtet werden. Auf dem einsamen langen Fußweg zur S-Bahn, sie hofften, dass wenigstens ab und zu eine dieser Bahnen fahre, denn die Straßenbahn hatte ihren Betrieb eingestellt, gerieten sie in eine plötzlich aufgetauchte und panisch flüchtende Menschenmenge. Es fielen zwar keine Schüsse, aber die rennenden, schreienden Menschen, die trotz des Verbots auf der Straße waren, brachten Rainer und Gudrun dazu, sich immer wieder in Hauseingänge zu retten, dort Ausschau zu halten, um dann das nächste Stück ihres Weges in Angriff zu nehmen. Es war bereits Mitternacht, als sie erschöpft und erleichtert ihre neue Wohnung betraten.
Am nächsten Tag ging Gudrun früh in ihr Büro. Die Stadt war um sieben Uhr noch ruhig, aber überall zeigte sich Polizei, als herrsche noch immer Ausnahmezustand. Gleich bei ihrer Ankunft erfuhr sie, dass Mister Mackay, jener neuseeländische Journalist, mit dem sie sich am Vorabend hatten treffen wollen, erschossen worden sei. Nach Polizeiangaben sei er von zwei Polizisten auf der Straße angesprochen worden, hätte, als sie ihn fragten, wieso er sich trotz Verbots auf der Straße aufhalte, mit der Rechten in die Jackeninnentasche gegriffen, worauf ein Polizist in einer nachvollziehbaren Notwehrsituation einen Warnschuss abgegeben habe, der unglücklicherweise den Mann schwer verletzte. Als die Ambulanz verspätet eintraf, sie hatte Mühe, durch die abgedunkelten und teilweise gesperrten Straßen zu kommen, war er bereits verblutet. Mit der rechten Hand umklammerte er noch im Tod seinen Journalistenausweis, den er den Beamten hatte vorweisen wollen.
An dem Tag, einem Sonnabend, konnte Gudrun mittags Feierabend machen und eilte nach Hause, um Rainer davon zu erzählen. Rainer schüttelte entsetzt den Kopf.
»Begreifst du endlich, wie gefährlich das ist, was du tust. Um ein Haar, und sie hätten dich vielleicht auch irrtümlich erschossen.«
»Man darf sich nicht alles gefallen lassen, Rainer. Heute haben diese Sozialfaschisten zwei Zeitungen verboten und den Frontkämpferbund. Morgen werden diese Lumpen die Gewerkschaften verbieten. Dagegen müssen wir kämpfen, sonst haben wir schon jetzt verloren.«
»Ja, Gudrun, aber bitte nicht immer nur du. Und nicht gegen eine bewaffnete Macht. Das ist gefährlich.«
»Ach, Rainer, du bist und bleibst ein Träumer. Immer nur Kunst und Literatur im Kopf, damit kann man die Welt nicht retten. Man muss auch mal Farbe bekennen.«
»Deine Gewerkschaftsleitung war jedenfalls klüger als du. Die hatten es euch verboten.«
»Die sind nicht klüger, die kleben nur an ihren Sesseln und wollen es sich mit keinem verderben. Aber nach diesem Blutmai ist die Stimmung gekippt. Wir werden dafür sorgen, dass die alten Bonzen bei der nächsten Wahl rausfliegen, und dann machen wir eine christlich-sozialistische Gewerkschaft aus unserem verschnarchten Verein.«
»Mit dir als Vorsitzender?«
»Wart es ab, Rainer. Mach dich auf was gefasst. Ein Heimchen am Herd, dazu tauge ich nicht.«
Die neue Wohnung mit einem eigenen Schreibtisch in der ruhigen Dichterstube begeisterte Rainer, und er beschloss, neben den Aufträgen für den Lokal-Anzeiger