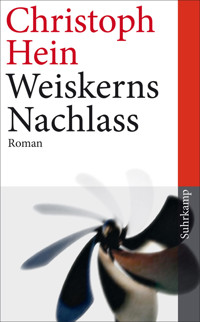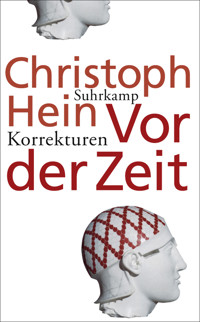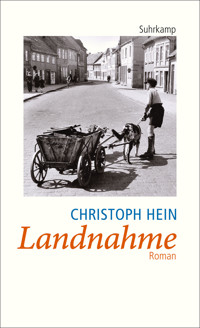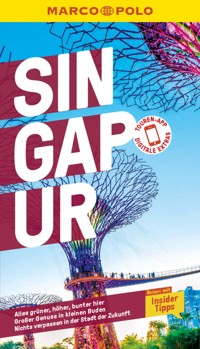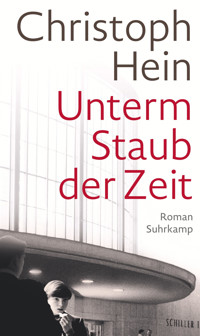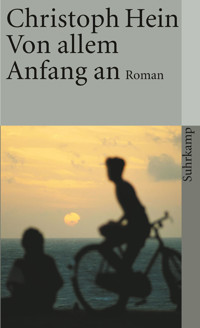9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem vieldiskutierten Roman erzählt Christoph Hein von einem Vater, dessen Kind die Familie verriet, um sich in den Dienst der RAF zu stellen. Und er erzählt von einem wichtigen, oft verdrängten Stück bundesdeutscher Geschichte. Als der bundesweit gesuchte Terrorist Oliver Zurek bei einem Schußwechsel mit Beamten des Grenzschutzes von einer Kugel tödlich verletzt wird, kommt es zu einem politischen Skandal. Denn die offiziellen Mitteilungen über seinen Tod – es ist von Selbstmord die Rede – stimmen nicht mit den Zeugenaussagen überein. Olivers Vater, ein ehemaliger Gymnasialdirektor, mißtraut den Behörden und versucht, die Wahrheit über den Tod seines Sohnes zu erfahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Christoph Hein
In seiner frühen Kindheit ein Garten
Roman
Suhrkamp
Die namentlich genannten Personen des Romans
sind frei erfunden.
Umschlagabbildung: © Premium/nonstock
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2005
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73600-5
»Es gibt glückliche Kinder, die in ihrer
frühen Kindheit einen Garten, eine
Landschaft ihr Reich nennen können.«
Iris Murdoch, Der Schwarze Prinz
1.
Sie schaute auf die Uhr, die neben dem Fernseher an der Wand stand. Es war ein alter Regulator, den sie von seinen Eltern vor Jahrzehnten zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen hatten, ein hoher hölzerner Kasten, in dem hinter einer Glasscheibe ein Pendel schwang. Das Uhrwerk musste wöchentlich aufgezogen werden, und die Zeitanzeige war nicht genau, aber die Pendeluhr hatte alle Neueinrichtungen der Wohnung überlebt. In ihren ersten Ehejahren war sie das einzige wertvolle Stück ihrer Einrichtung, und später passte sie gut zu den Möbeln, die sie sich im Laufe der Zeit in verschiedenen Antiquitätengeschäften zusammengekauft hatten. Richard Zurek hatte es sich angewöhnt, unmittelbar vor dem Beginn der Abendnachrichten neben dem Regulator zu stehen, um beim Gongschlag im Fernsehen den großen Zeiger auf die Zwölf zu stellen. Jeden Abend schob er den Zeiger einen Zentimeter vor, und jeden Abend sagte er dabei den gleichen Satz: »Amici, diem perdidi.«
Als sie wieder auf die Uhr schaute, bemerkte sie, dass der Zeiger kaum weitergerückt war, es waren nur zwei oder drei Minuten vergangen.
An diesem Abend hatte ihr Mann den Zeiger nicht gestellt. Er war vor sieben Uhr aus dem Haus gegangen. Den ganzen Tag war er in der Wohnung umhergelaufen, immer wieder zu ihr in die Küche zurückgekommen, um sie etwas zu fragen, irgendetwas. Sie hatte den Kopf geschüttelt, als er wieder in der Küche erschien und sie nach seiner Taschenlampe fragte.
Beim Kaffeetrinken war ihm der Löffel zweimal aus der Hand gefallen, und den Kuchen hatte er, ohne es zu bemerken, zerkrümelt, während er mit ihr sprach.
»Was bist du nervös, Richard. Fehlt dir etwas? Du solltest zum Arzt gehen. Wann warst du das letzte Mal bei Doktor Sebald?«
Ihr Mann schüttelte den Kopf. »Es ist alles in Ordnung. Ich fühle mich wunderbar. Und bei Sebald war ich gerade. Er wird mich für einen Hypochonder halten, wenn ich schon wieder bei ihm auftauche.«
»Aber du bist so schrecklich nervös. Was hast du nur?«
»Nichts, Rike, gar nichts.«
Er klang verärgert und betonte jede Silbe auf eine Art und Weise, die ihr klarmachen sollte, dass er kein weiteres Wort darüber verlieren wollte. Eine Sekunde später riss er mit dem Ärmel seines Jacketts die Kaffeetasse um, so dass sich der Rest seines Kaffees über die Tischdecke ergoss. Friederike, seine Frau, verzog nur den Mund, stand rasch auf, rückte das Geschirr beiseite, um die Decke abzunehmen, knüllte sie zusammen und wischte mit ihr die polierte Tischoberfläche trocken. Dann eilte sie in die Küche, holte Küchenpapier und rieb den Tisch nochmals gründlich ab.
Ihr Mann saß hilflos daneben, die Hände im Schoß, und war verlegen. Immer wieder knurrte er etwas vor sich hin. Als seine Frau aus der Küche zurückkam und sich wieder an den Tisch setzte, das Geschirr hinstellte und ihm neuen Kaffee eingoss, sagte er anklagend: »Das kommt davon. Weil du mich mit deinen Fragen löcherst.«
»Sehr schön. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Dann haben wir ja einen Schuldigen gefunden.«
Schweigend beendeten sie ihr Kaffeetrinken. Nachdem die Frau das Geschirr in die Küche gebracht hatte, kam sie nochmals ins Wohnzimmer.
»Geh mal unter die Leute, Richard. Du bist seit Wochen nicht mehr rausgegangen. Sitzt den ganzen Abend mit mir vor diesem dummen Fernsehapparat, kein Wunder, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt.«
Er hatte nur geknurrt, aber eine halbe Stunde später kam er ins Schlafzimmer, wo sie gerade Wäsche in den Schrank räumte. Er hatte den Mantel angezogen, die Schottenmütze hielt er in der Hand, und sagte ihr, dass er durch die Stadt gehen und auch im Bahnhof vorbeischauen wolle.
Der Bahnhof war eine Gaststätte. Als vor dreißig Jahren die Bahnlinie, die in ihre Stadt führte, eingestellt worden war, hatte sein alter Schulfreund Fred Plöger das prächtige Bahnhofsgebäude aus roten Klinkern preiswert kaufen können und die unteren Räume zu einem Restaurant umbauen lassen. Nach einem halben Jahr des Umbaus und der Vorbereitungen eröffnete er es als Weingaststätte mit elsässischer Küche. Er hatte versucht, seinem Haus einen anziehenden Namen zu geben und es ›Zur Kupferpfanne‹ genannt, aber seine Stammgäste, die alle aus dem Wohnviertel stammten, sprachen nur vom Bahnhof, wenn sie von ihm und seiner Gaststätte redeten, und so hatte Plöger sich seinen Gästen gefügt und ein Jahr nach der Eröffnung das Glasschild über der Eingangstür neu beschriften lassen. Nun hieß seine Gaststätte auch offiziell ›Der Bahnhof‹.
Als Zurek das Restaurant betrat, sah er sich um und grüßte einige der Gäste mit einem Kopfnicken. Dann ging er zu einem Tisch, an dem ein Ehepaar saß, gab beiden die Hand und unterhielt sich kurz mit ihnen. Er sah sich nochmals um und setzte sich dann auf einen der Barhocker neben der Theke.
»Was darf es sein, Herr Direktor?«, erkundigte sich der junge Mann, der hinter der Theke mit dem Einräumen von Gläsern beschäftigt war.
»Einen kleinen Roten, bitte.«
»Einen Franken habe ich, einen sehr trockenen. Der wird Ihnen gefallen.«
»Sehr schön. Den nehme ich. – Ist Ihr Vater nicht da?«
»Er war den ganzen Nachmittag im Restaurant. Kann sein, dass er nachher noch mal reinschaut.«
Der junge Mann nahm eine Flasche von der hinteren Anrichte, zeigte Zurek das Etikett und goss dann etwas von dem Wein in einen winzigen Tonkrug, den er zusammen mit einem Glas vor den Gast auf die Theke stellte.
»Wohl bekomms Ihnen, Herr Direktor.«
Zurek dankte ihm.
»Und? Wie geht das Geschäft, Ronald?«
»Klagen kann man immer, aber wir sind zufrieden.«
Ronald war der Sohn von Fred Plöger und arbeitete seit dem Schulabschluss im Restaurant seines Vaters. Er war einige Jahre in dieselbe Klasse wie Zureks Sohn Oliver gegangen, bis dieser auf das Gymnasium kam. Zurek, der an derselben Schule der Stadt Deutsch, Latein und Physik unterrichtet hatte und bis zu seiner Pensionierung zwanzig Jahre der Direktor der Schule gewesen war, hatte ihn und seinen Sohn unterrichtet.
»Nochmals Glückwunsch zu Ihrem Sohn. Und vielen Dank, dass Sie uns die Anzeige geschickt haben. Es ist Ihr zweites Kind, nicht wahr?«
»Genau, das zweite. Jetzt sind die Nächte wieder sehr kurz.«
»Ja, ich weiß. Meine Tochter hat einen kleinen Sohn. Aber es ist die schönste Zeit im Leben, Ronald. Wir haben drei Kinder großgezogen, ich weiß, was das heißt. Glauben Sie mir, es ist die wunderbarste Zeit in Ihrem Leben.«
»Die Große ist drei Jahre alt. Sie ist wirklich ein Sonnenschein.«
»Drei, vier Jahre, das ist das schönste Alter. Wissen Sie, was die Amerikaner sagen? Bei ihnen heißt es, nur deshalb würden immer wieder Menschen geboren, damit die Dreijährigen nicht aussterben. Nehmen Sie sich für die Kinder Zeit und genießen Sie es. Wenn sie erst in die Pubertät kommen, dann fangen die Sorgen an. Und hören nicht mehr auf.«
Ronald warf einen besorgten Blick zu dem Gast, der lächelte ihn unbefangen an und trank ruhig sein Glas aus. Dann stand er auf und legte eine Münze auf die Theke.
»Grüßen Sie bitte Ihren Vater. Wir haben uns lange nicht gesehen.«
»Sie lassen sich selten bei uns blicken, Herr Doktor Zurek. Vater meinte schon, Sie hätten sich bestimmt ein anderes Stammlokal gesucht.«
»Nein. Aber es ist wahr, in den letzten Jahren bin ich selten aus dem Haus gekommen. Genauer gesagt, seit Olivers Tod.«
Er sah dem jungen Mann in die Augen, während er sprach, als habe er ihm eine Aufgabe gestellt und warte nun auf das Ergebnis. Der junge Plöger wurde verlegen, er fühlte sich unbehaglich, beugte sich über die Theke und stieß Biergläser auf die im Wasserbecken stehenden Bürsten.
»Vater würde sich freuen, Sie zu sehen«, sagte er ohne aufzublicken, »vielleicht kommen Sie nun wieder öfter zu uns.«
»Ja«, murmelte der alte Mann. Dann setzte er sich zurück auf den Barhocker und sagte: »Wir haben uns nie darüber unterhalten, Ronald, dabei wart ihr beide einmal ein Herz und eine Seele, du und Oliver. Weißt du, was mit ihm passiert ist? Wie ist es dazu gekommen?«
Der junge Mann nahm die gewaschenen Gläser aus dem Becken und stellte sie zum Trocknen auf das Lochblech der Theke.
»Nein, keine Ahnung. Zu mir hat er darüber nie ein Wort gesagt. Wir hatten uns aus den Augen verloren. Er war selten in der Stadt, das wissen Sie besser als ich. Und besucht hat er mich seit dem Studium nie wieder. Manchmal traf ich ihn zufällig, aber da hat man sich nicht groß unterhalten. Guten Tag und guten Weg, das war alles. Mehr weiß ich nicht. Mich hat das auch alles überrascht. Ich hab es nicht verstanden. Ausgerechnet Ihr Sohn, Herr Doktor Zurek, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Sie waren immer so …«
Er unterbrach sich und suchte nach Worten.
»Was meinst du, Ronald? Engstirnig, spießig, ein Kleinbürger? Sicherlich hattet ihr für euren Direx keine schmeichelhaften Bezeichnungen.«
»Nein, Sie waren ein guter Lehrer, aber streng, sehr streng. Ich hatte immer Manschetten vor Ihnen, auch wenn ich nur zu Besuch bei Oliver war. Sie waren für mich immer eine Respektsperson, der Direktor eben. Irgendwie drohte immer eine schlechte Note, wenn ich Sie sah. Verstehen Sie mich richtig, als Bub hatte man immer etwas ausgefressen, und ein Lehrer ist halt der Lehrer.«
»Vielleicht war ich zu streng mit ihm.«
»Nein, das meinte ich nicht. Sie müssen sich keinen Vorwurf machen. Ich glaube, Sie haben Ihr Bestes gegeben.«
»Davon bin ich leider nicht überzeugt, Ronald. Und ich denke jeden Tag darüber nach. Seit fünf Jahren. Jeden Tag denke ich an ihn.«
Der junge Mann entschuldigte sich, einer der Gäste verlangte die Rechnung.
»Grüßen Sie Ihren Vater«, sagte der alte Mann. Er stand auf, setzte sich die Schottenmütze auf den Kopf und verließ das Restaurant. Ronald Plöger war hinter dem Tresen hervorgekommen und hielt ihm die Tür auf, bevor er zu einem der Tische ging. Nachdem Richard Zurek den Mantel abgelegt und die Schuhe ausgezogen hatte, ging er ins Wohnzimmer. Seine Frau sah ihn prüfend und erwartungsvoll an, er sagte nichts und setzte sich in den Sessel.
»Gleich kommen die Nachrichten. Soll ich den Apparat anschalten?«
»Ja.«
»Ich habe sie vorhin schon angeschaut. Es war nichts Besonderes, nichts von Interesse.«
»Das ist gut.«
»Und wie war es bei dir? Wen hast du gesehen?«
»Ich habe Herrn Baumann auf der Straße getroffen. Seine Frau hatte einen Schlaganfall.«
»Wie alt ist sie? Ich glaube, drei Jahre älter als wir.«
»Sie ist neunundsiebzig, sagte mir ihr Mann. Sie hat jetzt Mühe zu reden, man versteht sie kaum noch. Aber die Lähmung lässt vielleicht nach, habe der Arzt gesagt. Und im Bahnhof habe ich mit dem jungen Plöger gesprochen. Er lässt dich grüßen.«
»Es war gut, dass du mal rausgegangen bist, Richard.«
Auf dem Fernsehschirm war eine Uhr zu sehen, dann begannen die Spätnachrichten, und die beiden schauten wortlos auf den Apparat. Als der Wetterbericht begann und keine weitere Nachricht zu erwarten war, schaltete er den Apparat aus.
»Nichts von Bedeutung«, sagte er, »jedenfalls nicht für uns.«
»Wenn du nicht aufgibst und nun sogar den Staat verklagen willst, dann kommen wir nie zur Ruhe. Wenn du deinem Freund Immenfeld folgst, dann fängt alles wieder von vorne an«, sagte sie bekümmert.
Er nickte. »So wird es kommen«, sagte er dann, »doch das ist kein Grund, einen Mörder laufenzulassen und einem Unschuldigen die letzte Ruhe zu verwehren. Aber nicht Lutz Immenfeld entscheidet, sondern wir, du und ich, und niemand anders.«
Er erhob sich so mühselig aus dem Sessel, dass seine Frau besorgt zu ihm sah und misstrauisch jeden seiner Schritte verfolgte.
2.
Er wurde wach, als seine Frau neben dem Bett stand.
»Das Frühstück ist fertig. Zieh dir den Bademantel über und komm Kaffee trinken.«
»Wie spät ist es denn? Ich muss noch einmal eingeschlafen sein.«
»Neun Uhr. Ist doch schön, Richard. Auf uns wartet ja keiner mehr.«
Nach dem Frühstück duschte er und zog sich an. Dann ging er wieder ins Bad, um sich sorgfältig zu rasieren. Als er in die Küche kam, deutete seine Frau auf eine Tasse, sie hatte ihm bereits seinen Tee eingegossen. Er nahm die Tasse in die Hand und ging in sein Arbeitszimmer.
Der Raum war von einem gewaltigen Schreibtisch beherrscht, der mitten im Zimmer stand. Zwei Wände waren mit einem massiven, zum Schreibtisch gehörenden Bücherschrank und mit Regalen zugestellt, in denen neben den Büchern Aktenordner standen und einige Papierbündel lagen. Er stellte sich vor das schmale Regalteil am Fenster, in dem früher die Geschichtsatlanten und die voluminösen, großformatigen Lexika gestanden hatten, die er für seinen Unterricht brauchte. Nach und nach hatte er sie herausgenommen und im Keller deponiert, um Platz für die Aktenordner zu schaffen. Jetzt standen in diesem Regal zusammengepresst die grauen Ordner, in denen er seinen Briefwechsel mit den Behörden und seinem Anwalt Feuchtenberger abgeheftet hatte, die Schreiben der Staatsanwaltschaft und ihre Pressemitteilungen, die unzähligen Zeitungsartikel und die Kopien von Büchern und Aufsätzen der Zeitschriften, die sich mit dem Fall befassten. In drei der Ordner hatte er gesondert die Artikel der Boulevardpresse gesammelt. Da er in den vergangenen Jahren immer wieder zu diesen Unterlagen greifen und in ihnen blättern musste, hatte er diese reich bebilderten und mit dicken Überschriften versehenen Zeitungsseiten in eigene Ordner gesteckt, er wollte nicht, dass sie ihm beim Durchsuchen der Akten überraschend unter die Augen kamen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!