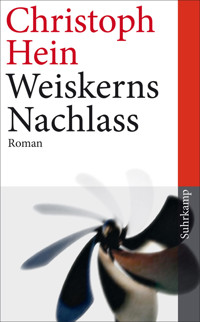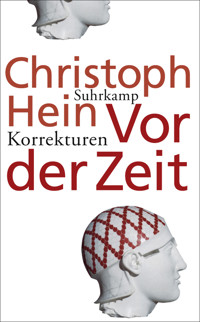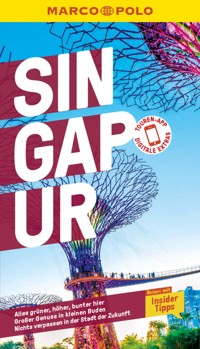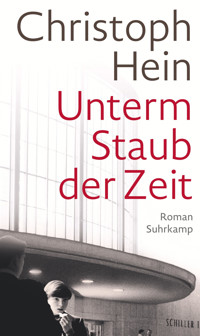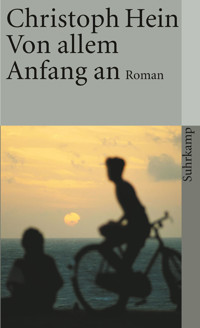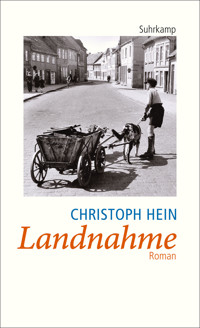
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernhard Haber ist zehn, als er 1950 mit seinen Eltern aus Breslau in eine sächsische Kleinstadt kommt, wo man Vertriebene und Ausgebombte lieber heute als morgen wieder abreisen sähe. Zwar werden Handwerker gebraucht, und Bernhards Vater ist Tischler, aber die Einheimischen bestellen ihre Möbel natürlich nicht bei dem Fremden.
Dem Jungen begegnet man in der Schule nicht viel besser, sich durchbeißen und immer wiedere Schläge einstecken - das erkennt er rasch als den einzigen Weg. Daß Bernhard nach der 8. Klasse eine Tischlerlehre beginnt, wundert niemanden, eher schon, daß er später zeitweise als Karusselbesitzer sagenhaft viel Geld verdient. Peter Koller, der in einem selbstgebauten Auto zahlende Gäste nach Westberlin gebracht hat und dafür ein paar Jahre ins Gefängnis muß, weiß genauer, woher Bernhards Wohlstand stammt, aber er verpfeift ihn nicht.
Überhaupt hat Haber Glück mit den Leuten um sich herum: mit seiner Frau Friederike, die ihn anhimmelt, mit seiner Schwägerin Katharina, die ihm beigebracht hat, was Liebe ist, mit dem Sägereibesitzer Sigurd, der dafür sorgt, daß Bernhard als Tischlermeister in den Kegelklub aufgenommen wird, wo die Selbständigen sich treffen, um den nötigen Einfluß auf die Politik des Ortes zu nehmen ... vor 1989 und erst recht in den wilden Jahren danach.
Christoph Hein erzählt die Lebensgeschichte Bernhard Habers über fast fünfzig Jahre aus der Sicht und mit den Stimmen von fünf Wegbegleitern. Es ist der Lebenslauf eines Außenseiters in der Provinz, der mit der großen Geschichte scheinbar nichts zu tun hat und doch den Verlauf deutscher Geschichte vom zweiten Weltkrieg bis zur Jahrtausendwende exemplarisch spiegelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernhard Haber ist zehn, als er 1950 mit seinen Eltern aus Breslau in eine sächsische Kleinstadt kommt, wo man Vertriebene und Ausgebombte lieber heute als morgen wieder abreisen sähe. Sich durchbeißen und immer wieder Schläge einstecken – das erkennt der Junge rasch als den einzigen Weg. Dass Bernhard nach der 8. Klasse wie sein Vater eine Tischlerlehre beginnt, wundert niemanden, eher schon, dass er später zeitweise als Karussellbesitzer sagenhaft viel Geld verdient. Peter Koller, der in einem umgebauten Auto zahlende Fahrgäste nach Westberlin gebracht hat und dafür ein paar Jahre ins Gefängnis muss, weiß genauer, woher Bernhards Wohlstand stammt, aber er verpfeift ihn nicht. Überhaupt hat Haber Glück mit den Leuten um sich herum: mit seiner Frau Friederike, die ihn anhimmelt, mit seiner Schwägerin Katharina, die ihm beigebracht hat, was Liebe ist, mit dem Sägereibesitzer Sigurd, der dafür sorgt, dass Bernhard als Tischlermeister in den Kegelklub aufgenommen wird, wo die Selbständigen sich treffen, um den nötigen Einfluss auf die Politik des Ortes zu nehmen ... vor 1989 und erst recht in den wilden Jahren danach.
»Landnahme ist ein großartiger Roman ... Selten zuvor hat der Autor Hein im Übrigen so komische Episoden und Nebengeschichten zu bieten gehabt, ob das nun die wilde Ballonfahrt eines wunderbar verrückten Alten ist, eine sommerliche Käferplage oder die Mühsal mit der Liebe.« Volker Hage, Der Spiegel
Christoph Hein, geboren 1944 in Heinzendorf/Schlesien, lebt in Berlin. Sein Werk erscheint im Suhrkamp Verlag, zuletzt der Roman In seiner frühen Kindheit ein Garten (2005).
Christoph Hein
Landnahme
Roman
Suhrkamp
Umschlagfoto: Sven Paustian
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73295-3
www.suhrkamp.de
Auf dem Podest am Ende der Freitreppe standen vier Männer und lächelten unbeirrt der Menschenmenge zu, die sich auf dem Marktplatz versammelt hatte. Einer von ihnen sah mehrmals auf seine Uhr, dann gab er den Musikern ein Zeichen, und die Kapelle spielte den York’schen Marsch. Wenn die vier Männer miteinander sprachen, lächelten sie nicht, ihre Gesichter wirkten besorgt, sie waren nervös.
»Länger können wir nicht warten«, sagte der Älteste von ihnen. »Was glauben die, wer sie sind? Königliche Hoheiten? Es ist nur das Prinzenpaar.«
»Reg dich nicht auf, Sigurd«, sagte ein kleiner, untersetzter Mann, »ich gehe und hole sie.« Er nickte den anderen zu, wandte sich um, öffnete die schwere Rathaustür und ging hinein.
Der Prinz stand mitten im Flur des Rathauses. Er schwieg und nickte, als der Mann erschien und ihm mitteilte, dass alle auf sie warteten. Dann sah er zu der Prinzessin, die auf der Bank saß und ein Taschentuch vor ihr Gesicht hielt.
»Es ist Zeit, wir müssen jetzt hinausgehen. Wir können es nicht weiter verzögern«, wiederholte der Mann und sah gleichfalls zur Prinzessin, die ihre Wangen betupfte, kurz in einen Handspiegel schaute und aufstand. Sie war auffallend blass und lächelte bemüht, auf ihrem Gesicht waren Tränenspuren unübersehbar. Der Mann ging der Prinzessin entgegen.
»Die halbe Stadt steht auf dem Platz und wartet«, sagte er zu ihr und sah sie beschwörend an.
Er reichte ihr seine Hand und führte sie zu dem Prinzen. Dann ging er zur Tür, öffnete sie und machte mit einem Arm eine große auffordernde Geste, um das Prinzenpaar zum Hinausgehen zu bewegen. Die beiden liefen die wenigen Schritte bis zur Tür und dem Podest der Freitreppe nebeneinander, ohne sich anzusehen oder gar anzufassen.
Die Prinzessin war ganz in Weiß gekleidet und trug eine Krone in dem aufgesteckten Haar. Der Prinz trug einen weißseidenen Anzug, auch er lächelte, presste jedoch dabei grimmig die Lippen aufeinander. Neben ihnen standen die vier Männer, die wie das Prinzenpaar der Menschenmenge vor ihnen auf dem Rathausplatz zuwinkten. Die Blaskapelle, die sich am Fuße der Treppe aufgestellt hatte, spielte nun den Präsentiermarsch.
Auf dem Platz standen mehr als zweihundert Leute, viele von ihnen hatten kleine Kinder mit, sie hielten sie an der Hand oder trugen sie auf den Schultern, damit sie das Prinzenpaar besser sehen konnten. Die Kinder hatten bemalte Gesichter, silberne und rote Sterne klebten auf ihren Wangen, Stirnen und Nasen, einige hatten Papiermützen auf dem Kopf oder Teufelskappen und gefütterte Mützen, auf denen Tiergesichter und Fratzen aufgestickt waren und die man den Kindern weit über die Ohren gezogen hatte, denn es war eisig kalt. Alles starrte zum Prinzenpaar und zu den Männern auf dem Podest, die unermüdlich lächelten und abwechselnd mit der rechten und der linken Hand den Versammelten zuwinkten. Die vier Männer trugen dunkle Anzüge und in einem seltsamen Kontrast dazu glänzende rotgoldene Papierhelme auf dem Kopf. Hinter ihnen standen kostümierte junge Mädchen, die Prinzengarde mit dem Funkenmariechen, fünf stramme Mädchen mit kurzen Röcken und knielangen roten Stiefeln. Sie bewegten sich zur Musik und trampelten mit den Füßen, um sich warm zu halten. Ihre Augen leuchteten vor Stolz, und sie bemühten sich, zwischen den Rücken der Männer hindurch auf den Rathausplatz zu sehen und nach ihren Freundinnen und Bekannten Ausschau zu halten.
Einer der Männer auf dem Podest sah zu dem Dirigenten der Blaskapelle, und als dieser zu ihm blickte, gab er ihm ein Zeichen. Die Musik brach nach wenigen Takten ab. Der kleinere Mann, der das Prinzenpaar aus dem Rathaus begleitet hatte, hielt plötzlich einen übergroßen Schlüssel aus goldbezogener Pappe in der Hand, den er dem Prinzen überreichte. Die Kapelle spielte einen Tusch, dann erklärte der Mann, der als Sigurd angesprochen worden war, über ein aufgestelltes Mikrofon, dass man nun nach der Schlüsselübergabe mit dem Umzug durch die Stadt beginnen werde. Wieder warf er einen Blick zu dem Dirigenten, der den Einsatz für einen weiteren Tusch gab. Der Mann auf dem Podest trat vom Mikrofon zurück, er winkte der Menge zu und strahlte begeistert, während er sich halblaut mit seinem Nachbarn unterhielt.
Die vier Männer waren gleichaltrig, alle waren sie Ende fünfzig und etwas beleibt. Sie schienen selbstbewusst und mit sich zufrieden zu sein, und offensichtlich waren sie gewichtige, einflussreiche Personen der Stadt. Man könnte sie stattliche Erscheinungen nennen, mit ihren spitz zulaufenden, reich geschmückten Karnevalshelmen auf dem Kopf wirkten sie weniger lächerlich als vielmehr abgearbeitet, müde und fett.
Nach dem Ende des Tusches begannen die Musiker das nächste Karnevalslied zu spielen, wobei sie mit erhöhter Lautstärke vereinzelte falsche Töne zu kaschieren suchten. Das Prinzenpaar und die vier Männer traten von der das Podest begrenzenden Mauer zurück, einer der Männer schob die Prinzengarde nach vorn, wobei er scheinbar absichtslos die Taillen und Hintern der Mädchen berührte. Die fünf Mädchen standen für einen Moment still, dann begannen sie nach einem Kommando des Funkenmariechens zu tanzen. Sie rissen abwechselnd ihre Beine hoch, so weit es ihnen möglich war, und warfen unentwegt Kusshände in die Menge auf dem Platz. Gelegentlich kam eins der Mädchen aus dem Takt, weil es das Gleichgewicht zu verlieren drohte, dann stellte es sich rasch in der Grundstellung auf und bemühte sich mit hochrotem Gesicht, wieder Anschluss zu bekommen und noch energischer und begeisterter als zuvor Kusshände zu verteilen. Einige Leute auf dem Platz klatschten im Takt, andere winkten den Mädchen zu und riefen ihre Vornamen, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Da die Mauerbrüstung nur einen eingeschränkten Blick auf die oben stehenden Mädchen und Männer erlaubte, konnten die Leute auf dem Platz wenig von ihren Beinen sehen, und allein an den Bewegungen der Oberkörper waren die Bemühungen der Prinzengarde zu erraten.
Der Prinz winkte unablässig, ohne einen Blick seiner Karnevalsprinzessin zuzuwenden. Diese lächelte tapfer und wirkte in ihrem prächtigen weißgoldenen Kleid hilflos und verloren. Der Sprecher drängte sich wieder zum Mikrofon und rief etwas, das keiner verstehen konnte, denn die Musik war zu laut. Er nahm das Prinzenpaar in die Arme und schob die beiden zur Treppe. Der Prinz und die Prinzessin gingen die Stufen hinunter. Der junge Mann bot der Prinzessin nicht den Arm an, sie gingen nebeneinander, ohne sich anzufassen oder auch nur anzusehen. Hinter ihnen liefen die Mädchen der Prinzengarde die Treppe hinunter, bei jeder Stufe die Beine hochwerfend, ängstlich besorgt, niemanden anzustoßen, aber auch nicht die Treppenstufen zu verfehlen. Das Funkenmariechen kontrollierte überdies die Bewegungen ihrer Kameradinnen, sie warf Blicke nach rechts und links. Bevor sie die letzte Stufe erreichte, riss sie mit dem linken Fuß die angeklebte Mikrofonleitung von dem steinernen Treppengeländer, das Mikrofon wurde von der Brüstung gerissen und fiel mit einem lauten und von den Lautsprechern übertragenen Scheppern zu Boden, bevor es einer der Männer aufheben und in Sicherheit bringen konnte.
Die Kapelle stellte sich für den Umzug auf. Es gab ein wenig Verwirrung, da zwischen den Musikern und der Freitreppe nicht genügend Platz war für das Prinzenpaar und die Garde der Mädchen. Der Kapellmeister musste erst energisch auf seine Bläser einreden, bevor sich diese ein paar Meter weiter neu ordneten. Die vier Männer waren auf dem Podest geblieben, sie sprachen miteinander. Der Redner hielt das Mikrofon in der Hand und untersuchte es missmutig, um festzustellen, ob es beschädigt war.
Ein Herr mit einem kleinen weinenden Mädchen auf dem Arm kam zu der Treppe, ging ein paar Stufen hinauf und sprach jenen Mann an, der das Prinzenpaar aus dem Rathaus geleitet hatte, der schüttelte den Kopf und bedeutete ihm, im Augenblick für ihn keine Zeit zu haben, da er beschäftigt sei. Der Herr mit dem kleinen Mädchen ließ sich nicht abwimmeln, er ging zwei Stufen höher und erklärte dem Redner, dass das kleine Mädchen seinen Großvater verloren habe und er ihn über das Mikrofon ausrufen möge. Er reichte ihm das Mädchen zu. Der Redner stellte sich mit dem Kind auf dem Arm an die Brüstung, nahm das Mikrofon vor den Mund und rief über den Platz, es werde ein Großvater gesucht, der sich melden möge, um sein Enkelkind abzuholen. Er ließ seinen Blick über die auf dem Platz versammelte Menge gleiten, und da sich niemand bemerkbar machte, fragte er das Kind nach dem Namen des Großvaters. Das Mädchen gab ihm stockend Antwort, und der Mann sagte in das Mikrofon, der Großvater heiße Opa und möge sich bitte umgehend bei ihm melden. Er wandte sich nochmals zu dem Mädchen auf seinem Arm und fragte es, wie es selbst heiße. Da er in Eile war und die verschreckte Kleine zu fordernd und schroff gefragt hatte, presste sie die Lippen aufeinander und verzog das Gesicht, als wolle sie gleich wieder losheulen.
Ein älterer Mann mit einem Kind an der Hand kam auf die Rathaustreppe zu. Er versuchte mit Winken die Aufmerksamkeit des weinerlichen kleinen Mädchens auf sich zu ziehen und so rasch, wie die Trippelschritte des anderen Mädchens, das er an seiner Hand hielt, es ihm erlaubten, zu ihm zu gelangen. Es dauerte einige Augenblicke, ehe die Kleine auf dem Podest ihren herbeieilenden Großvater entdeckte, und mit einem großen Seufzer der Erleichterung begann sie nun hemmungslos zu weinen. Der Redner stellte das Mädchen auf die Füße und schickte, als der Großvater mit dem zweiten Mädchen an der Treppe angelangt war und immerzu besänftigend den Namen des Mädchens rief, das heulende Kind die Treppe hinunter und in die Arme des Großvaters.
Der Herr, der das Kind gebracht hatte, stand auf der Treppe und sah dem Redner zu, der nun das Mikrofonkabel zusammenlegte.
»Guten Tag, Holzwurm«, sagte er schließlich halblaut.
Der Angesprochene sah auf und unterbrach seine Arbeit. Er sah den Fremden prüfend mit zusammengekniffenen Augen an.
»Sprechen Sie mit mir? Wollen Sie etwas von mir?«, fragte er misstrauisch.
Der Mann lächelte ihn freundlich an. Er kam eine weitere Stufe höher und fragte: »Erkennst du mich nicht, Holzwürmchen?«
Der andere sah ihn prüfend an, wandte sich dann wortlos ab, verknotete gemächlich und sorgfältig das Kabel und steckte das Mikrofon zwischen die Schnur. Danach sah er den Mann an und schüttelte leicht den Kopf. »Nein. Ich glaube nicht. Sie sind nicht von Guldenberg, nicht wahr?«
»Das ist richtig. Aber ich habe hier gelebt. Das ist lange her. Ein paar Jahre. Nein, ein paar Jahrzehnte schon.«
»Ich kann mich an Sie nicht erinnern. Waren wir Schulkameraden?«
»Acht Jahre lang«, sagte der Fremde, »die ganze Grundschule hindurch. Nein, in Wahrheit waren es nur fünf Jahre. Und ein paar Jahre davon haben wir zusammen auf einer Schulbank gesessen.«
Der Mann mit dem Mikrofon in der Hand fasste nach seinem Kopf, um sich über die Haare zu streichen. Als seine Finger die Karnevalskappe berührten, nahm er sie hastig ab, faltete sie zusammen und klemmte sie unter einen Arm. Das schütter gewordene Haar war grau, und tiefe Geheimratsecken hatten die weißliche Kopfhaut entblößt.
»Nein, ich erinnere mich nicht an Sie.«
»Der Pillendreher. Das war mein Spitzname.«
»Sagt mir nichts. Tut mir Leid.«
»Thomas Nicolas heiße ich. Wir waren Banknachbarn.«
»Und wie kommen Sie hierher?«, fragte der Mann, den der andere als Holzwurm angesprochen hatte. Dann korrigierte er sich: »Wie kommst du hierher?«
»Ein Zufall. Ich war auf der Durchfahrt und dachte, ich schaue mir mal an, was aus meinem alten Städtchen geworden ist.«
»Und? Zufrieden? In den letzten Jahren wurde viel gebaut und restauriert.«
»Ja, ich habe es gesehen. Es ist alles kleiner geworden. Die Kirche, das Rathaus, dieser Platz, das war damals alles größer, viel größer.«
Der andere sah ihn verständnislos an, und der Fremde fuhr lächelnd fort: »Oder ich bin größer geworden, vielleicht liegt es daran.«
»Verzeihung, ich habe zu tun. Wir haben Karneval. Der Umzug, die Feiern, ich muss mich darum kümmern. Vielleicht sieht man sich ein andermal.«
Er verschwand für einen Moment hinter der offen stehenden Rathaustür. Als er zurückkam, hatte er sich den Papierhelm wieder aufgesetzt. Er sprach die drei Männer an, die zuvor mit ihm auf dem Podest gestanden und jetzt auf ihn gewartet hatten. Gemeinsam gingen sie eilig die Treppe hinab und stellten sich hinter das Prinzenpaar. Der Dirigent sah kurz zu ihnen und gab dann den Musikern ein Zeichen, die Musik setzte ein, und langsam kam der Zug in Bewegung.
Bevor die Spitze des Festzugs mit der Kapelle, dem Prinzenpaar und den Honoratioren in der Straße hinter dem Rathaus verschwand, warf der als Holzwurm angesprochene Mann einen Blick zurück. Thomas Nicolas, der Fremde, der seiner Heimatstadt einen kurzen Besuch abstattete, stand auf der Rathaustreppe und lächelte ihm zu.
Thomas Nicolas
Das neue Schuljahr hatte bereits begonnen, als Mitte September Fräulein Nitzschke in der dritten Schulstunde mit einem Neuen in der Klasse erschien. Fräulein Nitzschke war die Klassenlehrerin und gab bei uns Deutsch und Heimatkunde. Sie war Ende vierzig und unverheiratet und legte Wert darauf, als Fräulein angesprochen zu werden. Wenn einer der Eltern mit ihr sprach und Frau Nitzschke zu ihr sagte, verbesserte sie ihn mit einem leichten, nachdrücklichen Lächeln, als wäre es für sie von besonderer Bedeutung, nicht verheiratet zu sein. Sie war eine sehr hagere Frau, vorn und hinten ein Brett, wie die älteren Schüler auf dem Schulhof sagten, und hatte stets stark gepuderte Wangen, was sehr ungewöhnlich war und worüber auch die Erwachsenen in der Stadt sprachen. Man vermutete, sie habe eine unreine Haut oder eine Krankheit, Genaues wusste keiner. Wenn sie durch die Bankreihen ging und sich zu den Schülern herunterbeugte, konnten wir den süßlichen Duft des Puders riechen.
Fräulein Nitzschke ging mit dem Neuen nach vorn zum Lehrertisch, setzte sich und wartete, bis Ruhe eingetreten war und alle zu ihr schauten oder vielmehr zu dem Jungen, der neben ihr stand und finster vor sich hin starrte.
»Wir haben einen neuen Mitschüler bekommen«, sagte Fräulein Nitzschke endlich, »er wird sich uns selbst vorstellen.«
Sie sah den Jungen aufmunternd an. Der blickte unbewegt in die Klasse und musterte uns eindringlich.
»Sag uns bitte deinen Namen.«
Der Neue warf einen kurzen Blick zu der Lehrerin, dann murmelte er etwas, ohne jemanden anzusehen.
Die Klasse wurde jetzt unruhig. Er hatte seinen Namen so beiläufig und leise gesagt, dass ihn kaum einer verstand. Einer von uns schrie: »Lauter!«, und andere lachten. Was wir sofort begriffen hatten, war, dass er einen dieser rauhen, ostdeutschen Dialekte sprach. Alle hatten sofort mitbekommen, dass wieder ein aus Pommern oder Schlesien Vertriebener in unsere Schule gekommen war.
Unmittelbar nach dem Krieg war die Stadt mit ihnen überfüllt. Sie waren in Wohnungen eingewiesen worden, deren Besitzer nur unter dem Druck der städtischen Verordnung und der Polizei ein oder zwei Zimmer ausgeräumt hatten, um sie den Fremden widerwillig zu überlassen. Alle hofften, dass diese aus ihrer Heimat Vertriebenen bald weiterziehen würden oder vom Wohnungsamt eine eigene Wohnung zugewiesen bekämen. Wenn auch die Stadt vom Krieg und von den Bombern weniger heimgesucht worden war als die Kreisstadt und drei von den Dörfern in der Nähe, so gab es noch immer Kriegsschäden zu reparieren, und weder die Stadt noch die Leute hatten das Geld, neue Häuser zu bauen. Da es überdies an Baumaterial fehlte, wurden selbst die notwendigsten Reparaturen sehr schleppend ausgeführt.
Jetzt, fünf Jahre nach dem Krieg, wohnten noch immer viele Umsiedler bei uns und schienen in Guldenberg bleiben zu wollen, zumal die neue Grenze im Osten wohl endgültig war und damit die deutschen Provinzen hinter der Oder polnisch bleiben würden und diese Leute nie wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten. Auch in unserer Schule gab es genügend Kinder der Vertriebenen. Die meisten von ihnen sprachen inzwischen unseren Dialekt, und nur gelegentlich konnte man an einem ungewöhnlichen und befremdlichen Wort ihre Herkunft erraten oder weil sie die Rachenlaute heiserer als wir aussprachen. Sie waren allesamt ärmlicher gekleidet als die Kinder der Einheimischen, ihre Strümpfe und Joppen waren geflickt, runde Lederstücke waren nicht nur auf den Ellbogen angebracht, und vor allem ihr Schuhwerk war alt und rissig.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!