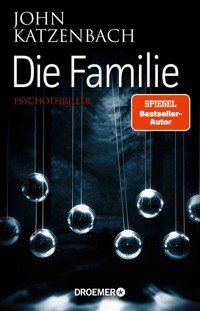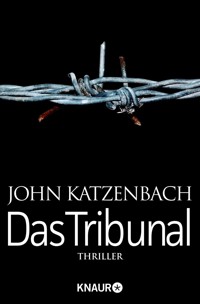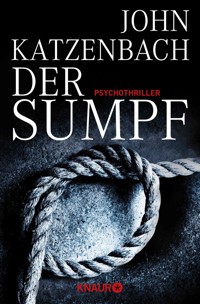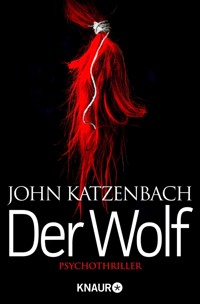9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die attraktive Studentin Ashley Freeman begeht einen folgenschweren Fehler: Angeheitert verbringt sie eine Nacht mit Michael O'Connell, einem Computerfreak und geschickten Hacker. Was sie nicht weiß: Michael ist ein Psychopath – und er hat beschlossen, dass Ashley die Frau seines Lebens ist. Nichts und niemand wird ihn davon abbringen – schon gar nicht Ashley. Unerbittlich stellt er ihr nach, verschärft seinen Psychoterror gegen ihre Freunde und Verwandten. Immer schneller beginnt sich eine Spirale des Schreckens zu drehen, die Ashleys gesamte Familie in die Tiefe reißt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
John Katzenbach
Das Opfer
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Anke Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Gewidmet den üblichen Verdächtigen:
Wollen Sie eine Geschichte [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Epilog
Gewidmet den üblichen Verdächtigen:
Frau, Kindern, Hund
Wollen Sie eine Geschichte hören? Eine wirklich außergewöhnliche Geschichte?«
»Sicher!«
»Gut. Aber zuerst müssen Sie mir etwas versprechen: dass Sie niemals irgendjemandem verraten, woher Sie diese Geschichte haben. Und falls Sie sie jemals weitererzählen – egal wo, unter welchen Umständen und in welcher Form –, Sie müssen versprechen, dass Sie genug verschweigen, um die Spur zu mir und zu den Menschen, von denen sie handelt, zu verwischen. Niemand darf je erfahren, ob sie wahr ist oder nicht. Niemand darf je ihre genaue Quelle offenlegen. Und jeder muss automatisch davon ausgehen, dass sie genau wie alle anderen Geschichten, die Sie erzählen, frei erfunden ist.«
»Dramatisieren Sie nicht ein bisschen? Worum geht es in der Geschichte überhaupt?«
»Es wird jemand getötet. Es ist vor ein paar Jahren passiert, vielleicht aber auch nicht. Möchten Sie die Geschichte hören?«
»Ja.«
»Dann geben Sie mir Ihr Wort.«
»In Ordnung. Sie haben mein Wort.«
Es lag eine nervöse Unruhe in ihrem Blick, und ihre Stimme ließ dunkle Vorahnungen erwachen, als sie sich vorbeugte, einmal tief Luft holte und sagte: »Im Grunde fing alles an, als er den Liebesbrief fand.«
1
Der Geschichtsprofessor und die beiden Frauen
Als Scott Freeman den Brief, den er im Zimmer seiner Tochter in der obersten Kommodenschublade gefunden hatte, zusammengeknüllt hinter alten, weißen Sportsocken, zum ersten Mal las, begriff er mit einem Schlag, dass jemand sterben würde.
Er hätte dieses Gefühl nicht wirklich benennen können, aber es überkam ihn wie eine böse Ahnung und nistete sich eiskalt in seinem Hinterkopf ein. Er stand wie erstarrt und las immer wieder dieselben Worte: Keiner könnte dich jemals so lieben wie ich, weder heute, noch irgendwann. Wir sind füreinander bestimmt, und daran wird nichts und niemand etwas ändern. Gar nichts. Wir werden für immer zusammen sein. So oder so.
Der Brief trug keine Unterschrift.
Er war auf gewöhnlichem Computerpapier getippt – kursiv gesetzt, so dass es an eine altmodische Handschrift erinnerte. Da Scott keinen Umschlag dazu finden konnte, gab es weder Absender noch Poststempel, die ihm weitergeholfen hätten. Er legte den Brief auf den Schreibtisch und versuchte, die Knitter zu glätten, die dem Blatt Nachdruck und Bedrohlichkeit verliehen. Er betrachtete die Worte aufs Neue und versuchte, sie in einem harmlosen Licht zu sehen. Die Liebesbeteuerungen eines Grünschnabels, nichts weiter als die Vernarrtheit eines Kommilitonen, eine Schwärmerei, die Ashley nur deshalb vor ihnen verschwiegen hatte, weil sie selbst nur eine alberne Gefühlsduselei darin erkennen konnte. Im Ernst, versuchte er sich einzureden, du siehst Gespenster.
Doch nichts konnte verhindern, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief.
Scott Freeman hielt sich nicht für einen unbesonnenen oder leicht aufbrausenden Mann. Er neigte weiß Gott nicht zu Kurzschlussreaktionen, sondern war ein Mensch, der grundsätzlich das Für und Wider jeder Entscheidung abwog und jede Facette seines Lebens unter die Lupe nahm wie einen geschliffenen Diamanten. Er war durch und durch Akademiker. Als Reminiszenz an seine Jugend in den späten sechziger Jahren trug er sein Haar zottelig lang, meist lief er in Jeans und Turnschuhen herum, dazu standesgemäß ein abgetragenes Kordjackett mit Lederflicken an den Ärmeln. Zum Autofahren wie zum Lesen brauchte er jeweils eine Brille, und er achtete darauf, dass er sie immer bei sich hatte. Mit täglicher sportlicher Betätigung hielt er sich fit – bei gutem Wetter durch Joggen, im langen New England-Winter auf einem Laufband im Haus. Teils machte er das zum Ausgleich dafür, dass er sich zuweilen einsam betrank und sich manchmal zum Scotch on the Rocks eine Marihuanazigarette gönnte. Scott war stolz auf seine Lehrtätigkeit, die ihm jeden Tag aufs Neue Gelegenheit bot, sich vor einem vollen Hörsaal wirkungsvoll in Szene zu setzen. Außerdem liebte er sein Fachgebiet und fieberte jeden Sommer dem September entgegen, statt den müden Zynismus vieler seiner Kollegen zu teilen. Er führte, fand er, ein äußerst geregeltes Leben, und da er den Details der Vergangenheit vielleicht allzu viel Begeisterung entgegenbrachte, leistete er sich als Kontrastprogramm einen zehn Jahre alten Porsche 911, den er – außer wenn es schneite – tagtäglich zu plärrender Rock-and-Roll-Musik fuhr. Für den Winter hielt er sich einen ramponierten Pick-up. Er hatte die eine oder andere Affäre, allerdings nur mit Frauen seines Alters, die ihre Erwartungen nicht allzu hoch schraubten und ihn nicht daran hinderten, seine ganze Passion den Red Sox, den Patriots, den Celtics und den Bruins sowie sämtlichen Sportmannschaften am College zu widmen.
Er hielt sich für einen Mann der Routine, und manchmal kam ihm der Gedanke, dass er in seinem ganzen Leben als Erwachsener nur drei richtige Abenteuer erlebt hatte: Einmal hatte ihn, als er mit Freunden vor der Felsenküste Maines Kajak fuhr, eine starke Strömung und ein plötzlicher Nebel von seinen Gefährten getrennt, und er war stundenlang in einer grauen, stillen Dunstglocke dahingetrieben, in der die einzigen Geräusche, die ihn begleiteten, das Klatschen der Wellen an die Plastikwände seines Kajaks und das gelegentliche Luftschnappen einer Robbe oder eines Tümmlers in seiner Nähe waren. Die feuchte Kälte war ihm den Rücken hochgekrochen und hatte ihm die Sicht getrübt. Er hatte gewusst, dass er sich in Gefahr befand, vielleicht sogar weit mehr, als er ahnte, doch er hatte nicht die Nerven verloren, sondern gewartet, bis das Boot der Küstenwache aus dem Nebel auftauchte. Der Kapitän hatte ihm klargemacht, er hätte sich nur noch wenige Meter von einer starken Meeresströmung befunden, die ihn aufs offene Meer hinausgezogen hätte, und so hatte er nach seiner Rettung bedeutend mehr Angst gehabt als mitten in der prekären Lage.
Das war eines seiner Abenteuer gewesen. Die anderen beiden hatten länger gedauert. Mit achtzehn, als frischgebackener Studienanfänger, hatte Scott es abgelehnt, sich vom Wehrdienst zurückstellen zu lassen, weil er es nicht mit seiner Moral vereinbaren konnte, dass andere sich einer Gefahr aussetzten, die er selbst mied. Damals erschien ihm dieses jugendlich hochfliegende Ehrgefühl moralisch geboten, doch als der Musterungsbescheid kam, war alle Romantik verflogen. In kürzester Zeit fand er sich zuerst als Rekrut wieder und wenig später bei einer Versorgungseinheit in Vietnam. Ein halbes Jahr lang diente er bei der Artillerie. Seine Aufgabe bestand darin, Koordinaten über Funk zu empfangen und an den Frontkommandeur weiterzuleiten, der Schusshöhe und -weite darauf abstimmte und unter lautem Zischen die nächsten Salven abfeuern ließ – worauf ein Grollen folgte, das ihm immer viel tiefer in den Ohren hallte als jeder Donner. Später verfolgten ihn Alpträume, in denen er Teil einer Tötungsmaschinerie war, die außerhalb seiner Sicht- und Reichweite ablief und die er zuweilen nicht einmal hören konnte, so dass er mitten in der Nacht erwachte und sich fragte, ob er Dutzende, Hunderte oder auch niemanden umgebracht hatte. Im Zuge eines turnusmäßigen Truppenwechsels kam er nach einem Jahr heim, ohne auch nur einen einzigen Schuss auf jemanden abgegeben zu haben, den er hätte sehen können.
Nach dem Wehrdienst hatte er um die Politik, die in seinem Land hohe Wellen schlug, einen großen Bogen gemacht und sich mit einer Zielstrebigkeit in sein Studium gestürzt, die ihn selbst überraschte. Nachdem er den Krieg aus eigener Erfahrung kannte, fand er Trost in der Geschichte, in Entscheidungen, die vor langer Zeit gefallen waren, in großen Passionen, die nur noch als Echo widerhallten. Er sprach nicht über seine Zeit beim Militär, und jetzt, im mittleren Alter, als unkündbare Respektsperson, bezweifelte er sehr, ob auch nur ein einziger seiner Kollegen wusste, dass er im Krieg gewesen war, zumal es ihm selbst oft wie ein Traum, vielleicht ein Alptraum vorkam und nicht wie ein tatsächliches, todbringendes Lebensjahr.
Sein drittes Abenteuer war natürlich Ashley gewesen.
Scott Freeman nahm den Brief, ging zu Ashleys Bett und setzte sich auf die Kante. Auf dem Bett lagen drei Kissen, und eins davon, das er ihr vor über drei Jahren zum Valentinstag geschenkt hatte, war mit einem Herzen bestickt. Außerdem saßen da noch die beiden Teddybären, die sie Alphonse und Gaston getauft hatte, und eine ausgefranste Steppdecke, die sie zu ihrer Geburt bekommen hatte. Beim Anblick der Decke musste Scott daran denken, wie sie in den Wochen vor Ashleys Geburt Witze darüber gemacht hatten, dass beide Großmütter dem noch ungeborenen Kind Steppdecken schenkten. Die andere befand sich auf einem ähnlichen Bett in einem ähnlichen Zimmer im Haus ihrer Mutter.
Sein Blick wanderte durch das Zimmer. An einer Wand hingen Fotos von Ashley mit Freunden, außerdem alle möglichen Trophäen, einschließlich Zetteln in der flüssig akkuraten Handschrift von Schülerinnen. Da prangten Poster von Athleten und Poeten, ein gerahmtes Gedicht von William Butler Yeats, das mit den Worten endete: Ich leide, wenn ich dich küsse,/Da ich wissen muss,/Dass ich Dich vermissen werde,/Wenn du erwachsen bist.Er hatte es ihr zum fünften Geburtstag geschenkt und oft beim Einschlafen ins Ohr geflüstert. Es gab Fotos von ihren verschiedenen Fußball- und Softball-Teams sowie ein Bild vom Highschool-Abschlussball, das genau in der Blüte ihrer jugendlichen Schönheit entstanden war, Ashley in einem Kleid, das sich eng an jede neu entdeckte Kurve schmiegte, das Haar fiel ihr anmutig auf die nackten, schimmernden Schultern. Scott Freeman wurde bewusst, dass er hier das typische Sammelsurium an Erinnerungen vor Augen hatte, die klassische Dokumentation einer Kindheit, so wie vermutlich in jedem x-beliebigen anderen Jugendzimmer, und doch auf seine Weise einmalig. Eine Archäologie des Erwachsenwerdens.
Auf einem Foto posierten sie alle drei. Ashley war sechs, als es, vielleicht einen Monat bevor ihre Mutter ihn verließ, entstand. Es stammte vom Strandurlaub der Familie, und es schien ihm, als läge etwas Hilfloses in dem Lächeln, das sie alle drei aufgesetzt hatten. Ashley hatte an diesem Tag zusammen mit ihrer Mutter eine Sandburg gebaut, doch die Flut hatte ihre Mühe zunichte gemacht und ihr ganzes Gebäude unterspült, obwohl sie in wildem Eifer Burggräben angelegt und Sandwälle aufgetürmt hatten.
Er suchte die Wände, die Schreibtischplatte und die Schubladen ab und konnte absolut nichts Ungewöhnliches entdecken. Das beunruhigte ihn erst recht.
Scott sah noch einmal auf den Brief. Keiner könnte dich jemals so lieben wie ich.
Er schüttelte den Kopf. Das stimmte nicht, dachte er. Jeder liebte Ashley.
Was ihm Angst machte, war die Vorstellung, dass jemand von diesem Unsinn überzeugt war. Für einen Moment versuchte er sich noch einmal einzureden, er leide nur an einem dummen, übertriebenen Beschützerinstinkt. Ashley war kein Teenager mehr, nicht einmal mehr eine College-Studentin. Sie hatte sich für ein Aufbaustudium in Kunstgeschichte in Boston eingeschrieben und führte ihr eigenes Leben.
Der Brief war nicht unterschrieben. Demnach wusste sie, von wem er kam. Anonymität war eine ebenso aussagekräftige Signatur wie ein Name.
Neben Ashleys Bett stand ein rosa Telefon. Er nahm es und wählte ihre Handynummer.
Sie meldete sich beim zweiten Klingeln.
»Hi, Dad, was gibt’s?«
In ihrer Stimme schwang Jugend, Enthusiasmus und Vertrauen mit. Erleichtert atmete er langsam aus.
»Gibt’s was Neues?«, fragte er. »Wollte nur mal deine Stimme hören.«
Momentanes Zögern.
Das gefiel ihm nicht.
»Nichts Besonderes eigentlich. Mit dem Studium läuft’s gut. Die Arbeit ist, na ja, wie Arbeit eben ist. Aber das weißt du ja alles. Eigentlich hat sich nichts geändert, seit ich letzte Woche zu Hause war.«
Er holte tief Luft. »Da habe ich dich kaum zu Gesicht bekommen. Und wir hatten nicht viel Gelegenheit, miteinander zu reden. Ich wollte mich nur vergewissern, dass bei dir alles in Ordnung ist. Kein Ärger mit deinem neuen Boss oder einem der Profs? Hast du schon eine Rückmeldung wegen des Studiengangs, für den du dich beworben hast?«
Wieder schwieg sie einen Moment. »Nein, eigentlich nicht.«
Er hüstelte. »Was ist mit Jungs. Männer wohl eher. Irgendwas, das ich wissen sollte?«
Sie antwortete nicht sofort.
»Ashley?«
»Nein«, erwiderte sie hastig. »Eigentlich nicht. Jedenfalls nichts, womit ich nicht selbst klarkommen würde!«
Er wartete. Doch sie sagte nichts mehr.
»Gibt es etwas, das du mir erzählen möchtest?«
»Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, Dad, willst du mir nicht verraten, was du mit dem Verhör bezweckst?«
Die Frage war in einem scherzhaften Ton gestellt, der zu seiner besorgten Stimmung nicht recht passte.
»Versuche nur, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Dein Leben rauscht einfach an mir vorbei«, erklärte er, »und ab und zu muss ich dir einfach hinterherjagen und dich stellen.«
Sie lachte, auch wenn es nicht wirklich von Herzen kam. »Na ja, deine alte Klapperkiste ist ja zumindest schnell genug.«
»Irgendetwas, worüber wir reden sollten?«, wiederholte er und sah im selben Moment missmutig zu Boden, da ihr das überflüssige Nachhaken natürlich nicht entgehen konnte.
Sie antwortete prompt: »Noch einmal, nein. Wieso fragst du? Hast du irgendwas?«
»Nein, nein, alles in Ordnung.«
»Und Mom? Und Hope? Geht’s ihnen gut?«
Er hielt die Luft an. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie die Lebensgefährtin ihrer Mutter beim Namen nannte, brachte ihn aus dem Konzept, auch wenn er sich nach so vielen Jahren allmählich daran gewöhnt haben sollte.
»Alles bestens. Bei beiden, nehme ich an.«
»Wieso rufst du dann an? Macht dir sonst etwas zu schaffen?«
Er betrachtete den Brief.
»Nein, nichts. Nichts Besonderes. Wollte nur mal hören. Für alle Fälle. So ist das nun mal bei Vätern: Uns macht ständig was zu schaffen, wir machen uns grundsätzlich Sorgen, wir malen uns immer das Schlimmste aus. Wir sehen an allen Ecken und Enden Gefahren lauern. Deshalb sind wir die langweiligsten, absolut farblosesten Menschen auf der Welt.«
Er hörte sie lachen und fühlte sich gleich etwas besser.
»Hör mal, ich muss ins Museum. Ich melde mich bald wieder, okay?«
»Sicher. Ich liebe dich.«
»Ich dich auch, Dad. Bis dann.«
Er legte auf, und ihm kam der Gedanke, dass manchmal das, was man nicht hört, wichtiger ist als das, was gesagt wird. Und eben hatte er zwischen den Zeilen nur Probleme herausgehört.
Hope Frazier beobachtete die Rechtsaußen der gegnerischen Seite genau. Die junge Frau neigte dazu, ihre Spielfeldseite an sich zu reißen, so dass die Verteidigerin hinter ihr frei stand. Hopes eigene Spielerin, die eng deckte, sah noch nicht recht, wie sie die Risikofreude ihrer Gegnerin in eine Offensive ummünzen sollte. Hope schritt ein Stück die Seitenlinie ab, dachte einen Moment daran, die Spielerin auszuwechseln, überlegte es sich dann aber anders. Sie zog einen kleinen Schreibblock aus ihrer Gesäßtasche, suchte einen Bleistiftstummel in der Jacke und machte sich eine kurze Notiz. Etwas, das beim Training zur Sprache kommen sollte, dachte sie. Hinter sich hörte sie Gemurmel von den Mädchen auf der Bank; sie waren an das Bild gewöhnt, wie der Block während eines Spiels herausschnellte. Manchmal bedeutete das ein späteres Lob, mitunter aber auch sein paar extra Laufrunden nach dem Training am nächsten Tag. Hope drehte sich zu den Mädchen um.
»Sieht irgendjemand, was ich sehe?«
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Highschool-Mädchen, dachte sie. Eben noch die große Klappe, dann bringen sie kein Wort heraus. Ein Mädchen zeigte auf.
»Ja, Molly, was?«
Molly stand auf und zeigte auf die Rechtsaußen. »Die macht uns auf ihrer Seite ziemlich Probleme, aber wir könnten uns ihren Leichtsinn zunutze machen …«
Hope klatschte in die Hände. »Der Meinung bin ich auch!« Sie sah, wie die anderen Mädchen grinsten. Also morgen keine extra Runden. »Also dann, Molly, wärm dich auf und geh ins Spiel. Geh für Sarah im Mittelfeld rein, sieh zu, dass du den Ball unter Kontrolle bekommst, und mach was aus deiner Position.« Hope ging zur Bank hinüber und setzte sich auf Mollys Platz.
»Seht euch das Spielfeld an, meine Damen«, sagte sie ruhig. »Habt das Ganze im Auge. Es geht nicht immer nur um den Ball zu euren Füßen, es geht auch um Raum, Zeit, Geduld und Engagement. Es ist wie Schach. Ihr müsst aus einer Schwäche Vorteil ziehen können.«
Als die Menge plötzlich lauter wurde, sah sie auf. An der gegenüberliegenden Seitenlinie hatte es einen Zusammenprall gegeben, und ein paar Leute forderten wild gestikulierend die Schiedsrichterin auf, die gelbe Karte zu zücken. Ein besonders wütender Vater marschierte am Spielfeld auf und ab und fuchtelte mit den Armen. Hope erhob sich und lief ein Stück entlang der Seitenlinie, um zu sehen, was passiert war.
»Trainerin …«
Sie blickte auf und sah, dass der Linienrichter auf ihrer Seite ihr zuwinkte.
»Ich glaube, die brauchen Sie …«
Sie beobachtete, wie der Trainer des gegnerischen Teams bereits im Eiltempo über das Spielfeld lief, und so legte sie selbst einen Schritt zu, während sie einen Verbandskasten und eine Flasche Jod aus der Tasche zog. Sie machte einen kleinen Bogen in Richtung Molly.
»Molly … ich hab’s nicht mitbekommen. Was ist passiert?«
»Die sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Ich glaube, Vicki ist die Luft weggeblieben, aber das andere Mädchen scheint es schlimmer erwischt zu haben.«
Als sie die Stelle erreichte, konnte ihre Spielerin schon wieder sitzen, doch die Gegnerin lag am Boden, und Hope hörte leises Schluchzen. Sie ging zuerst zu ihrem Schützling. »Alles in Ordnung, Vicki?« Das Mädchen nickte, doch ihr stand Angst ins Gesicht geschrieben. »Tut’s irgendwo weh?«
Einige der Spielerinnen hatten eine Traube gebildet, und Hope schickte sie wieder an ihre jeweiligen Positionen. »Was meinst du? Kannst du aufstehen?«
Vicki nickte erneut, und Hope stützte sie am Arm. »Setzen wir uns eine Weile auf die Bank«, sagte sie ruhig. Vicki schüttelte den Kopf, doch Hope packte sie fester am Arm. An den nächstgelegenen Seitenlinien hatte einer der Väter die Stimme erhoben und ließ eine wüste Beschimpfung gegen den gegnerischen Trainer vom Stapel. Bis jetzt war es noch nicht in Obszönitäten ausgeartet, doch Hope wusste, dass dazu nicht mehr viel fehlte. Sie drehte sich in seine Richtung um.
»Immer hübsch die Ruhe bewahren«, rief sie zu ihm. »Sie kennen die Regeln in Bezug auf Verunglimpfungen.«
Der Mann wandte den Blick langsam vom Spielfeld zu ihr. Sie sah, wie er den Mund aufmachte, als wollte er etwas sagen, dann aber innehielt. Eine Sekunde sah es so aus, als wolle er seiner Wut freien Lauf lassen. Ihm war anzusehen, dass er sich nur mit größter Mühe beherrschen konnte, doch er quittierte Hopes Bemerkung nur mit einem funkelnden Blick und sah weg. Hope hörte, wie der andere Trainer »Idiot!« murmelte. Sie geleitete Vicki langsam vom Spielfeld. Das Mädchen war noch ein bisschen wacklig auf den Beinen, doch sie brachte immerhin heraus: »Mein Dad sieht schnell rot.« Die Worte kamen in einem ebenso schlichten wie verletzten Ton, und Hope begriff in dieser Sekunde, dass es um weit mehr als einen Zusammenstoß auf dem Spielfeld ging.
»Vielleicht solltest du diese Woche nach dem Training zu mir kommen und mit mir darüber reden. Oder komm in einer Freistunde zu mir ins Sprechzimmer.«
Vicky schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Coach. Geht nicht. Das lässt er nicht zu.«
Schluss, aus.
Hope drückte dem Mädchen den Arm. »Dann bei anderer Gelegenheit.«
Sie hoffte, dass sich eine ergeben würde. Es ging nicht fair zu, musste sie denken, als sie Vicki auf die Bank setzte und eine neue Spielerin einwechselte, es gab keine gleichen Chancen für alle. Sie blickte auf die andere Seite des Spielfelds, wo Vickis Vater ein Stück von den anderen Eltern entfernt mit verschränkten Armen und funkelnden Augen stand, als zählte er die Sekunden, in denen Vicki nicht mitspielen konnte. Hope wurde plötzlich klar, dass sie stärker, schneller und wahrscheinlich gebildeter war als der Vater und ganz gewiss mehr von Fußball verstand. Sie hatte jede Trainerlizenz erworben, an jedem Weiterbildungsseminar teilgenommen, und hätte sie in dem Moment einen Ball vor den Füßen gehabt, dann wäre es ihr gewiss nicht schwergefallen, den cholerischen Vater zu beschämen und ihn mit ein bisschen trickreicher Beinarbeit und schnellen Tempowechseln aus dem Konzept zu bringen. Aber selbst wenn sie nicht nur ihr eigenes Können ins Spiel gebracht hätte, sondern auch die Meisterschaftstrophäen sowie ihr NCAA-Zertifikat, das für die gesamten Staaten galt, hätte das alles nichts an der ganzen Sache geändert. Hope überkam eine Woge der Frustration, die sie wie so oft unterdrückte. Während ihr diese Dinge durch den Kopf gingen, löste sich eine ihrer Spielerinnen an der rechten Flanke, preschte nach vorn und donnerte den Ball schnell und geschickt an der Torhüterin vorbei. Gewinnen, dachte Hope, als die Mädchen ihrer Mannschaft lachend und jubelnd von den Bänken sprangen und sich gegenseitig in die Hände klatschten, Gewinnen war vielleicht das Einzige, was ihr Sicherheit gab.
Sally Freeman-Richards wartete im Dämmerlicht des späten Oktobernachmittags in ihrem Büro, nachdem ihre Sekretärin wie auch die beiden Partneranwälte ihrer Kanzlei sich verabschiedet und in die abendliche Rushhour gestürzt hatten. Zu bestimmten Jahreszeiten, besonders aber im Herbst, senkte sich die untergehende Sonne aggressiv hinter die weißen Türme der episkopalen Kirche am Rande des College-Campus und flutete gleißend hell durch die Fenster der angrenzenden Büros. Es war eine Zeit in der Schwebe. Dieses Licht hatte etwas Gleichgültiges, Unberechenbares an sich; nicht nur einmal hatte ein Auto einen Studenten, der von späten Seminaren zurückeilte, beim Überqueren der Straße erfasst, weil der Fahrer durch die Windschutzscheibe geblendet wurde. Über die Jahre war Sally schon zwei Mal mit diesem Phänomen in Berührung gekommen, einmal als Verteidigerin des unglückseligen Fahrers, das andere Mal als Klägerin gegen die Versicherung eines Studenten, der sich beide Beine brach.
Sally beobachtete, wie sich die Sonne im Büroraum ausbreitete und dabei bizarre, undefinierbare Schattenfiguren an die Wände warf. Sie liebte diesen Moment. Schon seltsam, dachte sie, dass ein Licht, das so wohlig warm schien, solche Gefahren bergen konnte. Es hing ganz davon ab, wo man sich gerade befand – zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Sie seufzte bei dem Gedanken, dass die Juristerei nicht zuletzt an dieser Frage hing. Angesichts der Stapel brauner Briefumschläge und Anwaltsakten, unter denen sich ihr Schreibtisch bog, verzog sie das Gesicht. Mindestens ein halbes Dutzend, das dort lag, war reine juristische Routinearbeit. Eine Geschäftsschließung. Eine berufliche Abfindung. Ein unbedeutender Prozess über einen Streit zwischen Nachbarn um ein Stück Land. In einer anderen Ecke des Büros bewahrte sie in einem Aktenschrank die kniffligeren Fälle auf, die im Zentrum ihrer Tätigkeit standen. Diese Verfahren betrafen andere lesbische Frauen im ganzen Tal. Dort lagen alle möglichen Schriftsätze, von Adoptionen bis zu Eheauflösungen. Sogar die Verteidigungsschrift zu einem Totschlagsverfahren, bei dem sie den zweiten Vorsitz führte, war dabei. Sie bearbeitete ihre Fälle fachkundig, nahm moderate Honorare, zeigte Anteilnahme und hielt sich für die beste Anwältin, wenn es um unberechenbare, unangemessene Gefühle ging. Dass dabei auch gewisse Rachegelüste im Spiel waren, dass sie mit ihrem Schwerpunkt indirekt auch offene Rechnungen beglich, war ihr klar, obschon sie ihr eigenes Leben nicht annähernd so kritisch unter die Lupe nahm wie gezwungenermaßen oftmals das ihrer Klienten.
Sie schnappte sich einen Bleistift und schlug eine der langweiligen Akten auf, schob sie jedoch ebenso schnell wieder beiseite. Sie ließ den Stift erneut in den Henkelbecher mit der Aufschrift »World’s Best Mom« fallen. Sie hegte hinsichtlich dieser Einschätzung ihre Zweifel.
Da es nichts wirklich Eiliges gab, das sie zu Überstunden gezwungen hätte, stand sie auf. Sie fragte sich gerade, ob Hope schon zu Hause war und was sie wohl zum Essen gezaubert hatte, als das Telefon klingelte.
»Sally Freeman-Richards.«
»Hallo, Sally, Scott am Apparat.«
Sie war gelinde überrascht, die Stimme ihres Ex zu hören.
»Hallo, Scott. Ich war gerade auf dem Weg zur Tür …«
Er stellte sich ihr Kanzleibüro vor. Vermutlich war es ordentlich und gut durchorganisiert, im Gegensatz zu der fröhlichen Anarchie, die in seinem eigenen herrschte. Er fuhr sich kurz mit der Zunge über die Lippen, während er daran denken musste, wie er es hasste, dass sie seinen Nachnamen beibehalten hatte. Sie hatte die Entscheidung damit begründet, dass es die Dinge für Ashley erleichterte, wenn sie älter wurde, obwohl sie ihn mit ihrem eigenen Mädchennamen verbunden hatte.
»Hast du einen Moment Zeit?«
»Du klingst besorgt.«
»Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich Grund dazu, vielleicht auch nicht.«
»Worum geht’s?«
»Um Ashley.«
Sally Freeman-Richards hielt den Atem an. Die wenigen Gespräche, die sie miteinander führten, waren kurz und bündig und drehten sich um Kleinigkeiten, die nach dem Scheitern ihrer Ehe noch zu klären waren. Seit ihrer Trennung vor so vielen Jahren war Ashley das einzig echte Bindeglied zwischen ihnen, und so war es nur noch darum gegangen, ihre Aufenthalte in den beiden Haushalten zu regeln oder die Studiengebühren und die Autoversicherung zu bezahlen. Im Lauf der Zeit hatten sie sich zu einer Art Détente durchgerungen, die es ihnen gestattete, diese Dinge praktisch und zweckdienlich anzugehen. Dabei tauschten sie sich kaum oder gar nicht darüber aus, wie sie sich verändert hatten und warum, als ob ihrer beider Leben in ihrer Erinnerung und in der gegenseitigen Wahrnehmung mit der Scheidung zum Stillstand gekommen sei.
»Was ist los?«
Scott Freeman zögerte. Er war sich nicht sicher, wie er das, was ihn bedrückte, angemessen in Worte fassen sollte.
»Ich hab einen beunruhigenden Brief in ihrer Schublade gefunden«, erklärte er.
Auch Sally schwieg einen Moment.
»Wieso bist du an ihre Schublade gegangen?«, fragte sie.
»Das tut wirklich nichts zur Sache«, erwiderte er. »Fakt ist, ich hab ihn gefunden.«
»Ich weiß nicht, ob das nichts zur Sache tut«, antwortete Sally. »Du solltest ihre Privatsphäre respektieren.«
Scott war augenblicklich verärgert, beschloss jedoch, es sich nicht anmerken zu lassen. »Sie hat ein paar Socken und Unterwäsche dagelassen. Ich wollte die Sachen in die Schublade legen, da habe ich den Brief entdeckt. Ich hab ihn gelesen. Er hat mich beunruhigt. Vermutlich hätte ich ihn nicht lesen sollen, aber ich hab’s nun mal getan. Was für ein Strafmaß schlägst du vor, Sally?«
Sally verkniff sich eine Antwort, obwohl ihr mehr als eine einfiel. Stattdessen fragte sie: »Was war das für ein Brief?«
Scott räusperte sich, ein altes Hörsaalmanöver, um ein bisschen Zeit zu schinden, bevor er einfach sagte: »Hör zu.« Er las ihr den Brief vor.
Als er fertig war, schwiegen sie beide eine Weile.
»Gar so schlimm klingt er eigentlich nicht«, sagte Sally schließlich. »Wie’s aussieht, hat sie einen heimlichen Verehrer.«
»Einen heimlichen Verehrer. Das hört sich seltsam viktorianisch an.«
Sie ignorierte seinen Sarkasmus und erwiderte nichts.
Scott wartete einen Moment, bevor er fragte: »Aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung, mit all den Fällen, die du schon hattest, findest du das nicht unterschwellig obsessiv? Zwanghaft vielleicht? Was für eine Persönlichkeit schreibt einen solchen Brief?«
Sally holte tief Luft und fragte sich insgeheim dasselbe.
»Hat sie dir gegenüber irgendwas erwähnt? Etwas in diese Richtung?«, hakte Scott nach.
»Nein.«
»Du bist ihre Mutter. Würde sie nicht zu dir kommen, wenn sie irgendwelche Männerprobleme hätte?«
Der Ausdruck »Männerprobleme« durchzuckte sie wie ein Blitz, und sie weigerte sich, auf die Wut, die plötzlich zwischen ihnen schwang, zu reagieren.
»Ja, ich denke schon. Hat sie aber nicht.«
»Na schön, als sie letzte Woche da war, hat sie da irgendwas gesagt? Ist dir an ihrem Verhalten irgendetwas aufgefallen?«
»Auf beide Fragen nein. Und du? Sie war immerhin auch ein paar Tage bei dir …«
»Nein, ich hab sie kaum zu Gesicht bekommen. Sie war dauernd mit Freunden von der Highschool unterwegs. Du weißt schon, zum Abendessen weg, um zwei Uhr morgens wieder da, irgendwann mittags aufgestanden, durchs Haus getappt und das Ganze wieder von vorne.«
Sally Freeman holte tief Luft. »Also, Scott, ich glaube nicht, dass uns das allzu sehr aus der Fassung bringen sollte. Falls sie ein Problem hat, dann wird sie es früher oder später bei einem von uns zur Sprache bringen. Wir sollten ihr vielleicht einfach Zeit lassen. Und ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, ein Problem zu sehen, wo es vielleicht keines gibt. Warten wir ab, ob sie etwas sagt. Ich denke, du hörst die Flöhe husten.«
Was für eine vernünftige Antwort, dachte Scott. Sehr aufgeklärt. Sehr liberal. So ganz im Einklang mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Und so absolut falsch.
Sie stand auf, ging zu einem antiken Schrank in der Ecke des Wohnzimmers und ließ sich eine Sekunde Zeit, um einen chinesischen Teller auf seinem Ständer zurechtzurücken. Als sie zurücktrat, um ihre Korrektur zu begutachten, runzelte sie unwillkürlich die Stirn. In der Ferne hörte ich Kinder spielen. Doch in dem Zimmer, in dem wir uns unterhielten, lag nur knisternde Spannung.
»Woher will Scott wissen, dass da etwas nicht stimmt?«, gab sie meine Frage an mich zurück.
»Eben. Der Brief könnte, so wie Sie ihn wiedergeben, alles Mögliche bedeuten. Seine Exfrau hat gut daran getan, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.«
»Eine Reaktion, die einer Anwältin würdig ist, oder?«, fragte sie.
»Falls Sie damit meinen, vorsichtig, würde ich sagen, ja.«
»Und finden Sie, auch klug?«, hakte sie nach. Sie winkte ab. »Er wusste es, weil er es wusste, weil er es wusste. Wahrscheinlich so eine Art Instinkt, auch wenn wir uns damit die Sache zu einfach machen. Vielleicht dieser letzte Rest von animalischem sechsten Sinn, der rudimentär noch in uns allen steckt, Sie wissen schon, dieses dumpfe Gefühl, dass was nicht stimmt.«
»Das scheint mir ein bisschen weit hergeholt.«
»Finden Sie? Haben Sie schon mal einen von diesen Tierfilmen über die Serengeti in Afrika gesehen? Wie oft fängt die Kamera ein Tier ein, das plötzlich alarmiert den Kopf hebt? Ich kann zwar noch kein Raubtier ausmachen, das irgendwo in der Nähe auf der Lauer liegt, aber …«
»Na schön, nehmen wir für einen Moment an, Sie hätten recht. Ich kann trotzdem nicht sehen, wie …«
»Nun ja«, unterbrach sie mich. »Wenn Sie den Mann kennen würden, vielleicht schon.«
»Sicher, das würde vermutlich helfen. Hatte Scott nicht dasselbe Problem?«
»Allerdings. Nur dass er anfänglich praktisch gar nichts wusste. Er hatte keinen Namen, keine Adresse, kein Alter, keine Beschreibung, keinen Führerschein, keine Sozialversicherungskarte oder irgendeine Information über seine berufliche Tätigkeit in der Hand. Nichts. Alles, was er hatte, war eine Gefühlsäußerung auf einem Blatt Papier und eine tiefsitzende, diffuse Sorge.«
»Angst.«
»Ja, Angst. Ist das nicht die schlimmste Angst? Vor einer undefinierbaren, unbekannten Gefahr? Keine leichte Situation, nicht wahr?«
»Sicher. Die meisten Menschen würden gar nichts tun.«
»Dann war Scott anders als die meisten.«
Ich schwieg, und sie holte tief Luft, bevor sie sagte: »Wenn er allerdings da schon, direkt zu Anfang, gewusst hätte, mit wem er es zu tun hatte, dann hätte er vielleicht …« Sie hielt mitten im Satz inne.
»Was?«
»Nicht weitergewusst.«
2
Ein Mann mit ungewöhnlich großen Aggressionen
Die Nadel des Tätowierers sirrte so durchdringend wie eine Hornisse. Der Mann, der sich mit der Nadel über ihn beugte, war ein untersetzter Muskelprotz. An seinen Armen rankten sich mehrfarbige verschlungene Muster wie Efeu empor und breiteten sich von dort aus über die Schultern und um den Hals, um unterhalb seines linken Ohrs in den entblößten Giftzähnen einer Schlange zu enden. Wie zum Gebet beugte er sich, die Nadel in der Hand, herab. Doch bevor er sich an die Arbeit machte, zögerte er, sah auf und fragte: »Sind Sie auch ganz sicher, Mann?«
»Ja«, antwortete Michael O’Connell.
»Das Tattoo hab ich nämlich noch keinem verpasst.«
»Dann wird’s Zeit«, erwiderte O’Connell steif.
»Mann, ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun«, brummte der Künstler. »Wird ein paar Tage brennen.«
»Ich weiß immer, was ich tue«, erwiderte O’Connell. Er biss gegen den Schmerz die Zähne zusammen und lehnte sich im Behandlungsstuhl zurück. Er starrte nach unten und sah zu, wie der Bulle mit dem Muster begann. Michael O’Connell hatte sich für ein von einem schwarzen Pfeil durchbohrtes scharlachrotes Herz entschieden, aus dem blutrote Tränen tropften. In der Mitte des getroffenen Herzens sollten die Initialen AF stehen. Das Ungewöhnliche an dem Tattoo war die Körperstelle, für die es bestimmt war. Er sah, dass es den Künstler Überwindung kostete. Offenbar fiel es dem Mann schwerer, das Herz und die Initialen auf dem Ballen von O’Connells rechtem Fuß einzutätowieren, als es ihm selbst fiel, sein Bein hochzuhalten und nicht zu bewegen.
Als ihm die Nadel in die Haut drang, wartete O’Connell. Es ist eine empfindliche Stelle, an der man vielleicht ein Kind kitzeln oder eine Geliebte streicheln würde. Oder auf ein Insekt treten würde. Die Stelle passte perfekt zu der Vielschichtigkeit seiner Gefühle.
Michael O’Connell war ein Mann mit wenig Kontakt zur Außenwelt, der gleichsam mit dicken Tauen, scharfen Drähten und festen Schließriegeln in sein Inneres eingezwängt wurde. Er war knapp unter einem Meter achtzig groß und hatte kräftiges, lockiges, dunkles Haar. Viele Stunden Gewichtheben und Ringen an der Highschool hatten ihm breite Schultern und eine schmale Taille beschert. Er wusste, dass er gut aussah, dass die Art, wie er die Augenbrauen hochzog oder lässig auf der Bildfläche erschien, ihre Wirkung nicht verfehlte. Er kultivierte legere Kleidung, in der er umgänglich und freundlich erschien; er bevorzugte Fleece gegenüber Leder, um unter den Studenten nicht aufzufallen, und mied alles, was seine Herkunft verraten konnte, etwa zu enge Jeans oder T-Shirts mit aufgerollten Ärmeln. Er lief die Boylston Street Richtung Fenway entlang und genoss die Vormittagsbrise. Es lag schon ein wenig November in der Luft, der Wind wehte in Böen abgefallene Blätter und Unrat übers Pflaster. Er schmeckte die würzige Frische von New Hampshire, die ihn an seine Jugend erinnerte.
Sein Fuß tat weh, doch es war ein angenehmer Schmerz.
Der Tattookünstler hatte ihm ein paar Tylenol gegeben und sterilen Mull auf das Muster gelegt, O’Connell allerdings gewarnt, dass der Druck beim Laufen ziemlich schmerzen würde. Das ging in Ordnung, auch wenn er für ein paar Tage ein bisschen verkrüppelt war.
Bis zum Campus der Boston University war es nicht mehr weit, und er kannte eine Bar, die früh öffnete. Ein wenig vornübergebeugt humpelte er in eine Nebenstraße und versuchte, den Schmerz auszutarieren, der mit jedem Schritt hochschoss. Es hatte etwas Spielerisches. Bei diesem Schritt reicht der Schmerz bis zum Knöchel. Beim nächsten bis zur Wade. Kann er auch bis ins Knie oder höher stechen? Er drückte die Bartür auf und blieb einen Moment stehen, bis sich seine Augen an das verrauchte Schummerlicht gewöhnt hatten.
An der Bar saßen ein paar ältere Männer über ihren Schnaps gebeugt. Stammgäste, nahm er an, Männer, die sich von einem Gläschen zum nächsten hangelten.
O’Connell ging hinüber, knallte ein paar Scheine auf die Theke und winkte den Barkeeper heran.
»Bier und ’nen Kurzen«, bestellte er.
Der Barkeeper brummte etwas, zapfte gekonnt ein kleines Glas Bier mit einer Schaumkrone von einem halben Zentimeter und füllte ein Gläschen mit bernsteinfarbenem Scotch. O’Connell kippte den Scotch, so dass er ihm in der Kehle brannte, und nahm einen großen Schluck Bier. Er deutete auf das Glas.
»Dasselbe noch mal«, sagte er.
»Lass erst die Kohle sehen«, erwiderte der Mann an der Bar.
O’Connell zeigte mit dem Finger auf sein Bier. »Dasselbe noch mal«, wiederholte er.
Der Barkeeper sagte nichts. Er hatte sich bereits klar ausgedrückt.
O’Connell zuckten ein halbes Dutzend passende Antworten durch den Kopf, allesamt Auftakt zu einer Schlägerei. Er merkte, wie ihm das Adrenalin in den Ohren pochte und wie er innerlich unruhig wurde. In einem solchen Moment war es im Grunde egal, ob er gewann oder verlor, Hauptsache, er spürte die Erleichterung, die ihm ein paar Fausthiebe verschafften. Das Gefühl, wenn seine Hand das Fleisch eines anderen traf, war so köstlich und berauschend, dass selbst der Schnaps nicht mithalten konnte. Er wusste, dass es das Pochen in seinem Fuß vertreiben und ihn für Stunden mit Energie aufladen würde. Er starrte den Barkeeper an. Er war bedeutend älter als O’Connell, bleich, mit einem unübersehbaren Wanst. Kein großer Schlagabtausch, dachte O’Connell, während er merkte, dass sich seine eigenen festen Muskeln anspannten, um die geballte Energie zu entladen. Der Barkeeper beobachtete ihn scharf; jahrelange Erfahrung hatten ihn gelehrt, im Gesicht eines Kunden zu erkennen, was in diesem vorging.
»Meinen Sie, ich hätte kein Geld?«
»Lassen Sie mal sehen«, erwiderte der Mann hinter dem Tresen. Er trat zurück, und O’Connell registrierte, wie die anderen Männer an der Bar zur Seite gewichen waren und den Blick zur dunklen Decke hoben. Auch ihnen war diese Art Konflikt nicht neu.
Er wendete sich wieder dem Barkeeper zu. Der Mann war zu alt und mit der zwielichtigen Welt der heruntergekommenen Bar zu vertraut, um auf so etwas nicht vorbereitet zu sein. Und in dieser Sekunde erkannte O’Connell, dass der Barkeeper etwas in der Hinterhand hatte, das seine mangelnde Muskelkraft ersetzte. Einen Aluminium-Baseballschläger oder vielleicht eine hölzerne Fischkeule mit kurzem Griff. Möglicherweise auch etwas Effizienteres wie eine verchromte Neunmillimeter oder ein Kaliber .12. Nein, nicht die Neunmillimeter. Zu schwierig zu laden. Etwas Älteres, Antikeres, zum Beispiel eine .38 Police Special, entsichert, mit Kugeln für Pappziele geladen, um die Durchschlagskraft auf Menschen zu optimieren und gleichzeitig den Sachschaden für die Einrichtung möglichst gering zu halten. Er glaubte nicht, dass er schnell genug über den Tresen hechten konnte, um den Barkeeper zu packen, bevor der nach der Waffe griff.
Na schön, dachte er achselzuckend. Er schnellte herum und funkelte den Gast an, der ein paar Schritte von ihm entfernt lehnte.
»Was guckst du so, du alter Sack?«, schnauzte er ihn an.
Der Mann hielt den Blick abgewandt.
»Wollen Sie noch einen Drink?«, wollte der Barkeeper wissen.
O’Connell konnte die Hände des Mannes nicht mehr sehen.
Er lachte. »In so ’nem Scheißladen jedenfalls nicht«, sagte er. Er stand auf und ließ im Hinausgehen die Männer schweigend zurück. Er nahm sich vor, dem Kerl bei Gelegenheit einen Besuch abzustatten, was ihn mit einer Woge der Befriedigung erfüllte. Es gab nichts Angenehmeres im Leben, als sich an eine Grenze zu wagen und die Möglichkeit der Eskalation zu genießen. Wut war wie eine Droge; in Maßen genossen, machte sie ihn high. Doch in regelmäßigen Abständen war es nötig, sie so richtig auszukosten und sich ganz zu verausgaben. Er sah auf die Uhr. Kurz nach Mittag. Manchmal kam Ashley für ein Sandwich mit befreundeten Kunstgeschichtsstudenten auf die Campuswiese. Da war es ein Kinderspiel, sie im Auge zu behalten, ohne von ihr entdeckt zu werden. Vielleicht sollte er einfach rüberschlendern und nach ihr sehen.
Das erste Mal war Michael O’Connell Ashley Freeman durch Zufall vor sechs Monaten begegnet. Er arbeitete als Teilzeit-Automechaniker an der Tankstelle nicht weit von der ausgebauten Massachusetts Turnpike, während er in seiner Freizeit Computerkurse belegte und sich am Wochenende in einer Studentenkneipe in der Nähe der Uni als Barkeeper ein bisschen dazuverdiente. Sie war von einem Skiwochenende mit ihren Freundinnen zurückgekehrt, als ihnen dank eines der in Boston allgegenwärtigen Schlaglöcher der rechte Hinterreifen platzte und zerfetzte, was im Winter ziemlich oft vorkam. Ihre Zimmergenossin hatte den Wagen in die Werkstatt bugsiert und O’Connell den Reifen gewechselt. Da die Visa-Karte der Zimmergenossin durch die Eskapaden am Wochenende ausgereizt war und zurückgewiesen wurde, hatte O’Connell den Reifen mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt, ein Akt der Großzügigkeit und des scheinbaren Samaritertums, der auf die vier Mädchen im Wagen seine Wirkung nicht verfehlte. Sie wussten natürlich nicht, dass die Karte, die er benutzte, gestohlen war, und hatten ihm bereitwillig ihre Adressen und Telefonnummern gegeben und ihm versprochen, bis Mitte der Woche das Geld bereitzuhalten, wenn er kurz vorbeikäme, um es abzuholen. Der neue Reifen sowie seine Montage beliefen sich auf 221 Dollar. Keins der Mädchen hatte auch nur für einen Moment begriffen, wie lächerlich geringfügig diese Summe war, um dafür Michael O’Connell in ihr Leben zu lassen.
Abgesehen von seinem guten Aussehen war Michael O’Connell auch mit außergewöhnlich scharfen Augen ausgestattet. Es fiel ihm nicht schwer, Ashleys Silhouette bereits aus der Entfernung von über einem Häuserblock zu erkennen, und so versteckte er sich halb hinter einer Eiche, um sie ins Visier zu nehmen. Er wusste, dass ihn niemand bemerken würde; er war zu weit entfernt, es liefen zu viele Menschen vorbei, es herrschte zu dichter Verkehr und eine zu grelle Oktobersonne. Außerdem wusste er, dass er die Fähigkeit entwickelt hatte, wie ein Chamäleon mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Eigentlich hätte er bei seiner Gabe, sich ständig in jemand anderen zu verwandeln, wirklich Schauspieler werden sollen.
In einer heruntergekommenen Kneipe, in der Alkoholiker und Kleinkriminelle verkehrten, ließ er den knallharten Typen raushängen. Unter Bostons Studentenscharen gab er sich ebenso selbstverständlich als College-Kid. Der mit Computerbüchern zum Bersten gefüllte Rucksack kam ihm dabei zupass. Michael O’Connell fand, dass er perfekt zwischen den Welten hin und her wanderte, indem er sich grundsätzlich darauf verließ, dass die Menschen sich nicht mehr als eine Sekunde nahmen, um ihn zu taxieren.
Hätten sie genauer hingesehen, hätten sie es wohl mit der Angst zu tun bekommen.
Ein einziger Blick genügte, um in der Gruppe der jungen Leute Ashleys rotblonden Schopf auszumachen. Etwa ein halbes Dutzend von ihnen saß in einem losen Kreis beim Lunch zusammen. Sie lachten und erzählten sich etwas. Er wusste, dass er, wäre er der Siebte in ihrer Runde gewesen, nur schweigend dagesessen hätte. Dabei war er ein guter Lügner, er konnte plausible Geschichten erfinden, und die Leute glaubten ihm – wer er war, wo er herkam, was er schon gemacht hatte, doch in einer Gruppe hatte er immer Angst, es könnte mit ihm durchgehen, er könnte etwas Unbedachtes, Unwahrscheinliches sagen und unnötig Zweifel säen, was er auf jeden Fall vermeiden musste. War er dagegen mit einer von ihnen, mit Ashley, allein, dann fiel es ihm nicht schwer, verführerisch zu sein und Anteilnahme zu wecken.
Michael O’Connell beobachtete die Mädchen und überließ sich der langsam aufsteigenden Wut.
Es war ein vertrautes Gefühl, das er einerseits willkommen hieß und andererseits hasste. Es war nicht dasselbe wie die Wut vor einer Schlägerei oder bei einem Streit mit seinem Chef, egal welchen Gelegenheitsjob er gerade hatte, oder mit seinem Vermieter oder der alten Frau, die neben seinem winzigen Apartment wohnte und ihn mit ihren Katzen und ihren argwöhnischen Blicken nervte. Er konnte sich mit jedem anlegen, auch handgreiflich werden, und es hatte nichts zu sagen. Doch seine Gefühle gegenüber Ashley waren etwas vollkommen anderes.
Er wusste, dass er sie liebte.
Wenn er sie aus sicherer Entfernung unerkannt beobachtete, brodelte er innerlich. Er versuchte, sich zu entspannen, doch es gelang ihm nicht. Er wandte sich ab, da es einfach zu weh tat, aus der Ferne hinüberzusehen, doch ebenso schnell drehte er sich wieder zurück, weil es noch viel unerträglicher war, sie nicht zu sehen. Jedes Mal, wenn sie lachte, wenn sie den Kopf zurückwarf und ihr das Haar verführerisch über die Schulter fiel, wenn sie sich vorbeugte, um jemandem zuzuhören, stand er Qualen aus. Jedes Mal, wenn sie die Hand ausstreckte und zufällig die eines anderen streifte, trieb es ihm Eispickel in die Brust.
Michael O’Connell starrte hinüber und hatte das Gefühl, fast eine Minute nicht mehr geatmet zu haben.
Sie schnürte ihm die Luft ab, so dass er nicht mehr klar denken konnte.
Er griff in seine Hosentasche und fühlte nach dem Messer – keins von diesen Schweizer Messern, wie man sie bei den Bostoner Studenten hundertfach im Rucksack finden konnte, sondern ein zehn Zentimeter langes Klappmesser, das er in Somerset in einem Laden für Campingartikel gestohlen hatte. Es hatte ein beachtliches Gewicht. Er legte die Hand darum und drückte fest zu, und obwohl die Klinge im Griff versenkt war, schnitt es ihm ins Fleisch. Ein bisschen zusätzlicher Schmerz, dachte er, macht den Kopf frei.
Michael O’Connell liebte es, die Waffe bei sich zu haben, weil sie ihm das Gefühl gab, gefährlich zu sein.
Manchmal kam es ihm so vor, als bewegte er sich in einer Welt von Menschen, die alle im Begriff standen, etwas zu werden. Studenten wie Ashley waren im Aufbruch zu etwas anderem, als sie im Augenblick noch waren. Jura für die künftigen Anwälte, Medizin für die angehenden Ärzte. Kunst. Philosophieseminare. Fremdsprachenstudium. Medienwissenschaft. Jeder wurde irgendetwas, war kurz davor, eine Laufbahn einzuschlagen und irgendwo dazuzugehören.
Er wünschte, er wäre zur Armee gegangen. Er konnte sich gut vorstellen, dass er beim Militär mit seinen Talenten genau am richtigen Platz gewesen wäre, vorausgesetzt, sie hätten darüber hinweggesehen, dass er Befehle nicht gut vertrug. Vielleicht hätte er es beim CIA versuchen sollen. Aus ihm wäre ein ausgezeichneter Spion geworden. Oder auch Auftragskiller. Das hätte ihm gefallen. Eine Art James Bond. Er wäre ein Naturtalent gewesen.
Stattdessen, erkannte er, war er auf dem besten Weg zum Kriminellen. Sein liebstes Studienfach war die Gefahr.
Einen Häuserblock entfernt kam Bewegung in die Gruppe. Wie auf Kommando standen sie auf, strichen sich die Kleider sauber und hatten keine Ahnung, was außerhalb ihrer albernden, lachenden Runde vor sich ging.
Er setzte sich in Bewegung und folgte ihnen langsam, wobei er darauf achtete, immer denselben Abstand einzuhalten und sich auf dem Bürgersteig unter die anderen Fußgänger zu mischen, bis Ashley zusammen mit den anderen die Eingangstreppe zu einem Gebäude hinaufstieg und verschwand.
Er wusste, dass ihr letztes Seminar um 16:30 zu Ende war. Anschließend ging sie für zwei Stunden zu ihrem Job im Museum. Er war neugierig, ob sie an diesem Abend schon etwas vorhatte.
Er schon. Er hatte immer etwas vor.
»Eins verstehe ich nicht …«
»Was meinen Sie?«, fragte sie mit der Geduld eines Lehrers gegenüber einem begriffsstutzigen Schüler.
»Wenn dieser Kerl …«
»Michael. Michael O’Connell. Hübscher irischer Name. Geläufiger Name in Boston. Von Brockton bis Somerville und darüber hinaus muss es Tausende davon geben. Erinnert an Messdiener, die Weihwasser schwenken und im Kirchenchor singen, oder an Feuerwehrleute mit Uilleann Pipes an einem kalten, windigen St. Patrick’s Day.«
»Mit anderen Worten, er heißt nicht wirklich so? Das gehört zu dem Puzzle, richtig? Wenn ich der Sache nachginge, würde ich bei dem Namen nicht fündig, stimmt’s?«
»Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.«
»Sie machen mir die Sache schwerer als nötig.«
»Meinen Sie? Finden Sie nicht, dass ich das am besten beurteilen kann? Vielleicht gehe ich ja davon aus, dass Sie früher oder später aufhören, mir Fragen zu stellen, und versuchen, die Wahrheit selbst herauszufinden. Sie wissen schon jetzt genug, um zumindest einen Anfang zu machen. Sie werden das, was ich gesagt habe, mit dem vergleichen, was Sie in Erfahrung bringen können. Darum geht es ja. Und ich möchte es Ihnen nicht allzu leicht machen. Sie nennen es ein Puzzle. Ich denke, das trifft es.«
Sie war ziemlich direkt. Falls das, was sie sagte, bedächtig klingen sollte, kam es bei mir jedenfalls nicht so an.
»Meinetwegen«, gab ich nach, »also weiter im Takt. Wenn dieser Michael tatsächlich auf ein randständiges Leben zusteuerte und dabei war, die Karriereleiter der Kleinkriminalität hochzustolpern, wie passt da Ashley ins Bild? Ich meine, sie müsste diesen Kerl doch in zwei Sekunden durchschaut haben, oder? Sie war recht gebildet. Sie hat vielleicht schon Vorlesungen über Stalker und ähnliche Leute gehört. Ich bitte Sie, selbst in der Gesundheitsfibel der staatlichen Highschools findet sich ein Abschnitt über diese Typen, in alphabetischer Reihenfolge, die kommen direkt hinter dem Stichwort Sexualität. Sie muss folglich ziemlich schnell begriffen haben, mit wem sie es zu tun hat, und dann hätte sie doch alles darangesetzt, ihn loszuwerden. Was Sie erzählen, klingt nach obsessiver Liebe, aber dieser O’Connell erscheint mir eher wie ein Psychopath, und …«
»Ein angehender Psychopath, ein Möchtegern-Psychopath …«
»Ja, meinetwegen, aber wo nahm die Obsession ihren Anfang?«
»Gute Frage«, räumte sie ein. »Und eine, die eine Antwort verdient. Aber bei allen Stärken, über die Ashley verfügt, liegen Sie falsch, wenn Sie glauben, sie hätte erkennen müssen, dass sie sich mit Michael O’Connell ein Problem eingehandelt hat.«
»Kann schon sein. Was war es denn für sie?«
»Theater«, antwortete sie. »Allerdings wusste sie nicht, was für eine Inszenierung.«
3
Eine junge Frau von gewöhnlicher Unwissenheit
Zwei Tische entfernt von Ashley Freeman und ihren Freunden saß ein halbes Dutzend Mitglieder einer Baseball-Mannschaft der Northeastern University und diskutierte hitzig über die Stärken und Schwächen der Yankees und der Red Sox, wobei die Urteile jeweils laut und teilweise derb ausfielen. Hätte Ashley nicht in ihren vier Studienjahren in Boston viele Stunden in Studentenkneipen zugebracht, hätte sie die Lautstärke vielleicht irritiert, doch so war sie mit dieser und ganz ähnlichen Debatten hinlänglich vertraut. Gelegentlich kam es dabei zu Schubsereien oder Handgreiflichkeiten, meistens ließen es die Kontrahenten jedoch beim verbalen Schlagabtausch bewenden. Oft wurden phantasievolle Spekulationen darüber ausgetauscht, welche bizarren sexuellen Praktiken die Spieler der einen oder der anderen Mannschaft in ihrer Freizeit pflegten. Tiere vom Bauernhof spielten dabei eine zentrale Rolle.
Ihr gegenüber waren ihre Freunde in eine eigene leidenschaftliche Diskussion vertieft. Es ging um eine Ausstellung von Goyas berühmten Skizzen Die Schrecken des Krieges, die an der Harvard University zu sehen war. Sie waren mit der U-Bahn quer durch die Stadt zur Ausstellung gefahren und dann verstört zwischen den schwarzweißen Zeichnungen von Verstümmelung, Folter, Meuchelmord und Todesqual umhergewandert. Dabei war Ashley aufgefallen, dass man zwar die Zivilbevölkerung immer klar von den Soldaten unterscheiden konnte, diese Einteilung den Menschen aber keine Anonymität gewährte. Und genauso wenig Sicherheit. Der Tod, musste sie denken, ist ein Gleichmacher. Er bricht den menschlichen Geist, ungeachtet der politischen Überzeugungen. Er ist unerbittlich.
Unbehaglich rutschte sie auf ihrem Sitz hin und her. Bilder, besonders von Gewalt, setzten ihr sehr zu, daran hatte sich seit ihrer Kindheit nichts geändert. Sie blieben ihr hartnäckig im Gedächtnis haften, sei es nun Salome, die in einer Renaissance-Version den Kopf des Johannes bewundert, oder Bambis Mutter, die versucht, den Jägern zu entkommen. Selbst das theatralische Morden in Quentin Tarantinos Kill Bill fand sie irritierend.
Ihr Date aus Fleisch und Blut war an diesem Abend ein schlaksiger, langhaariger Psychologie-Absolvent vom Boston College namens Will, der sich über den Tisch beugte und, während er ein Argument vorbrachte, versuchte, den Abstand zwischen seiner Schulter und ihrem Arm zu reduzieren.
Zarte Berührungen waren, fand sie, wichtiger Bestandteil der Werbung. Jede noch so kleine geteilte Empfindung konnte zu etwas Intensiverem führen. Sie wusste nicht recht, was sie von ihm halten sollte. Ganz offensichtlich war er intelligent und nachdenklich. Er war mit einem halben Dutzend Rosen an ihrer Wohnungstür erschienen, der psychologischen Entsprechung einer »Du kommst aus dem Gefängnis frei«-Karte beim Monopoly, wie er sagte. Das heißt, er konnte etwas Beleidigendes oder Dämliches tun oder sagen, und sie sah es ihm zumindest einmal nach. Ein Dutzend Rosen, sagte er, wären zu viel gewesen, allzu offensichtlich, wohingegen die Hälfte zugleich vielversprechend wie unverbindlich war. Ihr war das witzig und nachvollziehbar erschienen, und so fand sie ihn anfänglich nett, doch es dauerte nicht lange, bis sie das Gefühl bekam, dass er ein wenig zu sehr von sich eingenommen war und sich gerne selbst reden hörte, was sie enttäuschend fand.
Ashley strich sich das Haar aus dem Gesicht und versuchte zuzuhören.
»Goya wollte schockieren. Er wollte den Politikern und Aristokraten, die den Krieg verherrlichten, die Realität vor Augen halten, so dass sie nicht wegsehen konnten …«
Die letzten Worte seiner Bemerkung gingen wegen des Gebrülls zwei Tische weiter unter. »Ich sag dir, worin Derek Jeter gut ist. Er beugt sich vornüber und …«
Sie musste innerlich grinsen. Es kam ihr plötzlich vor, als sei sie in eine Bostoner Variante von Twilight Zone geraten, mitten zwischen Schnösel und Pöbel.
Sie wechselte die Stellung und hielt eine neutrale Distanz, die Will weder er- noch entmutigte, und dachte unwillkürlich daran, wie viel Pech sie bis dahin in der Liebe gehabt hatte. Sie fragte sich, ob das einfach nur eine vorübergehende Phase war, wie das Erwachsenwerden, oder die Aussicht auf ihre Zukunft. Sie hatte das Gefühl, dass ihr irgendetwas kurz bevorstand, doch sie wusste nicht, was.
»Sicher, nur hat die Kunst schon immer mit dem Dilemma gekämpft, dass sie – auch wenn sie den Krieg zeigt, wie er ist – ihn noch nie verhindern konnte, sondern immer nur als Kunst gefeiert wird. Wir fühlen uns von Guernica magisch angezogen und sind ungemein beeindruckt von Picassos tiefer Vision, aber empfinden wir deshalb mit den Bauern, die im Bombenhagel gestorben sind, so etwas wie Mitgefühl? Sie waren mal Menschen aus Fleisch und Blut. Ihr Tod war real. Doch er wird dem Kunstwerk untergeordnet.«
Das wiederum sagte Will, ihr Rendezvous. Ashley räumte ein, dass es eine kluge Bemerkung war, andererseits aber auch etwas, das jeder x-beliebige, politisch korrekt denkende College-Student hätte sagen können. Sie warf einen Blick zu den lauten Baseballspielern hinüber. Auch wenn der Alkohol eine Rolle spielte, gefiel ihr der Überschwang an ihrer Kabbelei. Sie liebte es, mit einem Bier im Fenway-Park-Stadion zu sitzen, aber auch, durchs Museum of Fine Art zu schlendern. Sie war sich nicht sicher, in welche Diskussionsrunde sie besser passte.
Ashley warf Will einen verstohlenen Blick zu. Wahrscheinlich glaubte er, dass er ein Mädchen mit intellektueller Protzerei am schnellsten ins Bett bekam. Das war typisch für ältere Semester. Sie beschloss, ihn ein wenig aus dem Konzept zu bringen.
Ashley schob abrupt ihren Stuhl zurück und stand auf. »He!«, brüllte sie. »Ihr da drüben, seid ihr vom BC? Von der BU? Der Northeastern?«
Der Tisch der Baseballspieler verstummte augenblicklich. Wenn ein schönes Mädchen jungen Männern etwas zuruft, kann sie sich sicher sein, volles Gehör zu finden.
»Northeastern«, erwiderte einer von ihnen und erhob sich halb, um ihr mit fernöstlicher Höflichkeit zuzunicken, was zur Etikette der Rowdy-Bar allerdings in krassem Gegensatz stand.
»Na ja, wer Lobeshymnen auf die Yankees singt, der kann sie gleich auf General Motors oder IBM singen oder auf die Republikaner. Ein Red-Sox-Fan zu sein hat was mit Poesie zu tun. Jeder kommt einmal an einen Scheideweg im Leben, an dem er Farbe bekennen muss. Genug der Worte.«
Die anderen Jungs am Tisch brachen in schallendes Gelächter und gespielte Empörung aus.
Will lehnte sich grinsend zurück. »Das«, sagte er, »nenne ich knapp und bündig geantwortet.«
Ashley lächelte und fragte sich, ob er am Ende doch ganz nett war.
In früheren Jahren hatte sie manchmal gedacht, dass es wohl im Grunde leichter war, unscheinbar zu sein. Unscheinbare Mädchen konnten sich verstecken.
Mit dreizehn oder vierzehn hatte sie eine radikale Phase durchgemacht, in der sie so ziemlich gegen alles war: Sie führte lautstarke, fußstampfende Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihren Lehrern, ihren Freunden, trug schlabberige, sackartige, erdfarbene Klamotten, setzte eine leuchtend rote Strähne in ihrem Haar direkt neben eine tintenschwarze, hörte Grunge-Rock, trank starken, schwarzen Kaffee, probierte es mit Rauchen und sehnte sich nach Tattoos und Body-Piercings. Diese Phase hatte ein paar Monate angehalten, lange genug, um sich mit so ziemlich allem, was sie an der Schule machte, sowohl im Unterricht als auch beim Sport, Ärger einzuhandeln. Es kostete sie ein paar Freundschaften, und diejenigen, die ihr die Stange hielten, runzelten ein wenig besorgt die Stirn.
Zu Ashleys Überraschung war in diesem Lebensabschnitt die einzige Erwachsene, mit der sie in halbwegs zivilisierter Weise reden konnte, Hope, die Gefährtin ihrer Mutter. Das war wirklich erstaunlich, da ein Teil von ihr Hope für die Trennung ihrer Eltern verantwortlich machte und sie ihren Freunden oft erzählt hatte, wie sehr sie die Frau dafür hasste. Diese Unwahrheit hatte ihr zu schaffen gemacht, schon weil es das war, was ihre Freunde von ihr hören wollten, und es sie beunruhigte, dass sie ihnen nach dem Munde redete. Nach Grunge und Gothic hatte sie sich eine Zeitlang in der Rolle der Musterschülerin im Schottenröckchen gefallen, danach dann als Sportfanatikerin, worauf sie sich einige Wochen lang dem Veganertum verschrieb und nur noch Tofu und Veggie-Burger aß. Sie hatte sich im Theaterspielen versucht und ganz passabel die Bibliothekarin Marian in dem Musical The Music Man hingelegt, hatte sich in seitenlangen Ergüssen ihrem Tagebuch anvertraut, sich zeitweise als Emily Dickinson, Eleanor Roosevelt und Carrie Nation stilisiert – mit einem Touch von Gloria Steinem und Mia Hamm. Sie hatte für Habitat for Humanity an einem Haus mitgebaut und war mit dem größten Drogendealer ihrer Highschool zu einem furchterregenden Trip in eine nahe gelegene Stadt mitgefahren, um eine gewisse Menge Crack abzuholen – ein Abenteuer, das auf einer Überwachungskamera der Polizei festgehalten wurde und den Anruf eines Kriminalbeamten bei ihrer Mutter nach sich zog. Sally Freeman-Richards war außer sich vor Wut gewesen, hatte ihr wochenlang Hausarrest erteilt, sie angeschnauzt und ihr klargemacht, dass sie weiß Gott von Glück sagen konnte, nicht hinter Gittern gelandet zu sein, und dass sie es schwer haben würde, das Vertrauen ihrer Mutter wiederzuerlangen. Hope und ihr Vater waren jeweils zu nachsichtigeren Schlüssen gekommen und hatten von jugendlicher Rebellion geredet, wobei Scott sich an ein paar Dummheiten erinnerte, die er sich in ihrem Alter geleistet hatte, über die sie lachen konnte und die sie trösteten. Sie glaubte nicht, dass sie bewusst auf Gefahr aus war, doch Ashley wusste auch, dass sie es ab und zu darauf ankommen ließ, und sie hielt sich für einen Glückspilz, wenn sie daran dachte, dass sie bis jetzt ungeschoren davongekommen war. Ashley kam sich oft vor wie Ton auf einer Töpferscheibe, die sich so lange dreht, bis die Masse Gestalt annimmt, und sie rechnete jeden Moment mit dem Hitzeschwall des Schmelzofens, um gebrannt zu werden.
Sie fühlte sich orientierungslos. Ihren Job beim Museum, wo sie beim Katalogisieren der Exponate half, machte ihr wenig Spaß. Es war ein Job, bei dem man in einem Hinterzimmer hockte und auf einen Computerbildschirm starrte. Außerdem war sie sich nicht sicher, ob das Graduierten-Programm in Kunstgeschichte, für das sie sich beworben hatte, das Richtige für sie war, denn manchmal dachte sie, dass sie nur deshalb auf dieses Fach verfallen war, weil sie geschickt mit Stift, Tinte und Pinsel umgehen konnte. Das machte ihr schwer zu schaffen, denn wie so viele junge Menschen glaubte sie, dass sie nur das tun sollte, was sie wirklich liebte. Und noch hatte sie nicht herausgefunden, was es war.
Sie hatten die Bar verlassen, und Ashley zog gegen die abendliche Kälte den Mantel enger um sich. Ihr war bewusst, dass Will ein bisschen Beachtung verdiente. Er sah gut aus, war aufmerksam und hatte möglicherweise Sinn für Humor. Er hatte einen seltsamen, etwas hoppelnden, irgendwie drolligen Gang und war im Großen und Ganzen jemand, der bei ihr durchaus Chancen besaß. Zugleich wurde ihr allerdings bewusst, dass sie bereits fast zwei Häuserblocks gelaufen waren und nur noch etwa fünfzig Meter bis zu ihrer Haustür hatten, und bis jetzt hatte er ihr noch keine richtige Frage gestellt.
Ihr fiel ein kleines Spielchen ein. Falls er ihr eine Frage stellte, die sie interessant fand, hatte er sich ein zweites Date verdient. Fragte er sie dagegen nur, ob er mit raufkommen könnte, war es das gewesen.
»Was meinst du?«, fragte er plötzlich. »Wenn Typen in einer Bar sich wegen Baseball in die Haare kriegen, geht es ihnen dabei um den Sport oder um den Streit? Ich meine, schließlich gibt es letztlich keine richtigen Antworten, sondern nur die Loyalität gegenüber einer Mannschaft. Und über blinde Treue lässt sich eigentlich nicht streiten, oder?«
Ashley lächelte. Das war sein zweites Date.
»Natürlich«, fügte er hinzu, »ist Liebe zu den Red Sox etwas für mein Oberseminar in ›Die Psychologie des Abnormen‹.«
Sie lachte. Eindeutig ein zweites Date.
»Da wären wir«, sagte sie. »War ein netter Abend.«
Will sah sie an. »Sehen wir uns wieder? Das nächste Mal vielleicht in einer etwas ruhigeren Umgebung?«, schlug er vor. »Vielleicht können wir uns besser kennenlernen, wenn wir nicht gegen das Gebrüll und die wilden Spekulationen über Derek Jeters Vorlieben für Lederpeitschen und Sexspielzeuge in Überlebensgröße und die Körperöffnungen, in die sie eingeführt werden, ankämpfen müssen.«
»Das fände ich schön«, sagte Ashley. »Rufst du mich an?«
»Ganz bestimmt«, antwortete Will.
Sie stieg die erste Stufe zum Eingang ihres Wohnblocks hoch, als ihr bewusst wurde, dass sie immer noch seine Hand hielt. Sie drehte sich um und gab ihm einen langen Kuss. Einen relativ keuschen Kuss, bei dem ihre Zunge nur so eben zwischen seine Lippen drang. Ein verheißungsvoller Kuss, der für die folgenden Tage mehr versprach, wenn auch nicht für diese Nacht. Er schien die Botschaft zu verstehen, was sie zu schätzen wusste, denn er trat einen halben Schritt zurück, verbeugte sich galant wie ein Höfling aus dem 18. Jahrhundert und verabschiedete sich mit einem Handkuss.
»Gute Nacht«, sagte sie. »Ich fand’s wirklich schön.«