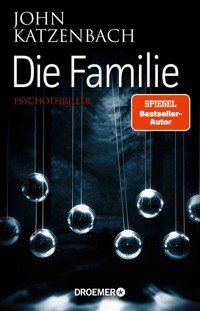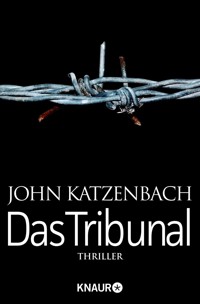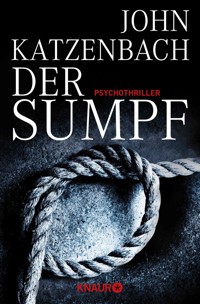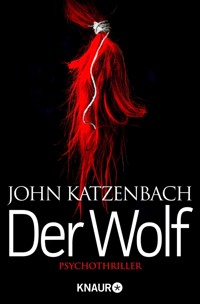9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jeffrey Clayton, ein Psychologieprofessor, der auf das Profiling von Serienkillern spezialisiert ist, wird von der Polizei beauftragt, den grausamen Mord an einer jungen Frau aufzuklären. Dieser Mord ist ein Geheimnis – denn er hat sich ausgerechnet in einem streng überwachten Gebiet ereignet, das seinen wohlhabenden Bewohnern absolute Sicherheit verspricht. Das Verbrechen, das es eigentlich nicht geben darf, führt Clayton auf verschlungenen Pfaden zurück in seine eigene, dunkle Familiengeschichte. Der Mord ähnelt einer Tat aus Jeffreys Nachbarschaft, die 25 Jahre zurückliegt. Damals zählte sein eigener Vater zu den Verdächtigen – bis er kurz darauf auf mysteriöse Weise ums Leben kam ... Das Rätsel von John S. M. Katzenbach: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 850
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
John Katzenbach
Das Rätsel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
»Ich wollte das ideale [...]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
»Ich wollte das ideale Tier jagen«, erklärte der General. »Also fragte ich mich: ›Welche Eigenschaften hat die ideale Beute?‹ Und die Antwort lautete natürlich: ›Sie muss mutig sein, gerissen und vor allem ein vernunftbegabtes Wesen.‹«
»Aber kein Tier verfügt über Vernunft«, warf Rainsford ein.
»Mein lieber Freund«, sagte der General, »eines schon.«
Richard Connell,
The Most Dangerous Game
Prolog
Die Königin der Rätsel
Ihre Mutter schlief unruhig im Zimmer nebenan; sie war todkrank. Es war fast Mitternacht, und der Luftzug, den der Deckenventilator träge durch den Raum schickte, schien die Hitze vom Tage nur anders zu verteilen.
Das altmodische Jalousienfenster stand einen Spaltbreit offen, um die lakritzschwarze Nacht hereinzulassen. Todeswütig warf sich eine Motte gegen die Scheibe. Sie sah dem Insekt eine Weile zu und fragte sich, ob es nun vom Licht gelockt wurde, wie die Dichter und Romantiker glaubten, oder ob es das Licht in Wahrheit hasste und sich in einer hoffnungslosen Attacke auf die Quelle seines Ärgers stürzte.
Sie spürte ein dünnes Rinnsal Schweiß zwischen den Brüsten und wischte es sich mit dem T-Shirt weg, ohne auch nur für einen Moment den Zettel aus den Augen zu lassen, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag.
Es war billiges weißes Papier. Die Worte waren in einfachen Druckbuchstaben geschrieben:
DIEERSTEPERSONBESITZTDAS,
WASDIEZWEITEPERSONVERSTECKTHAT.
Sie lehnte sich zurück und klopfte wie ein Trommler, der seinen Rhythmus sucht, mit dem Kugelschreiber auf den Tisch. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie Gedichte und Notizen mit der Post bekam, kurze Texte unterschiedlichster Art, die verschlüsselte Botschaften enthielten. Meist handelte es sich dabei um – unerhörte – Liebesschwüre oder auch den Versuch, eine Verabredung zu forcieren. Zuweilen waren die Schreiben obszön. Das eine oder andere war eine harte Nuss – absichtlich so kompliziert zu knacken, so obskur, dass sie nicht weiterwusste. Immerhin verdiente sie damit ihren Lebensunterhalt, und so war es nur fair, wenn einer ihrer Leser den Spieß rumdrehte.
Diese spezielle Nachricht allerdings bereitete ihr Kopfzerbrechen, weil sie nicht in ihrem Postfach bei der Zeitschrift eingegangen war. Ebenso wenig über ihr berufliches E-Mail-Konto. Dieser Brief war an diesem Tag in den verblichenen, rostigen Briefkasten am Ende ihrer Auffahrt eingesteckt worden, damit sie ihn abends fand, wenn sie von der Arbeit kam. Und im Unterschied zu fast sämtlichen anderen Botschaften, die sie erhielt, fehlten Absender und Unterschrift. Das Kuvert war nicht gestempelt.
Der Gedanke, dass jemand wusste, wo sie wohnte, behagte ihr nicht.
Die meisten Menschen, die sich die Zeit mit den von ihr entworfenen kleinen Spielchen vertrieben, waren harmlos. Computerprogrammierer. Akademiker. Buchhalter. Hier und da ein Polizist, ein Anwalt oder Arzt. Viele dieser Berufsgruppen erkannte sie inzwischen daran, wie sie beim Lösen der Rätsel vorgingen, das war oft so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Inzwischen konnte sie sogar einschätzen, welchen ihrer Stammkunden welche Spiele am besten lagen; manche waren versiert im Knacken von Kryptogrammen und Anagrammen, andere unschlagbar, wenn es darum ging, literarische Rätsel zu lösen, obskure Zitate zu erkennen oder auch wenig bekannte Autoren mit historischen Ereignissen zu verknüpfen. Diese Klientel löste ihre sonntäglichen Kreuzworträtsel mit Tinte.
Natürlich gab es auch andere.
Sie war stets auf der Hut vor Leuten, die ihre Paranoia in jeder versteckten Botschaft bestätigt sahen. Oder die in jedem Gedankenlabyrinth, das sie kreierte, Hass und Wut ausmachten.
Niemand ist wirklich harmlos, sagte sie sich. Heute nicht mehr.
An den Wochenenden fuhr sie mit ihrer halbautomatischen Pistole in einen Mangrovensumpf nicht weit von dem etwas heruntergekommenen einstöckigen Dreizimmerhaus aus Schlackenstein, das sie schon den größten Teil ihres Lebens mit ihrer Mutter teilte, und wurde zur geübten Schützin.
Beim Anblick der persönlich eingeworfenen Nachricht spürte sie, wie sich ihr Magen unangenehm zusammenzog. Sie öffnete die Schreibtischschublade und entnahm die kurzläufige Magnum, Kaliber.357, der Schatulle, um sie neben ihrem Monitor auf den Tisch zu legen. Sie gehörte zu dem halben Dutzend Waffen, das sie besaß, darunter auch ein geladenes, vollautomatisches Sturmgewehr, das an der Rückwand ihres Kleiderschranks am Haken hing.
»Es gefällt mir nicht«, erklärte sie laut, »dass du weißt, wer ich bin und wo ich wohne. Das verstößt gegen die Regeln.«
Als sie einsehen musste, dass sie nicht vorsichtig genug gewesen war, verzog sie das Gesicht und nahm sich vor, herauszufinden, wo die undichte Stelle war – welche Sekretärin oder Redaktionsassistentin ihre Anschrift verraten hatte –, und alles zu tun, um sie zu stopfen. Die Geheimhaltung war ihr heilig; das verlangte nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihr Leben. Sie sah sich den Wortlaut der Nachricht an. Auch wenn sie mit einiger Sicherheit sagen konnte, dass sich kein Zahlencode dahinter verbarg, stellte sie rasch ein paar Rechnungen an, verknüpfte die Buchstaben mit ihrem Stellenwert im Alphabet, addierte und subtrahierte, ging Variationen durch, um zu sehen, ob die Notiz einen Sinn ergab. Das Ganze erwies sich als fruchtlos. Egal, was sie versuchte, es kam nur Kauderwelsch heraus.
Sie fuhr den Computer hoch und schob eine Diskette mit berühmten Zitaten ein, ohne jedoch etwas auch nur annähernd Ähnliches zu finden.
Sie brauchte ein Glas Wasser und stand auf, um in die kleine Küche zu gehen. Neben dem Spülstein trocknete ein sauberes Glas. Sie füllte es mit Eis und Leitungswasser, das einen salzigen Beigeschmack hatte. Sie rümpfte die Nase und sagte sich, dass dies zu den kleinen Unannehmlichkeiten gehörte, die man in Kauf nehmen musste, um in den Upper Keys zu wohnen. Der größere Nachteil bestand darin, dass man isoliert und einsam lebte. Sie blieb im Türrahmen stehen, starrte auf das Blatt Papier am anderen Ende des Zimmers und fragte sich, wieso sie diesem kleinen Zettel erlaubte, ihr den Schlaf zu rauben. Sie hörte, wie ihre Mutter stöhnte und sich im Bett herumwälzte, und wusste schon, bevor sie rief: »Susan? Bist du da?«, dass sie aufgewacht war.
»Ja, komme schon«, antwortete sie.
Sie eilte ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Früher war es bunt gewesen; ihre Mutter hatte gern gemalt und über die Jahre hinweg viele ihrer Bilder an den Wänden aufgehängt. Gemälde und exotische, fließende Kleider sowie Tücher, die wahllos über der Staffelei und anderen Gegenständen ausgebreitet waren – das hatte dem Zimmer Farbe gegeben. Jetzt war alles Tabletts mit Medikamenten und einem Sauerstoffgerät gewichen – in Schränke verbannt, um den Zeichen der Gebrechlichkeit zu weichen.
Das Zimmer, fand Susan, roch nicht einmal mehr nach ihrer Mutter, sondern einfach nur antiseptisch. Hygienisch rein. Ein sauberer, weiß getünchter, desinfizierter Ort zum Sterben.
»Schmerzen?«, fragte die Tochter. Es war immer dieselbe Frage, und sie kannte die Antwort und wusste, dass sie nicht der Wahrheit entsprach.
Ihre Mutter setzte sich mühsam auf. »Nur ein bisschen. Nicht schlimm.«
»Willst du eine Tablette?«
»Nein, das wird schon. Ich habe gerade an deinen Bruder gedacht.«
»Soll ich ihn für dich anrufen?«
»Nein, dann macht er sich nur Sorgen. Er ist bestimmt viel zu eingespannt und braucht seine Ruhe.«
»Das glaube ich nicht. Ich denke, er würde gern mit dir reden.«
»Na ja, morgen vielleicht. Ich habe von ihm geträumt. Von dir auch, Schatz. Ich habe von meinen Kindern geträumt. Lassen wir ihn schlafen. Wieso bist du noch auf?«
»Ich habe noch gearbeitet.«
»Hast du die nächsten Rätsel entworfen? Was ist es diesmal? Zitate? Anagramme? Welche Stichworte willst du geben?«
»Nein, keins von meinen eigenen. Ich hab über etwas gebrütet, das mir jemand geschickt hat.«
»Du hast so viele Fans.«
»Die lieben nicht mich, Mutter. Es sind die Rätsel.«
»Das ist egal. Du solltest ruhig mehr Ruhm einstreichen. Du solltest dich nicht verstecken müssen.«
»Es gibt jede Menge Gründe, ein Pseudonym zu benutzen, Mutter. Das weißt du doch am besten.«
Die ältere Frau lehnte sich zurück. Sie war nicht wirklich alt, sondern nur von der Krankheit gezeichnet. Ihre Haut war erschlafft und bildete Falten an ihrem Hals, ihr Haar breitete sich zerzaust über das Kissen aus. Es war immer noch kastanienbraun; ihre Tochter half ihr dabei, es einmal pro Woche zu tönen – ein Ritual, auf das sie sich beide freuten. Viel Eitelkeit war der Älteren nicht geblieben; das meiste war dem Krebs zum Opfer gefallen. Doch das Tönen ihrer Haare gab sie nicht auf, und ihre Tochter war darüber froh.
»Mir gefällt der Name, den du dir ausgesucht hast. Er ist sexy.«
Die Tochter lachte. »Bedeutend mehr als ich.«
»Mata Hari. Die Spionin.«
»Sicher, aber nicht die beste, wie du weißt. Man hat sie erwischt und erschossen.«
Ihre Mutter gluckste, und die Tochter lächelte bei dem Gedanken, dass die Krankheit sich vielleicht nicht ganz so schnell ausbreiten würde, wenn sie ihre Mutter nur öfter zum Lachen brachte.
Die Ältere wendete den Blick nach oben, als entdeckte sie an der Zimmerdecke eine Erinnerung.
»Ich kenne eine Geschichte«, erzählte sie lebhaft. »Ich habe sie in einem Buch gelesen, als ich noch ziemlich jung war – Mata Hari soll sich, kurz bevor der französische Offizier dem Exekutionskommando den Schießbefehl erteilt hat, die Bluse aufgerissen haben, um ihre Brüste zu entblößen, als wollte sie den Soldaten sagen: Wagt es ja nicht, etwas so Schönes zu zerstören …«
Die Mutter schloss für einen Moment die Augen, als koste es sie Kraft, sich diese Anekdote ins Gedächtnis zu rufen; die Tochter setzte sich auf den Bettrand und nahm ihre Hand.
»Aber sie haben trotzdem geschossen. Wie traurig. Männer eben.«
Die beiden Frauen grinsten einen Moment.
»Es ist nur ein Name, Mutter. Und für jemanden, der sich Rätsel für Zeitschriften ausdenkt, passt er ziemlich gut.«
Die Mutter nickte. »Ich denke, ich nehme eine Tablette«, meinte sie. »Und morgen rufen wir deinen Bruder an. Er soll uns was über Mörder erzählen. Vielleicht kann er uns sagen, weshalb die französischen Soldaten dem Schießbefehl gehorchten. Bestimmt hat er eine Theorie. Wäre doch nett.« Sie lachte trocken.
»Ja, das wäre schön.« Die Tochter griff nach dem Tablett und öffnete ein Pillenfläschchen.
»Vielleicht doch lieber zwei«, überlegte die Mutter.
Die Tochter zögerte, dann schüttete sie sich die beiden Tabletten in die Hand. Die Mutter öffnete den Mund, und die Tochter legte ihr die Dragees auf die Zunge. Dann richtete sie ihre Mutter auf und hielt ihr den eigenen Becher Wasser an die Lippen.
»Schmeckt grässlich«, seufzte die Mutter. »Weißt du, dass wir, als ich klein war, das Wasser aus den Bergquellen der Adirondacks trinken konnten? Du stehst mit den Füßen im Bach und musst dich nur bücken, um es mit den Händen aufzufangen – das klarste, kühlste Wasser, das du dir denken kannst. Es war weich und schwer, als ob du etwas isst, wenn du es schluckst. Wunderbar rein und sehr kalt.«
»Ja, ich weiß – das hast du mir schon oft erzählt«, erwiderte die Tochter nachsichtig. »Das ist nicht mehr so. Nichts ist mehr so. Und jetzt versuch, ein bisschen zu schlafen. Du brauchst deinen Schlaf.«
»Hier ist alles so heiß. Es ist immer so heiß. Weißt du, manchmal kann ich nicht sagen, ob sich nur mein Körper so heiß anfühlt oder auch die Luft ringsum.«
Sie legte eine Pause ein, bevor sie sagte: »Nur noch ein einziges Mal, weißt du, nur noch einmal möchte ich dieses Wasser auf der Zunge spüren.«
Die Tochter legte den Kopf ihrer Mutter langsam auf das Kissen und wartete, bis ihre Lider schwer wurden und sich schlossen. Sie schaltete die Nachttischlampe aus und kehrte in ihr eigenes Zimmer zurück. Sie sah sich um und wünschte sich, irgendetwas zu entdecken, das nicht nur zweckmäßig und gewöhnlich war oder so herzlos wie die Pistole auf ihrem Computertisch. Irgendetwas, das verriet, wer sie war oder sein wollte.
Doch sie fand nichts. Stattdessen starrte ihr das Blatt entgegen.
DIEERSTEPERSONBESITZTDAS,
WASDIEZWEITEPERSONVERSTECKTHAT.
Du bist einfach nur müde, dachte sie. Du hast hart gearbeitet, und für diese Zeit, für diese fortgeschrittene Hurrikansaison, ist es zu heiß. Viel zu heiß. Dabei wirbelten über den Atlantik immer noch mächtige Stürme, die von der Küste Afrikas ausgingen, aus dem Ozean Kräfte saugten, um in der Karibik oder – schlimmer noch – in Florida zu landen. Sie grübelte. Vielleicht wird einer über uns hinwegfegen. Spätsaisonstürme. Tückische Stürme. Die alteingesessenen Bewohner der Keys behaupten, das wären die schlimmsten, aber eigentlich macht es keinen Unterschied. Sturm ist Sturm. Wieder starrte sie auf die Botschaft und redete sich trotzig ein: Eine anonyme Botschaft ist kein Grund zur Besorgnis, nicht einmal eine so kryptische wie diese.
Eine Weile bemühte sie sich, ihrer Lüge zu glauben, dann setzte sie sich wieder an den Schreibtisch und griff nach einem Block Papier.
»Die erste Person …«
Das könnte Adam sein. Vielleicht ist es biblisch.
Sie fing an, in größeren Zusammenhängen zu denken.
Die erste Familie – nun ja, das wäre der Präsident, allerdings wusste sie nicht, wie das funktionieren sollte. Dann kam ihr die berühmte Lobrede auf George Washington in den Sinn – »Erster im Krieg, Erster im Frieden …« –, und sie arbeitete eine Weile in dieser Richtung weiter, was sich aber schnell als frustrierend erwies. Sie hatte keinen George in ihrem Bekanntenkreis. Auch keinen Washington.
Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und wünschte sich, die Klimaanlage würde funktionieren. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass sie ihr Können in Sachen Rätseln vor allem ihrer Geduld verdankte und Erfolg haben würde, wenn sie nur einfach methodisch heranging. Also tauchte sie die Finger ins Eiswasser, rieb sich die Nässe über Stirn und Hals und machte sich bewusst, dass kein Mensch ihr eine verschlüsselte Nachricht schickte, wenn er nicht wollte, dass sie die Botschaft auch entwirrte. Sonst würde er sie gar nicht erst schicken.
Es kam immer wieder vor, dass einer der regelmäßigen Leser ihrer Rätsel ihr eine Nachricht schickte, wenn auch stets an ihr Pseudonym, ihre Büroadresse. Außerdem gaben diese ausnahmslos ihre eigene Adresse an – oft wiederum verschlüsselt –, da es diesen Leuten meistens viel mehr darum ging, ihr zu zeigen, wie brillant sie waren, als um die Chance, sie persönlich zu treffen. Über die Jahre hatte es tatsächlich ein paar Fälle gegeben, bei denen sie hatte passen müssen, doch solchen Niederlagen folgten jedes Mal Erfolge.
Sie starrte wieder auf die Worte.
Sie erinnerte sich an etwas, das sie einmal gelesen hatte, ein Sprichwort, eine Art Weisheit, die von Familiengeneration zu Familiengeneration weitergegeben wurde. Wenn du wegrennst und du hörst Hufschläge hinter dir, dann gehe besser davon aus, dass es ein Pferd und kein Zebra ist.
Kein Zebra.
Mach’s nicht kompliziert, schärfte sie sich ein. Such nach der einfachen Antwort.
Also gut. Die erste Person. Die erste Person Singular.
Demnach Ich.
»Die erste Person besitzt …«
Erste Person plus besitzanzeigendes Verb?
Ich habe …
Sie beugte sich über ihren Block und nickte. »Wer sagt’s denn«, murmelte sie leise.
»… was die zweite Person versteckt hat.«
Die zweite Person wäre dann du. Oder dir … dich.
Sie schrieb: Ich habe dich. Sie nahm sich das Wort »versteckt« vor.
Einen Moment lang dachte sie, es läge an der Hitze, dass sie sich schwindelig fühlte, und sie atmete einmal tief durch, während sie nach dem Glas Wasser griff.
Das Gegenteil von verstecken wäre finden.
Sie betrachtete ihre Notiz und sagte laut:
»Ich habe dich gefunden …«
Die Motte an der Scheibe ließ endlich von ihren verzweifelten Selbstmordversuchen ab und taumelte auf die Fensterbank, wo sie kurz vor ihrem Tod noch einmal zuckte.
Sie war allein. Eine nie da gewesene, plötzliche Woge der Angst brandete in die überhitzte Stille, und sie schnappte nach Luft.
1. Kapitel
Professor Tod
Seine dreizehnte Vorlesung in diesem Semester ging dem Ende entgegen, und er war nicht sicher, ob irgendjemand seinen Ausführungen folgte. Er blickte zu der Wand, in der sich früher einmal ein Fenster befunden hatte, doch heutzutage war es vernagelt und übertüncht. Er fragte sich für einen Moment, ob draußen ein klarer Himmel auf ihn wartete. Wohl eher nicht. Jenseits der grünen Wände des Hörsaals vermutete er eine grau verhangene Welt. Er wandte sich wieder seinem Kolleg zu.
»Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wie Menschenfleisch schmeckt?«, fragte er unvermittelt.
Jeffrey Clayton, ein junger Mann, der sich betont unmodisch gab, so dass er anonym und farblos wirkte, dozierte über den eigentümlichen Hang eines bestimmten Typs von Serienkiller zum Kannibalismus, als er aus dem Augenwinkel heraus das stumme Alarmsignal unter seinem Pult rot aufblinken sah. Er unterdrückte den Anflug von Angst, der ihm in die Kehle stieg, und schaffte es, seine Ausführungen nur kurz zu unterbrechen, während er sich von der Mitte des kleinen Podests hinter sein Pult begab. Langsam glitt er auf seinen Stuhl.
»Und es ist kaum zu übersehen« – er tat, als blätterte er in seinen Notizen –, »dass der Drang, das Opfer zu verschlingen, seine Vorläufer in primitiven Kulturen hat, wo der Glaube herrscht, dass man sich die Stärke oder Tapferkeit eines Feindes einverleibt, indem man zum Beispiel sein Herz isst, oder seine Intelligenz durch den Verzehr seines Hirns. Etwas auffällig Ähnliches findet man bei dem Mörder, der eine Obsession für die Eigenschaften seines Opfers entwickelt. Er sehnt sich danach, mit der Zielperson eins zu werden …«
Während er sprach, glitt seine Hand behutsam unter den Tisch. Misstrauisch ließ er den Blick über die Reihen der etwa hundert Studenten schweifen, die im schwach erleuchteten Hörsaal vor ihm unruhig auf ihren Stühlen saßen. So wie ein Kapitän allein auf hoher See den dunklen Ozean nach einer vertrauten Boje absucht, starrte er in die verschatteten Gesichter.
Doch er entdeckte nichts als den üblichen Nebelschleier: Langeweile, Geistesabwesenheit, den einen oder anderen Anflug von Interesse. Er suchte nach Hass. Nach Wut.
Wo bist du?, fragte er stumm. Wer von euch will mich töten?
Nach dem Warum fragte er nicht. Das Wieso und Warum war nach so vielen Toten nicht mehr wichtig und trat hinter der Häufigkeit und Alltäglichkeit zurück.
Das rote Licht unter seinem Pult blinkte weiter. Mit dem Zeigefinger drückte er ein halbes Dutzend Mal die Notsignaltaste. Sie würde bei der Campus-Polizei einen Alarm auslösen, die dann automatisch ein Sondereinsatzkommando schickte. Allerdings nur, wenn das System funktionstüchtig war, was er durchaus bezweifelte. In der Herrentoilette hatte am Morgen keine der Toiletten funktioniert, und er hielt es für unwahrscheinlich, dass die Universität eine komplizierte elektronische Verbindung instand halten konnte, wenn schon die sanitären Anlagen sie überforderten.
Er redete sich gut zu: Du schaffst das schon. Wäre ja nicht das erste Mal.
Er ließ weiter den Blick über den Hörsaal schweifen. Er wusste, dass der eingebaute Metalldetektor, der den Hintereingang zum Hörsaal erfasste, zu Funktionsstörungen neigte, andererseits vergaß er nicht, dass in diesem Semester ein Kollege dieselbe Warnung missachtet hatte und von zwei Schüssen in die Brust getroffen worden war. Der Mann hatte etwas von den schriftlichen Hausaufgaben für den kommenden Tag gemurmelt, während er auf dem Flur verblutete und ein geistesgestörter Studienabsolvent dem sterbenden Lehrer Obszönitäten ins Gesicht brüllte. Eine Fünf in einer Zwischenprüfung war offensichtlich der Grund für den Gewaltausbruch gewesen – eine Erklärung, die nicht mehr oder weniger plausibel erschien als irgendeine sonst.
Clayton gab, um eine solche Konfrontation zu vermeiden, grundsätzlich keine Noten, die schlechter waren als Drei. Zu sterben, weil man einen Studenten im zweiten Jahr hatte durchfallen lassen – das war es nicht wert. Studenten, die er eindeutig am Rand einer mörderischen Psychose diagnostizierte, bekamen bei ihm automatisch eine Drei plus oder Zwei minus für ihre Arbeiten – ob sie nun welche einreichten oder nicht. Dem Sekretariat des Psychologischen Instituts war bekannt, dass jeder Student, dem Professor Clayton eine von diesen Noten gab, als Bedrohung einzustufen war, und so meldeten sie grundsätzlich jeden solchen Fall dem Campus-Wachdienst.
Im letzten Semester kam er auf drei, alle in seinem Einführungskurs über Verhaltensstörungen. Die Studenten hatten den Kurs in »Mordsspaß« umgetauft, was vielleicht nicht ganz die Stimmung traf, aber doch einigermaßen das Thema.
»… mit dem Opfer eins zu werden, ist letztlich Ziel und Zweck des Mordes. Dabei ist eine seltsame Mischung aus Hass und Begierde im Spiel. Oft wünschen sie sich, was sie hassen, und hassen, was sie sich wünschen. Außerdem geht es um Neugier und Faszination. Eine explosive Mischung aus widerstreitenden Gefühlen. Dies wiederum führt zu Perversion und zu Mord als Ventil …«
Machst du das gerade durch?, fragte er die unsichtbare Quelle der Bedrohung.
Unter dem Tisch packte er mit der Hand den Griff der halbautomatischen Pistole, die er dort in einer Vorrichtung untergebracht hatte. Er legte den Zeigefinger an den Abzug und löste zugleich mit dem Daumen die Sicherung. Für einen Moment wurde er wütend. Der Antrag auf Haushaltsmittel zur Anschaffung von kugelsicheren Westen war beim Senat nicht durchgegangen, und der Rektor, der sich auf Kürzungen berief, hatte es eben erst abgelehnt, Gelder zu bewilligen, um in Hörsälen und Übungsräumen die Überwachungskameras zu modernisieren. Allerdings sollte in diesem Herbst das Footballteam neue Trikots bekommen, und der Trainer der Basketballmannschaft durfte sich schon wieder zu einer Gehaltserhöhung beglückwünschen – nur der Lehrkörper wurde wie immer ignoriert.
Das Pult bestand aus Panzerstahl, und das Dezernat für Bau- und Haustechnik hatte ihm versichert, es sei allem gewachsen außer durchschlagskräftiger, Teflonummantelter Munition. Natürlich wusste er so gut wie jedes andere Fakultätsmitglied, dass solche Kugeln in jedem x-beliebigen Sportgeschäft in Gehweite der Universität zu bekommen waren. Auch Sprengladungen und Dumdumgeschosse, solange man bereit war, die gepfefferten Preise im Umfeld des Campus zu zahlen.
Jeffrey Clayton war noch ein gutes Stück von der Lebensmitte, dem Schmerbauch, den wässrigen, desillusionierten Augen und dem nervösen, ängstlichen Tonfall entfernt – alles Dinge, die seine älteren Kollegen kennzeichneten. Seine Erwartungen an das Leben – von Anfang an höchst bescheiden – welkten erst seit kurzem dahin wie eine Pflanze, die man in eine dunkle Ecke gestellt hat. Mit drahtigen Muskeln in Armen und Beinen war er immer noch flink wie ein Wiesel, und seine wachen Augen – das rechte Auge litt gelegentlich unter einem nervösen Zucken – lagen hinter der altmodischen, randlosen Brille versteckt. Er hatte den Gang eines Athleten und die Körperhaltung eines Läufers – was er seit seinen Highschool-tagen auch war. In der Fakultät schätzte man seinen süffisanten Humor; ein Gegengift, behauptete er, gegen sein unermüdliches Studium der Kausalzusammenhänge von Gewalt.
Ducke ich mich nach links, dachte er, habe ich die richtige Schussstellung und bin durch das Pult abgeschirmt. Zwar wäre der Winkel falsch, um das Feuer zu erwidern, aber unmöglich wäre es nicht.
Er zwang sich zu einer stetigen, sonoren Vortragsweise. »In der Anthropologie gibt es eine Theorie, die besagt, dass diverse primitive Kulturen nicht nur vermehrt Menschen hervorgebracht haben, die sich in der heutigen Gesellschaft wahrscheinlich zu Serienmördern entwickelt hätten, sondern dass man diese Männer sogar verehrt und ihnen eine herausragende Stellung eingeräumt habe.«
Er ließ den Blick fortgesetzt über die Zuhörer wandern. In der vierten Reihe saß rechts eine junge Frau, die sich nervös auf ihrem Platz wand. Ihre Hände zuckten auf dem Schoß. Amphetaminentzug?, spekulierte er. Kokainabhängige Psychose? Seine Augen schweiften weiter und blieben an einem hoch gewachsenen jungen Mann genau in der Mitte hängen, der trotz des schummrigen Lichts, das die gelben Neonlampen an der Decke über den Hörsaal warfen, eine Sonnenbrille trug. Der Junge saß mit angespannten Muskeln reglos da, als hätte ihn die Paranoia wie mit Stricken an den Stuhl gefesselt. Er hatte die Hände vor sich auf dem Tisch geballt. Aber leer, wie Jeffrey Clayton augenblicklich sah. Leere Hände. Finde die Hände, die eine Waffe verstecken.
Er hörte seinem eigenen Vortrag zu, als käme seine Stimme von einem Geist, der über seinem Körper schwebte: »Es ist durchaus anzunehmen, dass etwa der Aztekenpriester, der die Aufgabe hatte, seinem Menschenopfer das Herz lebendig herauszureißen, na ja, dass er seinen Beruf genoss. Gesellschaftlich akzeptierter und geachteter Serienmord. Höchst wahrscheinlich ging der Mann jeden Morgen glücklich und zufrieden zur Arbeit – gab seiner Frau ein Küsschen auf die Wange, zauste den Kleinen die Haare, nahm seine Aktentasche, klemmte sich für die U-Bahn-Fahrt das Wall Street Journal unter den Arm und freute sich auf einen anregenden Tag am Opferaltar …«
Er erntete verhaltenes Kichern, das er dazu nutzte, einen Ladestreifen in die Pistole einzulegen, ohne dass das metallische Klicken zu hören war.
In der Ferne läutete eine Glocke das Ende der Vorlesungsstunde ein. Die rund hundert Studenten im Hörsaal wurden unruhig und fingen an, ihre Jacken und Rucksäcke einzusammeln.
Das ist der gefährlichste Moment, dachte er.
Ans Auditorium gewandt, sagte er laut: »Nächste Woche schreiben wir eine Klausur. Bis dahin sollten Sie alle die Protokolle von Charles Mansons Gefängnisverhören gelesen haben. Sie finden Kopien im Handapparat in der Bibliothek. Sie kommen auf jeden Fall in der Klausur vor …«
Die Studenten standen auf, und er hatte unter dem Tisch die Pistole fest im Griff. Ein paar der jungen Leute wollten zu ihm nach vorne kommen, doch er winkte sie mit der freien Hand zurück.
»Die Sprechstundenzeiten hängen draußen aus. Jetzt habe ich keine Zeit …«
Er sah, wie ein Mädchen zögerte. Neben ihr stand ein junger Mann. Die Arme eines Gewichthebers, das Gesicht von Akne entstellt, wahrscheinlich durch Steroidmissbrauch. Der Professor fragte sich, ob dieselbe stumpfe Schere, mit der der Student die chirurgischen Eingriffe an seinem Sweatshirt vorgenommen hatte, auch für seine Frisur verantwortlich war. Normalerweise hätte er danach gefragt. Die beiden kamen nach vorne.
»Benutzen Sie den hinteren Ausgang«, wies Clayton sie laut an. Wieder wedelte er mit der Hand. Das Paar zögerte.
»Ich möchte mit Ihnen über mein Examen reden«, erklärte das Mädchen schmollend.
»Dann machen Sie einen Termin mit der Universitätssekretärin. Ich sehe Sie in meinem Büro.«
»Es dauert nicht lang«, versuchte sie, ihn zu beschwatzen.
»Nein«, erwiderte er. »Tut mir leid.« Er sah an ihr vorbei, dann wieder abwechselnd zu ihr und dem Jungen, jederzeit darauf gefasst, dass sich jemand durch das Gewühl der Studenten drängen könnte – eine Waffe in der Hand.
»Ach kommen Sie, Prof, geben Sie ihr doch ’ne Minute«, quengelte der Freund. Das aufdringliche Beharren passte ebenso gut zu ihm wie das Grinsen, das dank des Eisen-Piercings in der Oberlippe schief geriet. »Sie möchte jetzt mit Ihnen reden.«
»Ich bin beschäftigt«, antwortete Clayton.
Der Junge kam näher. »Ich glaube nicht, dass Sie so scheißbeschäftigt sind, dass …«
Doch seine Freundin legte ihm eine Hand auf den Arm, mehr war nicht nötig, um ihn im Zaum zu halten.
»Ich kann noch einmal wiederkommen«, lenkte sie ein. Sie schenkte Clayton ein kokettes Lächeln und entblößte dabei verfärbte Zähne. »Schon in Ordnung. Ich brauche eine gute Note, und ich kann gerne in Ihr Büro kommen.« Sie verstummte und strich sich mit der Hand durchs Haar, das auf der einen Seite ihrer Schädeldecke kurzgeschoren war, während es ihr auf der anderen in üppigen Locken auf die Schulter fiel. »Unter vier Augen«, fügte sie hinzu.
Der junge Mann wirbelte herum und fragte sie, mit dem Rücken zum Professor: »Was soll das heißen?«
»Nichts«, gab sie immer noch lächelnd zurück. »Ich mach einen Termin.«
Dieses letzte Wort betonte sie verheißungsvoll, wobei sie Clayton anstrahlte und dabei vielsagend die Brauen hochzog. Dann schnappte sie sich ihren Rucksack und machte kehrt. Der Gewichtheber knurrte nur kurz in seine Richtung, dann folgte er eilig der jungen Frau.
Clayton hörte verebbend ein Drängen: »Was zum Teufel sollte der Scheiß?«, während das Paar die Treppe zum hinteren Teil des Hörsaals hochstieg, bevor es dort im Dunkeln verschwand.
Mehr Licht, dachte er. In den hinteren Reihen gehen ständig die Glühbirnen kaputt, ohne ersetzt zu werden. Dabei sollte jeder Winkel ausgeleuchtet sein. Er spähte in den Schatten in der Nähe des Ausgangs und fragte sich, ob sich dort jemand versteckt hatte. Er ließ den Blick über die nunmehr leeren Stuhlreihen schweifen und versuchte, auszumachen, ob dort jemand im Hinterhalt lag.
Der stumme Alarm blinkte immer noch rot. Er hätte gern gewusst, wo das SWAT-Team blieb, bevor ihm klar wurde, dass es nicht kommen würde.
Er hämmerte sich ein: Ich bin allein.
Und merkte im nächsten Moment, dass das so nicht stimmte.
Die Gestalt rekelte sich lässig auf einem Stuhl ganz weit hinten am Rand der Dunkelheit und wartete. Er konnte die Augen nicht erkennen, doch er sah, dass der Mann, obwohl er sich klein zu machen schien, groß und kräftig war.
Clayton hob die Pistole und richtete sie auf die Gestalt. »Ich bringe Sie um«, drohte er in strengem, ausdruckslosem Ton.
Zur Antwort kam ein Lachen aus dem Schatten.
»Ich werde nicht zögern, Sie zu töten.«
Das Lachen verebbte, und eine Stimme sagte: »Professor Clayton, Sie erstaunen mich. Begrüßen Sie Ihre Studenten immer mit der Waffe in der Hand?«
»Wenn ich mich gezwungen sehe«, erwiderte Clayton.
Die Gestalt erhob sich von ihrem Sitz, und Clayton sah, dass die Stimme zu einem großen, nicht mehr ganz jungen Herrn in einem schlecht sitzenden Anzug mit Weste gehörte. Er hielt eine kleine Mappe in der Hand, die Clayton bemerkte, als der Mann in einer freundlichen Geste die Arme ausbreitete.
»Ich bin kein Student …«
»Offensichtlich.«
»… auch wenn ich die Sache über das Einswerden mit dem Opfer genossen habe. Stimmt das, Professor? Können Sie das belegen? Ich wäre neugierig, die Studien zu sehen, die eine solche Behauptung untermauern. Oder war das aus dem Bauch heraus?«
»Intuition«, erklärte Clayton, »gepaart mit Erfahrung. Es gibt keine aussagekräftigen klinischen Studien. Hat es noch nie gegeben, und ich bezweifle, dass es je welche geben wird.«
Der Mann lächelte. »Zweifellos haben Sie Ross und seine bahnbrechende Arbeit über Chromosomendefekte gelesen? Und wie sieht es mit Finch und Alexander und der Michigan-Studie über das genetische Profil von zwanghaften Mördern aus?«
»Sind mir vertraut«, erwiderte Clayton.
»Natürlich. Sie waren Ross’ Forschungsassistent. Der erste, den er eingestellt hat, nachdem die Fördermittel bewilligt worden waren. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die andere Studie eigentlich komplett von Ihnen stammt. Unter deren Namen veröffentlicht, aber Ihre Arbeit, richtig? Bevor Sie Ihren Doktor gemacht haben.«
»Sie sind gut informiert.«
Der Mann kam langsam die Hörsaaltreppe herunter. Clayton zielte und hielt die Pistole mit beiden Händen. Er bemerkte, dass der Mann älter war als er selbst, wahrscheinlich Mitte bis Ende fünfzig, mit grau meliertem Haar, das er sehr kurz geschnitten trug. Trotz seines wuchtigen Körpers wirkte er agil, fast leichtfüßig. Clayton taxierte ihn, so wie er es mit einem Sportkonkurrenten tun würde: kein Langstreckenmann, aber ein ernst zu nehmender Sprinter, der gefährlich beschleunigen konnte.
»Langsamer bitte«, sagte Clayton. »Und halten Sie Ihre Hände so, dass ich sie sehen kann.«
»Ich versichere Ihnen, Professor, ich bin keine Bedrohung.«
»Da habe ich meine Zweifel. Sie haben beim Betreten des Hörsaals den Metalldetektor ausgelöst.«
»Ehrlich, Professor, ich bin nicht das Problem.«
»Auch das wage ich zu bezweifeln«, erwiderte Jeffrey Clayton in scharfem Ton. »Es gibt alle möglichen Bedrohungen und alle möglichen Probleme in dieser Welt, und ich habe das Gefühl, Sie verkörpern ein paar davon. Öffnen Sie Ihr Jackett. Ohne hektische Bewegungen, wenn ich bitten darf.«
Der Mann war auf etwa fünf Meter herangekommen und blieb stehen. »Seit meinem Studium hat sich an der Uni einiges geändert«, meinte er.
»Was Sie nicht sagen. Zeigen Sie mir Ihre Waffe.«
Der Mann enthüllte ein Schulterhalfter mit einer ähnlichen Pistole, wie sie Clayton in der Hand hielt.
»Darf ich Ihnen meinen Ausweis zeigen?«, fragte er.
»Gleich. Es gibt sicher noch eine Ersatzwaffe, nicht wahr? Am Fußgelenk vielleicht? Oder hinten in Ihrem Gürtel? Wo ist sie?«
Wieder lächelte der Mann. »Hinten im Gürtel.« Er hob langsam die Anzugjacke und drehte sich um, so dass eine zweite, kleinere Automatik in einem Halfter am unteren Rücken zum Vorschein kam. »Zufrieden?«, wollte er wissen. »Wirklich, Professor, ich bin in einer offiziellen Angelegenheit hier …«
»Offizielle Angelegenheit ist ein wunderbarer Euphemismus, der für alle möglichen gefährlichen Aktivitäten stehen kann. Und jetzt ziehen Sie langsam die Hosenbeine hoch.«
Der Mann seufzte. »Kommen Sie schon, Professor, erlauben Sie mir, mich auszuweisen.«
Clayton ruckte nur kurz mit dem Lauf seiner Pistole. Der Mann zuckte die Achseln und hob zuerst den Hosenaufschlag am linken, dann am rechten Bein. Am rechten kam ein drittes Halfter ans Licht, in dem ein Wurfmesser steckte.
»In meinem Fachgebiet kann man nicht vorsichtig genug sein.«
»Und um welches handelt es sich?«
»Nun, Professor, ich beschäftige mich mit demselben Thema wie Sie.«
Er legte eine Pause ein, so dass sich noch einmal ein Grinsen über seine Züge schieben konnte wie eine Wolke über den Mond.
»Mit dem Tod.«
Jeffrey Clayton deutete mit der Pistole auf einen Stuhl in der ersten Reihe. »Jetzt sehe ich mir gerne diesen Dienstausweis an«, sagte er.
Der Besucher steckte vorsichtig die Hand in die Jackentasche und zog ein Kunstledermäppchen heraus, das er dem Professor entgegenhielt.
»Werfen Sie es einfach hier hin, setzen Sie sich und verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf.«
Zum ersten Mal flackerte Verärgerung in den Augen des Mannes auf, doch ebenso schnell gelang es ihm, seine Gefühle unter demselben, gelassen spöttischen Lächeln zu verbergen. »Finden Sie das nicht ein wenig überzogen, Professor Clayton? Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient …« Der Mann ließ sich auf dem gewünschten Platz in der vordersten Reihe nieder, und Clayton beugte sich vor, um die Dienstmarke entgegenzunehmen, zielte dabei aber mit der Waffe weiter auf die Brust des Fremden.
»Überzogen?«, gab er zurück. »Verstehe. Ein Mann, der kein Student ist, dafür aber mindestens drei Waffen trägt, betritt meinen Hörsaal durch den Hintereingang, ohne einen Termin zu haben, ohne sich vorzustellen; er scheint die eine oder andere Kleinigkeit über mich zu wissen, versichert mir augenblicklich, er sei keine Bedrohung, und legt mir nahe, keine Vorsicht walten zu lassen? Haben Sie eigentlich die leiseste Ahnung, wie viele meiner Kollegen in diesem Semester angegriffen wurden? Wie viele Schusswechsel es gegeben hat, in die Studenten verwickelt waren? Und wissen Sie, dass wir der Amerikanischen Bürgerrechtsunion eine einstweilige Verfügung verdanken, in deren Konsequenz wir die psychologische Unbedenklichkeitsprüfung bei der Immatrikulation neuer Studenten einstellen mussten? Angeblich ein Eingriff in die Privatsphäre und so. Reizend, nicht wahr? Jetzt können wir die Verrückten nicht mehr aussieben, bevor sie bewaffnet bei uns auf der Matte stehen.« Zum ersten Mal lächelte Clayton. »Vorsicht«, erklärte er, »ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens.«
Der Mann im Anzug nickte. »Da, wo ich arbeite, haben wir keine Probleme damit.«
Immer noch mit einem Lächeln antwortete der Professor: »Ich schätze, das ist gelogen. Sonst wären Sie nicht hier.«
Clayton klappte den Ausweis auf und sah einen goldgeprägten Adler über den Worten: ABTEILUNGSTAATSSICHERHEIT. Der Adler wie die Aufschrift prangten über der unverwechselbaren, fast quadratischen Form des neuen Westlichen Territoriums. Darunter stand deutlich in roten Ziffern eine Einundfünfzig. Auf der anderen Seite fand sich der Name des Mannes, Robert Martin, mit Unterschrift sowie seinem Dienstgrad: Special Agent.
Dies war das erste Mal, dass Clayton ein Dokument des geplanten Einundfünfzigsten Bundesstaates zu sehen bekam. Er starrte eine Weile darauf, bevor er langsam sagte: »Mr. Martin, oder sollte ich Agent Martin sagen, falls das Ihr richtiger Name ist, Sie sind also bei der SS?«
Das Gesicht des Mannes verdüsterte sich. »Wir ziehen State Security, Staatssicherheit, vor, so viel Zeit muss ein. Die Abkürzung schätzen wir bekanntlich nicht, da sie hässliche historische Assoziationen weckt. Ich persönlich sehe das nicht so eng, aber andere sind da, sagen wir, sensibler. Im Übrigen ist der Ausweis ebenso wie der Name echt. Falls Sie es wünschen, können wir ein Telefon suchen, und ich gebe Ihnen eine Nummer, die Sie gerne anrufen können, um sich davon zu überzeugen. Wenn Ihnen dann wohler ist.«
»Ich wüsste nicht, wie ich mich mit irgendetwas, das den ›Einundfünfzigsten Bundesstaat‹ betrifft, wohl fühlen sollte. Wenn ich könnte, würde ich dagegen stimmen, das er eingeführt wird.«
»Glücklicherweise zählen Sie mit dieser Meinung zu einer klaren Minderheit. Und waren Sie überhaupt schon mal da, Professor? Haben Sie schon mal dieses Maß an Schutz und Sicherheit erlebt, das wir dort genießen? Nicht wenige sind der Überzeugung, dass er für das wahre Amerika steht. Ein Amerika, das in dieser modernen Welt verloren gegangen ist.«
»Und nicht wenige glauben, dass Sie alle verkappte Faschisten sind.«
Wieder grinste der Agent, und dieses selbstzufriedene Lächeln verbannte den Anflug von Ärger aus seinem Gesicht.
»Fällt Ihnen nichts Besseres als dieses abgegriffene Klischee ein?«, gab Agent Martin zurück.
Clayton antwortete nicht gleich. Er warf dem Agenten die Dienstmarke wieder zu. Ihm fiel das von Brandwunden vernarbte Hautgewebe an der Hand des Mannes ins Auge und die überaus kräftigen Finger. Er schätzte, dass die Faust des Agenten für sich allein schon eine schlagkräftige Waffe war, und fragte sich, ob er auch an anderen Körperteilen Narben trug. In dem schwachen Licht konnte er gerade noch eine rötliche Stelle an Martins Hals ausmachen, und er wurde neugierig auf die Geschichte, die sie erzählte; was auch immer passiert sein mochte, es hatte höchstwahrscheinlich eine beträchtliche Wut zurückgelassen, die im Kopf des Agenten widerhallte. Das gehörte in der Psychologie der Verhaltensstörungen zu den elementaren Lektionen. Clayton hatte über die Kausalität von Gewalt und körperlicher Deformation ausgiebig geforscht, und deshalb nahm er sich vor, diesen Aspekt Martins im Auge zu behalten.
Der Professor ließ ganz langsam die Waffe sinken, legte sie vor sich auf den Schreibtisch und schlug mit den Fingern auf dem Metall einen kurzen Trommelwirbel. »Egal, worum Sie mich bitten wollen, ich werde es nicht tun«, erklärte er nach kurzem Zögern. »Egal, was Sie von mir wollen, ich hab es nicht und kann es nicht. Es interessiert mich nicht, weshalb Sie hergekommen sind.«
Agent Martin bückte sich und griff nach der Ledermappe, die er zu seinen Füßen abgestellt hatte. Er warf sie aufs Podium, wo sie mit einem Klatschen zu Boden fiel, das durch den ganzen Hörsaal hallte. Sie rutschte mit einem ratschenden Geräusch bis zur Ecke von Claytons Pult. »Werfen Sie nur einen Blick darauf, Professor.«
Clayton wollte sich danach bücken, hielt jedoch inne. »Und wenn ich es nicht tue?«
Martin zuckte die Achseln, wobei jedoch dasselbe Grinsen einer Grinsekatze wie wenige Minuten zuvor seine Lippen umspielte. »Oh, das werden Sie, Professor. Das werden Sie. Es würde Ihre Willenskraft übersteigen, mir diese Tasche zurückzuschieben, ohne nachzusehen, was drin ist. Nein, das machen Sie nicht. Ihre Neugier ist längst geweckt, und sei es auch nur ein akademisches Interesse. Sie sitzen mir gegenüber und fragen sich, was mich wohl dazu bewogen hat, die heile Welt, in der ich lebe, zu verlassen und hier rauszukommen, wo so ziemlich alles passieren kann, nicht wahr?«
»Es interessiert mich nicht die Bohne, wozu Sie gekommen sind. Und ich werde Ihnen nicht helfen.«
Der Agent schwieg, und es sah nicht so aus, als dächte er über die Weigerung des Professors nach, sondern über eine andere Überzeugungsstrategie. »Sie haben mal Literatur studiert, wenn ich recht informiert bin?«
»Sie scheinen überaus gut informiert zu sein. Ja.«
»Langstreckenläufer und obskure Bücher. Sehr romantisch. Aber auch ziemlich einsam, oder?«
Clayton starrte den Agenten schweigend an.
»Professor und Einsiedler in einer Person, nicht wahr? Was mich betrifft, so hab ich schon immer mehr für Sport übrig gehabt. Ich war in der Hockeymannschaft. Ich ziehe es vor, mein Gewaltpotenzial zu kanalisieren, es in geordnete, gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken. Wie auch immer, erinnern Sie sich an die Szene am Anfang des großen Romans von Monsieur Camus, La Peste? Delikater Moment im Glutofen der nordafrikanischen Stadt, als der Arzt, der für die Gesellschaft immer nur Gutes getan hat, sich auf einmal umschaut und sieht, dass Ratten aus dem Schatten taumeln, um in der sengenden Hitze und dem gleißenden Licht zu sterben. Und der Mann erkennt, nicht wahr, Professor, dass etwas Schreckliches bevorsteht. Denn es ist ein unerhörter Vorgang, dass eine Ratte zum Sterben aus der Gosse und Kloake und dem Dunkel herausgekrochen kommt. Erinnern Sie sich an diese Szene, Professor?«
»Ja«, erwiderte Clayton. Als Student hatte er in einem Seminar über apokalyptische Literatur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts für seine Argumentation in der Abschlussklausur genau dieses Bild verwendet. Er wusste augenblicklich, dass der Agent, der vor ihm saß, diese Arbeit gelesen hatte, und ihn überkam dieselbe Panik wie in dem Moment, als er das rote Licht hatte aufleuchten sehen.
»Diese Situation ist irgendwie dieselbe, nicht wahr? Sie wissen, dass etwas Schreckliches zu Ihren Füßen liegen muss, denn weshalb sonst sollte ich meine eigene persönliche Sicherheit aufgeben, um zu Ihnen in den Hörsaal zu kommen, wo eines Tages nicht einmal mehr diese halbautomatische Pistole Ihnen angemessenen Schutz bieten kann?«
»Sie klingen nicht wie ein Polizist, Agent Martin.«
»Bin ich aber, Professor. Ein Polizist für unsere Zeit und unsere Verhältnisse.« Er deutete mit einer vagen Geste auf das Alarmsystem des Hörsaals. In den Ecken unter der Decke waren altmodische Videokameras installiert. »Die funktionieren nicht, oder? Sind offenbar mindestens zehn Jahre alt. Vielleicht auch älter.«
»Beides richtig.«
»Aber man lässt sie absichtlich da hängen, nicht wahr? Immerhin könnten sie bei jemandem einen Hauch von Bedenken auslösen, richtig?«
»Das ist vermutlich die Logik dahinter.«
»Ich finde das interessant«, meinte Martin. »Wer zweifelt, zögert vielleicht. Das würde Ihnen die Zeit verschaffen, die Sie brauchen, um … ja, was? Zu fliehen? Ihre Waffe zu ziehen und sich zu verteidigen?«
Clayton spielte mehrere Reaktionen gedanklich durch, verwarf sie aber alle. Stattdessen starrte er auf die Mappe am Boden. »Ich habe den Behörden schon bei mehreren Gelegenheiten geholfen. Es war immer eine ziemlich undankbare Sache.«
Der Agent unterdrückte ein leises Lachen. »Für Sie vielleicht. Die Polizei ihrerseits war Ihnen überaus dankbar. Sie werden wärmstens empfohlen. Sagen Sie, Professor, ist die Wunde an Ihrem Bein gut verheilt?«
Clayton nickte. »Das wissen Sie zweifellos selbst«, erwiderte er.
»Der Mann, der Sie Ihnen beigebracht hat – was ist aus dem geworden?«
»Ich vermute, die Antwort kennen Sie genauso gut wie ich.«
»Ja, in der Tat. Er sitzt im Todestrakt in Texas, nicht wahr?«
»Ja.«
»Alle Berufungsverfahren ausgeschöpft, richtig?«
»Ich denke ja.«
»Dann sollte er jeden Moment die Todesspritze bekommen, meinen Sie nicht?«
»Nein, das meine ich nicht.«
»Werden Sie eingeladen, Professor? Ich finde, bei der Soiree müssten Sie als Ehrengast zugegen sein. Ohne Ihre Arbeit hätte man ihn nicht geschnappt, ist doch so, oder? Wie viele Menschen hat er noch gleich umgebracht? Waren es sechzehn?«
»Nein, siebzehn. Prostituierte in Galveston. Und einen Polizisten.«
»Ah, richtig. Siebzehn. Sie hätten leicht der achtzehnte sein können, wären Sie nicht so fix gewesen. Mit einem Messer, oder?«
»Ja, er hat ein Messer benutzt. Viele verschiedene Messer. Zuerst ein großes italienisches Schnappmesser mit einer fünfzehn Zentimeter langen Klinge. Dann hat er zu einem Jagdmesser gewechselt, mit einer gezackten Schneide, gefolgt von einem Skalpell, und zuletzt wählte er ein altmodisches Rasiermesser. In ein, zwei Fällen hat er ein gewetztes Buttermesser verwendet, und das alles hat der Polizei reichlich Kopfzerbrechen bereitet. Aber ich glaube nicht, dass ich dieser Exekution beiwohnen will, nein.«
Der Agent nickte, als verstünde er etwas, das zwischen den Zeilen mitschwang. »Ich kenne Ihre sämtlichen Fälle, Professor«, sagte er kryptisch. »Viele waren es ja nicht, wie? Und jedes Mal haben Sie sich geziert. Das steht auch in Ihrer Akte beim FBI. Professor Clayton stellt sein Fachwissen nur ungern zur Verfügung, egal, wo das Problem liegt. Ich frage mich, was Sie ab und an dazu bewegt, diese ach so eleganten heiligen Hallen der ehrwürdigen Alma Mater zu verlassen, um in den Niederungen der realen Gesellschaft auszuhelfen? Wenn Sie sich tatsächlich einmal hergeben, ist es dann das Geld? Nein. Aus materiellen Dingen scheinen Sie sich nicht viel zu machen. Ruhm? Offenbar nicht. Dem gehen Sie offenbar aus dem Weg, untypisch für Ihren Berufsstand. Faszination? Vielleicht. Das leuchtet durchaus ein – na ja, und wenn Sie sich einmal herabbequemen, dann scheinen Sie einzigartig erfolgreich zu sein.«
»Ich habe ein-, zweimal Glück gehabt. Das ist alles. Meistens ist es nichts weiter als eine Mischung aus Sachkenntnis und Spekulation. Das wissen Sie.«
Der Agent holte tief Luft und senkte die Stimme. »Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel, Professor. Ich weiß alles über diese erfolgreichen Fälle. Und ich vermute, dass Sie besser sind als das andere halbe Dutzend Akademiker und Spezialisten, auf die sich die Behörden manchmal stützen. Ich weiß von dem Mann in Texas und wie er Ihnen in die Falle getappt ist, und von der Frau in Georgia, die in dem Altenheim gearbeitet hat. Ich weiß von den beiden Teenagern in Minnesota mit ihrem kleinen Mordclub und dem kleinen Streuner unten in Springfield, einen Steinwurf von hier. Miese kleine Stadt, aber was der Kerl dort gemacht hat, wirklich, das hatten die nicht verdient. Fünfzig, oder? Zu so vielen Geständnissen haben Sie ihn jedenfalls gebracht. Aber es waren mehr, oder, Professor?«
»Ja, es waren mehr. Bei fünfzig haben wir aufgehört zu zählen.«
»Kleine Jungs, nicht wahr? Fünfzig kleine, verwahrloste Bengel, die in der Umgebung des Jugendzentrums herumlungerten – die auf der Straße lebten und dann starben. Wer interessierte sich schon für die?«
»Sie haben recht«, stimmte Clayton ausdruckslos zu. »Niemand hat sich für sie interessiert. Weder vor ihrer Ermordung noch danach.«
»Ich weiß über den Mann Bescheid. Ehemaliger Sozialarbeiter, richtig?«
»Wieso fragen Sie, wenn Sie es wissen?«
»Eigentlich interessiert sich niemand dafür, wieso jemand ein Verbrechen begeht, oder, Professor? Das Einzige, was zählt, ist, wer und wie.«
»Seit man den Zusatzartikel zur Unentschuldbarkeit in die Verfassung aufgenommen hat – ja, da liegen Sie richtig. Aber als Polizist sollten Sie das alles ebenfalls wissen.«
»Und Sie sind der Professor mit dem antiquierten Interesse an der emotionalen Befindlichkeit von Kriminellen. Der veralteten, aber zuweilen auch notwendigen Psychologie des Verbrechens.«
Martin holte tief Luft.
»Der profilierteste Profiler«, sagte er. »Sollte ich Sie nicht so nennen?«
»Ich werde Ihnen nicht helfen«, beharrte Clayton.
»Der Mann, der mir die Frage nach dem Warum beantworten kann, stimmt’s, Professor?«
»Diesmal nicht.«
Der Agent lächelte wieder. »Ich weiß von jeder Narbe, die diese Fälle Ihnen beigebracht haben.«
»Das wage ich zu bezweifeln«, entgegnete Clayton.
»Doch, bestimmt.«
Clayton wies mit dem Kinn auf die Mappe. »Und das da?«
»Das da ist was Besonderes, Professor.«
Jeffrey Clayton stieß ein kurzes, sarkastisches Lachen aus, das durch den leeren Hörsaal hallte. »Was Besonderes! Jedes Mal, wenn jemand an mich herangetreten ist – und es ist immer wieder das Gleiche, wissen Sie! –, kam ein Mann in einem nicht eben teuren blauen oder braunen Anzug, mit einer Lederaktentasche und einem Verbrechen, das eine einmalige Expertise erforderte – jedes Mal sagt ihr alle genau das Gleiche. Ob der Anzug nun vom FBI oder dem Secret Service oder der örtlichen Polizei in einer Großstadt stammt oder meinetwegen auch aus irgendeinem entlegenen Revier, etwas Besonderes ist es allemal. Soll ich Ihnen was sagen, Agent Martin von der SS? Sie sind nichts Besonderes. Kein bisschen. Die Fälle sind einfach nur schrecklich, weiter nichts. Sie sind hässlich und abscheulich – sie haben immer mit dem Tod in seiner ekelhaftesten, widerwärtigsten Form zu tun. Geschundene und zerstückelte Menschen, vielleicht auch in immer wieder neuen, einfallsreichen Variationen ausgeweidet und zu Hackfleisch verarbeitet. Aber soll ich Ihnen sagen, was sie nicht sind? Etwas Besonderes. Nein, das sind sie nicht. Sie gleichen sich alle. Immer wieder dieselbe Geschichte, ein bisschen anders verpackt. Besonders? Nein. Kein bisschen. Eher gewöhnlich. Serienmord ist in unserer Gesellschaft so alltäglich wie eine schlichte Erkältung. So vertraut wie der tägliche Sonnenauf- und –untergang. Es ist eine Ablenkung. Ein Zeitvertreib. Eine Unterhaltung. Verdammt, wir sollten knappe Spielberichte im Sportteil der Tageszeitung einführen, direkt neben den Ranglisten. Kurz und gut, dieses Mal werde ich, egal wie ratlos und verwirrt Sie sein mögen, egal, wie sehr Sie die Sache frustriert, einfach passen.«
Der Agent stellte beide Beine auf den Boden. »Nein«, entgegnete er ruhig. »Nein, ich glaube nicht.«
Clayton beobachtete, wie Agent Martin sich langsam erhob. Zum ersten Mal sah er in die Augen des Mannes, die sich verengten und ihn mit einer schneidenden Härte, einer schmerzenden Intensität fixierten – wie ein Scharfschütze seine Zielperson in den Blick nimmt, in der Millionstel Sekunde, bevor er abdrückt. Martins Stimme hatte einen harten, klirrenden Ton angenommen, und er betonte jede Silbe einzeln:
»Behalten Sie die Aktentasche. Überprüfen Sie den Inhalt. Sie finden die Nummer eines hiesigen Hotels, unter der Sie mich erreichen können. Ich erwarte Ihren Anruf heute Abend.«
»Und wenn ich beim Nein bleibe? Wenn ich nicht anrufe?«
Der Agent starrte ihn weiter an. Er holte tief Luft, bevor er sagte: »Jeffrey Clayton. Professor für Psychologie des Abnormen, Universität Massachusetts. Berufung kurz nach der Jahrtausendwende. Lehrstuhl drei Jahre später durch Mehrheitsbeschluss. Keine Frau. Keine Kinder. Hin und wieder eine Freundin, die sich wünscht, Sie würden sich endlich entscheiden und eine Familie gründen, aber Sie denken gar nicht daran, was? Nicht, weil Sie schwul wären, sondern aus einem anderen Grund, stimmt’s? Vielleicht kommen wir bei Gelegenheit darauf zu sprechen. Was noch? Ach so, ja. Sie lieben Fahrradtouren in den Bergen und spielen manchmal in der Sporthalle bei einem Basketballmatch mit, außerdem joggen Sie jeden Tag Ihre sieben, acht Meilen. Bescheidene Ausbeute an akademischen Schriften. Sie sind Autor einer Reihe bemerkenswerter Studien zu gemeingefährlichem Verhalten, die relativ unbekannt geblieben sind, dafür aber haben Sie quer durchs Land bei Strafverfolgungsbehörden von sich reden gemacht, weil die nämlich Ihre profunden Kenntnisse bedeutend besser zu würdigen wissen als Ihre Kollegen an der Hochschule. Gelegentliche Vorträge in der Abteilung für Verhaltensforschung beim FBI in Quantico, bevor die dichtgemacht haben. Die verfluchten Kürzungen. Gastdozent im John Jay College für Strafrechtspflege in New York …«
Der Agent legte eine Atempause ein.
»Sie kennen demnach meinen Lebenslauf«, unterbrach ihn Clayton.
»In- und auswendig«, erwiderte der Agent schroff.
»Den hätten Sie auch von der PR-Abteilung der Universität bekommen können.«
Agent Martin nickte. »Eine Schwester, die in Islamorada, Florida, lebt, hat nie geheiratet, oder? Genau wie Sie. Ist das nicht eine verblüffende Übereinstimmung? Sie kümmert sich um Ihre Mutter. Pflegebedürftige Frau. Und sie arbeitet da unten bei einer Zeitschrift. Schreibt Rätsel. Einmal die Woche. Interessanter Job, muss ich sagen. Hat sie dasselbe Alkoholproblem wie Sie, oder ist es bei ihr eine andere Abhängigkeit?«
Clayton saß kerzengerade. »Ich habe kein Alkoholproblem, genauso wenig wie meine Schwester.«
»Nicht? Gut. Freut mich zu hören. Frage mich nur, wie dieses kleine Detail bei meinen Recherchen auftauchen konnte …«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Nein, vermutlich nicht.«
Der Polizist lachte wieder.
»Ich weiß alles über Sie«, erklärte er. »Und auch eine Menge über Ihre Familie. Sie sind ein Mann, der einiges vorzuweisen hat. Ein Mann, der in Sachen Mord berühmt-berüchtigt ist.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich meine, Sie wurden erfolgreich zu einer Reihe von Fällen hinzugezogen, aber Sie zeigten kein Interesse daran, aus diesen Erfolgen Profit zu schlagen. Sie haben mit den Spitzenleuten auf diesem Gebiet zusammengearbeitet, scheinen aber mit Ihrer Anonymität ganz zufrieden zu sein.«
»Das«, entgegnete Clayton schroff, »ist meine Sache.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Haben Sie gewusst, dass Ihre Studenten Sie hinter Ihrem Rücken Professor Tod nennen?«
»Ja, das ist mir zu Ohren gekommen.«
»Und, Professor Tod, wieso ziehen Sie es vor, sich weitgehend im Verborgenen hier an einer großen, schlecht ausgestatteten, teilweise altersschwachen staatlichen Uni abzurackern?«
»Auch das ist meine Angelegenheit. Mir gefällt es hier.«
»Aber jetzt ist es auch meine Angelegenheit, Professor.«
Clayton sagte nichts. Er strich mit den Fingern über den Stahl der Pistole auf dem Schreibtisch vor ihm.
Der Agent fuhr in unfreundlichem, fast heiserem Ton fort: »Sie werden die Aktentasche nehmen, Professor. Sie werden nachsehen, was drin ist. Dann werden Sie mich anrufen und mir helfen, mein Problem zu lösen.«
»Sind Sie da so sicher?«, fragte Clayton in einem Ton, der trotziger als beabsichtigt ausfiel.
»Ja«, erwiderte Agent Martin, »ja, ich bin mir sicher. Denn, Professor, ich kenne nicht nur Ihren Lebenslauf, diesen ganzen Quatsch für das Who’s who und all das, was die PR-Seiten Ihrer Uni füllt, sondern ich weiß noch etwas anderes, etwas Wichtigeres, etwas, das all diese anderen Behörden, Universitäten, Zeitungen, Studenten, Kollegen und weiß Gott wer noch alles eben nicht wissen. Ich habe sozusagen selbst noch mal die Unibank gedrückt, Professor. Fachbereich Töten. Und zufällig habe ich auch bei Ihnen studiert. Habe dabei ein paar interessante Entdeckungen gemacht.«
Clayton konnte nur mit Mühe das Zittern in seiner Stimme verbergen. »Was sollte das wohl sein?«, fragte er.
Agent Martin lächelte. »Sehen Sie, Professor, ich weiß, wer Sie wirklich sind.«
Clayton sagte nichts. Eine Eiseskälte durchfuhr seinen Körper.
Der Agent ging in Flüsterton über. »Hopewell, New Jersey. Wo Sie die ersten neun Jahre Ihres Lebens verbracht haben … bis Sie eines Nachts im Oktober, vor einem Vierteljahrhundert, weggegangen und nie zurückgekehrt sind. Da hat es alles angefangen, richtig, Professor?«
»Alles was?«, schoss Clayton zurück.
Der Agent nickte bedächtig, wie ein Kind auf dem Spielplatz, das mit einem Geheimnis prahlt.
Agent Martin schwieg und beobachtete, welche Wirkung seine Worte in Claytons Mimik auslösten, als rechnete er sowieso mit keiner Antwort auf seine Frage. Er ließ das Schweigen, das sich wie früher Morgennebel im Herbst über den leeren Raum zwischen ihnen legte, langsam sinken.
Dann nickte er erneut. »Ich freue mich auf Ihren Anruf heute Abend, Professor. Es gibt jede Menge Arbeit und wenig Zeit. Am besten fangen wir ganz schnell an.«
»Wollen Sie mir mit irgendetwas drohen, Agent Martin? Falls ja, drücken Sie sich lieber etwas deutlicher aus, denn ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das soll.« Clayton sprach hastig, viel zu hastig, um zu überzeugen, was ihm in dem Moment klar wurde, als ihm die Worte herausgeplatzt waren.
Der Agent schüttelte sich ein wenig wie ein Hund, der aus einem Nickerchen erwacht. »Oh doch«, erwiderte er gleichmütig, »oh doch, ich glaube, das wissen Sie genau.« Er zögerte nur für Sekunden. »Sie dachten, Sie könnten sich verstecken, nicht wahr?«
Clayton sagte nichts.
»Sie dachten, Sie könnten sich für immer verbergen?«
Der Agent deutete mit einer letzten Geste auf die Aktentasche, die neben dem Pult lag, dann machte er kehrt und stieg, ohne sich noch einmal umzusehen, forsch und energisch die Treppe hoch. Die Dunkelheit am hinteren Ende des Hörsaals schien ihn zu verschlucken. Als sich die Tür zu dem hell erleuchteten Korridor öffnete, trat noch einmal der breite Rücken des Polizisten in einer scharfen Silhouette hervor. Dann fiel die Tür mit einem dumpfen Schlag zu, und der Professor war endlich allein auf dem Podium.
Jeffrey Clayton saß, wie an seinen Stuhl geschweißt, reglos da.
Dann sah er sich einen Moment lang hektisch in alle Richtungen um und schnappte nach Luft. Er konnte es nicht ertragen, dass der Hörsaal keine Fenster hatte. Es war, als wäre die Luft im Raum zu dünn geworden. Aus dem Augenwinkel heraus sah er die rote Alarmleuchte unbeachtet weiter blinken.
Er legte die Hand an die Stirn und begriff. Alles aus. Mein Leben ist vorbei.
2. Kapitel
Ein Problem, das sich nicht von selbst löst
Er lief langsam über den Campus und hatte keinen Blick für die Studententrauben, die sich auf den Pfaden drängten, während ihn frostige Gedanken und schwarze Panik aus fremdartigen Schichten seines Bewusstseins verstörten.
Hinter dem kühlen Herbstnachmittag lauerte schon der Abend, und zwischen den nackten Zweigen der letzten Eichen, die über das Universitätsgelände verstreut waren, schlich sich bereits die Dunkelheit ein. Durch Jeffrey Claytons Wollmantel drang eine kurze, kalte Böe, und er zitterte. Er hob für einen Moment den Kopf und blickte nach Westen, wo der schmale Strich eines purpurroten Horizonts die fernen Hügel in Falten legte. Der Himmel selbst schien zu einem Dutzend verschiedener Schattierungen eines schwachen Graus zu verschwimmen, die alle mit Nachdruck erklärten, dass der Winter nahte. Wenn die glühenden Farben des Herbstes längst verblasst waren und der erste Schnee nicht mehr lange auf sich warten ließ – das war in seinen Augen die schlimmste Jahreszeit in New England. Wie ein lebensmüder alter Mann zog sich die Welt in ihr Schneckenhaus zurück. Die uralten, brüchigen Knochen, die bei jedem Schritt knirschten, taugten nur noch, um sich von einem Tag zum nächsten zu schleppen, während sich bereits der erste Frost des Todes meldete.
Etwa fünfzig Meter entfernt, vor der Kennedy Hall, einem der vielen trostlosen Zementgebäude, denen die alten efeubewachsenen Klinkerbauten gewichen waren, kam es zu einem Handgemenge, und wütende Stimmen wehten mit der kalten Brise herüber. Jeffrey kauerte sich hinter einen Baumstamm. Nicht sinnvoll, sich von einer verirrten Kugel erwischen zu lassen. Er horchte, konnte jedoch nicht herausfinden, worum sich die Auseinandersetzung drehte; er hörte nur einen Schwall von Obszönitäten, die wie tote Blätter in einem Sturm hin und her gewedelt wurden.
Er sah, wie zwei Campus-Polizisten auf den Kampf zueilten. Sie trugen Schutzkleidung am ganzen Körper, und ihre schweren, stahlverstärkten Stiefel klangen auf den geteerten Wegen wie Hufe. Hinter den undurchsichtigen Schutzvisieren ihrer Helme konnte er ihre Augen nicht sehen. Aus einer anderen Richtung näherten sich zwei weitere Beamte. Im Laufschritt lösten sie die Bewegungsmelder der Straßenlaternen aus, in deren gelbem Licht ihre gezückten Waffen glitzerten. Die Campus-Polizei patrouillierte grundsätzlich nur noch paarweise, seit im vergangenen Jahr Mitglieder einer Studentenverbindung einen Mann in ihre Gewalt gebracht hatten, der allein und undercover an einem Drogenfall gearbeitet hatte. Sie hatten ihn in einen Keller geschleppt, nackt ausgezogen und sich an seinem bewusstlosen Körper in erniedrigender Weise vergangen, um ihn schließlich in Brand zu stecken. Zu viel Alkohol, zu viele Drogen, ein wenig Kerosin und das völlige Fehlen eines Gewissens.
Der Mann starb, und das Haus der Studentenverbindung brannte nieder. Obwohl auf dem Campus fast jeder wusste, wer die Tat begangen hatte, kamen die drei verantwortlichen Studenten nie vor Gericht, da das meiste Beweismaterial in den Flammen aufgegangen war. Inzwischen war nur noch einer von ihnen am Leben. Einer war noch vor dem Abschlussexamen in einem der vielstöckigen Studentenwohnheime bei einem mysteriösen Vorfall zu Tode gekommen. Er war einundzwanzig Stockwerke tief einen Fahrstuhlschacht hinuntergestürzt. Der Zweite hatte eine Nacht im August auf Cape Cod nicht überlebt, als er mit seinem Sportwagen in einem Preiselbeersumpf gelandet und ertrunken war.
Wie Jeffrey erfahren hatte, war wohl ein zweites Fahrzeug im Spiel gewesen, das sich mit dem Sportcoupé eine rasante Verfolgungsjagd geliefert hatte. Die zuständige Dienststelle der Staatspolizei hatte dagegen offiziell erklärt, es habe sich um den Unfall eines einzigen Wagens gehandelt. Natürlich gehörte der Wachdienst auf dem Campus zur Staatspolizei.
Der dritte Student, so hatte er gehört, war zu seinem letzten Jahr an die Uni zurückgekehrt; er verließ sein Zimmer nicht mehr und war dabei, langsam, aber sicher den Verstand zu verlieren oder auch zu verhungern, während er sich im Wohnheim verschanzte.
Inzwischen hatten sich die vier Polizisten in die Menge gedrängt. Einer schwang in großem Bogen einen Schlagstock aus Graphit. Links von ihm klirrte splitterndes Glas, dann folgte ein kreischender Schmerzensschrei. Als Jeffrey hinter dem Baum hervortrat, hatte sich die Menge bereits zerstreut, einige der Studenten liefen eilig davon. Die vier Polizisten standen breitbeinig über zwei jungen Männern, die in Handschellen zu Boden gedrückt wurden. Einer der Jugendlichen bäumte sich auf und spuckte auf die Cops, was ihm einen Tritt in den Brustkorb einbrachte. Der Junge schrie auf, so dass es von den Gebäuden rund um den Campus widerhallte.
Erst jetzt bemerkte der Professor eine Gruppe junger Frauen, die der Auseinandersetzung aus dem Fenster im zweiten Stock des Instituts für Rassenkonfliktforschung zugesehen hatten. Sie schienen den Vorfall amüsant zu finden, denn hinter der kugelsicheren Scheibe lachten sie und zeigten mit dem Finger auf das Geschehen. Sein Blick wanderte zum Erdgeschoss des Seminargebäudes, das in völligem Dunkel lag. Das war auf dem Campus bei nahezu allen Bauten die Regel. Es galt als zu schwierig und zu teuer, die Büros und Übungsräume im Parterre in Schuss zu halten. Zu viele Einbrüche, zu viel Vandalismus. Folglich hatte man sämtliche ebenerdigen Räume den Graffiti und zerbrochenen Fensterscheiben überlassen. Auf den Treppen nach oben waren Sicherheitsschleusen eingerichtet, die dabei halfen, die meisten Waffen aus den Hörsälen und Übungsräumen fernzuhalten. In jüngster Zeit war allerdings das Problem aufgetaucht, dass einige Studenten in den verlassenen Erdgeschosstrakten, jeweils unter den Räumen, in denen eine Klausur anstand, Feuer legten. Jetzt, in der Prüfungsphase, experimentierte der Wachdienst damit, in den leer stehenden Bereichen abgerichtete Hunde loszulassen. Die Tiere jaulten viel, so dass sich die Studenten bei den Klausuren schwer konzentrieren konnten, während ansonsten die Rechnung aber aufzugehen schien.
Die Ordnungshüter hatten die beiden Verhafteten aufgehoben und kamen auf Jeffrey zu. Er sah, dass sich ihre Köpfe unablässig in alle Richtungen drehten, um die Dächer im Auge zu behalten.
Scharfschützen, dachte er und horchte, ob Hubschrauber im Anflug waren, um zusätzlich Schutz zu bieten.