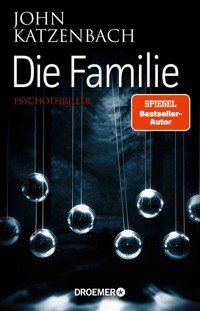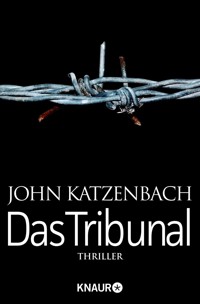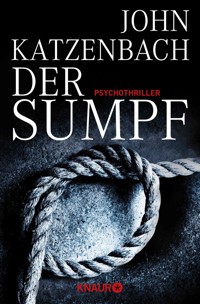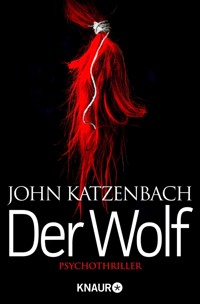9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der pensionierte Psychologieprofessor Adrian Thomas bekommt von seinem Arzt eine niederschmetternde Diagnose: Demenz. Damit haben sich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Vor seinem inneren Auge erscheint die Schreckensvision seines unaufhaltsamen, unheilbaren Abgleitens in die Dunkelheit. Verstört blickt der alte Mann auf die Straße hinaus und sieht in der anbrechenden Dämmerung ein vielleicht sechzehnjähriges Mädchen vorübereilen. Gleichzeitig rollt ein Lieferwagen heran, bremst ab und beschleunigt wieder: Das Mädchen ist verschwunden. Der alte Professor ist verwirrt. Hat er gerade eine Entführung beobachtet? Wenn es tatsächlich ein Verbrechen war, muss er handeln. Die Frage ist nur, wie. Kann er noch klar genug denken, um das Mädchen zu finden? Der Professor von John Katzenbach: Psychothriller im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
John Katzenbach
Der Professor
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der pensionierte Psychologieprofessor Adrian Thomas bekommt von seinem Arzt eine niederschmetternde Diagnose: Demenz.Damit haben sich seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Vor seinem inneren Auge erscheint die Schreckensvision seines unaufhaltsamen, unheilbaren Abgleitens in die Dunkelheit. Verstört blickt der alte Mann auf die Straße hinaus und sieht in der anbrechenden Dämmerung ein vielleicht sechzehnjähriges Mädchen vorübereilen. Gleichzeitig rollt ein Lieferwagen heran, bremst ab und beschleunigt wieder: Das Mädchen ist verschwunden. Der alte Professor ist verwirrt. Hat er gerade eine Entführung beobachtet? Wenn es tatsächlich ein Verbrechen war, muss er handeln. Die Frage ist nur, wie. Kann er noch klar genug denken, um das Mädchen zu finden?
Inhaltsübersicht
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Epilog
Für meinen alten Freund, Bob A.
1
Als die Tür aufging, wusste Adrian, dass er tot war.
Der hastig abgewandte Blick, die eingezogenen Schultern, die nervösen, gehetzten Schritte, mit denen der Arzt das Zimmer durchquerte, ließen keinen Zweifel. Fragte sich also nur: Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie schlimm wird es werden?
Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten.
Adrian Thomas sah zu, wie der Neurologe in den Testergebnissen blätterte, bevor er sich hinter seinem großen Eichenschreibtisch verschanzte. Der Arzt lehnte sich im Sessel zurück, beugte sich wieder vor, blickte auf und sagte endlich: »Die Untersuchungsergebnisse schließen die meisten naheliegenden Diagnosen aus …«
Adrian hatte nichts anderes erwartet. MRT. EKG. EEG. Blut. Urin. Ultraschall. Hirnszintigramm. Eine ganze Phalanx an kognitiven Funktionstests. Inzwischen waren über neun Monate vergangen, seit er zum ersten Mal festgestellt hatte, dass er Dinge vergaß, die man sich gewöhnlich leicht merken konnte. Wie er zum Baumarkt gefahren war, wo er plötzlich vor dem Regal mit Glühbirnen stand und nicht den blassesten Schimmer hatte, was er kaufen wollte; wie er einmal in der Stadt einem alten Kollegen über den Weg gelaufen war und ihm ums Verrecken der Name nicht mehr einfiel, obwohl der Mann zwanzig Jahre lang im Dozentenzimmer nebenan gesessen hatte. Vor sechs Tagen dann hatte er abends eine geschlagene Stunde lang im Wohnzimmer ihres Hauses im westlichen Massachusetts mit seiner längst verstorbenen Frau angeregt geplaudert. Sie hatte sogar in ihrem geliebten Queen-Anne-Sessel mit dem Paisley-Bezug vor dem Kamin gesessen.
Als ihm schließlich dämmerte, was gerade geschehen war, hatte er nicht geglaubt, dass ein Computerausdruck oder eine Farbfotografie von seiner Gehirnstruktur diese Dinge sichtbar machen würde. Trotzdem hatte er sich pflichtbewusst einen Notfalltermin bei seinem Internisten geben lassen, der ihn unverzüglich an den Facharzt weiterverwies. Dort beantwortete er geduldig jede Frage, ließ sich abtasten, stupsen und röntgen.
Als seine tote Frau wieder verschwunden war und er zu seinem Entsetzen erkannte, was passiert war, hatte er den Schluss gezogen, dass er auf dem besten Wege war, verrückt zu werden – eine laienhafte, undifferenzierte Bezeichnung für Psychose oder Schizophrenie. Andererseits hatte er sich nicht verrückt gefühlt. In Wahrheit hatte er sich sogar recht gut gefühlt, als sei es völlig normal, stundenlang mit einem Menschen zu reden, der seit drei Jahren tot war. Sie hatten sich über seine zunehmende Einsamkeit unterhalten, darüber, weshalb er nach ihrem Tod und nach seiner Emeritierung auf einmal angefangen hatte, an der Uni unentgeltlich Seminare abzuhalten. Sie hatten über die neuesten Filme, über interessante Bücher diskutiert und darüber gesprochen, ob sie sich dieses Jahr im Juni ein paar Wochen Auszeit auf Cape Cod gönnen sollten.
Noch während er dem Neurologen gegenübersaß, kam ihm der Gedanke, dass es ein schrecklicher Fehler gewesen war, die Halluzinationen auch nur eine Sekunde lang für ein Krankheitssymptom zu halten. Er hätte von Anfang an erkennen sollen, dass sie ein Segen waren. Er war nunmehr ganz allein, und es wäre doch angenehm, sein Leben für die Spanne, die ihm auf Erden noch blieb, wieder mit Menschen zu bevölkern, die er einmal geliebt hatte, ob sie nun existierten oder nicht.
»Ihre Symptome deuten darauf hin …«
Er wollte gar nicht hören, was der Arzt ihm zu sagen hatte, der ihn mit einem gequälten Ausdruck ansah und der viel jünger war als er selbst. Irgendwie war es unfair, von einem so jungen Mann gesagt zu bekommen, dass man todkrank war. Das hätte allenfalls einem grauhaarigen Gott in Weiß zugestanden, in dessen müder, sonorer Stimme die Erfahrung eines langen Berufslebens mitschwang, und nicht diesem Grünschnabel mit der Fistelstimme, der unbehaglich auf seinem Sessel wippte.
Er hasste das sterile, hell erleuchtete Sprechzimmer mit seinen gerahmten Diplomen und den Bücherregalen, in denen die medizinische Fachliteratur bestimmt nur zur Zierde stand. Der Mann war der Typ, der sich die nötigen Informationen schnell und bequem auf dem Computer oder einem Blackberry besorgte. Adrian blickte an dem Doktor vorbei aus dem Fenster und sah, wie sich auf den belaubten Zweigen einer Weide eine Krähe niederließ. Es schien, als würde der Arzt seinen Sermon in einer fernen Welt herunterleiern, an der er von diesem Moment an kaum noch Anteil hatte. Einen kleinen Anteil vielleicht. Einen unmaßgeblichen Anteil. Eine Sekunde lang stellte er sich vor, dass er lieber der Krähe zuhören sollte, und plötzlich stellte er schockiert und verwirrt fest, dass er für einen Augenblick dachte, es sei die Krähe, die ihm diesen Vortrag hielt. Da das eher unwahrscheinlich war, senkte er den Blick und zwang sich, dem Doktor zuzuhören.
»… Es tut mir leid, Professor Thomas«, sagte der Neurologe zögernd. Er wählte seine Worte mit Bedacht. »Aber ich glaube, Sie leiden in fortgeschrittenem Stadium an einer relativ seltenen Krankheit namens Lewy-Körper-Demenz. Sagt Ihnen das was?«
Vage, ja. Er hatte den Begriff schon ein-, zweimal gehört, wenn ihm auch nicht gleich einfiel, wo. Vielleicht hatte ihn einer der Kollegen am Psychologischen Institut der Universität einmal verwendet, um ein Forschungsprojekt zu begründen oder sich über ein Förderantragsverfahren zu beklagen. Er schüttelte trotzdem den Kopf. Besser, er hörte die ungeschminkte Wahrheit von einem Experten auf diesem Gebiet, auch wenn der Arzt viel zu jung war.
Die Worte flogen ihm wie Schutt nach einer Explosion um die Ohren und rieselten wie Trümmerstaub auf die Schreibtischplatte: Stetig. Fortschreitend. Rapide Verschlechterung. Halluzinationen. Kontrollverlust der Körperfunktionen. Verlust des kritischen Denkvermögens. Verlust des Kurzzeitgedächtnisses. Verlust des Langzeitgedächtnisses.
Und schließlich das Todesurteil: »Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber typischerweise gehen wir von fünf bis sieben Jahren aus. Vielleicht. Und ich glaube, dass Sie …« – der Arzt legte eine Pause ein und blickte auf seine Notizen, bevor er fortfuhr – »… bereits seit mindestens einem Jahr an dieser Krankheit leiden, somit wäre dies die maximale Lebenserwartung. In den meisten Fällen schreitet die Krankheit bedeutend schneller fort …«
Nach kurzem Zögern folgte ein serviles »Wenn Sie eine zweite Meinung einholen wollen …«.
Wieso, fragte Adrian sich, sollte er eine schlechte Nachricht zweimal hören wollen?
Und dann ein weiterer und einigermaßen vorhersehbarer Schlag: »… Die Krankheit ist nicht heilbar. Es gibt Medikamente, die einige der Symptome lindern können – Alzheimer-Mittel, atypische Antipsychotika, um die Trugbilder und Wahnvorstellungen zu behandeln –, doch garantieren können wir nichts, und oft bringen sie keine signifikante Besserung mit sich. Doch man sollte es damit probieren, um zu sehen, ob sie die Funktionen für eine gewisse Zeit aufrechterhalten …«
Adrian wartete eine kleine Pause ab, bevor er sagte: »Aber ich fühle mich nicht krank.«
Der Neurologe nickte. »Auch das ist leider typisch. Für einen Mann Mitte sechzig sind Sie in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung. Sie haben das Herz eines viel jüngeren Mannes …«
»Viel Sport und Joggen …«
»Nun, das ist gut.«
»Demnach bin ich gesund genug, um bei meinem eigenen Verfall zuzusehen? Wie von einem Ringplatz bei meinem eigenen K. o.?«
Der Neurologe ließ sich mit der Antwort Zeit. »Ja …«, sagte er schließlich. »Aus einigen Studien können wir den Schluss ziehen, dass möglichst viel geistige Betätigung in Kombination mit einem körperlich aktiven Alltag sowie Sport die Wirkung auf die Stirnlappen, in denen die Krankheit lokalisiert ist, teilweise verzögern können.«
Adrian nickte. Das wusste er. Ebenso wie er wusste, dass die Stirnlappen für Entscheidungsprozesse zuständig sind und für die Fähigkeit, die Welt zu begreifen. Die Stirnlappen waren mehr oder weniger der Teil seines Gehirns, der ihn zu dem gemacht hatte, der er war, und der ihn jetzt zu einem vollkommen anderen und wahrscheinlich nicht wiederzuerkennenden Menschen machen würde. Von einem Moment zum anderen rechnete er nicht mehr damit, noch lange Adrian Thomas zu sein.
Dieser Gedanke beschäftigte ihn, und er hörte dem Neurologen nicht länger zu, bis die Frage in sein Bewusstsein drang: »Haben Sie zu Hause Hilfe? Frau? Kinder? Andere Angehörige? Es wird nicht lange dauern, bis Sie auf eine gute Versorgung angewiesen sind. Danach werden Sie in eine Pflegeeinrichtung wechseln müssen. Ich würde möglichst bald mit diesen Menschen sprechen. Ihnen begreiflich machen, was Ihnen bevorsteht …« Während er das sagte, griff der Arzt nach einem Rezeptblock und machte sich zügig daran, reihenweise Medikamente aufzuschreiben.
Adrian lächelte. »Ich habe alle Hilfe, die ich brauchen werde, zu Hause.«
Die Neun-Millimeter-Halbautomatik Mister Ruger, dachte er. Die Waffe befand sich in der obersten Nachttischschublade neben seinem Bett. Das Dreizehn-Schuss-Magazin war zwar voll, doch ihm würde eine Kugel genügen.
Der Arzt sagte noch einiges über häusliche Krankenpflege und Versicherungsbeiträge, über Vollmachten und Patientenverfügungen, längere Krankenhausaufenthalte und die Notwendigkeit, alle seine künftigen Arzttermine einzuhalten, seine Medikamente zu nehmen – auch wenn sie den Krankheitsverlauf kaum beeinflussen würden, könnten sie ja immerhin ein wenig helfen. Adrian erkannte, dass er den weiteren Ausführungen des Arztes keine Beachtung mehr zu schenken brauchte.
Eingebettet in die Parzellen ehemaliger landwirtschaftlicher Flächen am Rande von Adrians kleiner Universitätsstadt, auf denen exklusive herrschaftliche Wohnsitze entstanden waren, befand sich ein Naturschutzgebiet mit einem Wildpark, der sich über einen bescheidenen Hügel erstreckte – von den Bewohnern als Berg bezeichnet, kam er in Wahrheit eher einer topographischen Bodenwelle gleich.
Zum Mount Pollux wand sich ein Wanderweg hinauf, der zunächst durch den Wald und dann zu einer Lichtung führte, wo man einen prächtigen Ausblick über das Tal hatte. Es hatte ihn schon immer gestört, dass es neben dem Mount Pollux nicht auch noch einen Mount Castor gab, und er hatte sich gefragt, wer dem Hügel einen so hochtrabenden Namen gegeben hatte. Irgendein aufgeblasener Akademiker vermutlich, ein Mitglied der Fakultät vor zweihundert Jahren, als sie den Studenten am College in schwarzem Zwirn und gestärktem weißem Kragen die klassische Bildung eintrichterten. Doch trotz des fragwürdigen Namens und des allzu ehrenvollen Titels »Mount« war ihm dieser Ort im Lauf der Jahre ans Herz gewachsen. Es war ein stilles Fleckchen Erde, das die Hunde der Umgebung liebten, weil sie hier ohne Leine tollen durften, und das er selber mochte, weil er hier mit seinen Gedanken allein sein konnte.
Er stellte seinen alten Volvo in einer Parkbucht am unteren Ende des Weges ab und machte sich zu Fuß an den vertrauten Aufstieg. Normalerweise hätte er bei dem aufgeweichten Boden Wanderstiefel getragen, und ihm war bewusst, dass er wahrscheinlich nicht weit kommen würde, ohne seine Schuhe zu ruinieren, doch er sagte sich, dass er sich darum jetzt keine Gedanken mehr zu machen brauchte.
Der Nachmittag ging bereits zur Neige, und es zog ihm kalt den Rücken hoch. Er war für einen Spaziergang nicht richtig angezogen, und mit der Abenddämmerung schwebte ein letzter Winterhauch über die Wälder von Neuengland. Neben seinen durchnässten Schuhen ignorierte er auch die Kälte.
Auf dem Pfad begegnete er keiner Menschenseele. Keine Golden Retriever, die auf einer Spur durchs Unterholz schossen. Nur Adrian mit stetigem Schritt. Er war dankbar für die Einsamkeit. Ihm kam der seltsame Gedanke, dass er womöglich bei einer zufälligen Begegnung einem wildfremden Menschen erzählen würde: »Ich habe eine Krankheit, von der Sie noch nie gehört haben und an der ich sterben werde, nur dass sie mich bis dahin langsam, aber sicher lahmlegt.«
Mit Krebs oder einer Herzerkrankung, dachte er, blieb man, während es einen umbrachte, zumindest der Mensch, der man war. Er empfand Wut und hätte am liebsten um sich geschlagen, doch stattdessen marschierte er einfach nur weiter den Hügel hinauf. Er horchte auf seinen Atem. Der war regelmäßig. Normal. Kein bisschen angestrengt. Ein gequältes Röcheln wäre ihm bedeutend lieber gewesen, irgendetwas, das ihm sagte, es gehe mit ihm zu Ende.
Bis zum Gipfel, wenn man es so nennen wollte, brauchte er ungefähr eine halbe Stunde. Eine Hügelkette im Westen streifte das letzte Sonnenlicht, und er setzte sich auf eine große Moräne aus Schiefergestein und starrte ins Tal. Die ersten Zeichen des Neuengland-Frühlings waren schon deutlich zu erkennen. Er sah die ersten Blumen, vor allem gelbe und violette Krokusse, die aus der feuchten Erde gekrochen waren, erste grüne Blattknospen bedeckten die Zweige der Bäume wie ein Dreitagebart. Über ihm formierte sich ein Schwarm kanadischer Wildgänse auf dem Flug nach Norden zu einem langgestreckten V. Ihr heiseres Schreien hallte vom blassblauen Himmel wider. Das alles war so normal, dass er sich ein wenig albern vorkam, weil das, was in ihm vor sich ging, mit dem Rest der Welt nicht im Einklang war.
In der Ferne konnte er die Türme der Kirche im Zentrum des Universitätscampus erkennen. Das Baseballteam würde im Schlagtunnel trainieren, weil das Feld noch unter einer Plane steckte. Nicht weit davon hatte er sein Dozentenzimmer gehabt und – wenn er um diese Jahreszeit nachmittags das Fenster öffnete – das ferne Geräusch eines Schlägers am Ball gehört. So wie ein Rotkehlchen, das irgendwo in einem Innenhof der Colleges nach einem Wurm scharrte, war es für ihn nach einem langen Winter stets ein willkommener Frühlingsbote gewesen.
Adrian holte tief Luft. »Geh nach Hause«, befahl er sich laut und vernehmlich. »Erschieß dich, solange all diese Dinge, die dir Freude bereitet haben, noch real sind. Denn die Krankheit nimmt sie dir weg.«
Er hatte sich immer zugutegehalten, ein entschlussfreudiger Mensch zu sein, und so passte es zu seinem Naturell, durch Selbstmord einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Er suchte nach Argumenten für einen Aufschub, doch ihm fielen keine ein. Vielleicht, überlegte er, bleibst du einfach hier. Es war eine schöne Stelle. Einer seiner Lieblingsorte. Ein guter Ort zum Sterben. Er fragte sich, ob es im Lauf der Nacht kalt genug würde zum Erfrieren. Er bezweifelte es. Eher würde er wohl nur stundenlang frösteln und husten und dann den Sonnenaufgang erleben, was peinlich wäre, auch wenn er der einzige Mensch auf der Welt wäre, für den der Anblick des Sonnenaufgangs eine Niederlage bedeutete.
Adrian schüttelte den Kopf. Sieh dich um, dachte er. Was es wert ist, behalte im Gedächtnis. Das Übrige vergiss. Er betrachtete seine Schuhe. Sie waren lehmverkrustet und durchnässt, und er wunderte sich, dass sich seine Zehen nicht klamm anfühlten.
Bringen wir’s hinter uns, beharrte er. Adrian stand auf und klopfte sich den Schieferstaub von der Hose. Er sah, wie die Schatten durch die Bäume und das Unterholz sickerten und der Pfad den Hügel hinab mit jeder Minute, die verstrich, dunkler wurde.
Er warf einen letzten Blick ins Tal. Da habe ich unterrichtet. Dort drüben haben wir gewohnt. Er wünschte sich, bis zu dem Loft in New York sehen zu können, in dem er seine Frau kennengelernt und sich in sie verliebt hatte. Er wünschte sich, all die Stellen noch einmal zu sehen, an denen er aufgewachsen war. Er wünschte sich, die Rue Madeleine in Paris und das Bistro an der Ecke zu sehen, in dem er in seinen Freisemestern mit seiner Frau den Frühstückskaffee getrunken hatte, oder das Hotel Savoy in Berlin, wo sie in der Marlene-Dietrich-Suite logierten, als ihn das Institut für Psychologie zu einem Vortrag eingeladen hatte, und wo sie ihr einziges Kind zeugten. Er blickte angestrengt nach Osten, zu dem Haus am Cape, in dem er seit seiner Jugend viele Sommer verbracht hatte, und zu den Stränden, an denen er gelernt hatte, dem Streifenbarsch Fliegen auszuwerfen, oder auch zu den hiesigen Forellenbächen, in denen er zwischen uralten Kieseln im sprudelnden, gurgelnden Wasser gewatet war.
Eine Menge, was mir entgeht, räumte er ein. Nichts zu machen. Er kehrte all dem, was er sehen oder auch nicht sehen konnte, den Rücken und machte sich auf den Weg zurück. In der einsetzenden Dunkelheit wurde der Abstieg beschwerlich.
Nicht mehr weit von seinem Haus entfernt, fuhr er auf einer Querstraße langsam zwischen den Reihen bescheidener Einfamiliendomizile entlang, weißen, schindelverkleideten Bauten, in denen eine bunte Mischung aus Universitätsdozenten, Versicherungsangestellten, Zahnärzten, freiberuflichen Textern, Yogalehrern und Life-Coachs lebten, als er das Mädchen auf dem Bürgersteig entdeckte.
Er hätte sie kaum beachtet, wäre ihm nicht ihr entschlossener Schritt ins Auge gefallen. Sie schien genau zu wissen, was sie wollte. Sie hatte aschblondes Haar, das sie unter ihre leuchtend rosa Kappe der Boston Red Sox geschoben hatte, und ihr dunkler Parka war ebenso wie die Jeans an mehreren Stellen aufgerissen. Ungewöhnlich war ihr Rucksack, der prall mit Kleidern vollgestopft schien. Zuerst nahm er an, dass sie mit dem letzten Bus, der die zum Nachsitzen verdonnerten Kinder nach Hause brachte, aus der Highschool gekommen war und nun noch ein kleines Stück nach Hause lief. Doch an ihrem Rucksack baumelte ein großer Teddybär, und er konnte sich nicht erklären, wieso jemand ein Kinderspielzeug in die Highschool mitnehmen sollte. Sie hätte sich damit unweigerlich zum Gespött gemacht.
Als er langsam an ihr vorbeifuhr, warf er einen Blick auf ihr Gesicht. Sie war jung, fast noch ein Kind, dachte er, doch sie hatte diese besondere Schönheit, die Kinder an der Schwelle zum Erwachsenenalter besitzen. War sie fünfzehn? Sechzehn? Er konnte das Alter von Kindern nicht mehr sicher schätzen.
Sie blickte grimmig geradeaus. Seinen Wagen schien sie nicht einmal zu bemerken.
Adrian bog in seine Einfahrt ein, blieb jedoch hinter dem Lenkrad sitzen. Das Mädchen legte eine Entschlossenheit an den Tag, die einen besonderen Grund haben musste. Dieser Ausdruck nahm ihn gefangen und weckte seine Neugier. Als sie mit forschem Schritt zur nächsten Straßenecke lief, schaute er ihr im Rückspiegel hinterher.
Dann sah er etwas, das in dieser ruhigen, entschieden normalen Wohngegend ein wenig aus dem Rahmen fiel. Ein weißer Kleintransporter, so etwas wie ein Lieferwagen, aber ohne das Firmenlogo eines Elektriker- oder Malerbetriebs, fuhr langsam in seine Straße. Am Lenkrad saß eine Frau und auf der Beifahrerseite ein Mann. Das überraschte ihn. Es hätte andersherum sein müssen, doch dann machte er sich bewusst, dass er nur einem sexistischen Klischee aufsaß. Er beobachtete, wie der Lieferwagen das Tempo drosselte, als verfolgte er das Mädchen auf dem Bürgersteig.
Plötzlich hielt der Wagen an und verstellte Adrian den Blick auf das Mädchen. Es verging ein kurzer Moment, dann fuhr der Transporter plötzlich an und raste um die Ecke. Der Motor heulte auf, und die Hinterräder drehten durch. In dieser friedlichen Umgebung wirkte das Manöver unangemessen gefährlich, und so versuchte er, einen Blick auf das Nummernschild zu erhaschen, bevor es in das letzte Dämmerlicht vor Einbruch der Dunkelheit verschwand.
Er sah auf den Bürgersteig. Das Mädchen war verschwunden.
Doch auf der Straße lag die rosafarbene Baseballkappe.
2
Jennifer Riggins drehte sich nicht sofort um, als der Lieferwagen neben ihr heranfuhr. Sie hatte nichts anderes im Sinn, als zügig zu der Bushaltestelle zu kommen, die ungefähr achthundert Meter weiter an der nächsten Hauptstraße lag. Nach ihrem ausgeklügelten Fluchtplan würde sie der Linienbus ins Stadtzentrum bringen, von wo aus sie mit einem anderen Bus bis zu einem größeren Bahnhof in Springfield etwa dreißig Kilometer weiter fahren würde. Von dort aus konnte sie überallhin. In ihrer Jeanstasche hatte sie über 300 Dollar, die sie sich langsam, aber sicher aus der Handtasche ihrer Mutter oder der Brieftasche des Freundes ihrer Mutter zusammengeklaut hatte. Sie hatte sich damit Zeit gelassen, das Geld im Lauf der letzten vier Wochen gestohlen und in einer Schachtel in einer Schublade unter ihrer Wäsche versteckt. Sie hatte nie so viel auf einmal entwendet, dass es aufgefallen wäre, nur kleine Beträge, die übersehen wurden.
Sie hatte es sich zum Ziel gemacht, genug Geld zusammenzubekommen, um damit nach New York oder Nashville, vielleicht sogar bis nach Miami oder L. A. zu kommen, und hatte sich bei ihrem letzten Diebstahl am frühen Morgen mit einem Zwanziger und drei Ein-Dollar-Scheinen begnügt, dann aber auch noch die Visa-Karte ihrer Mutter dazugenommen. Bis jetzt war sie sich noch nicht sicher, wohin sie wollte. Hoffentlich irgendwohin, wo es warm war, Hauptsache, weit weg und in eine Gegend, die ganz anders war. Darum kreisten ihre Gedanken, als der Lieferwagen neben ihr heranfuhr und hielt. Ich kann gehen, wohin ich will …
Der Mann auf dem Beifahrersitz sagte: »Hey, Miss … kennen Sie sich hier aus?«
Sie blieb stehen und drehte sich zu dem Mann im Transporter um. Spontan fiel ihr auf, dass er sich am Morgen nicht rasiert hatte und dass seine Stimme für eine so normale Frage seltsam hoch und aufgeregt klang. Außerdem war sie ein wenig gereizt, weil sie sich nur ungern aufhalten ließ. Sie wollte nur schnell von zu Hause, aus dieser spießigen Gegend und der langweiligen kleinen Universitätsstadt weg, außerdem von ihrer Mutter und deren Freund, von der Art, wie er sie ansah, und den Sachen, die er machte, wenn sie alleine waren, weg von ihrer schrecklichen Schule, von ihren Klassenkameraden, die sie hasste und die jeden Tag der Woche über sie ablästerten.
Sie wollte an diesem Abend möglichst bald in einem Bus sitzen und irgendwohin fahren, denn sie wusste, dass ihre Mutter bis ungefähr neun oder zehn Uhr sämtliche Nummern angerufen hätte, die ihr einfielen, und danach vermutlich wie bereits bei früherer Gelegenheit die Polizei verständigt hätte. Jennifer wusste, dass es dann am Busbahnhof in Springfield von Bullen nur so wimmeln würde, also musste sie dort bereits weg sein, bevor die Freunde und Helfer auf den Plan gerufen wurden. All diese Überlegungen schossen ihr durch den Kopf, als sie auf die Frage des Mannes reagierte.
»Worum geht’s?«, fragte sie zurück.
Der Mann lächelte. Da stimmt was nicht, dachte sie. Wieso lächelt der?
Zuerst rechnete sie damit, dass der Mann eine irgendwie anzügliche Bemerkung machen würde, etwas Sexistisches, Beleidigendes oder Herablassendes wie: Hi, Süße, wie wär’s mit uns beiden? Irgend so eine sabbernde Gemeinheit. Ihr lag schon eine Antwort auf der Zunge, er solle sich zum Teufel scheren oder etwas in der Art, um dann einfach weiterzugehen, als sie hinter dem Mann eine Frau auf dem Fahrersitz entdeckte. Die Frau trug eine Strickmütze, und obwohl sie jung war, lag in ihren Augen ein barscher, steinharter Ausdruck, den Jennifer noch bei keinem Menschen gesehen hatte und der ihr augenblicklich Angst einjagte. Die Frau hatte eine kleine Videokamera in der Hand. Sie war auf Jennifer gerichtet.
Die Antwort des Mannes auf ihre Frage verwirrte sie. Sie hatte damit gerechnet, dass er nach einer Adresse in ihrem Viertel suchte oder nach dem direktesten Weg auf die Route 9, doch er sagte: »Um dich.« Was wollten die von ihr? Niemand wusste von ihrem Plan. Noch konnte ihre Mutter die irreführende Nachricht, die sie mit dem Magneten an der Kühlschranktür befestigt hatte, nicht gelesen haben. Und so zögerte sie genau die Sekunde, in der sie, so schnell sie konnte, hätte wegrennen oder aber laut um Hilfe rufen sollen.
Die Tür des Lieferwagens flog auf. Der Mann sprang vom Beifahrersitz. Er bewegte sich so schnell, wie sie es niemals für möglich gehalten hätte.
»Hey!«, sagte Jennifer. Zumindest glaubte sie später, dass sie hey gesagt hatte, auch wenn sie es nicht beschwören konnte.
Der Mann hatte ihr so fest ins Gesicht geschlagen, dass sie ins Wanken geriet. Der Schmerz explodierte in ihren Augen und schoss ihr durch den ganzen Körper. Ihr wurde schwindelig, alles drehte sich, und sie merkte, wie sie ohnmächtig wurde. Als sie zurücktaumelte und zusammensackte, packte er sie an der Schulter, damit sie nicht zu Boden fiel. Sie hatte weiche Knie, Schulter und Rücken fühlten sich wie Gummi an. Sie war vollkommen kraftlos.
Wie durch einen Nebelschleier nahm sie wahr, dass sich die Tür öffnete und der Mann sie ins Heck des Wagens schob. Sie hörte, wie die Tür mit einem Knall zufiel. Als der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in die Kurve ging, wurde sie auf die stählerne Ladefläche geworfen. Sie spürte das Gewicht des Mannes, der sie niederdrückte. Sie bekam kaum noch Luft, und vor Angst war ihr die Kehle wie zugeschnürt. Sie wusste nicht, ob sie versuchte, sich zu wehren oder herauszuwinden, sie wusste auch nicht, ob sie schrie oder weinte, denn in ihrem benommenen Zustand bekam sie alles nur noch wie von ferne mit.
Als es plötzlich schwarz um sie wurde, schnappte sie nach Luft und dachte, sie fiele in Ohnmacht, doch dann wurde ihr klar, dass der Mann ihr einen schwarzen Kissenbezug über den Kopf gezogen hatte und sie selbst die winzige Welt des Lieferwagens nicht mehr sehen konnte. Sie schmeckte Blut an den Lippen, ihr drehte sich immer noch der Kopf, und sie wusste nur, dass gerade etwas viel Schlimmeres mit ihr passierte als alles, was sie bis dahin kannte.
Ein Gestank drang durch den Kissenbezug, ein starker Ölgeruch vom Boden des Lieferwagens; dazu der süßliche Schweißgeruch von dem Mann, der sie niederdrückte. Irgendwo tief in ihrem Innern wusste sie, dass sie starke Schmerzen hatte, auch wenn sie nicht genau ausmachen konnte, wo. Sie versuchte, die Arme und Beine zu bewegen, doch wie ein Hund, der im Traum Karnickel jagt, zuckte sie nur hilflos in der Luft. Sie hörte, wie der Mann flüsterte: »Nein, das lassen wir schön sein.« Und dann explodierte es noch einmal auf ihrem Kopf und hinter ihren Augen. Das Letzte, was sie mitbekam, waren die Worte der Frau. »Bring sie nicht um, verdammt noch mal …«
3
Er hielt die rosa Kappe so behutsam wie ein Lebewesen und drehte sie um. An der Innenseite der Krempe stand in Tinte der Name Jennifer, gefolgt von einer grinsenden Ente und den Worten ist cool, als beantworteten sie eine Frage. Kein Nachname, keine Telefonnummer, keine Adresse.
Adrian saß auf seinem Bett. Neben ihm lag im scharfen Kontrast zu der bunten Patchwork-Decke, die seine Frau kurz vor ihrem Unfall auf einem Trödelmarkt erstanden hatte, seine Ruger Neunmillimeter. Im ganzen Schlafzimmer hatte er Fotos von seiner Frau und seiner Familie ausgebreitet, um sie sich ansehen zu können, während er sich wappnete. In seinem kleinen heimischen Arbeitszimmer, in dem er früher über seinen Vorlesungen und Stundenplänen gebrütet hatte, lag jetzt der Ausdruck eines Wikipedia-Artikels über Lewy-Körper-Demenz, den er an den ärztlichen Befund der Neurologenpraxis getackert hatte.
Blieb nur noch der Abschiedsbrief – etwas tief Empfundenes und Poetisches. Er hatte schon sein Leben lang ein Faible für Poesie gehabt und immer mal wieder eigene Verse geschmiedet. Er besaß ganze Regalwände voll mit Anthologien, von der Moderne bis zur Antike, von Paul Muldoon und James Tate bis zu Ovid und Catull. Vor ein paar Jahren hatte er ein Bändchen mit seinen eigenen Gedichten, Liebeslieder und Wahn, im Selbstverlag herausgegeben. Nicht dass er sie wirklich für gut hielt. Er liebte es einfach, sie zu schreiben, sei es im Freivers oder gereimt, und er hatte das Gefühl, dass sie ihm in diesem Moment helfen könnten – Poesie statt Bravour. Einen Moment war er abgelenkt. Er überlegte, wo er ein Exemplar seines Buchs aufbewahrte. Es gehörte, fand er, zusammen mit den Bildern und der Waffe aufs Bett. Dann wäre für denjenigen, der nach seinem Selbstmord am Ort des Geschehens eintreffen würde, alles vollkommen klar.
Er erinnerte sich daran, dass er, unmittelbar bevor er abdrücken würde, den Notruf wählen und einen Schuss in seinem Haus melden sollte. Auf diese Weise würden binnen weniger Minuten dienstfertige Polizisten erscheinen. Er wusste, dass er die Haustür einladend offen stehen lassen sollte. Mit solchen Vorsichtsmaßnahmen würde er verhindern, dass Wochen vergingen, bevor jemand seine Leiche fand. Keine Verwesung. Kein Geruch. Alles so sauber und ordentlich wie möglich. Gegen die Blutspritzer konnte er nun mal nichts machen.
Einen Moment kam ihm der Gedanke, ein Gedicht über sein Vorhaben zu schreiben: Von eigener Hand aus letzter Hand. Kein schlechter Titel, fand er.
Adrian wippte vor und zurück, als könnte die Bewegung Gedanken freisetzen, die in irgendwelchen dunklen Nischen in seinem Kopf feststeckten, zu denen er keinen Zugang mehr hatte. Möglicherweise gab es ein paar Angelegenheiten, die er vor seinem Selbstmord noch erledigen sollte – die eine oder andere vergessene Rechnung bezahlen, die Heizung und den Wasserboiler abschalten, die Garage zuschließen, den Müll hinaustragen. Er ertappte sich dabei, im Kopf eine kleine Erledigungsliste durchzugehen wie der typische Vorstadtbewohner am Samstagmorgen. Ihm kam der seltsame Gedanke, dass er mehr Angst davor hatte, mit seinem Tod anderen ein Durcheinander zu hinterlassen, als davor, sich tatsächlich umzubringen.
Das Durcheinander des Todes. Mehr als einmal war er derjenige gewesen, der es zu beseitigen hatte. Erinnerungen liefen gegen seine organisatorischen Überlegungen Sturm. Er kämpfte gegen die traurigen Bilder an, die ihm durch den Kopf geisterten, und konzentrierte sich mit aller Macht auf die Fotos, die ihn auf dem Bett und in den Bilderrahmen auf dem Tisch umgaben. Eltern, Bruder, Frau und Sohn: Komme gleich, dachte er. Schwester in der Ferne, Nichten, Freunde, Kollegen. Bis später dann. Es kam ihm vor, als spräche er mit den Menschen, die ihm da entgegenlächelten und -grinsten: glückliche Momente bei Barbecues, Hochzeiten und Urlaubsreisen – alle auf Zelluloid gebannt.
Er sah sich um. Die anderen Erinnerungen würden gleich für immer verschwinden. Die schrecklichen Zeiten, die es in seinem Leben viel zu oft gegeben hatte. Drück ab, und das ist alles vorbei. Er senkte den Blick und stellte fest, dass er immer noch die rosafarbene Kappe in Händen hielt.
Er wollte sie gerade weglegen und gegen die Waffe tauschen, hielt jedoch plötzlich inne.
Das wird die Leute verwirren, dachte er. Irgendein Polizist wird sich fragen: Was zum Teufel wollte der Mann mit einer rosafarbenen Red-Sox-Kappe? Das könnte sie unnötigerweise auf eine falsche Fährte locken und sie auf den Gedanken bringen, sie hätten es mit irgendeinem unerklärlichen Mord zu tun. Er hob die Kappe direkt in Augenhöhe, so wie man ein Juwel ans Licht hält, um darin die Unvollkommenheiten zu sehen.
Der grobe Baumwollstoff fühlte sich warm an. Er strich mit dem Finger das B entlang. Die rosa Farbe war ein wenig verblasst und das Schweißband ausgefranst. Das konnte nur passiert sein, weil das blonde Mädchen sie oft getragen hatte, besonders im Winter, anstelle einer wärmeren Skimütze vielleicht. Die Kappe war, aus unerfindlichen Gründen, ein äußerst beliebtes Kleidungsstück.
Was besagte, dass die Eigentümerin sie nicht einfach so am Straßenrand liegen gelassen hätte.
Adrian holte tief Luft und ging noch einmal alles genau durch, was er gesehen und mitbekommen hatte. Er wendete jeden Eindruck vor seinem geistigen Auge hin und her so wie die Baseballkappe mit den Händen: Das Mädchen mit der entschlossenen Miene. Die Frau am Steuer. Der Mann an ihrer Seite. Das kurze Zögern, als sie neben dem Teenager hielten. Das schnelle Anfahren und Verschwinden. Die zurückgebliebene Kappe. Was war passiert?
Flucht? Ausbruch? Vielleicht war es eine von diesen Sekten- oder Drogeninterventionen, bei denen die selbsternannten Helfer über ihre Zielperson herfallen, um dann in einem billigen Hotelzimmer ihre Tiraden gegen sie loszulassen, bis das arme junge Ding sich bekehrt oder einer Sucht schuldig bekennt.
Er glaubte nicht, dass er so etwas beobachtet hatte.
Er befahl sich: Geh noch einmal alles durch. Jede Einzelheit, bevor du alles vergessen hast. Denn er hatte Angst, dass alles, woran er sich erinnerte, und alles, was er daraus abgeleitet hatte, sich in kürzester Zeit in nichts auflöste wie der Frühnebel in der Sonne.
Er stand auf, trat an eine Kommode und fand einen Stift sowie ein kleines, in Leder gebundenes Notizbuch. Gewöhnlich hatte er die dicken, eleganten weißen Seiten zu Notizen für Gedichte verwendet, den einen oder anderen Gedanken, eine Wortgruppe notiert oder auch Reime, die sich später weiterentwickeln ließen. Er hatte das Buch von seiner Frau bekommen, und wenn er die glatte Oberfläche berührte, erinnerte es ihn an sie.
Also ließ er noch einmal alles Revue passieren und schrieb diesmal auf ein leeres Blatt ein paar Gedächtnisstützen: Das Mädchen … Sie hatte nur geradeaus geblickt, und er glaubte nicht, dass sie ihn auch nur gesehen hatte, als er an ihr vorbeifuhr. Sie hatte einen Plan, so viel stand fest, allein schon nach ihrer Blickrichtung und ihrem Schritttempo zu urteilen – und der hatte alles andere ausgeblendet.
Die Frau und der Mann … Er war in seine Einfahrt abgebogen, bevor der weiße Lieferwagen heranfuhr, auch daran gab es keinen Zweifel. Hatten sie ihn in seinem Wagen bemerkt? Nein. Unwahrscheinlich.
Das kurze Zögern … Sie waren dem Mädchen gefolgt, und sei es auch nur ein paar Meter weit. Das war offensichtlich. Es hatte so gewirkt, als ob sie das Mädchen taxierten. Was war danach wohl passiert? Haben sie miteinander gesprochen? Haben sie dem Mädchen angeboten, einzusteigen? Vielleicht kannten sie sich, und es handelte sich nur um die gutgemeinte Einladung, sie ein Stück mitzunehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Nein, dafür fuhren sie viel zu schnell weg.
Was genau hatte er gesehen, als sie um die Ecke bogen? Ein Kennzeichen von Massachusetts: QE2D. Er schrieb es auf. Er versuchte, sich die anderen beiden Ziffern ins Gedächtnis zu rufen, doch vergeblich. Umso deutlicher erinnerte er sich an das Aufheulen des Motors und das Quietschen der Reifen, als der Transporter losfuhr.
Und dann blieb die Kappe liegen.
Er hatte Mühe, das Wort Entführung zu Ende zu denken, und als er es doch tat, sagte er sich, dass dieser Schluss einfach nur abwegig sei. Da, wo er lebte, herrschten Vernunft, Bildung und Logik, außerdem ein ausgeprägter Sinn für Kunst und Schönheit. Seine Welt prägten Institutionen, an denen Wissen vermittelt wurde. Entführung – dieses hässliche Wort gehörte in dunklere Regionen und hatte in seiner Wohngegend keinen Platz.
Sicher, insgeheim taten sich wohl auch in den stillen Reihen gepflegter Vorstadthäuser hier und da moralische Abgründe auf – häusliche Gewalt, Fremdgehen, Drogenmissbrauch an der Highschool, Alkohol und ausschweifende Partys. Vielleicht hinterzogen manche Steuern oder betrieben fragwürdige Geschäfte – solche Dinge hätten ihn hinter der gutbürgerlichen Fassade nicht weiter verwundert. Doch er konnte sich nicht erinnern, in dieser Gegend je einen Schuss gehört zu haben. Selbst Blaurotlicht hatte er auf den umliegenden Straßen noch nie blinken gesehen.
Diese Dinge passierten anderswo. Sie gehörten in die Abendnachrichten, in die Live-Berichte aus den nahe gelegenen Metropolen, sie füllten die Schlagzeilen der Tageszeitung.
Adrian betrachtete die Ruger Automatik. Die Hinterlassenschaft seines Bruders.
Niemand wusste, dass er sie jetzt besaß. Die befreundeten Kollegen an der Fakultät wären zutiefst schockiert, wenn sie wüssten, dass er im Besitz dieser Waffe war. Eine hässliche Waffe, mit der nicht zu spaßen war und die kein Hehl daraus machte, wozu sie diente. Er hatte sie nie angemeldet, schließlich war er weder Jäger noch Mitglied der nationalen Schusswaffenvereinigung. Für die Cowboy-Mentalität, wonach der Besitz einer Waffe zum Recht auf Selbstverteidigung gehört, hatte er nur Verachtung übrig. Er war sich ziemlich sicher, dass seine Frau über die Jahre vergessen hatte, dass sich die Ruger noch im Haus befand, falls sie es überhaupt je mitbekommen hatte. Er hatte nie mit ihr darüber gesprochen, nicht einmal, als sie nach ihrem Unfall tapfer durchhielt, obwohl ihre Blicke keinen Zweifel daran ließen, dass sie sich nach Erlösung sehnte.
Hätte er den Mut gehabt, dachte er, hätte er ihr den Wunsch mit der Ruger erfüllen können. Jetzt stand er vor derselben Frage, und er wusste, dass es feige von ihm war, sich so davonzustehlen. Wäre es, wenn er sich den Lauf an die Schläfe setzte oder in den Mund hielt und abdrückte, erst der zweite Schuss, der je mit diesem Revolver abgefeuert wurde? Seine schwarze, metallische Oberfläche schien herzlos. Das Ding fühlte sich schwer und eiskalt an, als er es auf der flachen Hand wog.
Adrian ließ die Automatik aufs Bett fallen und drehte sich zu der Kappe um. Sie meldete sich in diesem Moment genauso laut zu Wort wie die Ruger. Er kam sich vor, als steckte er mitten in einer Auseinandersetzung zwischen zwei leblosen Gegenständen, die sich darüber stritten, was er machen sollte.
Er holte tief Luft und dachte nach. Plötzlich war es im Zimmer merkwürdig still, als hätten seine Selbstmordpläne einen höllischen Lärm gemacht, der abrupt verstummt war. Das Mindeste, was er tun konnte, überlegte er, war ein kurzer Anruf bei der Polizei. Das schien die Kappe von ihm zu verlangen.
Er griff zum Telefon und wählte den Notruf. Es entbehrte nicht der Ironie, dass er zuerst wegen einer Fremden anrief, um wenig später eine Meldung in eigener Sache durchzugeben.
»Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Was für einen Notfall haben Sie zu melden?«
»Es ist kein Notfall im strengen Sinne«, sagte Adrian. Er legte Wert darauf, dass seine Stimme nicht zitterte und verriet, dass er sich seit seinem Besuch beim Neurologen vor wenigen Stunden plötzlich wie ein alter Mann vorkam. Er wollte energisch und geistesgegenwärtig klingen. »Ich rufe an, weil ich einen Vorfall beobachtet habe, der möglicherweise für die Polizei von Interesse ist.«
»Was für einen Vorfall?«
Er versuchte, sich die Person am anderen Ende der Leitung vorzustellen. Der Mann in der Einsatzzentrale hatte es sich offenbar zu eigen gemacht, die Worte einzeln zu betonen, um Missverständnisse auszuschließen. Sein Ton war professionell ungerührt und sachlich, als käme jeder Satz, den er zu sagen hatte, im steifen Uniformkragen daher.
»Ich habe einen weißen Kleintransporter gesehen … Da war dieses junge Mädchen, Jennifer, das steht innen an ihrer Kappe, aber ich kenne sie nicht, auch wenn sie hier irgendwo in der Nähe wohnen muss. Eben ist sie noch da, und im nächsten Moment ist sie verschwunden …«
Adrian hätte sich ohrfeigen können. All seine Vorsätze, vernünftig und dynamisch zu klingen, hatten sich in einer Flut abgehackter, schlecht formulierter, voreiliger Beschreibungen aufgelöst. War das schon die Krankheit, die seine Sprachfähigkeit in Mitleidenschaft zog?
»Ja, Sir. Und was genau glauben Sie, beobachtet zu haben?«
Es piepste in der Leitung. Er wurde auf Band aufgenommen. »Haben Sie eine Vermisstenmeldung zu einer Jugendlichen in der Gegend von Hills?«, fragte er.
»Derzeit keine. Jedenfalls nicht von heute«, antwortete der Mann in der Einsatzzentrale.
»Nichts?«
»Nein, Sir. Es war in der ganzen Stadt ein ausgesprochen ruhiger Nachmittag. Ich werde Ihre Meldung aufnehmen und an das Kriminalkommissariat weiterreichen, für den Fall, dass später noch was reinkommt. Die werden sich dann, falls nötig, mit Ihnen in Verbindung setzen.«
»Vermutlich habe ich mich getäuscht«, sagte Adrian. Er legte auf, bevor der Mann Zeit hatte, ihn nach seinem Namen und seiner Anschrift zu fragen.
Adrian sah auf und blickte aus dem Fenster. Es war Nacht geworden, und in der ganzen Straße gingen die Lichter an. Zeit fürs Abendessen, dachte er. Zeit für die Familie. Man redete über die Ereignisse des Tages, bei der Arbeit, in der Schule. Alles ganz normal und vorhersehbar. Plötzlich platzte er mit einer Frage heraus, die in dem kleinen Schlafzimmer widerhallte, als hätte er sie über eine Schlucht gebrüllt. »Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll.«
»Aber natürlich weißt du das, Schatz«, entgegnete seine Frau auf dem Ehebett neben ihm.
4
Der Anruf kam erst kurz vor 23 Uhr herein, als Detective Terri Collins gerade ernsthaft überlegte, ins Bett zu gehen. Ihre beiden Kinder schliefen bereits in ihrem Zimmer – nach den Hausaufgaben und der Gutenachtgeschichte, wie es sich gehört. Sie hatte gerade noch einmal nach ihnen gesehen, indem sie die Tür einen Spaltbreit öffnete und sich im matten Licht, das aus dem Flur auf ihre Gesichter fiel, davon überzeugen konnte, dass sie fest schliefen.
Keine Albträume. Gleichmäßiger Atem. Nicht einmal ein Schniefen, das eine Erkältung ankündigte. Sie wusste aus der Selbsthilfegruppe, die sie gelegentlich besuchte, dass manche alleinerziehenden Eltern sich von ihren schlafenden Kindern nur mühsam losreißen konnten. Es war, als ob sich all das Unheil, das diese Situation heraufbeschworen hatte, um diese Zeit ungezügelter austoben konnte, so dass sie die Stunden, die dringend für Ruhe und Entspannung benötigt wurden, mit Ungewissheit, Sorgen und Ängsten vergeudeten.
Doch an diesem Abend war alles in Ordnung und vollkommen normal. Sie ließ die Tür angelehnt und tappte gerade zum Badezimmer, als in der Küche das Telefon klingelte. Auf ihrem Weg zum Apparat sah sie auf die Wanduhr. Um diese Zeit muss es was Ernstes sein, dachte sie.
Es war der Nachtdienst der Notrufzentrale im Polizeipräsidium. »Detective, ich habe hier eine sehr beunruhigte Frau auf der anderen Leitung. Ich glaube, Sie hatten früher schon mit Anrufen von ihr zu tun. Offenbar geht es um eine Ausreißerin …«
Detective Terri Collins wusste sofort, um wen es sich handelte. Vielleicht ist Jennifer ja diesmal tatsächlich abgehauen, dachte sie. Doch das war unprofessionell, und »abgehauen« war eine wenig einfühlsame Floskel dafür, dass ein Teenager die gewohnten Schrecken gegen andere und möglicherweise schlimmere tauschte.
»Bitte warten Sie einen Augenblick«, sagte Terri. Sie wechselte mühelos von der Mutterrolle zu der der Kommissarin. Es gehörte zu ihren Stärken, dass sie die verschiedenen Bereiche ihres Lebens säuberlich voneinander trennen konnte. Allzu viele Jahre allzu großer Turbulenzen hatten bei ihr das dringende Bedürfnis nach geordneten, geregelten Verhältnissen geweckt.
Sie schaltete den Beamten der Leitstelle in die Warteschleife, während sie eine zweite Nummer wählte, die auf einer Liste neben dem Küchentelefon stand. Zu den wenigen Vorteilen der Erfahrungen, die hinter ihr lagen, gehörte es, dass sie über ein Netzwerk an potenziellen Helfern verfügte. »Hallo, Laurie, ich bin’s, Terri. Es tut mir wahnsinnig leid, dich um diese Zeit zu behelligen, aber …«
»Du wirst zu einem Fall gerufen, und ich soll auf die Kinder aufpassen?« Es schwang unverkennbar Freude in der Frage ihrer Freundin mit.
»Ja.«
»Bin gleich da. Kein Problem, mach ich gerne. Was meinst du, wie lange es ungefähr dauert?« Terri schmunzelte. Laurie litt wie kaum ein anderer an Schlaflosigkeit, und Terri wusste, dass es sie insgeheim freute, mitten in der Nacht gerufen zu werden, besonders, um auf Kinder aufzupassen, nachdem ihre eigenen erwachsen und weggezogen waren. Es gab ihr die Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als sich sinnlos bis in die tiefe Nacht Kabelfernsehen reinzuziehen oder ängstlich in ihrem dunklen Haus hin und her zu laufen und über all das, was in ihrem Leben schiefgelaufen war, Selbstgespräche zu führen. Und das Thema war, wie Terri wusste, ein abendfüllendes Programm.
»Schwer zu sagen. Mindestens ein paar Stunden, eher länger, möglicherweise die ganze Nacht.«
»Dann bring ich die Zahnbürste mit«, antwortete Laurie.
Terri drückte auf die Warteschleifetaste und meldete sich wieder bei der Polizeileitstelle. »Sagen Sie Mrs.Riggins, dass ich in ungefähr einer halben Stunde bei ihr bin, um mit ihr zu reden. Sind schon uniformierte Polizisten da?«
»Unterwegs.«
»Geben Sie ihnen Bescheid, dass ich in Kürze dort bin. Sie sollten schon mal erste Zeugenaussagen aufnehmen, damit wir den zeitlichen Ablauf rekonstruieren können. Außerdem sollten sie versuchen, Mrs.Riggins zu beruhigen.«
Allerdings bezweifelte Terri, dass ihnen das gelingen würde.
»Verstanden«, sagte der Beamte und trennte die Leitung.
Laurie würde es in einer halben Stunde zu ihr schaffen. Terri mochte die Vorstellung, dass ihre Freundin ein fester Bestandteil jeder Ermittlung oder jedes Tatorts war, zu denen Terri gerufen wurde, nicht weniger wichtig als ein Kriminaltechniker oder Fingerabdruckexperte. Es war eine harmlose kleine Phantasievorstellung. Sie kehrte ins Bad zurück, spritzte sich ein wenig Wasser ins Gesicht und bürstete sich das Haar. So spät es auch war, wollte sie inmitten der verzweifelten Panik, die ihr gleich entgegenschlagen würde, frisch, gepflegt und außerordentlich kompetent erscheinen.
Es war dunkel auf der Straße, und in den Häusern brannten nur noch wenige Lichter, als Terri durch das Viertel von Mrs.Riggins fuhr. Das einzige Haus, in dem auf den ersten Blick noch jemand wach zu sein schien, war dasjenige, zu dem sie gerufen worden war. Das Licht an der Eingangsveranda schien hell, und Terri sah, dass sich im Wohnzimmer Gestalten bewegten. Ein Streifenwagen parkte in der Einfahrt, doch die Einsatzbeamten hatten das Blaurotlicht ausgelassen, so dass sich der Wagen unauffällig unter die anderen Fahrzeuge mischte, die auf den morgendlichen Exodus zur Arbeit oder zur Schule warteten.
Terri fuhr in ihrem zerbeulten, sechs Jahre alten Kleinwagen vor. Sie blieb einen Moment sitzen, um tief durchzuatmen, dann nahm sie ihre Umhängetasche mit Mikrokassettengerät und Notizbuch. Sie heftete ihre Dienstmarke an den Riemen der Tasche. Ihre Halbautomatik befand sich im Holster auf dem Sitz neben ihr. Nachdem sie sich noch einmal vergewissert hatte, dass sie gesichert und die Patronenkammer leer war, befestigte sie die Waffe am Gürtel ihrer Jeans. Sie trat in die Nacht hinaus und lief über den Rasen zum Haus.
Sie hatte diese Fahrt im Lauf der letzten anderthalb Jahre schon zweimal gemacht. Ihr Atem bildete weiße Wolken. Es war kälter geworden, allerdings nur so viel, dass man sich in Neuengland die Jacke ein bisschen enger zog und vielleicht den Kragen hochschlug. Es war eine klare, nächtliche Kälte, nichts im Vergleich zum strengen Winterfrost, eigentlich nur eine eindeutige Warnung, dass der Frühling zwar gelegentlich versuchte durchzudringen, aber noch nicht ganz angekommen war.
Terri wünschte sich, sie wäre erst kurz drüben am Revier vorbeigefahren und hätte in ihrem Vier-Personen-Kommissariat ihre Akte über die Familie Riggins gezogen, auch wenn sie zuversichtlich war, dass sie jede Einzelheit und jede Notiz in diesen Berichten im Gedächtnis abgespeichert hatte. Sie hasste das Gefühl, in einen Tatort hineinzumarschieren, der in Wahrheit etwas ganz anderes war, als es der erste Anschein nahelegte. Eine minderjährige Ausreißerin, so würde sie es fürs Dezernat formulieren, und so würde das Kommissariat den Fall auch behandeln. Sie wusste genau, was für Schritte sie unternehmen musste und welche Vorgehensweise für einen solchen Fall von Verschwinden in den Dienstvorschriften stand. Sie hatte sogar eine vage Ahnung vom wahrscheinlichen Ausgang des Falls.
Doch das war nur die Spitze des Eisbergs, rief sie sich ins Gedächtnis. Es gab einen tieferen Grund dafür, dass Jennifer beharrlich versuchte wegzulaufen, und es stand zu vermuten, dass sich hinter ihrem unbeirrbaren Wunsch, von zu Hause wegzukommen, ein dunkles Geheimnis verbarg, vielleicht das eigentliche Verbrechen in diesem Fall. Terri hegte einfach nur wenig Hoffnung, dass sie es je ans Licht bringen würde, egal, wie viele Aussagen von der Mutter oder ihrem Freund sie aufnahm oder wie hart sie an dem Fall arbeitete. Sie hasste den Gedanken, sich mit diesem verlogenen Spiel zu arrangieren.
Auf den Eingangsstufen zögerte sie. Einen Moment dachte sie an ihre eigenen beiden Kinder, die zu Hause fest schliefen und gar nicht gemerkt hatten, dass sie nicht mit geöffneter Tür in ihrem kleinen Schlafzimmer am Ende des Flurs lag und eine gedimmte Lampe anhatte, um sofort aufzuspringen, falls sie irgendwelche seltsamen Geräusche hörte. Sie waren noch so klein, dass der Kummer und die Sorgen, die sie ihr einmal machen würden – denn wer blieb schon davon verschont –, noch in weiter Ferne lagen.
Jennifer war da um einiges weiter. In so mancher Hinsicht weiter, musste Terri denken. Wie einen letzten Schluck Wasser aus einem Glas trank sie noch einmal die Nachtluft. Sie klopfte einmal, öffnete dann selbst die Tür und trat rasch in den kleinen Flur. An der Wand neben der Treppe zu den Schlafzimmern im Obergeschoss hing, wie sie sich erinnerte, ein Foto der neunjährigen Jennifer mit rosa Schleife im sorgfältig frisierten Haar. Das Mädchen hatte eine niedliche Lücke zwischen den Schneidezähnen. Es war die Art Fotos, die Eltern liebten und Teenager hassten, weil es beide an dieselbe Zeit erinnerte, die verschiedene Linsen auf unterschiedliche Weise verzerrten.
Links sah sie im Wohnzimmer Mary Riggins und Scott West, ihren Freund, auf der Sofakante hocken. Scott hatte Mary den Arm locker um die Schulter gelegt, und er hielt ihre Hand. In einem Aschenbecher auf einem Beistelltisch mit Softdrinkdosen und halbleeren Kaffeetassen brannten Zigaretten. Ein wenig unbehaglich hielten sich zwei uniformierte Beamte im Hintergrund. Bei dem einen handelte es sich um den Sergeant der Spätschicht, bei dem anderen um einen zweiundzwanzigjährigen Neuling, der erst seit einem Monat dabei war. Sie nickte ihnen zu und registrierte den unauffälligen Blick des Sergeants zur Decke, als Mary Riggins losschluchzte: »Sie hat es wieder getan, Detective …«, und Sturzbäche folgen ließ.
Terri wandte sich der Mutter zu. Sie hatte geweint, ihr Make-up verteilte sich in schwarzen Striemen über ihre Wangen, so dass sie ein wenig an Halloween erinnerte. Ihre Augen waren verquollen, und sie sah viel älter aus, als sie war. Tränen waren für Frauen im mittleren Alter immer eine heikle Angelegenheit – sie förderten im Handumdrehen all die Jahre zutage, die sie mit aller Macht zu verbergen suchten.
Statt irgendwelche weiteren Erklärungen abzugeben, drehte sich Mary Riggins einfach nur zur Seite und vergrub den Kopf an der Schulter von Liebhaber Scott. Er war ein wenig älter als sie und sah mit seinem grauen Haar selbst in Jeans und verwaschenem, rotkariertem Arbeitshemd distinguiert aus. Er arbeitete als New-Age-Therapeut und spezialisierte sich auf die holistische Behandlung einer ganzen Bandbreite an psychiatrischen Erkrankungen. Seine Praxis florierte in akademischen Kreisen, die für neue Techniken etwa so offen waren wie Menschen, die sich von einer Diät in die andere stürzen. Er fuhr ein leuchtend rotes Mazda-Sportcabrio und war oft sogar im Winter, wenn auch in Parka und Holzfällermütze, mit offenem Verdeck zu sehen, was irgendwie die Grenze von der Exzentrik zur Fahrlässigkeit überschritt.
Die städtische Polizei war mit Scott West und seiner Arbeit bestens vertraut; er und sein Mazda handelten sich mit verlässlicher Regelmäßigkeit Knöllchen wegen Geschwindigkeitsübertretung ein, und bei mehr als einer Gelegenheit musste sich die Polizei mit den wenig erfreulichen Folgen seiner eigensinnigen Heilungsmethoden befassen. Mehrere Selbstmorde. Eine Pattsituation mit einem messerschwingenden paranoiden Schizophrenen, dem er geraten hatte, das ihm verschriebene Haldol durch Johanniskraut zu ersetzen.
Terri stufte sich als nüchterne Pragmatikerin ein, die sich vom gesunden Menschenverstand leiten ließ und Klartext redete. Wenn sie dem einen oder anderen damit gelegentlich unfreundlich erschien, dann konnte sie damit leben. Sie hatte in ihrem Leben genügend Leidenschaft und Exzentrik und Irrwitz hinter sich, um Ordnung und Regeln zu schätzen, weil die sie vor Schlimmerem bewahrten.
Scott beugte sich vor. Er sprach im routinierten Habitus des Therapeuten: tiefes, ruhiges, vernünftiges Timbre. Der Ton sollte ihn in dieser Situation als ihren Verbündeten empfehlen, während Terri wusste, dass wohl eher das Gegenteil zutraf. »Mary ist schrecklich durcheinander, Detective. Allen unseren Bemühungen zum Trotz ist es dem Mädchen schon fast zur Gewohnheit geworden …« Er sprach den Satz nicht zu Ende.
Terri wandte sich an die beiden uniformierten Polizisten. Der Sergeant reichte ihr ein Blatt liniertes Papier, wie es jeder Highschool-Schüler in seinem Ringbuchordner benutzt. Die Handschrift war sorgfältig und zeugte von dem Wunsch des Verfassers, jedes Wort klar und leserlich zu schreiben; es war nicht die hastig hingekritzelte Notiz eines Teenagers, der es nur noch eilig hatte wegzukommen. Diese Nachricht war ausgefeilt. Terri war sich ziemlich sicher, dass sie, legte sie es darauf an, verworfene frühere Fassungen im Papierkorb oder in den Mülltonnen hinterm Haus finden würde. Terri las sich den Zettel dreimal durch.
Mom,
ich geh mit ein paar Freunden ins Kino, wir treffen uns vorher in der Mall. Wir essen da was zusammen, und vielleicht schlaf ich hinterher bei Sarah oder Katie. Ich ruf dich nach dem Kino an und sag dir Bescheid, oder ich komm dann nach Hause. Es wird jedenfalls nicht allzu spät. Ich hab die Hausaufgaben gemacht und bis nächste Woche nichts Neues auf.
Sehr vernünftig. Aufs Wesentliche beschränkt. Von vorn bis hinten gelogen. »Wo haben Sie das gefunden?«
»War mit einem Magneten an der Kühlschranktür befestigt«, sagte der Sergeant. »Unübersehbar.«
Terri las die Notiz noch ein paarmal durch. Du lernst dazu, nicht wahr, Jennifer? Sie überlegte. Du hast genau gewusst, was du schreiben musst.
Kino – ihre Mutter musste folglich annehmen, dass ihr Handy ausgeschaltet sein würde, was ihr ein Zeitfenster von mindestens zwei Stunden verschaffte, in denen sie logischerweise nicht zu erreichen wäre.
Ein paar Freunde – bewusst vage, aber scheinbar harmlos. Wahrscheinlich waren die beiden, deren Namen sie angab, Sarah und Katie, bereit, für sie zu schwindeln, oder selbst nicht erreichbar.
Ich ruf dich an – damit ihre Mutter und Scott dasitzen und auf das Klingeln des Telefons warteten, so dass wertvolle Minuten verstrichen.
Keine Hausaufgaben – auf diese Weise räumte Jennifer den offensichtlichsten Vorwand ihrer Mutter aus, sie anzurufen.
Saubere Arbeit, räumte Terri ein.
Sie sah zu Mary Riggins auf. »Sie haben bei ihren Freunden angerufen?«, fragte sie.
Scott fühlte sich bemüßigt, für sie zu antworten. »Selbstverständlich, Detective. Nach den letzten Kinovorstellungen haben wir sämtliche Sarahs und Katies angerufen, die uns einfielen. Wir konnten uns beide nicht entsinnen, diese Namen schon mal von Jennifer gehört zu haben. Dann sind wir alle anderen Namen durchgegangen, die wir von ihr in Erinnerung hatten. Keiner von ihnen war in der Mall gewesen, und keiner war mit Jennifer verabredet gewesen. Oder hatte sie nach Schulschluss am Nachmittag gesehen.«
Terri nickte. Cleveres Mädchen, dachte sie erneut.
»Jennifer scheint nicht allzu viele Freunde zu haben«, sagte Mary wehmütig. »Sie hat sich schon seit der Junior High immer ein bisschen schwergetan, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.«
Diese Bemerkung nahm, wie Terri vermutete, einen Gedanken auf, den Scott in vielen »Familien«-Diskussionen geäußert hatte. »Aber könnte sie vielleicht mit jemandem zusammen sein, den Sie nicht kennen?« Mutter wie Freund schüttelten gleichermaßen den Kopf. »Sie gehen nicht davon aus, dass sie vielleicht einen Freund hat, den sie vor Ihnen beiden geheim hält?«
»Nein«, antwortete Scott. »Das hätte ich mitgekriegt.«
Klar doch, dachte Terri. Sie sagte es zwar nicht laut, machte sich aber auf ihrem Schreibblock eine Notiz.
Mary riss sich zusammen und versuchte, nicht ganz so tränenselig zu reagieren, doch vor Angst zitterte ihre Stimme. »Als ich endlich daran dachte, in ihr Zimmer zu gehen, vielleicht war da ja noch eine Nachricht oder sonst irgendein Hinweis, da hab ich gesehen, dass ihr Teddy weg war. Sie hat ihn Mister Braunbär genannt. Sie hat nachts immer damit geschlafen … er ist für sie so was wie eine Kuscheldecke. Den hat ihr Vater ihr kurz vor seinem Tod geschenkt, ohne ihn wäre sie nirgends hingegangen …«
Zu sentimental, dachte Terri. Jennifer, diesen Teddybären mitzunehmen war ein Fehler. Vielleicht der einzige, aber in jedem Fall ein Fehler. Sonst hättest du vielleicht vierundzwanzig statt sechs Stunden Vorsprung. »Ist in den letzten Tagen irgendetwas Besonderes passiert, das Jennifer dazu gebracht haben könnte, jetzt wegzurennen?«, fragte sie. »Ein schlimmer Streit? Vielleicht ein Vorfall in der Schule?«
Mary Riggins schluchzte nur. Scott West zögerte nicht mit der Antwort. »Nein, Detective. Falls Ihre Frage auf irgendeinen Vorfall mit Mary oder mir abzielt, der Jennifer zu diesem Schritt bewegt haben könnte, kann ich Ihnen versichern, dass es da nichts gibt. Kein Streit, keine Forderungen. Keine jugendlichen Wutausbrüche. Sie hatte keinen Hausarrest. Sie wurde nicht bestraft. Tatsächlich war es hier in den letzten Wochen sogar ausgesprochen friedlich. Ich hoffte schon – ihre Mutter auch –, wir wären vielleicht über den Berg.«
Das liegt daran, dass sie ihre Pläne geschmiedet hat, dachte Terri. Scotts überheblicher, anmaßender Wortschwall enthielt mindestens eine Lüge, wenn nicht mehr. Früher oder später würde sie dahinterkommen. Ob ihr die Wahrheit dabei helfen würde, Jennifer zu finden, stand auf einem anderen Blatt.
»Sie ist ein ziemlich problembehafteter Teenager, Detective. Sie ist sensibel und intelligent, aber sehr verstört und verworren. Ich habe sie gedrängt, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber bis jetzt … Sie wissen ja, wie eigensinnig Kinder in dem Alter sein können.«
Das wusste Terri. Allerdings war sie sich nicht sicher, ob Eigensinn in diesem Fall das Problem traf. »Meinen Sie, dass sie ein bestimmtes Ziel haben könnte? Würde sie zu einem Angehörigen fahren? Einer Freundin, die weggezogen ist? Hat sie je davon gesprochen, in Miami Model zu werden oder Schauspielerin in L. A.? Oder in Louisiana auf einem Fischerboot zu arbeiten? Irgendwas, egal, wie nebensächlich oder weit hergeholt es Ihnen erscheinen mag. Es wäre eine erste Spur, der wir nachgehen können.«
Terri hatte diese Fragen bereits bei Jennifers ersten beiden Ausreißversuchen gestellt. Doch da hatte Jennifer keinen solchen Vorsprung wie heute Abend geschafft, sondern war nicht weit gekommen, das erste Mal ein paar Kilometer, das zweite Mal bis in die nächste Stadt. Diesmal war es anders.
»Nein, nein …«, sagte Mary Riggins und rang die Hände, bevor sie nach einer weiteren Zigarette griff. Terri sah, wie Scott versuchte, sie davon abzuhalten, indem er ihr die Hand auf den Unterarm legte, doch sie schüttelte ihn ab, griff nach der Marlboro-Packung und zündete sich eine neue Zigarette an, obwohl eine halb gerauchte noch im Aschenbecher glimmte.
»Nein, Detective. Mary und ich haben uns das Hirn zermartert, aber uns ist nichts eingefallen, was unserer Meinung nach helfen könnte.«
»Fehlt eigentlich kein Geld? Kreditkarten?«
Mary Riggins bückte sich und nahm eine Handtasche vom Boden. Sie riss sie auf, zog eine Lederbrieftasche heraus und leerte drei Tankstellenkreditkarten, eine blaue American-Express- und eine Discover-Karte zusammen mit einem Ausweis der Stadtbibliothek und einer Discount-Karte eines örtlichen Supermarkts auf den Tisch. Sie fummelte daran herum und suchte dann hektisch jedes Fach ihrer Brieftasche ab. Als sie aufsah, kannte Terri die Antwort auf ihre Frage.
Terri nickte und überlegte. »Ich brauche das aktuellste Foto, das Sie haben«, sagte sie.
»Hier«, antwortete Scott und reichte ihr etwas, das er offenbar bereitgehalten hatte. Terri nahm das Bild und betrachtete es. Ein lächelnder Teenager. Was für eine Lüge, dachte sie.
»Ich werde auch ihren Computer oder Laptop brauchen«, sagte Terri.
»Wozu sollte das …?«, fing Scott an, doch Mary unterbrach ihn. »Ihr Laptop steht auf ihrem Schreibtisch.«
»Das ist aber ein Eingriff in die Privatsphäre«, sagte Scott. »Ich meine, Mary, wie sollen wir Jennifer erklären, dass wir der Polizei gerade gestattet haben, ihren persönlichen …«
Er sprach nicht weiter. Terri dachte: Wenigstens merkt er, wie dämlich er klingt.Aber vielleicht macht ihm das ja im Moment die geringsten Sorgen. Dann stellte sie unvermittelt eine Frage, die sie vielleicht besser für sich behalten hätte. »Wo ist ihr Vater begraben?«
Für einen Moment herrschte Stille. Selbst das fast ununterbrochene Schluchzen verstummte für eine Weile. Terri sah, wie sich Mary Riggins zusammenriss und aufrichtete, als müsse sie im Rückgrat und zwischen den Schulterblättern erst ein wenig Kraft und Stolz zusammenkratzen. »Oben am Nordufer, nicht weit von Gloucester. Aber was spielt das für eine Rolle?«
»Wahrscheinlich keine«, sagte Terri. Insgeheim dachte sie allerdings: Da würde ich hingehen, wenn ich ein wütender, depressiver Teenager wäre, der nichts sehnlicher will, als von zu Hause wegzukommen. Würde sie nicht dem einzigen Menschen, von dem sie glaubt, je wirklich geliebt worden zu sein, einen letzten Besuch abstatten, bevor sie das Weite sucht? Sie schüttelte so sacht, dass es niemand im Raum sehen konnte, den Kopf. Ein Friedhof, dachte sie, oder auch New York, der beste Ort zum Untertauchen.
5
Zuerst beachtete kaum einer der Partygäste die stummen Bilder auf dem riesigen Flachbildfernseher an der Wand der Penthouse-Wohnung mit Blick über den Gorki-Park. Es war eine Aufzeichnung eines Fußballspiels zwischen Dynamo Kiew und Lokomotive Moskau. Ein Mann mit einem großen Fu-Manchu-Bärtchen hielt die Hand hoch, um die Menge zum Schweigen zu bringen, und jemand drehte die ohrenbetäubende Techno-Musik leiser, die aus einem halben Dutzend in die Wände eingelassener Lautsprecher dröhnte. Er trug einen teuren schwarzen Anzug zu einem violetten Seidenhemd mit offenem Kragen, darunter Goldschmuck und die passende Rolex am Handgelenk. In der modernen Welt, in der Gangster und Geschäftsleute sich zum Verwechseln ähnlich sehen, konnte er das eine wie das andere, vielleicht auch beides in einem sein. Neben ihm stand eine zart gebaute Frau, die gut zwanzig Jahre jünger sein mochte als er, mit gestyltem Haar und den Beinen eines Models in einem paillettenbesetzten Kleid, das ihre knabenhafte Figur kaum verhüllte, und sagte zuerst auf Russisch, dann auf Französisch und schließlich auf Deutsch: »Wir haben erfahren, dass es auf unserem Lieblings-Web-Broadcast eine ganz neue Serie geben soll, die heute Abend beginnt. Das dürfte für viele von Ihnen von einigem Interesse sein.«
Sie legte eine Pause ein. Die Gruppe kam näher heran und machte es sich auf Sofas und Sesseln rund um den Fernseher bequem. Auf dem Bildschirm erschien ein großer Eingabepfeil, und die Gastgeberin der Party bewegte den Cursor über die Signatur und klickte mit einer Maus. Augenblicklich ertönte Musik: Beethovens »Ode an die Freude« auf einem Synthesizer. Es folgte ein Bild des sehr jungen Malcolm McDowell, der in Stanley Kubricks Uhrwerk Orange