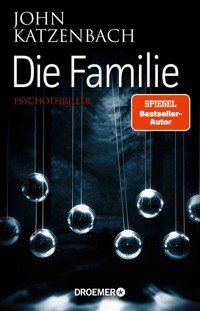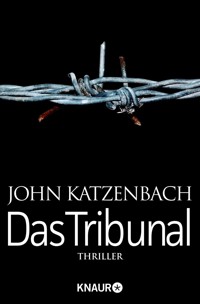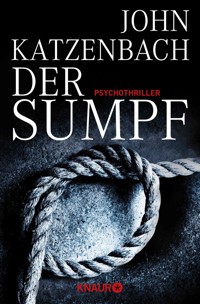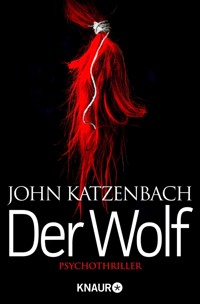
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er ist ein Mörder und erfolgloser Schriftsteller – und will mit einem spektakulären Verbrechen unsterblich werden. Seine Inspiration: das Märchen vom Rotkäppchen. Seine Opfer: drei rothaarige Frauen. In einem anonymen Brief kündigt ihnen der »böse Wolf« an, dass er sie jagen und zur Strecke bringen wird. Die Opfer wissen nichts voneinander. Und sie haben keine Ahnung, wann und wie der Täter Jagd auf sie machen wird. Zermürbt von ihrer Angst versuchen sie, ihr Leben zu retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
John Katzenbach
Der Wolf
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er ist 65, Schriftsteller, erfolglos - und will mit einem spektakulären Verbrechen unsterblich werden. Seine mörderische Inspiration: das alte Märchen vom »Rotkäppchen«. Seine Opfer: drei rothaarige Frauen zwischen siebzehn und Anfang fünfzig. In einem anonymen Brief teilt ihnen der »große böse Wolf« mit, dass er sie umbringen wird. Denn in Wirklichkeit habe das Märchen ein ganz anderes Ende.
Die Frauen wissen nichts voneinander – außer dass es noch zwei andere Opfer gibt. Und sie haben keine Ahnung, wie der Täter Jagd auf sie machen wird. Zermürbt von ihrer Angst, versuchen sie, sich gegen den Unbekannten zur Wehr zu setzen …
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Epilog
Den Lehrern am English Departmentdes Bard College, 1968 – 1972,in Dankbarkeit
Prolog
Rote Eins stand da und sah hilflos einem Mann beim Sterben zu, als ihr Brief an ihrem abgelegenen Wohnsitz auf dem Lande eintraf.
Rote Zwei war von Medikamenten, Alkohol und Verzweiflung wie benommen, als ihr Brief durch den Türschlitz ihres bescheidenen Vorstadtreihenhauses fiel.
Rote Drei starrte gerade auf einen Misserfolg und dachte darüber nach, dass ihr weitere, noch schlimmere Fehlschläge bevorstanden, während ihr Brief in dem Postfach direkt unter ihrem Zimmer im Wohnheim des Internats auf sie wartete.
Die drei Frauen waren zwischen siebzehn und einundfünfzig Jahre alt. Obwohl sie nur wenige Meilen voneinander entfernt wohnten, kannten sie sich nicht. Eine war Internistin; eine war Lehrerin an einer Mittelschule gewesen; eine war Schülerin an einer Prepschool. Sie hatten wenig miteinander gemein, bis auf ein unübersehbares Merkmal: ihr rotes Haar. Im glatten, kastanienbraunen Haar der Ärztin zeigten sich die ersten grauen Strähnen, und sie trug es streng aus dem Gesicht gekämmt. Bei der Arbeit band sie es immer zusammen. Die Lehrerin hatte üppige, leuchtend kupferfarbene Locken, die ihr wie elektrisch aufgeladen, dank ihres mangelnden Geschicks, zerzaust vom Kopf abstanden und auf die Schulter fielen. Die Schülerin war mit einem etwas helleren, verführerischen Blondrot gesegnet, einem unwiderstehlichen Rot, hätte es nicht ein Gesicht gerahmt, das jeden Tag ein wenig bleicher und zerfurchter schien, als schulterte das Mädchen eine Last, die für ihr Alter viel zu schwer wog. Die drei Frauen ahnten nicht, dass sie abgesehen von dem ins Auge springenden roten Haar weit mehr miteinander verband. Sie waren – jede auf ihre Weise – schutzlos und verwundbar.
Von außen waren die Briefe unauffällig: blickdichte, selbstklebende, weiße Umschläge, wie man sie in jeder Schreibwarenabteilung kaufen kann, und abgestempelt in New York. Die Mitteilung, die sie enthielten, war auf handelsüblichem Achtzig-Gramm-Papier mit demselben Computer gedruckt. Keine der Empfängerinnen verfügte über die forensischen Fachkenntnisse, die ihnen sagten, dass an diesen Briefen weder Fingerabdrücke noch sonst irgendwelche verräterischen DNA-Partikel, etwa von Spucke, einem Haar oder von Hautschuppen, zu finden waren, die wiederum einem versierten Ermittler mit Zugang zu einem modernen Labor Aufschluss darüber gegeben hätten, wer die Briefe abgeschickt hatte – vorausgesetzt, der Absender war in einer landesweiten DNA-Datenbank erfasst. Was der Absender nicht war. Kurz gesagt, die Briefe waren in einer Zeit des Instant Messaging, der E-Mail, des Mobilfunks und der SMS so antiquiert wie Rauchzeichen, Brieftauben oder die Morsetelegrafie. Die drei Briefe enthielten eine identische, scheinbar willkürliche Botschaft.
Dabei hielt sich der Schreiber nicht mit einer Anrede oder Einleitung auf:
Eines schönen Morgens nahm Rotkäppchen einen Korb mit allerlei Leckereien und machte sich auf den Weg zu ihrer Großmutter, die auf der anderen Seite des tiefen dunklen Waldes in einer Hütte wohnte …
Zweifellos habt ihr die Geschichte vor vielen Jahren als Kinder gehört. Allerdings haben sie euch vermutlich die bereinigte Version erzählt – wo sich die Großmutter in ihrer Kammer versteckt und Rotkäppchen dank dem wackeren Jägersmann mit seinem Messer nicht selbst zum Fraß des Bösen Wolfs wird. Diese Fassung hat einen glücklichen Ausgang, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Doch das ist nicht das ursprüngliche Märchen, das ein anderes, düsteres Ende nimmt und über die Jahre die unterschiedlichsten psychologischen Deutungen erfahren hat.
Es wäre ratsam, das in den kommenden Wochen zu beherzigen.
Ihr kennt mich nicht, aber ich kenne euch.
Es gibt drei von euch. Ich habe beschlossen, euch
Rote Eins
Rote Zwei
Rote Drei
zu nennen.
Ich weiß, dass sich jede von euch im Wald verirrt hat.
Und genauso wie das kleine Mädchen im Märchen seid ihr auserwählt zu sterben.
1
Der Böse Wolf
Auf die erste Seite schrieb er:
Kapitel 1: Auswahl
Er legte eine Pause ein, klimperte wie ein Magier bei einem Zaubertrick mit den Fingern über der Tastatur und beugte sich dann vor, um weiterzuschreiben.
Die erste – und in vielen Fällen entscheidende – Frage ist die Wahl des Opfers. Hier begehen die Gedankenlosen, die Ungeduldigen und die reinen Amateure die meisten ihrer idiotischen Fehler.
Er hasste es, in Vergessenheit zu geraten.
Es war fast fünfzehn Jahre her, seit er das letzte druckreife Wort geschrieben oder einen unschuldigen Menschen getötet hatte, und der erzwungene Ruhestand war ihm ein Greuel.
Nächstes Jahr würde er fünfundsechzig, und er rechnete nicht damit, noch allzu lange zu leben. Der Realist in ihm rief sich ins Gedächtnis, dass ein hohes Alter nicht in seinen Genen lag, auch wenn er äußerlich in bester Form war. Seine beiden Eltern waren mit Anfang sechzig an Karzinomen gestorben, seine Großmutter mütterlicherseits im selben Alter an Herzversagen, und so stand zu vermuten, dass auch ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Obwohl er schon seit Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen war, registrierte er seltsame Dauerbeschwerden, kurze, stechende, unerklärliche Schmerzen und eine seltsame Erschöpfung im ganzen Körper – klare Indizien seines Alterns und mögliche Hinweise darauf, dass in ihm etwas weit Schlimmeres heranwuchs. Vor vielen Monaten hatte er alles gelesen, was der berühmte Schriftsteller Anthony Burgess in jenem überaus produktiven Jahr zu Papier gebracht hatte, in dem man bei ihm – irrtümlicherweise – einen inoperablen, bösartigen Hirntumor festgestellt hatte. Auch ohne die Bescheinigung durch einen Arzt glaubte er, dass er in einer ähnlichen Situation stecken könnte, nur dass es bei ihm keine Fehldiagnose gab. Woran auch immer er litt, es war tödlich.
Und so war sein Entschluss gereift, in der ihm verbleibenden Zeit – seien es zwanzig Tage, zwanzig Wochen oder zwanzig Monate – etwas absolut Bedeutsames zu hinterlassen. Er musste etwas so Denkwürdiges, so Unvergessliches vollbringen, von dem man noch sprach, wenn er längst von dieser Erde abgetreten war und in der Hölle schmorte, falls es sie denn gab. Mit einem gewissen Stolz ging er fest davon aus, dass er unter den Verdammten einen Ehrenplatz einnehmen würde.
Und so fühlte er sich an dem Abend, an dem er seinen letzten Geniestreich als krönenden Abschluss in Angriff nahm, nach langer Zeit endlich einmal wieder so aufgeregt wie ein Kind vor Weihnachten. Nach der langen, erzwungenen Abstinenz eine letzte Runde zu spielen und sich mit seinem Meisterwerk ein Denkmal zu setzen erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung.
Perfekte Verbrechen gab es selten, doch sie kamen vor. Gewöhnlich waren sie weniger dem Genie der Kriminellen geschuldet als der zuverlässigen Inkompetenz der Ermittlungsbehörden, und normalerweise lief es auf die banale Frage hinaus, ob der Täter damit durchkam oder nicht. Zufällig perfekte Morde wäre wohl die angemessenere Bezeichnung, denn mit einem Mord ungeschoren davonzukommen war eigentlich keine allzu große Herausforderung. Echte perfekte Verbrechen dagegen bildeten eine Klasse für sich, und er hegte keinen Zweifel daran, dass er sich auf dem besten Wege dahin befand. Sein ausgeklügelter Plan würde ihm auf vielfältige Weise Befriedigung verschaffen.
Wenn dir das gelingt, dachte er genüsslich, wirst du Schulstoff. Sie diskutieren in Fernsehrunden darüber. Sie drehen Filme über dich. In hundert Jahren bist du so bekannt wie Billy the Kid oder Jack the Ripper. Vielleicht singt sogar irgendjemand ein Lied über dich. Keinen eingängigen, melodiösen Folksong. Eher Heavy Metal.
Mehr als irgendetwas sonst hasste er es, sich durchschnittlich zu fühlen.
Er hatte ein dringendes Verlangen nach unsterblichem Ruhm. Wann immer er im Lauf seines Lebens für kurze Zeit in den Genuss mäßiger Berühmtheit gelangt war, hatte er sich wie im Rausch gefühlt, nur dass auf jedes High die drückende Alltagsroutine gefolgt war. Er konnte sich genau erinnern, fast fünfzig Jahre war das jetzt her, wie er an der Highschool beim Football in einem Endrundenspiel im entscheidenden Moment den Ball erobert hatte. In den folgenden Tagen war er im Sportteil der Zeitung aus der Anonymität des Abwehrspielers zu plötzlichem Heldenstatus aufgestiegen und hatte eine Woche lang in den trostlosen Korridoren der Schule neidische Blicke und anerkennendes Schulterklopfen auf sich gelenkt – bis die Mannschaft am folgenden Freitagabend verlor. Später dann gewann er während seines vierjährigen, halbherzigen Studiums in einem Essaywettbewerb, der am College ausgetragen wurde, einen mit fünfhundert Dollar dotierten Preis. Sein Thema war: Wieso Kafka heute wichtiger ist denn je. Als er das Semester mit Bestnote abschloss, wurde er vom Direktor des Anglistik-Instituts besonders gewürdigt. »Scharfsinnige Argumentation und eloquenter Ausdruck«, sagte der Mann. Doch dann kamen ein neues Semester und ein Wettbewerb, den er nicht gewann, und es war vorbei. Später, nach vielen Jahren am Redaktionstisch einer Reihe von mittelgroßen Zeitungen, wo er nachts wie am Fließband die Grammatikfehler nachlässiger Reporter korrigierte, hatte ihn die Zusage eines angesehenen Verlags, seinen ersten Roman zu veröffentlichen, wie ein Stromschlag durchzuckt. Das Buch war unter einem Tusch recht positiver Rezensionen erschienen. Ein Naturtalent, hatte ein Kritiker kommentiert. Und nachdem er bei der Zeitung gekündigt hatte, um weitere Bücher zu schreiben, war er mit dem einen oder anderen Interview in einer Literaturzeitschrift oder im Feuilleton der Lokalzeitungen erschienen. Einmal hatte ein lokaler Fernsehsender einen kleinen Beitrag über ihn gebracht, als einer seiner vier Thriller zur Verfilmung vorgeschlagen wurde – auch wenn am Ende aus dem Drehbuch, das sich irgendein obskurer Autor an der Westküste aus den Fingern gesogen hatte, nichts wurde.
Doch schneller als erwartet gingen die Verkaufszahlen zurück, und selbst diese bescheidenen Erfolge verliefen im Sande, als er mit dem Schreiben ganz aufhörte. In den Buchläden, sogar auf den Ramschtischen für Restexemplare und Lagerbestände, suchte er vergeblich nach seinen Romanen. Und während er unerbittlich älter wurde, nannte ihn niemand mehr scharfsinnig oder ein Naturtalent.
Selbst das Morden hatte seinen Glanz für ihn verloren.
Die Tage schriller Schlagzeilen, das Trommelfeuer wochenlanger Zeitungskommentare voller Spekulationen war längst verstummt. Der Tod – selbst ein willkürlicher, brutaler Mord – hatte im Nachrichtengeschäft, so schien es ihm, sein Gütesiegel eingebüßt. Und der Stern des erbarmungslosen Einzeltäters war verblasst. Amokläufe irrer Psychoten, die in wildem Wahn wahllos um sich schossen, zogen die Presse immer noch magisch an. Auf das Blutbad in einem Drogenkrieg richteten sich nach wie vor die Fernsehkameras. Wenn jemand in einem Büro aus heiterem Himmel eine Schar von Kollegen niederschoss, verbreitete sich auch eine solche Heldentat in kürzester Zeit über alle Stationen. In einer Welt der kurzlebigen Sensationslust war für beharrliche, umsichtige Planung jedoch kein Platz – und so fühlte er sich zunehmend isoliert, nutzlos und ausgestoßen. Er hatte ein in Leder gebundenes Album angelegt, um die Rezensionen seiner Bücher und die Zeitungsausschnitte zu seinen vier Morden darin aufzubewahren. Vier Bücher. Vier Morde. Während er in früheren Tagen jeden Absatz genüsslich immer wieder gelesen hatte, war es ihm inzwischen zuwider, das Album auch nur aufzuschlagen. Sosehr ihn diese Morde und die Bücher, die er geschrieben hatte, einmal mit Stolz und Befriedigung erfüllt hatten, so sehr stießen sie ihm heute nur noch sauer auf.
Es nagte jede Stunde des Tages an ihm und erfüllte ihn mit zunehmender Frustration, es quälte ihn nachts mit Träumen, aus denen er schweißgebadet erwachte, dass er für seine beiden Berufungen keine stetige und größere Anerkennung geerntet hatte. In seinen Augen konnte er jedem Stephen King oder Ted Bundy das Wasser reichen, doch niemand schien das zu sehen. Die einzigen wahren Leidenschaften, die ihm blieben, waren Wut und Hass – was einer unheilbaren Krankheit recht nahekam, nur dass es hierfür keine Pille oder Spritze und keinen operativen Eingriff gab, nicht einmal die Möglichkeit einer klaren Diagnose durch Röntgen oder Kernspintomographie. So war er im Lauf des letzten Jahres, in dem er seinen ultimativen Coup akribisch vorbereitet hatte, zu der Erkenntnise gelangt, dass ihm kein anderer Ausweg blieb. Wollte er in den Jahren, die ihm blieben, in der Lage sein, lauthals über einen Witz zu lachen oder einen guten Wein zu einem exquisiten Essen zu genießen, bei einer Sportmeisterschaft mit einer Mannschaft mitzufiebern oder auch nur mit einem gewissen Optimismus einen Politiker zu wählen, dann blieb ihm gar nichts anderes übrig, als einen wahrhaft denkwürdigen Mord zu inszenieren. Nur so konnte er hoffen, seine letzten Tage mit Sinn und Leben zu erfüllen. Es würde ihm Gewicht verleihen, ihn bereichern – in jeder Hinsicht.
Planen. Ausführen. Entkommen.
Er schmunzelte bei dem Gedanken, dass dies die Heilige Dreifaltigkeit des Serienmörders war. Er war selbst ein wenig überrascht, dass er so viele Jahre gebraucht hatte, um zu erkennen, dass in dieser Gleichung ein viertes Element fehlte: darüber schreiben.
Er hämmerte energisch in die Computertastatur und stellte sich dabei vor, er säße am Schlagzeug einer Rockband – der Herzschlag der Musik.
Auch wenn ein plötzlicher, willkürlicher Mord, bei dem man einem geeigneten Opfer rein zufällig über den Weg läuft und dem Impuls folgt, durchaus etwas Bewundernswertes hat, bringen diese Taten letztlich keine wahre Befriedigung. Sie werden lediglich zu einer Art Sprungbrett, wecken den Wunsch nach mehr, werden irgendwann zum Zwang, so dass man aus Mordlust nicht mehr klar denken und planerisch vorgehen kann: der sichere Weg, sich zu verraten. Solche Taten sind unbeholfen, plump, und früher oder später klopft ein Polizist mit gezückter Waffe an deine Tür. Der beste, befriedigendste Mord ist eine Verbindung von intensiver, gründlicher Recherche, Hingabe und schließlich auch Begierde. Die Droge der Wahl ist hier die Kontrolle über die Situation. Denke weiter als die anderen, dränge deine Gegner ins Abseits, sei findiger und besser als sie – und du begehst einen in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Mord. Du wirst deine finstersten Bedürfnisse zufriedenstellen.
Genau dies habe ich mit meinen drei Rotkäppchen vor.
An dem Abend, als er die Briefe aufgab, kaufte er sich an einem kleinen Kiosk in der Nähe der Fußgängerbrücke, die an der 42. Straße in den Bahnhof Grand Central führt, ein altbackenes Croissant mit undefinierbarem Käse sowie einen Plastikbecher bitteren, brühend heißen Kaffee und bezahlte in bar. Er hatte sich eine dunkle Lederaktentasche an einem Schulterriemen umgehängt und trug einen schiefergrauen Wollmantel über seinem dunkelblauen Anzug. Sein graumeliertes, dunkles Haar hatte er aschblond getönt. Ergänzt wurde die Verkleidung durch eine dunkel umrandete Brille sowie einen falschen Lippen- und Kinnbart, beide aus einem Laden, der die Film- und Theaterindustrie mit Kostümen und Masken versorgte. Zusätzlich hatte er sich eine Schirmmütze aus Tweed tief in die Stirn gezogen. Er war davon überzeugt, dass er genug getan hatte, um jeder Gesichterkennungssoftware ein Schnippchen zu schlagen, auch wenn er ohnehin nicht damit rechnen musste, dass irgendein rühriger Ermittler darauf zurückgreifen würde.
Der Kaffee stieg ihm wohlig warm in die Nase, und er begab sich in die riesige Gewölbehalle des Bahnhofs. Die mattblaue Decke reflektierte gelbliches Licht, und er tauchte in die stetige Geräuschkulisse ein. Das Dröhnen ein- und ausfahrender Züge wirkte auf ihn wie Musikberieselung. Das Klicken seiner Schuhe auf dem blank gescheuerten Boden erinnerte ihn an einen Stepptänzer oder auch an eine Marschkolonne im präzisen Gleichschritt.
Es war der Höhepunkt der Rushhour, als er an seinem Croissant kaute und sich unter die Heerscharen der Berufspendler mischte, die mehr oder weniger alle so aussahen wie er. Auf seinem Weg zu einem Briefkasten direkt vor dem Bahnsteigeingang zu einem Pendlerzug nach New Jersey kam er an zwei gelangweilten New Yorker Polizisten vorbei. In diesem Moment hätte er sich am liebsten zu ihnen umgedreht und gerufen: »Ich bin ein Mörder!«, nur um ihre Reaktion zu sehen, doch er wusste sich zu beherrschen. Wenn die wüssten, wie nahe sie gerade einem Kapitalverbrecher waren … Bei der Vorstellung musste er unwillkürlich grinsen, denn diese Art von Ironie war Teil des ganzen Theaters. Er nahm sich vor, am Abend diese Überlegungen und Gefühle in seine Prosa aufzunehmen.
Er trug OP-Latexhandschuhe – es amüsierte ihn, dass offenbar keiner der beiden Cops dieses verräterische Detail bemerkt hatte. Wahrscheinlich haben sie mich einfach für einen Paranoiden mit Bakterienphobie gehalten. Er blieb vor einem Abfalleimer stehen, um die Reste seines Croissants und Kaffees zu entsorgen. In einer selbstverständlichen Bewegung, die er zu Hause eingeübt hatte, zog er die Tasche von der Schulter und holte drei Umschläge heraus, die er in der Hand hielt, während er sich vom Strom der Pendler zum Briefkasten treiben ließ. Mit gesenktem Kopf – er rechnete mit Kameras, die gegen potentielle Terroristen an uneinsehbaren Stellen installiert sein mochten – schob er die drei Briefe schnell durch den schmalen Schlitz, über dem ein Schild davor warnte, gefährliche Materialien einzuwerfen.
Auch darüber hätte er lauthals lachen können. Unter gefährlich verstand die Post der Vereinigten Staaten Drogen, Gift oder Flüssigkeiten, die zur Herstellung von Bomben dienten. Dabei wusste er, dass sorgfältig gewählte Worte weitaus gefährlicher sein konnten.
Manchmal, musste er denken, sind die Witze, die außer einem selbst niemand hören kann, die besten. Die drei Briefe befanden sich nun in einem der größten – und zuverlässigsten – Postverarbeitungssysteme der Vereinigten Staaten. Aus lauter Vorfreude hätte er am liebsten einen Jubelschrei ausgestoßen oder einen fernen Mond angeheult, der sich irgendwo über dem hohen Gewölbe des Grand Central verbarg. Er merkte, wie ihm das Blut in den Adern pochte und das Getöse der Züge und der Menschenmenge in den Hintergrund trat, während ihn eine eigene, wohlige Stille einhüllte. Es war, als tauche er ein in die glasklare Karibische See und betrachte die Lichtstrahlen, die diese azurblaue Welt durchzogen.
Wie der Taucher, als der er sich sah, atmete er langsam aus, während er unaufhaltsam wieder an die Oberfläche stieg.
Es geht also los, dachte er.
Dann ließ er sich von der anonymen Masse in einen vollbesetzten Pendelzug schieben. Es war ihm egal, wohin er fuhr, denn sein eigentliches Ziel lag ohnehin woanders.
2
Die drei Roten
Der Tag, an dem sie zu Rote Eins wurde, war für Dr. Karen Jayson hart genug.
Zunächst hatte sie an diesem Morgen einer Frau mittleren Alters sagen müssen, dass sie ihren Testergebnissen nach an Eierstockkrebs litt; mittags hatte sie durch einen Anruf der örtlichen Notaufnahme erfahren, dass einer ihrer langjährigen Patienten bei einem Autounfall schwer verletzt worden war; gleichzeitig hatte sie einen anderen Patienten mit einem Nierenstein ins Krankenhaus einweisen müssen, weil in diesem schweren Fall die übliche Schmerztherapie nicht griff. Anschließend hatte sie sich fast eine Stunde lang am Telefon mit einem Versicherungsangestellten herumgeschlagen, um diese ärztliche Entscheidung zu rechtfertigen. Unterdessen hatte sich ihr Wartezimmer mit Patienten gefüllt – von der Routineuntersuchung über die Mandelentzündung bis zur Grippe war alles dabei, und die Patienten, die mehr oder weniger frustriert und leidend ihre Zeit absaßen, steckten sich derweil munter gegenseitig an.
Am späten Nachmittag eines in ihren Augen ohnehin mühseligen Tags war sie in den Hospiztrakt des Altenheims »Schattenhain« gerufen worden – einer Einrichtung unweit ihrer Praxis, die weder an einem Hain lag noch besonderen Schatten bot –, um einem Sterbenden, den sie kaum kannte, letzten Beistand zu leisten. Der über neunzig Jahre alte Mann, von dem außer der Trichterbrust, den eingesunkenen Augen und einem flackernden Rest von Bewusstsein kaum etwas übrig war, klammerte sich mit der Zähigkeit eines Pitbulls ans Leben. Im Lauf ihres Berufslebens hatte Karen viele Menschen sterben sehen; für eine Internistin mit einer Zusatzausbildung in Gerontologie war das unvermeidlich. Doch auch nach so vielen Jahren Erfahrung mit dieser Situation hatte sie sich nie ganz daran gewöhnt, und obwohl sie nur neben dem Bett des Mannes stand und gelegentlich seine Tropfinfusion anpasste, war sie aufgewühlt und von ihren Gefühlen hin und her geworfen wie ein Baum im eisigen Wind. Sie wünschte sich, die Hospizschwestern hätten sie nicht gerufen, sondern diesen Todesfall alleine bewältigt.
Doch sie hatten es getan, und sie war gekommen.
Das Zimmer wirkte abweisend und kalt, obwohl die altmodischen Heizkörper auf Hochtouren liefen. Es herrschte trübes Licht, als verschaffte ein abgedunkeltes Zimmer dem Tod leichteren Zugang. Ein paar Apparate, ein verriegeltes Fenster, eine alte Nachttischlampe, zerwühlte, weiße Laken und ein schwacher Abfallgeruch waren alles, was den alten Mann umgab. Nicht einmal ein billiges, aber farbenfrohes Gemälde hing an einer der Wände, um die Trostlosigkeit des Zimmers aufzulockern. Es war kein guter Ort zum Sterben.
Zum Teufel mit den Dichtern, dachte sie, Sterben hat nicht den leisesten Hauch von Romantik, schon gar nicht in einem Altenpflegeheim, das bessere Tage gesehen hat.
»Er ist tot«, sagte die diensthabende Schwester.
Karen hatte in den letzten Sekunden dasselbe gehört: ein langsames Ausatmen, als entweiche das letzte bisschen Luft aus einem undichten Ballon, gefolgt von einem schrillen Signalton des Herzmonitors, wie man ihn aus den Ärzteserien im Fernsehen kannte. Sie beugte sich vor und schaltete nach einem prüfenden Blick auf die leuchtende grüne Linie den Apparat aus; auch die vermeintliche dramatische Spannung, konstatierte sie, ging dem routinemäßigen Sterben ab. Es erinnerte sie eher daran, wie in einem großen Zuschauerraum, nachdem das Publikum gegangen war, die Lichterreihen ausgeschaltet wurden, bis alle verloschen waren und nur noch Dunkelheit herrschte. Sie seufzte bei der Erkenntnis, dass selbst dieses Bild zu poetisch war, und flüchtete sich in die eingespielten nächsten Schritte. Auf der Suche nach einem Puls in der Carotis legte sie dem alten Mann die Finger an den Hals. Seine Haut fühlte sich wie Seidenpapier an, und ihr kam der seltsame Gedanke, dass schon die zarteste Berührung verräterische Narben hinterlassen würde.
»Todeseintritt 16 Uhr 44«, sagte sie.
Zahlen hatten mit ihrer mathematischen Verlässlichkeit etwas Befriedigendes, wie Puzzleteile, die man passgenau ineinanderfügt. Sie warf einen Blick auf die Patientenverfügung des Toten und spähte zur Schwester hinüber, die damit begonnen hatte, die Kabelanschlüsse von seiner Brust zu entfernen. »Wenn Sie mit Mister …«, sie wandte sich wieder dem Formular zu, »Wilsons Papieren fertig sind, bringen Sie mir sicher alles zur Unterschrift rüber?«
Karen schämte sich ein wenig dafür, dass ihr der Name des alten Mannes entfallen war. Ganz so anonym sollte der Tod nicht sein. Wie nicht anders zu erwarten, sah das Gesicht des Verstorbenen friedlich aus. Tod und Klischees, dachte sie, gehören einfach zusammen. Einen Moment lang fragte sie sich, was für ein Mensch Mister Wilson wohl gewesen war – eine Menge Hoffnungen, Träume, Erinnerungen und Erfahrungen, die um 16 Uhr 44 erloschen waren. Was hatte er erlebt? Familie? Schule? Krieg? Liebe? Trauer? Freude? In seinen letzten Augenblicken verriet nichts in diesem Raum, wer er gewesen war. Karen fühlte Wut in sich aufsteigen darüber, dass der Tod eine solche Anonymität mit sich brachte. Die Hospizschwester musste etwas von ihren Gefühlen bemerkt haben, denn sie beeilte sich, dem drückenden Schweigen ein Ende zu setzen.
»Schon traurig«, sagte die Schwester. »Mister Wilson war ein liebenswürdiger alter Herr. Wussten Sie, dass er nichts so sehr liebte wie Dudelsackmusik? Dabei war er kein Schotte. Ich glaube, er stammte irgendwo aus dem Mittleren Westen. Iowa oder Idaho. Schon seltsam.«
Karen vermutete, dass es zu dieser Liebe eine Vorgeschichte gab, doch die war nun unwiederbringlich verloren. »Wissen Sie von Angehörigen, die ich benachrichtigen sollte?«, fragte sie.
Die Schwester schüttelte den Kopf, sagte jedoch: »Ich muss noch mal in seinen Einweisungspapieren nachsehen. Ich weiß nur, dass wir niemanden angerufen haben, als er ins Hospiz kam.«
Die Schwester war bereits von der einen Routine – der Betreuung eines über Neunzigjährigen an der Schwelle zum Jenseits – zur nächsten Pflicht übergegangen, der ordnungsgemäßen, bürokratischen Abwicklung des Todes.
»Ich geh kurz raus, während Sie die Formulare zusammenstellen.«
Die Schwester nickte kaum merklich. Sie war mit Dr. Jaysons Gewohnheiten nach einem Todesfall vertraut: Nach einer heimlichen Zigarettenpause in der hintersten Ecke des Parkplatzes, wo die Ärztin sich – irrtümlicherweise – unbeobachtet glaubte, würde sie wieder hereinkommen, um im Hauptbüro, in dem ihr ein eigener Schreibtisch zur Verfügung stand, Kranken- und Pflegeformulare auszufüllen und anschließend mit ihrer Unterschrift unter den staatlich vorgeschriebenen Totenschein das unvermeidliche Ende eines Aufenthalts im Heim zu besiegeln. Das Altenheim lag nur wenige Blocks von dem quadratischen roten Ziegelbau des Ärztehauses entfernt, in dem Karen neben einem Dutzend anderer Kollegen der unterschiedlichsten Fachrichtungen von Psychiatrie bis Kardiologie ihre kleine Internistenpraxis betrieb. Die Schwester wusste, dass die Ärztin genau eine halbe Zigarette rauchen würde, bevor sie wieder hereinkam, um Mister Wilsons Papiere auszufüllen. In der Packung Marlboros, die Karen, wie jeder, der im Hospiztrakt arbeitete, wusste, in ihrer obersten Schreibtischschublade versteckte, hatte sie jede Zigarette sorgfältig und präzise abgemessen und die Mitte mit rotem Kugelschreiber markiert. Außerdem wusste die Schwester, dass Karen sich keinen Mantel überziehen würde, selbst wenn es in West Massachusetts in Strömen goss oder klirrend kalt war. Die Schwester vermutete, dass es für sie eine Art Bußübung war, sich den Launen des Wetters auszusetzen, eine selbst auferlegte Strafe für ihre abstoßende Sucht, mit der sie sich sehenden Auges früher oder später ins Grab bringen würde und für die praktisch jeder im Gesundheitswesen, zu dem die Ärztin gehörte, nur Verachtung übrig hatte.
Es war später Abend, lange nach der üblichen Essenszeit, als Karen in die Kieseinfahrt zu ihrem Haus einbog und an dem zerbeulten, alten Briefkasten am Straßenrand hielt. Sie lebte in einem ländlichen Teil des County, in dem die etwas teureren Eigenheime ein gutes Stück von der Straße zurückgesetzt lagen und viele davon Aussicht auf die fernen Berge boten. Wenn sich im Herbst das Laub färbte, war der Blick spektakulär, doch diese Jahreszeit war vorbei, und es herrschte kalter, nackter, nasser Winter.
Im Haus brannten sämtliche Lichter, allerdings nicht, weil jemand da war, um sie zu begrüßen; vielmehr hatte sie, da sie allein lebte und an traurigen Abenden wie diesem nicht in ein dunkles Haus zurückkommen wollte, eine Zeitschaltuhr eingerichtet. Es war zwar nicht dasselbe wie der Empfang durch eine Familie, doch gestaltete es die Heimkehr ein wenig behaglicher.
Sie hatte zwei Katzen – Martin und Lewis –, doch der arttypische Enthusiasmus, der ihr beim Nachhausekommen entgegenschlug, hielt sich, wie sie einräumen musste, in Grenzen. Bei der Wahl ihrer Haustiere hatte sie gemischte Gefühle gehegt. Sie hätte lieber einen Hund gehabt, einen Golden Retriever, der schwanzwedelnd an ihr hochsprang und seinen bescheidenen Verstand durch das Ungestüm wettmachte, mit dem er ihr seine Gefühle zeigte, doch da sie so lange arbeitete, hätte sie ein schlechtes Gewissen gehabt, besonders bei einer Hunderasse, die menschliche Gesellschaft brauchte. Die Katzen eigneten sich mit ihrer stolzen Unabhängigkeit und ihrer abgehobenen Lebenseinstellung besser für die Isolation von Karens Alltag.
Dass sie allein und weit weg von den Lichtern und dem Puls der Stadt lebte, hatte sich über die Jahre ergeben. Sie war einmal verheiratet gewesen. Es hatte nicht funktioniert. Sie hatte einen Liebhaber gehabt. Es hatte nicht funktioniert. Sie war eine Beziehung mit einer Frau eingegangen. Es hatte nicht funktioniert. Schließlich hatte sie auch One-Night-Stands mit Barbekanntschaften aufgegeben und wenig später den Internet-Vermittlungsdiensten den Rücken gekehrt, die einem mit Hilfe eines ausführlichen Fragebogens die perfekte Partnerschaft versprachen und damit lockten, dass die Liebe gleich um die Ecke auf sie wartete. Auch das hatte nicht funktioniert.
Was ihr blieb, waren ihr Beruf und ein Hobby, das sie vor den Kollegen verbarg: Sie war passionierte Komikerin, wenn auch blutige Amateurin. Einmal im Monat fuhr sie zu einem der vielleicht zehn Comedyclubs im gesamten Bundesstaat, die »Open-Mike-Abende« veranstalteten, und probierte verschiedene Nummern aus. Es war vollkommen unvorhersehbar, ob das Publikum johlen und lachen würde oder mit versteinernter Miene und verächtlich geschürzten Lippen vor ihr säße, bevor die unvermeidlichen Buhrufe ertönten und sie im gnadenlosen Scheinwerferkegel die Flucht ergreifen müsste. Karen liebte es, die Leute zum Lachen zu bringen, und sogar die peinliche Situation, von der Bühne gepfiffen zu werden, hatte für sie ihren eigenen Reiz. Beides erinnerte sie an die Brüchigkeit und Unwägbarkeit des Lebens.
Sie besaß einen kleinen Apple-Laptop mit einigen wenigen Anwendungsprogrammen, auf dem sie ihre Comedynummern schrieb und neue Witze ausprobierte. Ihr normaler Computer war voll mit Patientenakten, medizinischen Daten und dem üblichen elektronischen Kleinkram eines beschäftigten Berufstätigen. Den kleineren hielt sie vor den Kollegen, ihren wenigen Freunden und entfernten Verwandten geheim wie ihr Hobby selbst. Ihr Alter Ego als Comedian war, wie das Rauchen, eine Sucht, von der niemand wissen musste.
Die Briefkastenklappe stand der schlechten Gewohnheit des Briefträgers gemäß ein wenig offen, was oft dazu geführt hatte, dass ihre Post Schnee und Regen ausgesetzt gewesen war. Sie stieg aus, lief hinüber und nahm mit einem Griff alles heraus, ohne einen Blick darauf zu werfen. Inzwischen nieselte es, und ein paar eisige Tropfen erwischten sie im Nacken, so dass sie fröstelte. Mit ein paar eiligen Schritten war sie wieder hinterm Lenkrad, und sie fuhr energisch an, so dass unter den Rädern der Kies und das erste Eis, das sich in der Einfahrt gebildet hatte, aufspritzten.
Wie meist, wenn sie einen Totenschein unterschrieben hatte, musste sie immer wieder an den alten Menschen denken, der an diesem Tag gestorben war. Es war, als hätte er eine Art Vakuum bei ihr hinterlassen, das sie mit den spärlichen Informationen füllen musste. Dudelsack. Iowa. Sie hatte keine Ahnung, wie das zusammenpasste. Er war unter Fremden gestorben, wie freundlich die Hospizschwestern auch waren oder wie einfühlsam sie selbst gewesen sein mochte. Sie gab der Versuchung nach, zu spekulieren und sich eine Geschichte auszudenken, die ihre Neugier befriedigte.
Den Dudelsack hatte er zum ersten Mal in seiner Kindheit gehört, als ein neuer Nachbar aus Glasgow in das verwitterte Haus nebenan zog. Der Mann trank schon mal ein wenig über den Durst, und dann packte ihn das Heimweh. Wenn ihn die Sehnsucht erwischte, holte er sein Instrument aus einem Wandschrank und spielte es in der Abenddämmerung, während über dem flachen Horizont von Iowa die Sonne unterging. Der Mann vermisste die grünen Hügel und Täler seiner Heimat. Mister Wilson – der natürlich noch nicht Mister Wilson war – lag derweil in seinem Kinderzimmer und lauschte den vollen Klängen, die durch das geöffnete Fenster drangen. »Scotland the Brave« oder »Blue Bonnet«. Daher rührte Mister Wilsons Faszination. Gut möglich, dass es so gewesen war, befand Karen.
Sie überlegte. Gab das etwas für eine Nummer her? Ich habe also einen sterbenden alten Mann begleitet, der Dudelsackmusik liebte … könnte sie es so drehen, dass ihm die eigentümlichen Klänge des Instruments den Tod gebracht hatten und nicht die Gesetzmäßigkeiten des Alters?
Der Wagen kam knirschend vor der Haustür zum Stehen. Sie schnappte sich Aktentasche, Mantel sowie die Post und eilte voll bepackt durch die trübe Dunkelheit des nasskalten Abends zu ihrem Haus.
Die beiden Katzen kamen ihr zur Begrüßung gemächlich entgegen, wohl halb aus Neugier, halb aus Fressgier. Karen ging sofort in die Küche, um ihnen den Napf mit frischem Trockenfutter zu füllen, sich ein Glas Weißwein einzugießen und dann zu sehen, welche Reste im Kühlschrank nicht so lebensbedrohlich verdorben waren, dass sie sich davon etwas zum Abendessen aufwärmen konnte. Sie interessierte sich nicht sehr fürs Essen, was dabei half, drahtig zu bleiben, obwohl sie die fünfzig überschritten hatte. Sie ließ den Mantel auf eine Bank fallen und stellte ihre Aktentasche daneben. Dann lief sie zum Mülleimer, um die Post auszusortieren. Der Brief, der durch nichts weiter gekennzeichnet war als den New Yorker Poststempel, steckte zwischen einer Strom- und einer Telefonrechnung, zwei Werbebriefen für Kreditkarten, die sie nicht brauchte oder wollte, sowie Spendenaufrufen der Demokraten, der Ärzte ohne Grenzen und von Greenpeace.
Karen legte die Rechnungen auf eine Arbeitsplatte, warf die Werbung in den Papiermüll und riss den anonymen Umschlag auf.
Als sie die Nachricht las, zuckten ihre Finger, und sie schnappte laut nach Luft.
Dabei war sie von dem, was sie las, nicht einmal richtig schockiert.
Auch wenn sie wusste, dass sie allen Grund dazu hatte.
Als sie zu Rote Zwei wurde, war Sarah Locksley gerade nackt. Sie hatte zuerst die Hose ausgezogen, dann den Pullover und beides neben sich auf den Boden geworfen. Von ihrem gewohnten nachmittäglichen Cocktail aus Wodka und Barbituraten war sie ein wenig betrunken und betäubt, als der Briefträger ihr die Post durch den Schlitz in ihrer Haustür warf. Sie hörte, wie der Stapel Briefe in der Diele auf den Holzboden klatschte, und wusste, dass auf den meisten Zweite Mahnung oder Letzte Mahnung stand.
Dieser täglichen Flut an Zahlungs- und anderen Aufforderungen schenkte sie nicht die geringste Beachtung. Als sie aufstand, erhaschte sie einen Blick auf ihr Spiegelbild im Fernsehbildschirm und kam zu dem Schluss, keine halben Sachen zu machen. Also streifte sie den BH ab, schlüpfte aus dem Höschen und warf alles schwungvoll auf das Sofa in ihrer Nähe. Dann drehte sie sich vor dem Bildschirm nach links und nach rechts, um festzustellen, wie wenig von ihr übrig geblieben war. Sie fühlte sich dürr und ausgemergelt, entschieden zu dünn, und zwar nicht von einem besessenen Aerobictraining im Fitnessclub oder regelmäßigen Marathonläufen. Sie wusste, dass sie einmal sexy gewesen war und dass sie nur aus Verzweiflung so stark abgenommen hatte.
Sarah schaltete den Fernseher ein, und im selben Moment wich ihr eigenes Bild auf der Mattscheibe den vertrauten Figuren in einer Nachmittagsserie. Sie fand die Stummschaltung auf der Fernbedienung und setzte dem übertrieben rührseligen Dialog ein Ende.
Sie hatte es sich angewöhnt, zu den Bildern jeder Serie ihre eigene Geschichte zu erfinden. Sie ersetzte die Texte der Drehbuchautoren durch Worte, die ihrer Meinung nach besser angebracht waren. Für Sarah machte das die Geschichten wesentlich spannender und interessanter. Allerdings rechnete sie nicht damit, noch lange dazu in der Lage zu sein – die Big-Box-Filiale, in der sie den Apparat per Ratenzahlung gekauft hatte, würde ihn in den nächsten Wochen zurückverlangen. Dasselbe galt für die Möbel, ihren Wagen und vermutlich auch für das Haus.
Ihre Worte schienen im Raum widerzuhallen – ein wenig unscharf wie verwackelte Fotos.
Ach, Denise, ich liebe dich so …
Ja, Doktor Smith, ich liebe dich auch. Schließ mich in die Arme und zaubere mich fort von hier …
Auf dem Bildschirm hielt ein strammer, dunkelhaariger Bursche, der eher an ein männliches Model als einen Herzchirurgen erinnerte, eine Blondine umschlungen, die mit ihrer Superfigur so aussah, als hätte sie noch nie an einer schwereren Krankheit als einem abgebrochenen Fingernagel oder Schnupfen gelitten und außer zu ihren Brustimplantationen nie einen Arzt aufgesucht. Während sie die Lippen bewegten, steuerte Sarah weiter den Dialog bei.
Ja, Liebling, das werde ich … allerdings sind deine Untersuchungsergebnisse vom Labor zurückgekommen, und … ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit …
Unsere Liebe ist stärker als jede Krankheit …
Hah!, dachte Sarah. Träum weiter.
Dann dachte sie: Ich werde die reizende Denise und den gutaussehenden Doktor Smith wohl aus meinem Leben streichen.
Bei dem Gedanken stieß sie ein selbstzufriedenes Lachen aus. Mit Sicherheit war ihr Dialog wesentlich banaler und daher weitaus besser als das, was sie wirklich sagten.
Als der Abspann über den Bildschirm lief, erhob sie sich und trat ans Fenster zur Straße. Eine Weile stand sie, die Arme über dem Kopf verschränkt, völlig entblößt da und hoffte fast, einer ihrer neugierigen Nachbarn oder – besser noch – der gelbe Schulbus von der Mittelschule käme mit Schülern beladen vorbei und sie könnte der pubertierenden Schar eine richtig gute Darbietung liefern. Eine Handvoll der Kids würden sie noch aus dem Klassenzimmer kennen. Fünftes Schuljahr. Mrs. Locksley.
Sie schloss die Augen. Seht mich an, dachte sie. Worauf wartet ihr, verdammt, seht mich an!
Sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen und ihr, ohne dass sie etwas dagegen machen konnte, heiß die Wangen herunterliefen. Das war sie gewöhnt.
Bis zu dem Moment, in dem sie den Dienst quittierte, war Sarah eine beliebte Lehrerin gewesen. Falls sie einer ihrer ehemaligen Schüler heute so splitternackt am Fenster ihres Wohnzimmers sehen konnte, umso besser.
Sie hatte vor etwas mehr als einem Jahr gekündigt, an einem der letzten Tage vor Beginn der Sommerferien. Es war ein Montag, zwei Tage nach jenem strahlend warmen Morgen, an dem ihr Mann ihre dreijährige Tochter zu einer der harmlosesten Samstagserledigungen mitgenommen hatte – einer Einkaufsfahrt in den Supermarkt, um Milch und Müsli zu kaufen – und nie zurückgekehrt war.
Sarah wandte sich vom Fenster ab und starrte durchs Wohnzimmer zur Haustür, wo der Stapel Post auf dem Boden lag. Geh niemals an die Tür, dachte sie. Auch nicht, wenn es klingelt oder jemand dagegendonnert. Geh nicht ans Telefon, wenn der Anruf von einem Unbekannten kommt. Bleib einfach, wo du bist, denn es könnte ein junger Polizist sein, der seinen Smokey-Bear-Hut verlegen in der Hand hält, während er dir stockend die Nachricht überbringt. »Es hat einen Unfall gegeben, und es tut mir furchtbar leid, Ihnen das zu sagen, Mrs. Locksley …«
Manchmal fragte sie sich, wieso ihr Leben an einem so strahlend schönen Tag zerstört worden war. Es hätte Graupel oder Schneematsch herrschen müssen, eine trübe, trostlose Mischung wie heute. Stattdessen hatte an einem klaren, blauen Himmel die Sonne geschienen, und so hatte sie, als sie an jenem Morgen zu Boden fiel, den Himmel über sich abgesucht nach einer noch so kleinen, vorüberziehenden Wolke, um den Blick an irgendetwas heften zu können.
Sarah zuckte angesichts der Ungerechtigkeit die Achseln.
Sie blickte aus dem Fenster. Niemand kam vorbei. Also keine kleine Nacktdarbietung. Sie strich sich mit den Händen durch die rote Mähne und überlegte, wann sie das letzte Mal geduscht oder das zerzauste Haar durchgekämmt hatte. Ein paar Tage war es her, mindestens. Ich war mal schön. Ich war mal glücklich. Ich hatte das Leben, das ich mir wünschte.
Vorbei.
Sie wandte sich dem Stapel Briefen an ihrer Haustür zu. Die Wirklichkeit holt mich ein, stellte sie fest. Sie wünschte sich, betrunkener oder betäubter zu sein, doch sie fühlte sich vollkommen nüchtern.
Also trat sie an den Haufen Mahnbriefe heran. Ihr könnt alles haben, sagte sie. Ich will nichts davon behalten.
Der unauffällige Brief mit dem New Yorker Poststempel lag zuoberst. Sie konnte nicht sagen, wieso er ihr ins Auge sprang.
Sarah bückte sich und hob ihn auf. Zuerst hielt sie ihn für eine wirklich clevere Masche, die sich ein Gläubiger hatte einfallen lassen, damit sie reagierte. Der Stempel »Zweite Mahnung« in großen roten Lettern auf dem Umschlag bewirkte tatsächlich nur, dass sie die Forderung ignorierte. Aber gar nichts zu vermerken – also, das war geschickt. Ihre Neugier war geweckt. Paradoxe Psychologie.
Na schön, räumte sie ein, während sie träge den Umschlag aufriss. So viel muss man dir lassen. Die Runde geht an dich. Ich lese deinen Drohbrief, in dem du mich aufforderst, für etwas, das ich nicht mehr will oder brauche, Geld zu bezahlen, das ich nicht habe.
Sie las, und mit jedem Satz wurde ihr klar, dass sie an diesem Tag weder genug getrunken noch genug Pillen genommen hatte.
Als sie fertiggelesen hatte, fühlte sie sich zum ersten Mal richtig nackt.
Kurz nach der letzten Unterrichtsstunde am Vormittag wurde Jordan Ellis zu Rote Drei, und ihr war absolut elend zumute. Sie begriff ihre neue Rolle nicht sofort, da sie gerade dabei war, in einer Serie von Misserfolgen, die sich nun schon seit einem Jahr aneinanderreihten, den neuesten wegzustecken, diesmal in amerikanischer Geschichte. Sie starrte auf ihren Aufsatz, den die knappe Randbemerkung des Lehrers zierte: »Kommen Sie in meine Sprechstunde«, darunter eine schwache Vier. Sie knüllte die Blätter in der Faust zusammen, stieß einen tiefen Seufzer aus und strich sie wieder glatt. Die Note sagte wenig über ihre Fähigkeiten, so viel wusste sie. Worte, Sprache, Ideen, Sinn fürs Detail – das alles lag ihr im Blut. Vor nicht allzu langer Zeit war sie noch eine Einser-Schülerin gewesen, doch jetzt konnte sie nicht sagen, ob sie sich das für alle Ewigkeit abschminken musste.
Jordan merkte, wie die Wut in ihr hochstieg. Sie wusste, dass dies kein Einzelfall war, und dabei kam es jetzt darauf an. In Französisch würde sie durchfallen, nur mit Ach und Krach Geschichte schaffen, in Mathematik und Naturwissenschaft hoffentlich gerade noch mit einem blauen Auge davonkommen und sich in Literatur einigermaßen durchschleppen – während die Collegebewerbung wie ein Damoklesschwert über ihrem Kopf hing. Dabei war sie an dieser Anhäufung akademischer Desaster nicht schuld. Früher war ihr alles leichtgefallen. Jetzt erschienen ihr die Hürden unüberwindbar. Sie konnte sich nicht mehr konzentrieren. Sie schaffte die Arbeit nicht mehr, die ihr einmal Spaß gemacht hatte und so mühelos von der Hand gegangen war. Vor einer Woche hatte die Schulpsychologin ihr gegenübergesessen und ihr auf den Kopf zugesagt, sie verhalte sich aus Trotz selbstzerstörerisch, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Jede schlechte Note fasste sie in der einfachsten Gleichung zusammen: »Es hat Sie hart getroffen, Jordan, als Ihre Eltern Ihnen sagten, sie wollten sich scheiden lassen. Jetzt kommen Sie bitte darüber hinweg.«
Dabei war es nicht annähernd so einfach. Sie hasste Schwarzweißpsychologie. Im Weltbild der Schulpsychologin war das Leben offenbar eine Art Drahtseilakt über einem Abgrund, und Jordan war ein bisschen aus dem Tritt geraten.
Wenn sie dagegen die Landschaft ihres letzten Jahres an der Schule betrachtete, dann blickte sie inmitten von Lehm und Schlamm auf nichts als Steine und zerklüftetes Gelände. Jungen, mit denen sie einmal unbekümmert ihre ersten sexuellen Erfahrungen gemacht hatte, zogen jetzt über sie her. Mädchen, die sie einmal für Freundinnen gehalten hatte, tratschten unentwegt hinter ihrem Rücken. Die Lehrer, die sie früher wegen ihres Fleißes, ihrer Intuition und guten Arbeit gelobt hatten, behandelten sie jetzt, als wäre sie mit einem Schlag verblödet. Ihr Leben war so kompliziert, so verworren, dass sie nicht mehr weiterwusste. Ein ganz normaler Tag in Jordans Leben, sagte sie sich: am Morgen eine schlechte Note in der Klausur; beim Basketballtraining am Nachmittag den Ball so oft verfehlt, dass der Trainer dich anbrüllt und vor der nächsten Runde aus der Aufstellung nimmt; ein einsames Abendessen im Speisesaal, weil sich niemand zu dir setzen will. Wenn sie vor dem Schlafengehen keine Zahnpasta mehr hätte, würde ihr wahrscheinlich niemand auch nur einen Spritzer spendieren; und wenn es Zeit war zu schlafen, wälzte sie sich schlaflos im Bett hin und her, während sich ihr unter der Last all der Probleme die Brust zuschnürte wie bei einem Asthmaanfall. Am liebsten hätte sie sich irgendwo versteckt, aber nicht einmal das war möglich. Mit ihrem verdammten roten Haar – wie sie es hasste – stach sie aus jeder Menschentraube heraus, wo sie doch in der Anonymität untergehen wollte. Manchmal stopfte sie es sich sogar unter eine Skimütze, doch selbst das nützte nicht viel.
Sie lief mit gesenktem Kopf, zerknautschtem Parka und einem Rucksack, der ihr vom Gewicht der Bücher an den Schultern zerrte, den Fußweg zwischen dem Werkraum und den Laborräumen entlang. Der Regen war kalt und tropfte vom Efeu, der an ihrer exklusiven Privatschule die Wohngebäude der Schüler bedeckte. Wenigstens, dachte sie, passt das Wetter zu meiner Stimmung. Normalerweise waren die Gehwege Treffpunkte – die Schüler grüßten sich, blieben stehen, um über Lehrer und andere Schüler zu tratschen oder über Sport zu diskutieren. Jordan stapfte voran und war froh, dass das Wetter auch alle anderen zügig über das Netz aus geteerten Pfaden trieb, das den Campus durchzog. Es war früher Nachmittag, auch wenn der graue Himmel den Eindruck erweckte, als stünde der Einbruch der Nacht unmittelbar bevor. Statt mit den anderen zu Mittag zu essen, war sie nur kurz in die Cafeteria gehuscht, um sich eine Orange, ein Stück Weißbrot und eine kleine Milchtüte zu holen, alles in die Parkataschen zu stopfen und später ungestört in ihrem Zimmer zu essen.
Als Oberstufenschülerin hatte sie sich in einem der kleineren, umgebauten Häuser am Rande des Campus ein Einzelzimmer ohne Mitbewohner ergattert. Von außen war es mit seinem breiten Eingangsportal und der vornehmen Mahagonitreppe in der Mitte ein für Neuengland typisches, etwa hundert Jahre altes Schindelhaus. Früher einmal hatte hier der Kaplan der Lehranstalt gewohnt, und beim Betreten strömte einem ein süßlicher, sakraler Geruch entgegen. Heute hatten hier sechs Mädchen aus der Oberstufe ihre Zimmer, außerdem die Lacrosse-Trainerin der Schülerinnen und die Spanischlehrerin, eine gewisse Miss Gonzales, die auch als Heimmutter und Vertrauensperson fungieren sollte, jedoch den größten Teil ihrer Freizeit mit dem jungen Assistenten des Fußballtrainers zubrachte, einem verheirateten Mann und Vater zweier kleiner Kinder. Ihre ungezügelten – und in den Ohren der Mädchen sportlichen – Laute der Leidenschaft drangen durch die Wände sämtlicher Zimmer. Diese ekstatische Geräuschkulisse gab den Mädchen im Haus Anlass zum Lachen und zu heimlichem Neid.
Jordan schmunzelte über das ehebrecherische Stöhnen und die spitzen Schreie, die aus Miss Gonzales’ Apartment drangen. Es musste toll sein, sich so zu vergessen, ein himmelweiter Unterschied zu ihren eigenen tastenden, verlegenen Experimenten mit Jungen.
Sie schüttelte den Kopf, und langsam kehrten all die Sorgen und Probleme zurück, so dass es sich anfühlte, als hingen ihr nicht nur die Bücher im Rucksack an den Schultern. Zum ersten Mal, seit die Eltern ihr mit ihrer Nachricht einen solchen Schlag versetzt hatten, fragte sie sich ernsthaft, ob es überhaupt einen Sinn hatte weiterzumachen. Sie wusste, dass sie keine Schuld an der ganzen Misere hatte, und trotzdem kam es ihr so vor, als läge alles an ihr.
Aufgewühlt vom Chaos in ihrem Leben, betrat Jordan die Eingangshalle. Sie schüttelte sich den Kopf ein wenig ab und strich sich über den nassen Parka. Dann zog sie die Skimütze aus und ließ, weil niemand in der Nähe war, ihre Haare herunterfallen. Alle waren beim Mittagessen, und es blieb noch etwas Zeit, bevor die Sportaktivitäten am Nachmittag sie in den Schulalltag zurückbeorderten. Die Ruhe tat ihr gut, und sie trat zu dem Tisch, auf dem die Post des Wohnheims in sechs verschiedenen Ablagekästen sortiert war. Sie stellte fest, dass sich in ihrem drei Briefe befanden.
Die ersten beiden erkannte sie auf Anhieb an der Handschrift: das enge, kaum leserliche Gekritzel ihres Vaters und die schwungvollere, ausladendere Schrift ihrer Mutter. Es erschien Jordan geradezu zwingend, dass die beiden Briefe gleichzeitig eintrafen. Wieder einmal gab es einen völlig überzogenen Streit um irgendeinen dramatisierten Zankapfel zwischen den beiden. Sie lagen sich endlos in den Haaren und erlaubten ihren Anwälten, sich mit Drohungen aufzuspielen. Das entscheidende emotionale Schlachtfeld ihrer Eltern, das Waterloo, das sie wie Bonaparte und Wellington umkämpften, war Jordan. Sie brauchte die Briefe nicht zu öffnen, um zu wissen, was sie finden würde: eine Erklärung für die jeweilige nicht verhandelbare Position und die unschlagbaren Gründe, die dafür sprachen, dass Jordan sich der eigenen Auslegung der Ereignisse anschließen sollte. »Würdest du nicht viel lieber bei mir leben, Liebling, statt bei deinem Vater?« Oder: »Du weißt schon, dass im Denken deiner Mutter nur Platz für sie selber ist, nicht wahr, Schatz?«
Erst seit kurzem hatten ihre Eltern sich angewöhnt, förmlich über die Post mit ihr zu kommunizieren, nachdem beide festgestellt hatten, dass sie E-Mails ignorierte und ihr Handy, sobald die jeweilige Nummer erschien, auf Mailbox schaltete. Die taktile Präsenz des geschriebenen Wortes auf dem zartrosa gefärbten, teuren Briefpapier ihrer Mutter dagegen oder auch das gediegen schwere Geschäftspapier ihres Vaters konnte sie nicht so leicht beiseiteschieben. Aber, dachte sie, ich lerne dazu.
Sie steckte die beiden Briefe in den Rucksack. Es gab ihr ein kurzes Gefühl der Befriedigung, den ach so wichtigen Streitpunkt zwischen ihren Eltern zu ignorieren.
Der dritte Brief kam überraschend. Abgesehen von ihrem Namen und dem New Yorker Stempel gab er nichts preis. Zuerst vermutete sie dahinter einen der vielen Anwälte, die mit der Scheidung beauftragt waren, doch dann dachte sie daran, dass diese Typen grundsätzlich exklusives Briefpapier benutzten, auf dem ihr Name und ihre Adresse prangten und somit auf den ersten Blick klar war, worum es ging. Dieser Brief hier war dünn. Während sie zu ihrem Zimmer lief, die Tür öffnete und eintrat, wendete sie den Umschlag drei Mal in der Hand und sah ihn sich genau an. Sie war nicht scharf auf Post. Es waren ohnehin nie gute Neuigkeiten.
Sie ließ ihren Mantel auf den Boden fallen und warf den Rucksack aufs Bett. Dann nahm sie die Orange heraus und machte sich daran, sie zu schälen, hörte aber mittendrin auf und öffnete achselzuckend den Umschlag.
Sie las die Botschaft langsam, dann ein zweites Mal.
Als sie fertig war, sah Jordan auf, als hätte jemand mit ihr zusammen den Raum betreten. Ihre Unterlippe zitterte.
Das soll doch wohl ein Witz sein, dachte sie. Jemand spielt mir da einen üblen Streich. Das kann nicht ernst gemeint sein.
Es war die einzige nachvollziehbare Erklärung, auch wenn ihr in einem Winkel ihres Bewusstseins schwante, dass es dem Verfasser dieses Briefs nicht darum ging, etwas Nachvollziehbares zu tun.
An diesem Morgen hatte sie noch gedacht, dass man sich einsamer nicht fühlen konnte, doch jetzt wusste sie, dass das ein Irrtum gewesen war.
3
Panik Eins.
Panik Zwei.
Panik Drei.
Nach der Lektüre der Briefe geriet jede der drei Roten auf ihre eigene Weise in Panik. Sie alle wiegten sich in der Illusion, über ihre Emotionen, die plötzlich zu explodieren schienen, die Kontrolle zu bewahren. Jede von ihnen glaubte, angemessen auf die Drohungen zu reagieren, die richtigen Schritte zu unternehmen. Jede hatte das Gefühl, sie – und niemand sonst – könne für die eigene Sicherheit sorgen, falls sie überhaupt nach Sicherheit strebte. Jede versuchte die Bedrohung richtig einzuschätzen, und alle drei gelangten zu grundverschiedenen Schlüssen. Jede der drei war unsicher, ob sie in realer Gefahr schwebte oder einfach nur wütend sein sollte, auch wenn es weder für das eine noch das andere eine Erklärung zu geben schien. Jede hatte ihre liebe Not damit zu begreifen, dass die Sache ernst war, und empfand nichts als Ratlosigkeit. Jede geriet in einen Zustand der Verwirrung, ohne es zu merken.
Keine von ihnen schätzte ihre Lage annähernd richtig ein.
Als Karen Jayson nach der Lektüre der Botschaft den ersten Schock überwunden hatte, war ihr spontaner Impuls, bei der Polizei anzurufen.
Sarah Locksleys instinktive Reaktion war, die Pistole zu holen, die ihr verstorbener Mann in einer Stahlschatulle auf dem obersten Regal in seinem kleinen Arbeitszimmers aufbewahrt hatte.
Jordan Ellis sackte einfach nur auf ihr Bett und rollte sich wie unter Übelkeit und Bauchschmerzen ein, während sie überlegte, an wen sie sich in einer Welt, in der ihr niemand zuhören wollte, um Hilfe wenden konnte.
Karens Gespräch mit dem Detective verlief höchst unangenehm. Sie hatte den Brief zwei Mal gründlich gelesen und ihn dann wütend auf den Küchentisch geknallt, bevor sie das Telefon aus dem Sockel an der Wand nahm. Ihr schwirrte der Kopf, und sie konnte ihre Empörung kaum unterdrücken. Sie war es nicht gewöhnt, bedroht zu werden. Die alberne Märchenanspielung in dem Brief war ihr zuwider, und so gewann die effiziente, entschlossene, gebildete Frau in ihr die Oberhand: Ich habe nichts und niemanden zu fürchten. Und wer bist du? Der Böse Wolf? Wollen doch mal sehen. Ohne zu überlegen, was sie sagen sollte, wählte sie den Notruf.
Sie rechnete damit, dass der Mann in der Leitstelle sich bemühen würde, ihr zu helfen. Da lag sie falsch.
»Polizei, Feuerwehr, Notrufzentrale«, sagte er.
Selbst für eine solche Kurzmeldung, fand sie, klang die Stimme sehr jung.
»Hier spricht Doktor Karen Jayson, Marigold Road. Ich glaube, Sie verbinden mich am besten mit jemandem von der Kripo.«
»Um was für einen Notfall handelt es sich, Ma’am?«
»Doktor«, korrigierte sie ihn. Und bereute es augenblicklich.
»Verstehe«, hörte sie am anderen Ende. »Um was für einen Notfall handelt es sich, Frau Doktor?« Aus der Art, wie er das Wort betonte, hörte sie die Erschöpfung einer langen Arbeitsschicht heraus.
»Einen Drohbrief«, antwortete sie.
»Von wem?«
»Keine Ahnung. Er war nicht unterschrieben.«
»Ein anonymer Drohbrief?«
»Ja, genau.«
»Also, da sprechen Sie wohl am besten mit jemandem von der Kripo«, sagte der Beamte.
Mein Reden, dachte Karen, verkniff sich jedoch die Bemerkung.
Sie wartete darauf, durchgestellt zu werden. Die örtliche Polizei war klein und in einem wuchtigen roten Klinkerbau im Zentrum der nächstgelegenen Stadt untergebracht, direkt neben der Notaufnahme und Feuerwehr und gegenüber dem bescheidenen Rathaus. Sie wohnte gut fünf Meilen entfernt auf dem Lande und kam nur samstagmorgens an der Wache vorbei, wenn sie im unweit gelegenen Biomarkt einkaufte.
Vermutlich bestand die Hauptaufgabe der Ordnungshüter darin, die Geschwindigkeitsübertretungen gelangweilter Teenager auf den Highways zu ahnden, bei Handgreiflichkeiten zwischen Eheleuten einzuschreiten und mit den Drogendezernaten der größeren Städte zusammenzuarbeiten, da viele Dealer begriffen hatten, dass sie draußen auf dem Lande in aller Ruhe ihr Crystal Meth zusammenbrauen oder ihr Crack klein schnibbeln konnten, um es dann an den einschlägigen Straßen in der Stadt oder an den nahe gelegenen Colleges zu verhökern. Karen bezweifelte, dass in ihrer Kleinstadt zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als zehn Polizisten Dienst hatten oder einer darunter eine nennenswerte Ausbildung genossen hatte.
»Hier spricht Detective Clark«, meldete sich eine kräftige, nüchterne Stimme am Telefon. Mit Erleichterung stellte sie fest, dass dieser Beamte immerhin älter klang.
Sie nannte ihren Namen und erklärte dem Detective, sie habe einen Drohbrief erhalten. Sie wunderte sich, dass er sie nicht aufforderte, ihn vorzulesen, sondern eine Salve an Fragen abfeuerte, die nächstliegende zuerst.
»Haben Sie eine Vermutung, wer Ihnen den Brief geschickt haben könnte?«
»Nein.«
»Können Sie irgendwelche besonderen Merkmale entdecken, von denen Sie auf den …?«
»Nein«, fiel sie ihm ins Wort. »Einen New Yorker Poststempel, das ist alles.«
»Sie haben also keine Ahnung, um wen es sich bei dem Absender handeln könnte?«
»Nicht den leisesten Schimmer.«
»Also, hatten Sie in letzter Zeit irgendwelche Beziehungsprobleme …?«
»Nein. Seit Jahren nicht.«
»Haben Sie sich beruflich Feinde gemacht?«
»Nein.«
»Mussten Sie in jüngster Zeit einem Mitarbeiter kündigen?«
»Nein.«
»Hatten Sie Streitigkeiten mit Nachbarn? Zum Beispiel eine üble Auseinandersetzung über eine Grundstücksgrenze, oder Ihr Hund ist ausgebüxt und hat eine Katze gejagt, so was in der Art?«
»Nein, ich habe keinen Hund.«
»Ist Ihnen in den letzten Tagen oder Wochen etwas Ungewöhnliches aufgefallen, zum Beispiel anonyme Anrufe oder Fahrzeuge, die Ihnen auf dem Weg zur oder von der Arbeit gefolgt sind?«
»Nein.«
»Hat es in letzter Zeit bei Ihnen zu Hause oder im Büro Diebstähle oder Einbrüche gegeben?«
»Nein.«
»Haben Sie Ihre Brieftasche oder Kreditkarte oder sonst etwas verloren, anhand dessen man Sie identifizieren könnte?«
»Nein.«
»Wie steht es mit dem Internet? Ein Identitätsdiebstahl oder …«
»Nein.«
»Fällt Ihnen irgendjemand ein, der Ihnen aus irgendeinem Grund schaden will?«
»Nein.«
Der Detective seufzte, was Karen unprofessionell fand. Doch auch diesmal sagte sie nichts.
»Kommen Sie, Doktor, es muss da draußen irgendjemanden geben, dem Sie, vielleicht sogar ohne es zu merken, auf die Füße getreten sind. Haben Sie je einen Patienten falsch diagnostiziert? Oder jemandem eine medizinische Leistung vorenthalten, und derjenige wurde krank oder verstarb sogar? Hat Sie schon mal ein unzufriedener Patient verklagt?«
»Nein.«
»Ihnen fällt also absolut niemand ein …?«
»Nein, sag ich ja, nein.«
Der Detective schwieg einen Moment, bevor er fortfuhr.
»Und könnte es sein, dass Ihnen jemand einfach einen Streich spielen will?«
Das bezweifelte Karen. Ein paar der Comedians, die sie in den Clubs traf, hatten zwar einen etwas schrägen Sinn für Humor, und es konnte vorkommen, dass über die Konkurrenten mit Witzeleien hergezogen wurde, die durchaus etwas Sadistisches hatten und verletzten – doch ein Brief wie der auf dem Küchentisch ging entschieden über jeden Spaß hinaus, den sich selbst der schrillste Vogel einfallen lassen würde. »Nein. Und ich finde die Sache auch nicht besonders komisch.«
Sie sah im Geiste vor sich, wie der Detective am anderen Ende der Leitung die Achseln zuckte. »Also, ich fürchte, im Moment können wir da nicht allzu viel tun. Ich kann dafür sorgen, dass die Streifenwagen routinemäßig ein bisschen häufiger Ihre Straße abfahren. Ich werde die Angelegenheit bei unserer Tagesbesprechung erwähnen. Aber solange es keine offenkundige Tat gibt …«
Der Polizist sprach den Satz nicht zu Ende.
»Der Brief ist keine offenkundige Tat?«
»Ja und nein.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Na ja«, fuhr der Detective in einem Ton fort, der nach einem Vortrag vor einer Highschoolklasse über die Polizeiarbeit klang, »eine schriftliche Drohung stellt eine Straftat zweiten Grades dar. Aber Sie sagen, Sie haben keine Feinde – jedenfalls nicht, dass Sie wüssten –, und Sie haben nichts getan, das eine solche Drohung erklären könnte. Und es ist nichts weiter passiert – außer diesem Belästigungsbrief …«
»Meinen Sie nicht, Detective Clark, dass es mehr als eine Belästigung ist, wenn Ihnen jemand sagt, Sie seien ausgewählt worden zu sterben?«
Karen wusste, dass sie übertrieben steif und gestelzt klang. Sie hoffte, den Polizisten damit ein bisschen auf Trab zu bringen, doch es hatte die gegenteilige Wirkung.
»Doktor, ich würde das eher als einen bizarren Vorfall verbuchen oder jemandem mit einem lausigen Sinn für Humor zuschreiben, irgendwem, der Ihnen aus welchem Grund auch immer ein kleines bisschen Angst einjagen möchte, und die Sache vergessen, bis tatsächlich etwas passiert. Es sei denn, Sie sehen, wie Ihnen jemand folgt, oder Sie stellen fest, dass Ihr Bankkonto geplündert wurde oder so was in der Art. Oder jemand fordert Geld von Ihnen. In so einem Fall …«
Er zögerte, bevor er fortfuhr. »Bei den Fällen von Bedrohung, die wir zu sehen bekommen, handelt es sich meistens um einen Stalker. Jemanden mit einer Obsession für einen Lehrer oder einen Kollegen, den früheren Freund beziehungsweise die Freundin. Aber es ist immer eine Person, mit der man in Beziehung gestanden hat. Die Drohung ist im größeren Zusammenhang eines zwanghaften Verhaltens zu sehen. Aber davon kann hier offenbar nicht die Rede sein, oder? Haben Sie das Gefühl, dass Sie jemand verfolgt?«
»Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
»Also, überlegen Sie mal. Ist bei Ihnen sonst irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen?«
»Nein.«
»Sehen Sie.«
»Sie meinen, ich kann absolut nichts dagegen tun?«
»Nein. Ich meine, es gibt nichts, was wir tun können. Selbstverständlich sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Haben Sie eine Alarmanlage im Haus? Falls nicht, legen Sie sich lieber eine zu. Vielleicht schaffen Sie sich einen großen Hund an. Halten ein wachsames Auge auf die Leute, mit denen Sie in den letzten Monaten in Kontakt gekommen sind. Stellen Sie eine Liste von allen zusammen, denen Sie möglicherweise auf den Schlips getreten sind oder die einen Groll gegen Sie hegen könnten. Kann auch nicht schaden, mal Ihre Patienten unter die Lupe zu nehmen und deren Familien mit einzubeziehen. Vielleicht hat jemand, den Sie nicht allzu erfolgreich behandelt haben, einen psychotischen Schwager oder Cousin, der gerade aus dem Knast entlassen wurde. Denken Sie einfach nach. Normalerweise sieht der Bedrohte nicht, wer ihm das antut, obwohl er ihn vor der Nase hat; weil er ihm so was einfach nicht zutraut. Sie könnten sich natürlich auch einen Privatdetektiv nehmen und sehen, ob sich der Brief zurückverfolgen lässt – ist allerdings verdammt schwierig. Eine E-Mail – das eher. Aber ein altmodischer Brief? Selbst das FBI kommt da schon mal ins Schleudern. Erinnern Sie sich an diese Anthrax-Briefe? Oder den Unabomber? Das hat denen mächtig zu schaffen gemacht, trotz der modernsten technischen Mittel. Und hier in unserer kleinen Stadt haben wir natürlich nicht mal einen Bruchteil von deren Ressourcen und Personal. Was sag ich, nicht mal die Staatspolizei. Aber ich an Ihrer Stelle würde als Erstes diese Liste machen von Leuten, die vielleicht aus irgendeinem Grund sauer auf Sie sind, denn da könnte einer dabei sein, von dem Sie einfach keine Ahnung haben. Höchstwahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Wenn Sie mir einen Namen geben, von mir aus auch zehn, also, ich hab kein Problem damit, da mal vorbeizuschauen und Klartext mit denen zu reden. Ihnen so richtig Feuer unterm Hintern zu machen, im Namen des Bundesstaates Massachusetts. Bis dahin …«
»Sie meinen, die Drohung, jemanden umzubringen, ist kein Verbrechen, das Sie aufklären wollen?«
»Ich werde einen Bericht schreiben, damit Ihre Meldung aktenkundig wird. Aber ehrlich gesagt, Frau Doktor, sind leere Drohungen an der Tagesordnung.«
»In diesem Fall wirkt es nicht wie eine leere Drohung.«
»Nein, aber wer kann das schon sagen? Wahrscheinlich ist es nichts.«
»Ja«, sagte Karen. »Wahrscheinlich.«
Sie legte auf. Oder doch, fügte sie stumm hinzu.
Sarah Locksley zitterte, als sie langsam das kleine Büro ihres toten Mannes betrat. Es war ein schmaler Raum mit einem einzigen Fenster, an dem die Jalousien geschlossen waren, und einem verkratzten alten Eichenschreibtisch mit einem veralteten Computer darauf. Hier hatte er ihre Steuererklärung gemacht, ihre Rechnungen bezahlt und ab und zu an seinen Memoiren über die gefährlichen Monate zu Beginn des Irakkriegs geschrieben, in denen er Versorgungslaster und Schwermaschinen vom Flughafen nach Bagdad und zurück gefahren hatte. Von Anfang an hatten sie geplant, es in ein zweites Kinderzimmer umzufunktionieren, wenn sie wieder schwanger würde.