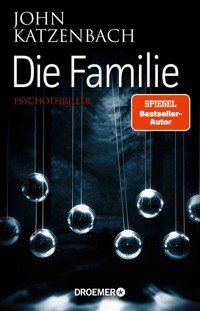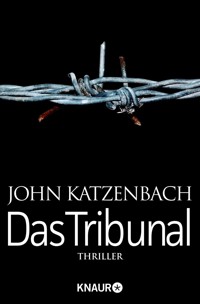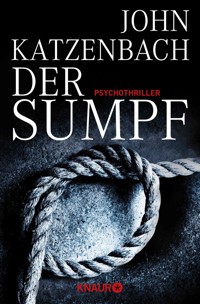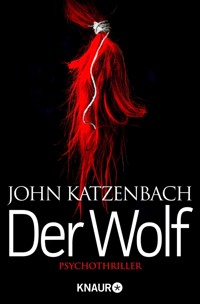9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein psychopathischer Serienkiller entführt die Literaturstudentin Anne Hampton und macht sie sich mit diabolischer Raffinesse gefügig. Anne hat keine Wahl: Entweder wird sie die Chronistin seiner Morde – oder sein nächstes Opfer. Detailversessen hält Doug Jeffers, ihr Peiniger, seine brutalen Morde mit der Kamera fest. Aber Fotos allein genügen ihm nicht mehr. Er möchte seine Taten auch mit Worten besungen wissen – und Anne ist sein Werkzeug. Ihre einzige Chance ist Detective Mercedes Barren aus Miami, deren Nichte der Fotograf ebenfalls auf dem Gewissen hat … Der Fotograf von John Katzenbach: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 845
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
John Katzenbach
Der Fotograf
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Für Maddy
»Na, ich habe noch [...]
1. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
2. Kapitel
4. Kapitel
3. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
4. Kapitel
7. Kapitel
5. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
6. Kapitel
11. Kapitel
7. Kapitel
12. Kapitel
8. Kapitel
13. Kapitel
9. Kapitel
14. Kapitel
10. Kapitel
15. Kapitel
11. Kapitel
16. Kapitel
12. Kapitel
17. Kapitel
13. Kapitel
18. Kapitel
14. Kapitel
19. Kapitel
Für Maddy
»Na, ich habe noch nie gehört, dass der Teu – dass Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt haben«, sagte Daniel Webster überrascht.
»Wirklich nicht?«, fragte der Fremde mit seinem abscheulichen Lächeln. »Nun, wer hätte wohl ein besseres Recht darauf als ich? Als dem ersten Indianer das erste Unrecht geschah, war ich dabei. Als das erste Sklavenschiff nach dem Kongo aussegelte, stand ich an Deck. Bin ich nicht in euren Büchern und Geschichten und Überlieferungen, seit die erste Siedlung steht? Wird nicht in jeder Kirche Neu-Englands ständig von mir gesprochen? Zugegeben, der Norden behauptet, ich sei Südstaatler, aber ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin recht und schlecht Amerikaner, wie Sie selbst, Herr Webster, und ich bin von bester Herkunft – denn, um die Wahrheit zu sagen, Herr Webster, obwohl ich nicht gerne damit prahle, mein Name ist in diesem Lande erheblich älter als der Ihre!«
Stephen Vincent Benét, Daniel Webster und die Seeschlange
1. Kapitel
Die Gründe für Detective Barrens Obsession
1.
Sie träumte schlecht.
Sie sah ein treibendes Boot, zuerst von fern, dann plötzlich aus der Nähe, bis sie merkte, dass sie selbst in diesem Boot saß und ringsum von Wasser eingeschlossen war. Zuerst empfand sie Panik; sie wollte nach jemandem suchen und ihm klarmachen, dass sie nicht schwimmen konnte, doch jedes Mal, wenn sie sich umsah, verlor sie fast den Halt, die Jolle hob sich auf dem bewegten Wasser und verharrte einen Moment lang auf einem Wellenkamm, bevor sie beängstigend tief hinuntertauchte. Als sie sich mit aller Macht am Mast festklammerte, schrillte plötzlich eine Sirene, und sie wusste, dass dies ein Leck im Rumpf signalisierte und dass ihr jeden Moment das Wasser bis zu den Knöcheln stehen würde. Die Sirene dröhnte weiter, und sie machte den Mund auf, um verzweifelt um Hilfe zu rufen, während sie sich auf dem schwankenden Boden mühsam aufrecht hielt.
Im Traum legte sich die Jolle plötzlich schräg, und sie herrschte ihr schlafendes Selbst an, Wach auf! Wach auf! Bring dich in Sicherheit!
Genau das tat sie auch.
Sie schnappte nach Luft, riss sich aus dem Halbschlaf und saß im nächsten Moment senkrecht, während sie mit der rechten Hand das Bettgestell packte – ein fester Halt inmitten der diffusen Ängste aus ihrem Traum. Erst jetzt merkte sie, dass das Telefon klingelte.
Sie fluchte, rieb sich die Augen und fand den Apparat ein Stück weit entfernt auf dem Boden. Mit einem Räuspern meldete sie sich: »Detective Barren. Was gibt’s?«
Ihr blieb keine Zeit, sich zu fragen, was passiert sein könnte. Sie lebte allein – kein Ehemann, keine Kinder, die Eltern längst tot, und so konnte sie ein Anruf mitten in der Nacht nicht so leicht wie die meisten Menschen, die beim ersten Klingeln im Dunkeln eine schlimme Nachricht befürchtet hätten, in Angst und Schrecken versetzen. Da sich Verbrechen nicht an die Bürozeiten hielten, musste eine Kripobeamtin damit rechnen, nachts aus dem Bett geholt zu werden. Deshalb vermutete sie, dass im Zuge einer Ermittlung ihr fachliches Können als Kriminaltechnikerin gefragt war.
»Merce? Haben Sie schon geschlafen?«
»Ja, aber macht nichts. Wer ist da bitte?«
»Merce, Robert Wills vom Morddezernat, ich …« Er brach mitten im Satz ab. Detective Barren wartete.
»Wie kann ich helfen?«, fragte sie.
»Merce, es tut mir sehr leid, dass ich es Ihnen sagen muss …«
Wie in einer Momentaufnahme sah sie Bob Wills an seinem Schreibtisch im Morddezernat sitzen. Es war ein karges, nüchternes Großraumbüro im grellen Neonlicht, mit Aktenschränken aus Metall und orange leuchtenden Schreibtischen, deren Signalfarbe auf ihre Weise die entsetzlichen Geschichten spiegelte, die sie in den Gesprächen der Kollegen untereinander oder auch bei Zeugenbefragungen anhören mussten.
»Was?«
Für einen Moment war sie seltsam erregt – im Gegensatz zu der hilflosen Panik in ihrem Alptraum spürte sie jetzt so etwas wie einen Nervenkitzel, eine gespannte Erwartung. Als ihr Anrufer weiterhin schwieg, breitete sich ein Vakuum in ihrem Magen aus, dann ein flaues Gefühl. »Worum geht es?«, fragte sie und merkte, wie sich die neue Empfindung in ihrer Stimme niederschlug.
»Merce, Sie haben eine Nichte …«
»Ja, verdammt. Susan Lewis. Sie studiert an der Uni. Was ist mit ihr? Hatte sie einen Unfall?«
In diesem Moment traf sie die Erkenntnis mit aller Wucht: Bob Wills vom Morddezernat. Mord. Mord. Mord. Und sie wusste, worum es bei dem Anruf ging.
»Es tut mir leid«, wiederholte Wills, doch seine Stimme kam wie aus der Ferne, und einen Moment lang wünschte sie sich in ihren Traum zurück.
Detective Mercedes Barren zog sich rasch an und machte sich durch die spätsommerliche Nacht zu der Adresse auf den Weg, die eine fremde Hand notiert zu haben schien; obwohl ihr Herz raste, hatte diese Hand sorgfältig auf dem Block Zahlen und Buchstaben aneinandergereiht. Auch das Gespräch mit dem Kollegen vom Morddezernat hatte jemand anders beendet. Währenddessen hatte Merce miterlebt, wie jemand mit ihrer eigenen, ausdruckslos gepressten Stimme nach den näheren Umständen, nach dem Ermittlungsstand, den Namen der mit dem Fall befassten Beamten, nach dem vermutlichen Tathergang und ersten Theorien fragte, die man verfolgen wollte. Nach Zeugenaussagen. Beweismaterial. Hartnäckig widersetzte sich dieser Jemand Detective Wills Ausweichmanövern und begriff sehr schnell, dass der zwar nicht zuständig war, ihr aber sagen konnte, was sie wissen wollte. Dabei schrie alles in ihr auf, und es kostete sie die größte Kraft, ihre Qual zu unterdrücken, die sich in einem lauten Schluchzen Luft machen wollte.
Sie gestattete sich nicht einen einzigen Gedanken an ihre Nichte.
Einmal wurde sie auf ihrem Weg durchs Stadtzentrum eine Sekunde lang von den Scheinwerfern eines Sattelschleppers geblendet, der mit wildem Hupkonzert gefährlich nah aufgefahren war, und sie ertappte sich dabei, wie sie die Angst vor einer Kollision durch die Erinnerung an ihre letzte Begegnung mit Susan vor zwei Wochen verdrängte. Sie hatten sich am Pool des kleinen Apartmenthauses gesonnt, in dem Detective Barren wohnte, und Susan hatte ihren Dienstrevolver entdeckt, der sich etwas unpassend zwischen Handtüchern, Sonnenmilch, einer Frisbee-Scheibe und einem Taschenbuchroman im Strandbeutel befand. Detective Barren musste an die Reaktion des Teenagers denken: Sie hatte die Waffe als abstoßend bezeichnet, was es in den Augen ihrer Besitzerin präzise traf.
»Wieso musst du sie überhaupt mitschleppen?«
»Weil wir genau genommen nie außer Dienst sind. Falls mir ein Verbrechen unter die Augen kommt, muss ich wie eine Polizistin reagieren.«
»Aber ich dachte, das brauchst du jetzt nicht mehr, ich meine, seit …«
»Stimmt. Seit der Schießerei nicht mehr. Nein, ich bin jetzt eine ziemlich gezähmte Polizistin. Bis ich zu einem Verbrechen gerufen werde, ist alles schon gelaufen.«
»Igitt. Leichen, oder?«
»Richtig. Igitt ist ebenfalls richtig.«
Sie hatten gelacht.
»Wär schon komisch«, hatte Susan gemeint.
»Was wäre komisch?«
»Von einer Polizistin im Bikini verhaftet zu werden.«
Sie hatten wieder gelacht. Ihre Nichte war aufgestanden und kopfüber in das blaue Wasser des Pools gesprungen. Detective Barren hatte Susan dabei beobachtet, wie sie mühelos unter Wasser bis zum gegenüberliegenden Beckenrand glitt, dann, ohne einmal aufzutauchen, wendete und wieder zum Ausgangspunkt zurückschwamm. Der Anflug von Eifersucht auf ihre Jugend war ebenso schnell verflogen, wie er gekommen war; schließlich war sie selbst auch ganz gut in Form.
Susan hatte die Arme auf dem Beckenrand verschränkt und ihre Tante gefragt: »Merce, wie kommt es eigentlich, dass du direkt am Meer wohnst und nicht schwimmen kannst?«
»Das bleibt mein süßes Geheimnis«, hatte sie erwidert.
»Kann ich nicht nachvollziehen«, hatte Susan erklärt, während sie aus dem Pool stieg und das Wasser von ihrem schlanken Körper floss. »Habe ich dir übrigens erzählt, dass ich diesen Herbst Meereskunde als Hauptfach wähle? Mit Sicherheit glitschige Fische.« Sie hatte gelacht. »Stachelige Krustentiere. Riesige Säuger. Jacques Cousteau, jetzt komm ich.«
»Das ist großartig«, hatte die Polizistin geantwortet. »Bei deiner Liebe zum Wasser.«
»Allerdings. Oh for a life of the sun, the sand, the deep blue sea and fish guts for me«, hatte Susan geträllert.
Wieder hatten sie gelacht.
Susan hatte immer gelacht, dachte die Polizistin und gab Gas. Sie tauchte in das Lichtermeer des Stadtzentrums ein und bahnte sich ihren Weg zwischen den Hochhäusern, die in den südlichen Himmel ragten. Obwohl ihr ein heißer Stich mitten durchs Herz ging, so dass ihr die Luft wegblieb, zwang sich Detective Barren, konzentriert zu fahren und sämtliche Erinnerungen aus dem Kopf zu verbannen, um klar denken zu können: Sieh dir alles genau an, mach dich gleich auf die Suche. Sie musste nur darauf achten, den Anblick, der sie erwartete, streng von ihren Erinnerungen zu trennen.
Detective Barren bog von der Route I ab und gelangte in eine Wohngegend. Es war spät, schon weit nach Mitternacht, und bis zum Morgengrauen blieben nur wenige Stunden. Es herrschte wenig Verkehr, und sie war schnell gefahren – getrieben von dem Gefühl der außerordentlichen Dringlichkeit, das einen gewaltsamen Tod stets begleitet. Wenige Kilometer vor dem Ziel drosselte sie jedoch unvermittelt das Tempo, bis ihr unscheinbarer Mittelklassewagen nur noch im Schneckentempo kroch. Sie suchte die Reihen der gepflegten, gutbürgerlichen Häuser nach Lebenszeichen ab. Die Straßen waren leer, die Häuser dunkel. Hier und da brannte in einem Zimmer noch Licht, und Merce fragte sich, welches Buch oder Fernsehprogramm, welcher Streit oder welche Sorgen den Bewohner vom Schlaf abhielten. Am liebsten hätte sie vor einem dieser Häuser angehalten, geklingelt und gefragt: »Haben Sie Kummer? Quält Sie eine Erinnerung, sind Sie deshalb noch wach? Möchten Sie vielleicht darüber reden?«
Sie bog in die Old Cutler Road ein und wusste, dass der Eingang zum Park nach wenigen hundert Metern kommen musste. Das Dunkel schien im Laub zu nisten; große Teebäume und Weiden versteckten zwischen ihren Blättern und Zweigen etwas von der Nacht. Wie Arme streckten sie ihre Äste über die Straße. Detective Barren hatte plötzlich das unheimliche Gefühl, vollkommen allein auf der Welt zu sein – die einzige Überlebende, die ziellos durch die Finsternis irrte. Die verblassten Buchstaben auf dem kleinen Eingangsschild waren kaum zu erkennen. Als ein Opossum vor die Räder ihres Wagens lief, schrak sie zusammen, trat heftig auf die Bremse und atmete erleichtert aus, als sie merkte, dass die Kreatur noch einmal davongekommen war. Sie kurbelte die Scheibe herunter und roch Salz in der Luft. Die Bäume in ihrer Umgebung waren geschrumpft: Die riesigen Palmen, welche die Autobahn gesäumt hatten, waren dem knorrigen, verknäulten Geäst der Mangroven gewichen. Die Straße beschrieb eine scharfe Kurve, und Merce wusste, dass dahinter die weitläufige Biscayne Bay auftauchen würde.
Zuerst dachte sie, das Wasser in der Bucht glitzere unter dem Mond.
Doch sie irrte sich.
Sie hielt abrupt an und starrte hinüber. Zuerst drang das Dröhnen mächtiger Generatoren in ihr Bewusstsein. Deren rhythmisches Stampfen speiste drei Reihen Scheinwerferlampen. Das grelle Flutlicht schnitt aus der Dunkelheit am Parkplatzrand eine Bühne, auf der sich Dutzende uniformierte Polizisten und Kripobeamte vorsichtig bewegten. Außerhalb des Lichtkegels waren einige Streifen-, ein Krankenwagen und die weißgrünen Fahrzeuge der Spurensuche abgestellt, deren blaurote Lichtblitze die arbeitenden Gestalten für Sekundenbruchteile bannten.
Detective Barren holte tief Luft und fuhr zu dem erleuchteten Abschnitt der Bucht hinunter.
Sie parkte am Rande des Geschehens und machte sich zu Fuß auf den Weg zur Mitte der Bühne, wo eine Gruppe Männer zusammenstand und etwas betrachtete, auf das ihr die Sicht versperrt war. Sie wusste, worum es sich handelte, doch das war eine sachliche Feststellung, ein Erfahrungswert ohne emotionale Anteile. Die Stelle war weitläufig mit gelbem Flatterband abgesperrt. Alle drei, vier Meter hing ein Schild daran: POLIZEILICHEABSPERRUNG – ZUTRITTVERBOTEN. Sie hob das Band hoch und schlüpfte darunter hindurch. Die Bewegung zog die Aufmerksamkeit eines Beamten in Uniform auf sich, der rasch auf sie zukam und sie mit ausgestreckten Händen aufzuhalten versuchte.
»Hören Sie«, sagte er. »Sie können da nicht rein.«
Sie starrte ihn an und blieb stehen.
Er ließ die Hände sinken.
Betont langsam öffnete sie ihre Handtasche und zog ihre Polizeimarke heraus.
Er warf einen kurzen Blick darauf und murmelte eine Entschuldigung. Inzwischen hatten auch die Männer in der Mitte des abgesperrten Bereichs ihre Ankunft bemerkt. Einer von ihnen löste sich aus der Gruppe und kam auf sie zu.
»Merce, um Gottes willen. Hat Wills Ihnen nicht gesagt, dass Sie nicht herkommen sollen?«
»Doch«, erwiderte sie.
»Hier gibt es nichts für Sie zu tun.«
»Woher zum Teufel wollen Sie das wissen?«
»Merce, tut mir leid. Das muss …«
Wütend fiel sie ihm ins Wort.
»Muss was sein? Schwer? Traurig? Schwierig? Tragisch? Was glauben Sie?«
»Beruhigen Sie sich erst mal. Hören Sie, Sie wissen, was wir jetzt tun. Können Sie einfach ein paar Minuten warten? Ich hole Ihnen eine Tasse Kaffe.« Er versuchte, sie am Ellbogen zu fassen und wegzuführen, doch sie schüttelte seinen Griff ab.
»Versuchen Sie nicht, mich aus dem Verkehr zu ziehen, verflucht noch mal!«
»Nur ein paar Minuten, dann erhalten Sie von mir einen umfassenden Bericht …«
»Ich will keinen Bericht, ich will sie selbst sehen.«
»Merce …« Der Detective breitete die Arme aus und versuchte immer noch, ihr den Blick zu verstellen. »Lassen Sie es sein.«
Sie holte tief Luft und schloss die Augen. Dann sagte sie, indem sie jedes Wort einzeln betonte: »Peter. Lieutenant Burns. Zwei Dinge. Punkt eins, das da drüben ist meine Nichte. Punkt zwei, ich bin Polizistin von Beruf. Ich will es selbst sehen, mit eigenen Augen!«
Der Lieutenant hielt inne. Er blickte sie an.
»Na schön. In ein paar Minuten ist der Gerichtsmediziner mit seiner vorläufigen Untersuchung fertig. Wenn sie Ihre Nichte auf eine Trage legen, können Sie rüberkommen. Wenn Sie wollen, können Sie sie dann auch offiziell identifizieren.«
»Nicht erst in ein paar Minuten und nicht auf einer Trage. Ich will sehen, was mit ihr passiert ist.«
»Merce, verdammt …«
»Ich will es sehen.«
»Wozu? Das macht es nur schwerer für Sie.«
»Woher zum Teufel wollen Sie das wissen? Wie sollte das irgendetwas schwerer machen?«
Hinter dem Lieutenant blitzte ein Licht auf. Er drehte sich um, und Detective Barren sah, wie ein Polizeifotograf aus unterschiedlichen Positionen Aufnahmen machte. »Jetzt«, erklärte sie. »Ich will sie jetzt sehen.«
»Okay«, gab der Lieutenant nach und trat beiseite. »Es ist Ihr Alptraum.«
Sie marschierte energisch an ihm vorbei.
Dann blieb sie stehen.
Sie holte tief Luft.
Sie schloss die Augen und stellte sich das Lächeln ihrer Nichte vor.
Noch einmal atmete sie tief durch, dann trat sie zum Leichnam. Präg dir alles ein, befahl sie sich. Brenn es dir ins Gedächtnis ein! Sie zwang sich, rund um die Gestalt, die sie immer noch nicht in den Blick zu nehmen wagte, den Boden abzusuchen. Sandboden und Blätter. Nichts, was einen klaren Schuhabdruck hergab. Mit geübtem Blick schätzte sie die Entfernung zwischen dem Parkplatz und der Gestalt ab – das Wort Leiche konnte sie nicht einmal denken. Zwanzig Meter. Eine gute Stelle, um eine Tote loszuwerden. Sie versuchte, analytisch vorzugehen: Es gab ein Problem. Es war für die Ermittler immer leichter, wenn – wieder stolperte sie über den Begriff – das Opfer an der Stelle gefunden wurde, an der es getötet worden war. Unweigerlich würde man Indizien finden.
Während sie weiter den Boden absuchte, hörte sie hinter sich die Stimme des Lieutenant: »Merce, wir haben alles genau abgesucht, Sie brauchen wirklich nicht …« Doch sie ignorierte ihn, kniete sich hin und spürte die feste Konsistenz des Bodens. Falls etwas davon an den Schuhen haften blieb, dachte sie, konnten sie einen Abgleich machen. Ohne sich umzudrehen und zu vergewissern, ob Lieutenant Burns noch da war, sagte sie laut: »Nehmt von der ganzen Umgebung Bodenproben.« Nach kurzem Schweigen hörte sie ein zustimmendes Murmeln. Sie machte weiter und beschwor sich stark zu sein, bis sie die Gestalt mit den Augen erreichte. Also gut, sagte sie sich. Jetzt sieh dir Susan an. Präge dir ein, was ihr heute Nacht zugestoßen ist. Sieh sie dir an. Von oben bis unten. Dir darf nichts entgehen.
Und sie hob den Blick.
»Susan«, sagte sie, wenn auch leise.
Nur ganz vage war sie sich der Gegenwart der anderen Polizisten bewusst. Sie hatten Gesichter, es waren Menschen, die sie kannte, Kollegen, Freunde, das war ihr bewusst, wenn auch allenfalls unterschwellig. Später sollte sie versuchen, sich ins Gedächtnis zu rufen, wer alles am Leichenfundort gewesen war, doch vergeblich.
»Susan«, flüsterte sie erneut.
»Ist das Ihre Nichte, Susan Lewis?« Es war die Stimme des Lieutenant.
»Ja.«
Sie zögerte.
»Das war Susan.«
Plötzlich durchflutete sie eine sengende Hitze, als ob sich einer der Scheinwerfer mit seinem gleißenden Lichtstrahl gezielt auf sie richtete. Sie schnappte nach Luft, dann noch einmal. Sie kämpfte gegen das Schwindelgefühl an. Sie musste an den Moment vor Jahren denken, als sie gemerkt hatte, dass sie von einem Schuss getroffen worden war und dass das Warme, das sie fühlte, ihr eigenes Blut war, das aus ihrem Körper sickerte. Genauso wie damals musste sie jetzt ihre ganze Kraft aufbieten, damit sich nicht ihre Augen verdrehten – als ob es heute genauso tödlich wäre, dem schwarzen Nichts der Ohnmacht nachzugeben wie vor Jahren.
»Merce?«
Sie hörte eine Stimme.
»Geht’s?«
Sie rührte sich nicht.
»Holt den Rettungsdienst!«
In diesem Moment schaffte sie es, den Kopf zu schütteln.
»Nein«, sagte sie. »Geht schon wieder.«
Was Dümmeres hätte sie nicht sagen können, dachte sie.
»Bestimmt? Wollen Sie sich setzen?«
Sie wusste nicht, mit wem sie sprach, als sie noch einmal den Kopf schüttelte und erklärte: »Mir fehlt nichts.«
Jemand hielt sie am Arm. Sie riss sich los.
»Überprüft ihre Fingernägel«, ordnete sie an. »Sie muss sich heftig gewehrt haben. Vielleicht müssen wir nach einem Verdächtigen mit Kratzspuren suchen.«
Sie sah, wie sich der Gerichtsmediziner über die Leiche beugte, behutsam jede Hand hochhob, um mit einem kleinen Skalpell ihre Fingernägel auszuschaben und die Partikel in Beweismitteltütchen zu füllen. »Nicht gerade üppig«, meinte er.
»Sie muss sich wie ein Tiger gewehrt haben«, beharrte Detective Barren.
»Vielleicht hatte sie keine Chance. Sie hat am Hinterkopf ein schweres Trauma. Von einem stumpfen Gegenstand. Wahrscheinlich war sie schon bewusstlos, als er das hier gemacht hat.« Der Doktor wies auf die Strumpfhose, die um Susans Kehle zugezogen war. Für Sekunden starrte Detective Barren auf die bläuliche Verfärbung der Haut.
»Überprüfen Sie den Knoten«, sagte sie.
»Hab ich schon«, entgegnete der Arzt. »Ganz normaler Knoten. Seite eins in der Pfadfinderfibel.«
Detective Barren betrachtete wie gebannt die Strumpfhose. Sie hätte alles dafür gegeben, sie lockern zu dürfen, damit ihre Nichte Luft bekam, als könne sie so den Tod in Schlaf verwandeln. Merce erinnerte sich an ein Erlebnis aus ihrer Kindheit. Sie war noch sehr klein gewesen, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, als der Hund der Familie von einem Auto überfahren wurde und starb. »Wieso ist Lady tot?«, hatte sie ihren Vater gefragt. »Weil ihre Knochen gebrochen waren«, hatte er geantwortet. »Aber als ich mir das Handgelenk gebrochen habe, hat der Arzt mir einen Gips drumgemacht, und jetzt ist es schon besser«, hatte sie erwidert. »Legen wir Lady einen Gips an.« – »Aber sie hat auch ihr ganzes Blut verloren«, hatte ihr Vater entgegnet. »Dann müssen wir eben das Blut wieder in sie reinbekommen«, hatte sie in wachsender Verzweiflung beharrt. »Ach, mein Kleines, wenn das doch nur ginge.« Und ihr Vater hatte seine Arme um sie gelegt, als sie eine der längsten Nächte ihrer Kindheit durchschluchzte.
Als sie jetzt Susans Leichnam anstarrte, sehnte sie sich nach diesen starken Armen.
»Was ist mit den Handgelenken?«, fragte sie. »Irgendwelche Zeichen von Gewaltanwendung?«
»Nein«, erklärte der Arzt, »und das ist aufschlussreich.«
»Allerdings«, meldete sich eine Stimme von der Seite. Detective Barren drehte sich nicht zu dem Sprecher um. »Das heißt, der Mistkerl hat ihr erst eins übergezogen und dann seinen Spaß mit ihr gehabt. Wahrscheinlich hat sie nicht einmal mitbekommen, was sie traf.«
Detective Barren ließ den Blick den Hals des Opfers hinunterwandern.
»Ist das da an der Schulter eine Bisswunde?«
»Sieht so aus«, bestätigte der Gerichtsmediziner. »Müssen wir mikroskopisch untersuchen.«
Einen Moment betrachtete sie die zerrissene Bluse ihrer Nichte. Susans Brüste waren entblößt, und sie hätte sie am liebsten zugedeckt. »Machen Sie Abstriche am Hals nach Speichelspuren«, bat sie.
»Schon erledigt«, erwiderte der Arzt. »Auch an den Genitalien. Im Leichenschauhaus nehme ich noch einmal welche.«
Detective Barren ließ den Blick weiter Zentimeter für Zentimeter den Körper hinunterwandern. Ein Bein war keusch über das andere geschlagen, als zeigte Susan selbst im Tod noch ihr zurückhaltendes Wesen.
»Gibt es irgendwelche Verletzungen im Genitalbereich?«
»Nichts, was wir hier draußen erkennen könnten.«
Detective Barren schwieg, während sie die gewonnenen Erkenntnisse auf sich wirken ließ.
»Merce«, sagte der Doktor freundlich, »das sieht den anderen vier verdammt ähnlich. Todesart. Körperstellung der Leiche. Fundort.«
Detective Barren sah ruckartig auf.
»Anderen? Anderen vier?«
»Hat Lieutenant Burns Ihnen das nicht erzählt? Sie glauben, es ist der Kerl, den sie in der Zeitung den Campus-Killer nennen. Ich dachte, das hätten sie Ihnen gesagt …«
»Nein …«, erwiderte sie. »Das hat mir keiner gesagt.«
Sie holte tief Luft.
»Aber das passt perfekt ins Bild. Es passt …« Sie stockte mitten im Satz.
Der Lieutenant meldete sich zu Wort. »Wahrscheinlich sein erster dieses Semester. Ich meine, mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen, aber das Grundmuster stimmt. Wir werden den Mord ihm zuschreiben, damit das Sonderdezernat übernehmen kann – ich denke, das wird das Beste sein, oder, Merce?«
»Ja.«
»Genug gesehen? Kommen Sie mit dort hinüber, damit ich Ihnen sagen kann, was wir haben und was nicht?«
Sie nickte. Sie machte die Augen zu und wandte sich von dem Leichnam ab. Sie hoffte, dass man Susan bald wegbringen würde, als könnte es ihr ein bisschen menschliche Würde wiedergeben und die Schändung, das Unwiderrufliche ihres Todes mildern, wenn man sie aus dem Dreck und dem Unterholz holte.
Sie wartete geduldig bei den Autos der Spurensicherung und der Kriminaltechnik. Sie gehörten zur Nachtschicht ihrer eigenen Dienststelle, und sie kannte alle Kollegen gut. Jeder von ihnen unterbrach seine Arbeit und kroch unter dem Flatterband hervor, um ein paar Worte zu ihr zu sagen, ihr auf die Schulter zu klopfen oder ihr die Hand zu schütteln, bevor sie den Fundort weiter untersuchten. Kurz darauf kehrte Lieutenant Burns mit zwei Bechern Kaffee zurück. Trotz der drückenden, nächtlichen Tropenhitze fröstelte sie plötzlich und legte die Hände um den Becher aus Styropor. Ihr Kollege sah zum Himmel, an dessen Rändern gerade das erste zarte Grau des Morgens die Dunkelheit ablöste.
»Wollen Sie es wirklich wissen?«, fragte er. »Bei Licht betrachtet ist es vielleicht besser …«
»Ich will es wissen. Und zwar alles«, unterbrach sie ihn.
»Na schön«, setzte er vorsichtig an. Sie wusste, dass er abzuwägen versuchte, ob es vielleicht die Ermittlungen behinderte, wenn er Informationen an sie weitergab. Natürlich fragte er sich, ob er es mit einer Kollegin oder einer völlig fassungslosen Angehörigen zu tun hatte. Dummerweise, dachte sie, hatte er es mit beidem zu tun.
»Lieutenant«, erklärte sie ihm, »ich will nur helfen. Wie Sie wissen, habe ich eine Menge Erfahrung. Ich möchte mich nützlich machen. Aber wenn Sie meinen, ich bin nur im Weg, dann halte ich mich raus …«
»Nein, nein, nein«, erwiderte er prompt.
Wie einfach, dachte sie. Sie wusste, dass ihr Anerbieten, keine Fragen zu stellen, ihr das Recht gab, jede Frage zu stellen.
»Im Augenblick«, begann der Lieutenant, »sind unsere Kenntnisse noch sehr lückenhaft. Offenbar ist sie mit ein paar Freunden auf dem Campus in eine Bar gegangen. Es war voll, es hingen eine Menge Kerle herum. Sie hat mit ein paar von ihnen getanzt. Ungefähr um zehn ist sie allein raus an die frische Luft. Ist nicht wieder reingekommen. Erst einige Stunden später, so um Mitternacht, haben sich ihre Freunde allmählich Sorgen gemacht und die Campus-Cops geholt. Etwa um dieselbe Zeit stolpern ein paar warme Brüder, die es gerade im Gebüsch miteinander treiben wollten, hier draußen über die Leiche …« Er hob eine Hand. »Nein, die haben nichts gesehen und nichts gehört. Und stolpern ist wörtlich gemeint. Einer der Jungs ist drübergefallen …«
Drüber, dachte sie, über einen toten Gegenstand. Sie biss sich auf die Lippe.
»Mädchen verschwindet vom Campus. Leiche wird in einem Park ein paar Kilometer weiter entdeckt, da brauchten wir nur zwei und zwei zusammenzuzählen. Seitdem sind wir hier. In ihrer Handtasche haben wir Ihren Namen gefunden, deshalb haben wir Sie angerufen. Die Tochter Ihrer Schwester, ja?«
Detective Barren nickte.
»Wollen Sie diesen Anruf übernehmen?«
O mein Gott, dachte sie.
»Ja. Wenn wir hier fertig sind.«
»Da drüben ist ein Münztelefon. Ich würde sie nicht warten lassen. Und wir brauchen hier wohl noch eine Weile …«
Ihr wurde bewusst, dass es allmählich immer heller wurde. Die nächtliche Dunkelheit zog sich immer weiter zurück, und die Gestalten nahmen immer klarere Konturen an.
»In Ordnung«, sagte sie.
Unwillkürlich musste sie denken, was für ein hoffnungslos banaler Akt es war, ihre Schwester und ihren Schwager anzurufen. Eine Sekunde lang hoffte sie, keine passenden Münzen zu haben, dann hoffte sie, das Telefon würde nicht funktionieren. Doch es war intakt. Die Vermittlung meldete sich in routinierter Heiterkeit, als sei sie gegen die nachtschlafende Zeit immun. Detective Barren ließ die Kosten auf ihre Dienststelle schreiben. Die Vermittlung fragte, wann jemand da sein würde, um die Kostenübernahme zu bestätigen. Detective Barren erklärte, dies sei stets der Fall. Dann hörte sie das elektronische Klicken der Nummernanwahl, und plötzlich klingelte es im Haus ihrer Schwester, bevor sie sich die passenden Worte zurechtgelegt hatte. Denk nach! Finde die richtigen Worte! Am anderen Ende der Leitung hörte sie die schlaftrunkene Stimme ihrer Schwester:
»Ja, hallo …«
»Annie, ich bin’s, Merce …« Sie biss sich auf die Lippe.
»Merce! Wie geht’s? Was …«
»Annie, hör zu: Es geht um Susan. Es hat einen …« Sie wusste nicht weiter. Unfall? Vorfall? Sie redete einfach, ohne nachzudenken, weiter, immer krampfhaft bemüht, einen ruhigen, ja ausdruckslosen, professionellen Ton zu wahren. »Bitte setz dich und hol Ben an den Apparat …«
Sie hörte, wie ihre Schwester nach Luft schnappte und dann ihren Mann ans Telefon rief.
Er meldete sich sofort. »Merce, was ist los?« Seine Stimme war gefasst. Ben war Wirtschaftsprüfer. Sie hoffte, er würde so klar denken wie im Umgang mit Zahlen. Sie holte tief Luft.
»Ich weiß nicht, wie ich es euch schonend erklären kann, also sag ich es geradeheraus. Susan ist tot. Sie wurde letzte Nacht getötet. Ermordet. Es tut mir leid.«
Detective Barren sah ihre Schwester vor Augen, wie sie sich vor etwa achtzehn Jahren, eine Woche vor der Niederkunft, mit einem riesigen Bauch durch die Julihitze quälte, die unerbittlich über dem trockenen Delaware Valley hing. Detective Barren hatte sich neben ihr an der Flagge festgehalten, die ihr der Captain der Ehrengarde gegeben hatte, während in ihrem Kopf ein großes schwarzes Loch gähnte, in dem die Worte des Geistlichen hohl widerhallten und sich mit dem kurzen Salut über dem Grab vermengten. Sie hatte keine Antworten für die Angehörigen und Freunde, die verlegen herangeschlichen kamen und keine Worte fanden für das Sterben eines so jungen, vitalen Mannes wie John Barren, und sei es auch im Krieg.
Annie hatte sich neben Detective Barren auf dem Sofa niedergelassen; als sie sich unbeobachtet fühlte, hatte sie die Hand ihrer Schwester genommen und auf ihren gewölbten Bauch gelegt, während sie mit entwaffnender Schlichtheit sagte: »Es ist nicht fair, dass Gott ihn dir genommen hat, aber hier ist ein neues Leben, und deine Liebe sollte nicht mit ihm begraben werden – schenke sie stattdessen diesem Kind.«
Das Kind war Susan.
Für einen Moment musste Detective Barren bei der Erinnerung lächeln: Das Baby hat mir das Leben gerettet.
Dann riss sie das erste qualvolle Schluchzen einer gebrochenen Mutter in die Realität zurück.
Ben hatte den nächsten Flieger nach Miami nehmen wollen, doch das hatte sie ihm ausreden können. Es wäre einfacher, erklärte Merce, wenn sie die Überführung des Leichnams mit einem Bestattungsunternehmen regelte, sobald der Gerichtsmediziner mit der Autopsie fertig war. Sie selbst würde den Sarg begleiten. Ben hatte gesagt, er werde das Weitere mit einem lokalen Beerdigungsinstitut abstimmen. Detective Barren bereitete die Eltern darauf vor, dass sich wahrscheinlich Zeitungen, vielleicht sogar das Fernsehen bei ihnen melden würden. Sie empfahl ihnen, zu kooperieren; die Reporter würden sich erkenntlich zeigen und weniger lästig fallen. Sie erklärte, dass Susan nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand das Opfer eines Serienkillers war, der im vergangenen Jahr an einigen Colleges von Miami sein Unwesen getrieben hatte, und dass die Polizei zur Klärung dieser Fälle eine Sonderkommission eingerichtet hatte. Diese Kollegen, sagte sie, würden sich mit ihnen in Verbindung setzen. Ben hatte gefragt, ob sie sicher sei, dass es sich um denselben Mörder handele, und sie hatte zu erklären versucht, dass nichts sicher sei, jedoch einiges für die These spreche. Ben hatte einen Moment lang seinem Zorn freien Lauf gelassen, war jedoch nach ein paar wütenden Bemerkungen fassungslos verstummt. Annie sagte nichts. Detective Barren vermutete, dass sie sich in einem anderen Zimmer aufhielt und dass die Verzweiflung sie mit ganzer Wucht treffen würde, sobald sie sich in die Augen sähen.
»Im Moment ist das alles, was ich euch sagen kann«, schloss Detective Barren. »Ich ruf wieder an, sobald ich mehr weiß.«
»Merce?« Es war ihre Schwester.
»Ja, Annie.«
»Bist du sicher?«
»Ach, Annie …«
»Ich meine, du hast es nachgeprüft, ja? Du bist dir ganz sicher?«
»Annie. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Es ist Susan.«
»Danke. Ich musste es nur absolut sicher wissen.«
»Es tut mir so leid.«
»Ja, natürlich. Du meldest dich.«
»Ben?«
»Ja, Merce. Ich bin noch dran. Wir hören von dir.«
»Ja.«
»O mein Gott, Merce …«
»Annie?«
»Gott!«
»Annie, du musst stark sein. Du musst!«
»Merce, steh mir bei. Ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt auflege, bringe ich sie dadurch um. O mein Gott. Was ist nur passiert? Ich versteh das alles nicht.«
»Ich versteh es auch nicht, Annie.«
»Merce, Merce, Merce …«
Detective Barren hörte, wie ihr Name verhallte. Sie wusste, dass ihre Schwester den Hörer auf das Bett hatte fallen lassen. Schluchzen drang durch die Leitung, und es war, als könne Detective Barren ein Herz brechen hören. Sie erinnerte sich, wie sie an der Highschool von der Seitenlinie aus einem Football-Training zugesehen hatte, als einer der Spieler unglücklich getroffen wurde. Das knackende Geräusch eines splitternden Knochens war lauter gewesen als der Zusammenprall der Körper. Sie hatte gesehen, wie sich einer der anderen Spieler übergeben musste, während die Trainer dem verletzten Jungen zu Hilfe eilten. Eine Sekunde lang rechnete sie mit demselben Knacken, dann legte sie so behutsam, als ginge es darum, ein schlafendes Kind nicht zu wecken, den Hörer auf die Gabel. Sie blieb reglos stehen und lauschte ihrem eigenen Herzschlag. Sie schluckte schwer, dann spannte sie die Armmuskeln an, ein Mal, zwei Mal. Anschließend die Beine. Sie spürte das Zusammenziehen und Lösen der Sehnen und Muskeln. Ich bin stark, dachte sie. Du musst noch viel stärker sein.
2.
Der Vormittag war bereits fortgeschritten, als Susans Leichnam endlich abtransportiert wurde. Detective Barren hatte am Rande des Fundorts ausgeharrt und dem systematischen Sammeln von Beweismaterial zugesehen. Polizisten in Uniform hielten die stetig wachsende Schar Neugieriger auf Distanz, wofür sie dankbar war. Die Nachrichtenmedien von Miami waren früh angerückt und versuchten, sich irgendwie Zugang zum Fundort zu verschaffen. Kameraleute filmten die Aktivitäten, während die Reporter Lieutenant Burns und andere Ermittler mit Fragen löcherten. Es war unvermeidlich, dass früher oder später einer der Journalisten von ihrer persönlichen Verbindung zu der Toten erfuhr und dies in den Berichten hervorhob. Sie beschloss, einfach zu warten, bis die Fragen kamen.
Als zwei Mitarbeiter von der Gerichtsmedizin Susan behutsam in einen schwarzen Leichensack schoben, hatte sie sich abgewandt. Sie ging zu Lieutenant Burns hinüber, der mit zwei geschniegelten Ermittlern in Anzug und Weste sprach, denen die zunehmende Schwüle nichts auszumachen schien. Als Burns sie kommen sah, öffnete er den Kreis und machte sie mit den beiden Männern bekannt.
»Merce. Detective Barren, ich weiß nicht, ob Sie Detective Moore und Detective Perry vom Morddezernat des Bezirks kennen. Sie leiten die Ermittlungen zu diesem Campus-Killer.«
»Ich habe von Ihnen gehört.«
»Ebenso andersherum«, erklärte Detective Perry.
Sie schüttelten einander die Hände und blieben verlegen stehen.
»Es tut mir leid, Sie unter solch traurigen Umständen kennenzulernen«, meinte Detective Perry. »Ich verfolge Ihre Arbeit mit größter Bewunderung. Besonders bei dieser Vergewaltigungsserie.«
»Danke«, erwiderte Detective Barren. Für eine Sekunde erschien vor ihrem geistigen Auge ein pockennarbiges Gesicht mit unförmiger Nase. Sie erinnerte sich, wie sie über rund zwei Dutzend Fallakten gebrütet hatte, bis sie irgendwann das Glied in der Kette fand, das zur Verhaftung führte. Der muskulöse Vergewaltiger hatte stets eine Strumpfmaske getragen. Fast sämtliche Opfer hatten ausgesagt, er litte unter schwerer Akne auf dem Rücken. Von einem Dermatologen hatte sie erfahren, dass Menschen mit Akne auf dem Rücken meist auch im Gesicht von Narben gezeichnet seien. Sie hatte allerdings vermutet, dass die Maske etwas anderes verbergen sollte.
Sie begann, den örtlichen Sport- und Fitnessclubs verstärkt Besuche abzustatten – eher eine Ahnung als ein konkreter Verdacht. In der Sporthalle in der Fifth Street von Miami Beach, in der angehende Boxer ihre Träume an Sandsäcken austobten, war ihr ein kleiner, sehr kräftiger Bursche der Federgewichtsklasse ins Auge gefallen, der nicht nur an Rücken und Gesicht schwere Akne aufwies, sondern auch eine deutlich gebrochene Nase sowie eine auffällig gezackte, rote Narbe an der Wange.
»Man sollte die Intuition nie unterschätzen«, sagte Detective Perry.
»Nur leider beeindruckt sie selten einen Richter, von dem man einen Durchsuchungsbefehl braucht.«
Sie lächelten zaghaft.
»Wie können wir Ihnen also helfen?«, fragte Detective Perry.
»Hat man irgendetwas unter der Leiche gefunden?«
»Nichts von Wert. Nur ein Stück Papier.«
»Was für ein Papier?«
»Genauer gesagt, einen Fetzen. Sieht aus wie die obere Hälfte von diesen Dingern, die beim Einchecken am Flughafen an den Koffergriff geklebt werden, nur um einiges größer. Jedenfalls irgendeine Art von Etikett.« Er hob die Hände. »Nein, nichts dran, was uns weiterhelfen könnte, lediglich das obere Viertel, das Übrige war abgerissen. Außerdem ist es schwer zu sagen, wie lange das schon da gelegen hatte. Vielleicht hat er sie zufällig darauf abgelegt, ein Stück Abfall, weiter nichts.«
Sie dachte an ihre Nichte inmitten von Müll. Sie schüttelte den Kopf, um einen klaren Gedanken zu fassen.
»Was haben Sie jetzt vor?«, erkundigte sich Detective Barren.
»Wir werden uns erst einmal in dem Nachtclub umsehen und schauen, ob wir jemanden finden, der mitbekommen hat, wie sie jemand angesprochen hat oder ihr gefolgt ist …« Der Lieutenant sah Detective Barren an. »Das kann dauern.«
»Zeit spielt keine Rolle.«
»Verstehe.«
Er schwieg.
»Hören Sie, Detective, das hier muss unerträglich für Sie sein. Wenn es um eine meiner Schwestern ginge, würde ich den Verstand verlieren. Ich würde den Kerl mit eigenen Händen töten wollen. Also, was mich betrifft, erhalten Sie jede Information über den Ermittlungsstand, die Sie wünschen, solange Sie nicht versuchen, unsere Arbeit zu machen. Ist das fair?«
Detective Barren nickte.
»Noch etwas«, fügte Detective Perry hinzu, »falls Ihnen irgendetwas einfällt, sagen Sie es mir persönlich.«
»Kein Problem«, erklärte Detective Barren und fragte sich im selben Moment, ob es gelogen war. »Nur eines möchte ich noch wissen. Das ist der fünfte, richtig? Wie weit sind Sie bei den anderen? Haben Sie schon einen konkreten Verdacht?«
Die beiden Ermittler zögerten und warfen einander Blicke zu.
»Gute Frage. Wir haben eine Reihe von Hinweisen, und es sind ein paar brauchbare dabei. Kommen Sie in ein paar Tagen, dann reden wir, okay? Wenn Sie sich ein bisschen gefangen haben, ja?«
Herablassendes Arschloch, dachte sie.
»In Ordnung«, stimmte sie zu.
Sie überließ die Männer ihrer Unterhaltung und kehrte zu den Wagen der Spurensicherung zurück. Ein dünner Mann von asketischem Aussehen glich gerade die Nummern, die mit schwarzem Filzstift auf die Plastiktüten geschrieben waren, mit einer Liste auf einem Klemmbrett ab. Er hatte große, knochige Hände, die durch die Luft zu flattern schienen. »Ach, Merce, ich dachte, Sie wären schon weg. Sie brauchen nicht dazubleiben, wissen Sie.«
»Ich weiß. Wieso sagt mir das jeder?«
»Tut mir leid. Es ist nur – wir wissen alle nicht so recht, wie wir reagieren sollen. Wahrscheinlich machen Sie uns nervös. Wir sind es nicht gewöhnt, uns von einem Toten irritieren zu lassen, und solange Sie da sind, fällt es schwer, es als reinen Job zu betrachten, es geht einem unter die Haut. Können Sie das verstehen?«
»Ja«, antwortete sie mit einem zaghaften Lächeln.
»Merce, ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr wir alle mit Ihnen fühlen. Alle haben sich hier am Fundort mächtig ins Zeug gelegt. Ich kann nur hoffen, dass wir was gefunden haben, das uns zu dem Mistkerl führt.«
»Danke, Teddy. Was haben Sie zusammenbekommen?«
»Viel zu viel. Hier ist die Liste.«
Er reichte ihr das Klemmbrett, und sie überflog das Blatt:
Blutprobe Kopf des Opfers
Blutprobe Unterleibsregion des Opfers
Speichelprobe Schulter des Opfers
Abstriche Genitalien des Opfers
Abstriche Schulter des Opfers (Bisswunde, s. Diagramm)
Bodenprobe A (s. Diagramm)
Bodenprobe B (s. Diagramm)
Bodenprobe C (s. Diagramm)
Probe Fingernägel, rechte Hand des Opfers (s. Diagramm)
dasselbe, linke Hand (s. Diagramm)
unbekannte Substanz/Blatt
mögliche Kleiderfaserprobe
Blutspur auf Blatt
Zigarettenstummel (s. Diagramm)
Zigarettenstummel (s. Diagramm)
benutztes Kondom
benutztes Kondom
unbenutztes Kondom in Folie (Marke Ramses)
Bierdose (Budweiser)
Cola-Dose
Perrier-Halbliterflasche
unbekannte Substanz in Alufolienverpackung
unbekannte Substanz in Plastikbeutel
Filmdöschen Kodacolor Instamatic
Filmdöschen Kodacolor Instamatic
Deckel von Filmdöschen Kodak 400 schwarzweiß für Negative
benutzte Flasche Cutter-Insektenschutz, 160 ml
Sea-and-Ski-Sonnenmilch, 350 ml
zerdrückte leere Schachtel Marlboro-Zigaretten
Damenhandtasche (Inhalt separat aufgelistet)
Damenbrieftasche (des Opfers)
Damenohrring
Etikettende, Farbe gelb, Herkunft unbekannt (unter Leiche)
»Was ist mit den Kondomen?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. »Merce, sehen Sie sich das Zeug an. Das findet sich auf jedem Picknickplatz. Die unbekannte Substanz ist möglicherweise Thunfisch, nur so eine Vermutung. Und sehen Sie sich die Diagramme an. Außer den Blut- und Hautproben haben wir alles in einem Umkreis von einigen Metern gesammelt. Alles Sachen, die man vielleicht zu einem kurzen Sonnenbad dabei hat – nicht bei einem Mord mitten in der Nacht.«
Sie nickte.
»Das tut weh, nicht wahr? Wollen Sie …«
»Ja.«
»Dachte ich mir. Jedenfalls wissen wir nichts, bevor wir das Zeug nicht im Labor haben, aber mir – und wohl auch so ziemlich allen anderen hier – kommt es so vor, als hätte er sie hierhergeschafft. Wahrscheinlich ist der Mistkerl mit dem Wagen bis zu dieser Stelle gefahren, um sie loszuwerden. Wenn wir den Wagen von dem Burschen ermittelt haben, haben wir ihn am Haken. Es muss Blut und Haut und alles Mögliche da drin zu finden sein. Das bekommt er nicht weg. Aber brauchbare Indizien hier am Leichenfundort? Können wir nur hoffen, aber ich würde nicht darauf zählen.«
Sie nickte wieder.
»Ich sag Ihnen mit alldem nichts Neues.«
»Nein.«
Sie gab ihm die Liste zurück und starrte auf die Reihen Plastiktüten, die im Laderaum des Vans fein säuberlich aufgereiht waren. Sie wusste nicht einmal, wonach sie suchen sollte.
»Was ist das?«, fragte sie und zeigte auf eine davon.
»Der letzte Punkt auf der Liste. Irgendein gelbes Etikett. Hat man unter der Leiche gefunden.«
Er reichte es ihr. Sie starrte auf das zerfetzte, gelbe Stück Papier in der durchsichtigen Plastikfolie und drehte den Beutel hin und her. Was bist du?, fragte sie stumm. Was hast du zu bedeuten? Was willst du mir sagen? Wie kommst du hierher? Sie hatte plötzlich das starke Verlangen, das kleine Stück Papier zu schütteln, um es zum Reden zu bringen. Ich werde dich nicht vergessen, sagte sie zu dem Papier. Dann ging sie die Reihe Tüten durch. Ich werde keine von euch vergessen.
Mit Schrecken wurde ihr bewusst, wie verrückt sie sich benahm. Sie legte das Tütchen in den Wagen zurück.
Sie musste ziemlich albern wirken. Sie wusste, dass es einige Zeit dauern würde, den Leichenfundort auszuwerten, und die Chancen, brauchbare Indizien zu finden, waren äußerst gering. Sie wurde rot und drehte sich weg. Sie sah, wie die Ermittler in ein Zivilfahrzeug stiegen. In der Ferne machte ein Polizeifotograf Aufnahmen von der Totalen. Der Wagen der Gerichtsmedizin verließ den Parkplatz, und am Ausgang warteten schon die Kameraleute, um die Abfahrt festzuhalten. Ein Gefühl der Hilflosigkeit überwältigte sie, und sie merkte, wie die dünne Fassade professioneller Sachlichkeit, die sie den ganzen Vormittag hatte aufrechterhalten können, jetzt, da die Kollegen von der Spurensicherung, der Gerichtsmedizin und vom Morddezernat die Szene verließen, zu bröckeln begann. Sie fühlte sich vollkommen ausgeliefert und mit ihren Gefühlen alleingelassen. Sie merkte, wie es ihr Brust und Kehle zuschnürte. Sie rang nach Luft und machte sich auf den Weg zu ihrem Wagen. Als sie die Tür öffnete, kam ihr ein Schwall der darin gestauten Hitze entgegen. Sie setzte sich in den Backofen und dachte an Susan. Sie dachte an ihren Traum. Wie in den letzten Minuten ihres Schlafs wollte sie schreien: Wach auf! Bring dich in Sicherheit!
Doch sie konnte es nicht.
Die Dame im Blumengeschäft hatte Detective Barren beäugt und schließlich gefragt: »Suchen Sie etwas für einen besonderen Anlass?« Detective Barren hatte mit ihrer Antwort einen Moment gezögert, und die Dame hatte unbekümmert weitergeplappert: »Ich meine, wenn Sie etwas für eine Kollegin oder Sekretärin suchen, kann ich Ihnen eins von diesen Blumenarrangements empfehlen. Oder sind sie für einen Kranken? Dann wäre so ein Bouquet das Richtige. Ein Krankenhausbesuch? Wir stellen immer fest, dass Krankenhauspatienten kleine Topfpflanzen lieben – wahrscheinlich macht es ihnen Freude zu sehen, wie die Pflanzen wachsen …«
»Sie sind für meinen Geliebten«, antwortete Detective Barren.
»Oh«, entfuhr es der Frau ein wenig verblüfft.
»Stimmt etwas nicht?«
»Nein, das ist nur ungewöhnlich. Wissen Sie, normalerweise kommen die Männer, um für ihre, ähm, Lebensgefährtinnen Blumen zu kaufen. Das hier ist mal was anderes.« Sie lachte. »Manche Dinge ändern sich nie, egal, wie modern wir sind. Männer kaufen ihren Freundinnen und Ehefrauen Blumen. Nicht umgekehrt. Sie kommen in den Laden und stehen ein bisschen verlegen vor der gekühlten Ware und starren die Blumen an, als hofften sie auf ein Zeichen, irgendetwas, das ihnen sagt: Kauf mich für deine Frau. Oder deine Freundin. Und durchaus nicht junge Männer. Die jungen Männer von heute scheinen den Wert schöner Blumen nicht mehr zu schätzen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind viel zu – ich weiß nicht – zu nüchtern geworden. Ich meine, es dauert bestimmt nicht mehr lang, und man verschickt Valentinskarten mit dem Computer. Aber es sind immer noch die Männer, nicht die Frauen. Nein, ich glaube, ich hatte noch nie eine Frau, die hier reingekommen ist …«
Detective Barren blickte die Frau an, und die Verkäuferin verstummte mitten im Satz, bevor sie sich nach einer Weile räusperte. »Oje, ich benehme mich ziemlich albern, oder?«
»Ein bisschen«, erwiderte Detective Barren.
»Oje«, wiederholte die Frau. Die Polizistin sah, wie die ältere Dame sich eine graue Strähne aus der Stirn strich und Haltung annahm. »Ich fange noch einmal an«, erklärte sie. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich hätte gerne Blumen«, sagte Detective Barren.
»Für jemand Besonderen?«
»Natürlich.«
»Gut, dann würde ich Ihnen Rosen empfehlen. Vielleicht nicht die originellste, aber die sicherste Wahl. Sie machen immer Freude, und dafür kaufen wir schließlich Blumen.«
»Ich denke, das wäre nett«, stimmte Detective Barren zu.
»Ein Dutzend?«
»Ausgezeichnet.«
»Ich hätte sie in Rot, Weiß und Rosa da?« Das war eine Frage.
Die Polizistin überlegte einen Moment. »Rot und Weiß, denke ich.«
»Ausgezeichnet. Ein bisschen Schleierkraut dazu – das bringt sie besonders hübsch zur Geltung.«
»Sie sehen sehr hübsch aus.«
»Danke.«
Detective Barren bezahlte, und die Frau reichte ihr die Schachtel. »Ich werde allmählich meschugge.«
»Wie bitte?«
»Wissen Sie, ich rede fast den ganzen Tag nur noch mit den Blumen. Manchmal vergesse ich, wie man mit Menschen spricht. Ich bin sicher, Ihr, äh, Freund wird sich über den Strauß freuen.«
»Mein Geliebter«, verbesserte die Polizistin.
Sie klemmte sich die Schachtel unter den Arm und überlegte, wie viele Jahre vergangen waren, seit sie das letzte Mal am Grab von John Barren gestanden hatte.
Anfang September lag noch kein bisschen Herbst in der Luft; vielmehr hielt sich hartnäckig die sommerliche Schwüle und ein trügerisch blauer Himmel mit ein paar großen weißen Wolken; ein Tag zum Faulenzen und Schwelgen in Erinnerungen an einen strahlenden August, statt an die klirrende Januarkälte zu denken, die in Delaware Valley mit unumstößlicher Gesetzmäßigkeit Schnee und beißend kalten Wind vom Fluss sowie Eis- und Graupelstürme brachte – eine unglückselige Mischung aus Böen, Schneeregen und Glatteis. Eins dieser ganz gewöhnlichen Unwetter, dachte Detective Barren mit einem leisen Lächeln. Es hatte sie unterwegs erwischt, mit einer leeren Autobatterie und durchnässten Stiefeln. Als sie schließlich – allein – in ihre leere, kalte, verwaiste Wohnung zurückgekehrt war, hatte sie sich geschworen, in einer warmen Gegend ganz von vorne anzufangen. Miami.
Sie legte die Blumen auf den Beifahrersitz des Leihwagens und nahm von Lambertville aus den Weg über die Brücke nach New Hope auf der anderen Seite des Flusses. Die für das Ausgefallene, Kostbare und Exklusive bekannte Kleinstadt dehnte sich entlang beider Ufer aus. Sie brauchte nicht lange, bis sie die Ortschaft hinter sich gelassen hatte und eine schattige Straße Richtung Friedhof fuhr. Sie fragte sich, wieso die Familie näher nach Philadelphia gezogen war, wo es auf dem Lande doch so schön war. Sie sah ihren Vater vor sich, wie er die Nachricht bekommen hatte, dass er an die University of Pennsylvania berufen worden war, und vor Freude wie ein Cowboy ihre Mutter zu einem Squaredance durchs Wohnzimmer wirbelte. Er hatte theoretische Mathematik und Quantenmechanik gelehrt; seine Intelligenz war beängstigend, seine praktische Lebenstüchtigkeit gleich null gewesen. Sie lächelte. Er hätte keine Sekunde lang begriffen, wie sie zur Polizei gehen konnte. Für die Methoden der deduktiven Beweisführung, für einige der investigativen Vorgehensweisen und die offensichtliche Präzision der Ermittlertätigkeit hätte er einen gewissen Respekt aufgebracht, doch die Realität, der ständige Kampf gegen das Böse, hätte ihn entsetzt. Nie hätte er begriffen, weshalb seine Tochter diese Arbeit so liebte, auch wenn er den schlichten Grund für ihre berufliche Hingabe bewundert hätte: Für sie war es die einfachste Möglichkeit, in einer Welt etwas Gutes zu bewirken, in der Mistkerle – an dieser Stelle stockte sie wie schon so oft in den letzten Tagen – liebenswürdige achtzehnjährige Mädchen voller Lebensdrang und vielversprechenden Neigungen und Talenten töten konnten. Detective Barren fuhr weiter, und die liebevolle Erinnerung an ihren Vater versank im Schatten, während in ihrem Kopf ein Skizzenblock Gestalt annahm, auf dem sie die Gesichtszüge des Killers zu zeichnen begann. Um ein Haar hätte sie das Friedhofstor übersehen.
Jemand hatte eine amerikanische Flagge auf John Barrens Grab platziert, und für einen Moment war sie nicht sicher, ob ihr das recht war. Doch dann sagte sie sich: Wenn das irgendeinem hiesigen Mitglied der Veterans of Foreign Wars eine Befriedigung verschafft, habe ich nicht das Recht, mich dagegen zu verwahren. Dafür waren Gräber und Gedenkstätten schließlich da – für die Lebenden, nicht für die Toten. Sie ertrug es nicht, den Grabstein und das verdorrte Gras anzublicken und sich vorzustellen, dass John darunter in seinem Sarg lag. Eine Erinnerung bahnte sich ihren Weg, bei der sie unwillkürlich den Atem anhielt:
Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden.
An einem der Sarggriffe hatte sich ein Etikett mit diesem Wortlaut befunden. Vermutlich hatte es entfernt werden sollen, bevor sie es zu sehen bekam, doch sie hatte es nun einmal entdeckt.
In ihrem abgrundtiefen Kummer hatte sie über dieses Anhängsel gerätselt.
Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden.
Zuerst war ihr der absurde Gedanke gekommen, John liege nackt darin, und die Army versuchte in einem idiotischen Männlichkeitswahn, sittlichen Anstand zu bewahren. Am liebsten hätte sie zu den Männern, die um den Sarg standen, gesagt, seid nicht albern, natürlich haben wir uns nackt gesehen, und es hat uns Freude gemacht. Wir waren schon an der Highschool ein Liebespaar und dann am College; in der Nacht, als er eingezogen wurde, und in den Stunden, bevor er mit dem Bus zur Kaserne fuhr, an der er seine Grundausbildung absolvierte; und dann in den zwei kurzen Wochen Urlaub, bevor er nach Übersee ging. Unten an der Küste von Jersey haben wir uns heimlich weggeschlichen, sobald unsere Eltern schliefen, und uns bei Mondschein nackt in den Sanddünen gewälzt.
Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden.
Sie hatte über diese seltsamen Worte nachgedacht. Sterbliche Überreste – nun ja, das war John. »Nicht aufgebahrt« bedeutete, dass sie ihn nicht anschauen konnte. Sie fragte sich wieso. Was hatten sie mit ihm gemacht? Sie versuchte, es herauszufinden, musste jedoch feststellen, dass man der Frau eines jungen Toten keine klaren Antworten gab. Stattdessen hatten alle sie in die Arme genommen und ihr gesagt, es sei das Beste so und Gottes Wille sei nun einmal unergründlich, und der Krieg sei die Hölle und alles Mögliche andere, was ihre Frage nicht beantwortete. Sie wurde ungeduldig und zunehmend verstört, woraufhin die Männer von der Army wie auch ihre männlichen Angehörigen nur umso beharrlicher schwiegen. Als sie ihre Forderungen schließlich lauter und schriller vorbrachte, fühlte sie sich fest am Arm gepackt. Es war der Leiter des Bestattungsinstituts, ein Mann, den sie noch nie im Leben gesehen hatte. Er hatte sie eindringlich angesehen und sie dann zum Staunen ihrer Familie in ein Nebenzimmer geführt. Dort hatte er sie nüchtern, geschäftsmäßig aufgefordert, in einem Sessel auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz zu nehmen.
Während sie sich setzte, hatte er verschiedene Papiere durchsucht und gewartet. Schließlich hatte er entdeckt, was er brauchte. »Man hat es Ihnen nicht gesagt, nicht wahr?«
»Nein«, erwiderte sie und hatte keine Ahnung, was er meinte.
»Man hat Ihnen nur gesagt, er sei tot, ja?«
Das entsprach der Wahrheit. Sie nickte.
»Nun denn«, sagte er knapp, um vorsichtig hinzuzufügen: »Sind Sie sicher, dass Sie es wissen wollen?«
Was wissen wollen, hatte sie sich gefragt, jedoch wieder genickt.
»In Ordnung«, seufzte er. Seine Stimme klang traurig. »Corporal Barren starb bei einer routinemäßigen Patrouille in der Provinz Quang Tri. Der Mann neben ihm trat auf eine Landmine. Eine große. Sie tötete Ihren Mann und die beiden anderen Männer.«
»Aber wieso kann ich ihn nicht …«
»Weil nicht genug von ihm übriggeblieben ist, was Sie sehen könnten.«
»Oh.«
Im Raum herrschte Schweigen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Kennedy hätte uns da rausgeholt«, erklärte der Leiter des Bestattungsinstituts. »Aber wir mussten ihn ja umbringen. Ich denke, er war unsere einzige Chance. Jetzt ist mein Junge da drüben. Gott, ich habe solche Angst. Es scheint, als würde ich jede Woche einen dieser Jungen unter die Erde bringen. Es tut mir so leid für Sie.«
»Sie müssen Ihren Sohn lieben.«
»Ja. Sehr.«
»Er war nicht ungeschickt, wissen Sie.«
»Wie bitte?«
»John. Er war trainiert. Er war sehr sportlich. Beim Football schaffte er die Touchdowns, beim Basketball warf er Körbe, und beim Baseball punktete er mit Homeruns. Er wäre nie auf eine Mine getreten.«
Sie dachte an den alten Kinderreim: Trittst du auf ’ne Ritze, mach ich meine Witze. Trittst du auf ’ne Mine irgendwo, werde ich des Lebens nicht mehr froh.
Sterbliche Überreste können nicht aufgebahrt werden.
»Hallo, Liebster«, sagte sie und nahm die Blumen aus der Schachtel.
Detective Barren saß auf dem Grab und verdeckte mit dem Rücken die eingemeißelten Lebensdaten ihres Mannes. Sie hob das Gesicht und beobachtete, wie die Wolkenschwaden in einer wundervollen Zwecklosigkeit über den endlosen blauen Himmel zogen. Wie ein Kind versuchte sie zu raten, was ihre einzelnen Formen darstellten, und erkannte Elefanten, Wale und Rhinozerosse. Sie dachte daran, dass Susan nur Fische und Wassersäugetiere gesehen hätte. Sie überließ sich der tröstlichen Phantasievorstellung, dass jenseits der Wolken ein Himmel war und John dort auf Susan gewartet hatte. Der Gedanke war tröstlich, auch wenn ihr die Tränen in die Augen traten. Sie wischte sie ärgerlich weg.
Sie war allein auf dem Friedhof, was ihr nur recht sein konnte, da ihr Betragen der Würde des Ortes nicht ganz entsprach. Ein leichter Wind linderte die Hitze und raschelte in den Bäumen. Sie lachte, ohne dass sie irgendetwas komisch fand, und sagte leise: »Ach, Johnny, ich werde bald vierzig, du bist seit achtzehn Jahren tot, und es ist immer noch die Hölle ohne dich.
Wahrscheinlich habe ich wegen Susan überlebt. Du warst tot, und sie kam zur Welt, und sie war so winzig, hilflos und krank. O Mann, Koliken, dann die Atemwegsbeschwerden und Gott weiß, was noch alles. Annie war völlig überfordert. Und Ben, na ja, der war gerade dabei, beruflich Fuß zu fassen, und hat die ganze Zeit gearbeitet. Also war ich plötzlich mittendrin – bin nächtelang aufgeblieben, damit Annie ein paar Stunden Ruhe bekam. Habe die Kleine gewiegt, habe sie durchs Zimmer getragen, immer hin und her, hin und her. All diese Babytränen, weißt du, die Schmerzen und das Unwohlsein, also, es war, als täte mir selbst der Bauch weh, als könnten wir beide uns ein bisschen besser fühlen, wenn wir zusammen weinten, und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht geschafft. Du alter Mistkerl! Du hattest kein Recht, dich in die Luft jagen zu lassen!«
Sie schwieg.
Sie musste an eine Nacht denken, als sie sich in seinem schmalen Bett im Studentenheim aneinanderdrängten und er ihr gestand, er hätte den Antrag auf Freistellung vom Wehrdienst während des Studiums nicht eingereicht. Das ist einfach nicht fair, hatte er erklärt. Die Farmerjungs und die Ghettokids würden abgeschlachtet, während sich die Söhne von Rechtsanwälten in den Eliteuniversitäten in Sicherheit wiegen dürften. Das System sei ungerecht und zynisch, da mache er nicht mit. Falls sie ihn einzögen, nur zu. Falls er die Musterung bestehe, sei’s drum. Keine Sorge, hatte er gesagt. Die Army will mich nicht. Unruhestifter. Anarchist. Aufwiegler. Ich gäbe einen lausigen Soldaten ab. Sie schreien Attacke!, und ich frage erst einmal nach, wo und weshalb und wie’s denn dazu käme, und überhaupt, wieso nicht besser da drüben und wie wär’s, wenn wir abstimmen würden? Bei der Vorstellung, wie John Barren eine Gruppendiskussion darüber anzettelte, ob sie den Feind angreifen sollten oder nicht, mit allem Für und Wider, hatten sie gelacht. Dabei hatte sie eine diffuse Angst überspielt, und als der Brief eintraf, der mit den Grüßen des Präsidenten begann, hatte sie darauf bestanden, vorher zu heiraten, weil es ihr wichtig erschien, seinen Namen zu tragen.
»Susan ging es irgendwann besser«, erzählte Detective Barren. »Es schien zwar ewig zu dauern, aber irgendwann ging es ihr besser. Und plötzlich war sie ein kleines Mädchen, und Annie war ein bisschen älter und ängstigte sich nicht mehr so sehr, und Ben musste nicht mehr ganz so hart arbeiten, und ich denke, es war ganz okay, dass ich nur noch Tante Merce war, denn sie würde am Leben bleiben, und ich wusste, ich auch.«
Detective Barren schluckte schwer.
»Gott, Johnny, und jetzt hat jemand sie umgebracht! Mein Baby! Sie hatte so viel Ähnlichkeit mit dir! Du hättest sie auch gerngehabt. Sie war wie das Baby, das wir beide bekommen hätten. Klingt das nicht abgedroschen? Lach bitte nicht, wenn ich sentimental werde. Ich kenne dich! Du warst schlimmer als ich. Wer von uns hat denn bitte schön im Kino geflennt? Erinnerst du dich an Tunes of Glory? Beim Alec-Guinness-Festival? Zuerst haben wir The Ladykillers gesehen, und du hast darauf bestanden, dass wir uns auch noch den nächsten Film anschauen. Weißt du noch? Nachdem sich John Mills erschossen hat und Guinness ein bisschen durchdreht und vor den anderen Männern in der Offiziersmesse einen langsamen Trauermarsch spielt? Der Dudelsack war sehr leise, und du hast im Kinosaal gesessen, und die Tränen sind dir nur so die Wangen herabgelaufen, also sag ja nicht, ich wäre die Rührselige von uns beiden. Und an der Highschool, weißt du noch, wie Tommy O’Connor gegen St. Brendan nicht durchkam und er dir den Ball abgegeben hat und du einfach losmarschiert bist und der ganze Platz gebrüllt oder den Atem angehalten hat, weil zehn Meter vor dem Korb die Meisterschaft auf dem Spiel stand? Ist doch nur ein Stück Netz, hast du gesagt, aber jedes Mal, wenn ich das Thema anschnitt, hast du zu weinen angefangen, du alter Blödmann. Ihr habt gewonnen, und du musstest heulen. Ich denke, Susan wäre es nicht anders ergangen. Sie hat über gestrandete Wale geweint und über Seehunde, die nicht den gesunden Instinkt hatten, vor den Jägern zu fliehen, oder wegen ölverschmierter Möwen. Das hätte dich auch berührt.«
Detective Barren holte tief Luft.
Ich bin verrückt, dachte sie.
Mit einem toten Ehemann über eine tote Nichte zu reden.
Aber man hat die, die ich liebe, umgebracht.
Alle.
Detective Barren zeigte ihre Dienstmarke einem Beamten in Uniform, der in der Dienststelle des Bezirkssheriffs am Wachtisch saß und sämtliche Besucher überprüfte. Sie nahm den Fahrstuhl zum zweiten Stock und fand das Morddezernat wieder. Eine Sekretärin ließ sie auf einem unbequemen Plastiksofa warten. Sie sah sich um und registrierte die allgegenwärtige Mischung aus altem und neuem Büromobiliar. Die Arbeit bei der Polizei bewirkt irgendwie, überlegte sie, dass selbst neue Dinge sehr schnell ihren Glanz verlieren. Sie fragte sich, ob zwischen dem Dreck, mit dem man sich befasste, und der schmuddeligen Atmosphäre der Büros irgendein Zusammenhang bestand. Ihr Blick wanderte über die drei Bilder an der Wand: der Präsident, der Sheriff und ein dritter Mann, den sie nicht kannte. Sie stand auf und trat an das Bild des Unbekannten heran. Unter dem Porträt eines lächelnden, ein wenig übergewichtigen Mannes mit der amerikanischen Flagge im Revers befand sich eine kleine, bronzemattierte Plakette. Darauf stand der Name des Abgebildeten und die Inschrift IMDIENSTGETÖTET, darunter ein zwei Jahre zurückliegendes Datum.
Sie erinnerte sich an den Vorfall; es war eine ganz normale Festnahme nach einem Fall von häuslichen Streitigkeiten gewesen, der in Totschlag geendet hatte. Ein betrunkener Vater und sein Sohn in Little Havana. Ein Mord wie aus dem Lehrbuch: Als die Polizei eintraf, stand der Vater schluchzend über der Leiche. Er war so verstört, dass die Uniformierten ihn einfach ohne Handschellen in einen Sessel setzten. Niemand hatte damit gerechnet, dass er explodieren würde, sobald sie versuchten, ihn mitzunehmen – dass er einem Polizisten die Pistole aus dem Halfter ziehen und auf sie richten würde. Detective Barren erinnerte sich nur zu gut an die Beerdigung mit den Ausgehuniformen, der gefalteten Flagge und dem Ehrensalut, die sie zu einer anderen Trauerfeier zurückversetzte. Wie albern, so zu sterben, dachte sie. Doch im nächsten Moment fragte sie sich, wie ein nützlicher Tod wohl aussah. Als Detective Perry den Raum betrat, drehte sie sich hastig um.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen«, begrüßte er sie. »Gehen wir in mein Büro.«
Sie folgte ihm den Flur entlang.
»Bürokabine, genauer gesagt. Großraumaufteilung. Richtige Büros mit einer ordentlichen Tür sind nicht mehr zu haben. Das nennt sich nun Fortschritt.«
Sie lächelte, und er bot ihr einen Stuhl gegenüber seinem Schreibtisch an.
»Also?«, meinte er.
»Das frage ich Sie«, erwiderte sie.
»In Ordnung«, sagte er. »Wir haben da etwas.« Er schob ihr ein Blatt Papier hin. Sie nahm es und starrte auf ein Phantombild eines Mannes mit lockigen Haaren und dunkler Haut, der gar nicht schlecht ausgesehen hätte, wenn ihm nicht die tiefliegenden Augen etwas Gespenstisches verliehen hätten. Allerdings nicht genug, um abstoßend zu wirken.
»Ist das …«
»Wir haben unser Bestes getan«, unterbrach er sie. »Wir haben es quer durch die Stadt und auf jedem Campus verteilt. Während Sie zur Beerdigung waren, haben wir es auf sämtlichen Fernsehsendern ausgestrahlt.«
»Und die Reaktionen?«
»Das Übliche. Jeder denkt, der sieht haargenau wie sein Vermieter oder der Nachbar aus, der ihm zufällig noch Geld schuldet, oder der Typ, mit dem seine Tochter sich trifft. Aber wir überprüfen alle einen nach dem anderen. Vielleicht werden wir ja fündig.«
»Und sonst?«
»Nun ja, die Morde sind nicht völlig deckungsgleich, aber unterm Strich tragen sie doch deutlich dieselbe Handschrift. Die Mädchen wurden alle an irgendeinem Treff oder in einer Bar angesprochen beziehungsweise bei irgendeinem Studententreffen oder einem studentischen Filmklub. ›Angesprochen‹ trifft es nicht ganz. ›Verfolgt‹ kommt der Sache näher. Niemand hat tatsächlich gesehen, wie der Typ sich seine Opfer geschnappt hat …«
»Aber …«
»Na ja, kein Aber. Wir führen Zeugenbefragungen durch. Wir überprüfen eine ganze Reihe Leute – Gärtner, Studenten, Bummler –, um einen Typen zu finden, der mehr oder weniger auf jedem Campus zu Hause ist, der jung ist und sich in die Szene einfügt.«
»Das kann eine Weile dauern.«
»Wir haben ein Dutzend Jungs drauf angesetzt.«