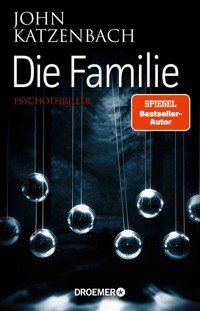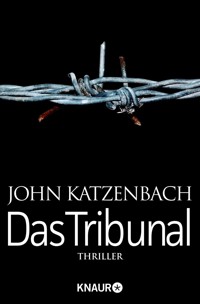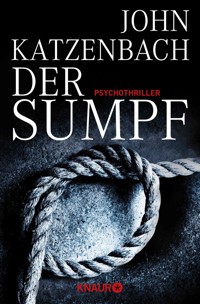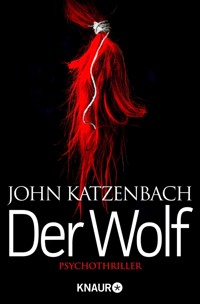9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Timothy Warner, Spitzname »Moth«, studiert Geschichte an der University of Miami - und er hat ein massives Drogenproblem. Jetzt ist er seit hundert Tagen »clean«, doch das hat er nur mit Hilfe seines Onkels Ed geschafft, eines prominenten Psychiaters und so etwas wie Moths Rettungsanker. Als Ed tot in seiner Praxis aufgefunden wird, stürzt Moth ins Bodenlose. Niemals war dies Selbstmord, auch wenn die Polizei noch so sehr davon überzeugt ist. Moths neue Aufgabe im Leben wird es, den Mörder zu stellen. Seine Nachforschungen führen ihn zu dem pensionierten Psychiatrieprofessor Jeremy Hogan, der seit einiger Zeit anonyme Drohanrufe bekommt. Ein unbekannter »Student Nr. 5« kündigt an, ihn umbringen zu wollen. Jedes Mal eröffnet er seinen Anruf mit der Frage: »Wessen Schuld ist es?« Es scheint, als wolle er Rache nehmen für ein Unrecht, das ihm vor Jahren während seines Studiums angetan wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
John Katzenbach
Der Psychiater
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen vonAnke und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Timothy Warner, Spitzname »Moth«, studiert Geschichte an der University of Miami - und er hat ein massives Drogenproblem. Jetzt ist er seit hundert Tagen »clean«, doch das hat er nur mit Hilfe seines Onkels Ed geschafft, eines prominenten Psychiaters und so etwas wie Moths Rettungsanker. Als Ed tot in seiner Praxis aufgefunden wird, stürzt Moth ins Bodenlose. Niemals war dies Selbstmord, auch wenn die Polizei noch so sehr davon überzeugt ist. Moths neue Aufgabe im Leben wird es, den Mörder zu stellen. Seine Nachforschungen führen ihn zu dem pensionierten Psychiatrieprofessor Jeremy Hogan, der seit einiger Zeit anonyme Drohanrufe bekommt. Ein unbekannter »Student Nr. 5« kündigt an, ihn umbringen zu wollen. Jedes Mal eröffnet er seinen Anruf mit der Frage: »Wer ist schuld?« Es scheint, als wolle er Rache nehmen für ein Unrecht, das ihm vor Jahren während seines Studiums angetan wurde ...
Inhaltsübersicht
Zitat
ERSTER TEIL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
ZWEITER TEIL
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
EPILOG
Vierundzwanzig Stunden nach dem [...]
Vier Wochen nach dem [...]
Ein halbes Jahr nach [...]
»Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir’s euch auch darin gleichtun.«William Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig3. Akt, 1. Szene
ERSTER TEIL
Gespräche zwischen Toten
So viel hatte Moth begriffen:
Sucht und Mord haben einiges gemein.
In beiden Fällen sollst du ein Geständnis ablegen:
Ich bin ein Mörder.
Beziehungsweise:
Ich bin suchtkrank.
In beiden Fällen erwartet man von dir, dass du dich dem unergründlichen Ratschluss einer höheren Instanz beugst:
Für den Mörder im klassischen Sinne ist es das Gesetz: Polizei, Richter, Gefängniszelle. Der gemeine Drogen- oder Alkoholabhängige muss sich dagegen vor Gott oder Jesus oder Buddha oder sonst einem höheren Wesen verantworten, einer Macht, die stärker ist als Drink und Drogen. So oder so: Füg dich, es ist der einzige Ausweg – wenn du denn einen Ausweg suchst.
Er war anders gestrickt, solche Bekenntnisse und Zugeständnisse gingen ihm gegen die Natur – im Unterschied zur Sucht. Die Sache mit dem Töten ließ er offen; fest stand nur, dass er es in absehbarer Zeit herausfinden würde.
1
Timothy Warner entdeckte die Leiche seines Onkels, weil er an diesem Morgen mit einem unwiderstehlichen und beängstigend vertrauten Verlangen aufwachte, einer Leere, die wie ein falscher Akkord auf einer E-Gitarre tief in seinem Innern dröhnte. Zuerst hielt er es für den Nachhall eines Traums, in dem er ungestraft einen Wodka nach dem anderen heruntergekippt hatte. Doch dann rief er sich ins Gedächtnis, dass er an diesem Morgen seit neunundneunzig Tagen trocken war, und ihm dämmerte, dass es ihn einen gewaltigen Kraftakt kosten würde, bis zum Schlafengehen nüchtern zu bleiben und seinen hundertsten Tag zu erleben. Die Lage war ernst, und bevor er die müden Glieder von sich gestreckt oder auch nur einen Blick aus dem Fenster geworfen hatte, um nach dem Wetter zu sehen, griff er nach seinem Smartphone und klickte auf die App, die automatisch zählte, wie viele Tage er sich ohne Rückfall hatte trocken halten können. Gestern war sie von achtundneunzig auf neunundneunzig gesprungen.
Einen Moment lang starrte er auf die Zahl. Der anfängliche Höhenflug war längst der Ernüchterung gewichen; nicht der leiseste Anflug von Stolz oder Befriedigung war geblieben. Nach dem ersten Enthusiasmus hatte schon bald die Erkenntnis gesiegt, dass die Zählung eher einer tickenden Bombe glich und ihn unerbittlich an das fortwährende Risiko erinnerte, schwach zu werden, sich gehenzulassen, zu resignieren.
Und es würde ihn umbringen.
Vielleicht nicht auf der Stelle, doch über kurz oder lang. Seit er nüchtern war, fühlte er sich manchmal wie auf einer sturmgepeitschten Klippe: als beugte er sich zaghaft über den Rand, starrte in die schwindelnde Tiefe. Eine einzige kräftige Böe, und der Sturz ins Bodenlose wäre unaufhaltsam.
Es war eine Gewissheit und jede Verharmlosung reiner Selbstbetrug.
Gegenüber seinem Bett lehnte ein dreiviertelhoher, billiger schwarzer Spiegel an der Wand seines kleinen Studios; daneben stand das teure Fahrrad, mit dem er zur Uni fuhr, nachdem ihn sein letzter Rückfall den Führerschein gekostet hatte. In der Oversize-Unterwäsche, in der er schlief, stellte er sich vor den Spiegel und betrachtete sein Ebenbild.
Ihm gefiel nicht unbedingt, was er sah.
Statt des schlanken, durchtrainierten Kerls von früher blickte er auf eine ausgemergelte Gestalt, statt Sixpack konnte er die Rippen zählen, und von einem der schmächtigen Schultermuskeln grinste ihm ein trauriges Clownsgesicht mit zerzausten Haaren entgegen – ein schlecht gemachtes Tattoo als Andenken an eine durchzechte Nacht. Auch er selbst trug sein pechschwarzes Haar lang und ungepflegt. Im Unterschied zum Clown hatte er dunkle Augenbrauen und ein gewinnendes, doch wie dieser ein wenig schiefes Lächeln, mit dem er auf andere freundlicher wirkte, als er nach eigener Einschätzung war. Er wusste nicht, ob er gut aussah, auch wenn es ihm dieses wirklich schöne Mädchen vor Jahren bescheinigt hatte. Er hatte die langen, dünnen Arme eines Langstreckenläufers. Im Footballteam der Highschool war er Außenstürmer gewesen; zudem ein Einserschüler, den andere um Hilfe baten, wenn sie bei einem schwierigen Chemie-Experiment oder einem prekär verschleppten Aufsatz in Schwierigkeiten waren. Einer der besten Spieler im Team, ein bulliger Lineman, strich eines Tages einfach so vier Buchstaben aus seinem Namen und begründete seine Umbenennung damit, Tim oder Timmy passe einfach nicht zu Moths getriebenem Gesichtsausdruck. Der Spitzname blieb an ihm hängen, und Timothy hatte eigentlich nichts dagegen einzuwenden, weil Motten außergewöhnliche Qualitäten besaßen und sich in ihrer Suche nach Licht tollkühn in offene Flammen stürzten. Moth also, basta. Von da an griff er nur bei seltenen Gelegenheiten auf seinen vollen Namen zurück, bei formellen Anlässen, Familienfesten und – vor neunundneunzig Tagen – auch bei seinem ersten Treffen mit den Anonymen Alkoholikern, wo er sich mit den Worten vorstellte: »Hallo, ich heiße Timothy, und ich bin Alkoholiker.«
Eher unwahrscheinlich, dass sich seine weit entfernt lebenden Eltern oder die beiden älteren Geschwister, zu denen sein Kontakt ebenfalls seit Jahren eingeschlafen war, überhaupt noch an seinen Spitznamen erinnern konnten. Der Einzige in seiner Familie, der ihn nach wie vor fast immer und mit Zuneigung so anredete, war sein Onkel, dessen Nummer Moth hastig wählte, während er sein Spiegelbild anstarrte. Er wusste, dass er sich vor sich selbst schützen musste, und ein Anruf bei seinem Onkel war praktisch der erste Schritt, zu dem ihn sein Selbsterhaltungstrieb drängte.
Wie nicht anders zu erwarten, schaltete sich der Anrufbeantworter ein. »Hier spricht Dr. Warner. Ich befinde mich gerade in einem Patientengespräch. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, und ich melde mich so bald wie möglich zurück.«
»Onkel Ed, hier spricht Moth. Heute Morgen hat mich das Verlangen derart erwischt, dass ich nicht weiß, wie ich es über die nächsten Stunden schaffen soll. Muss zu einem Treffen. Könntest du vielleicht auch hinkommen? In der Redeemer One, heute Abend um sechs? Also, falls möglich, bis dann. Ich warte auf dich, und vielleicht können wir hinterher noch ein bisschen reden. Tagsüber werde ich es wohl irgendwie packen.« Dieses windelweiche Versprechen nahm er sich selbst nicht ab, und sein Onkel würde das genauso wenig tun.
Vielleicht, überlegte Moth, gehe ich zu diesem Mittagstreff drüben im Campuszentrum oder der kleinen Vormittagsrunde in dem winzigen Zimmer hinter dem Laden der Heilsarmee. Oder ich lege mich ganz einfach wieder ins Bett, ziehe mir die Decke über den Kopf und trete bis zu dem Sechs-Uhr-Treffen gar nicht erst vor die Haustür.
Die abendlichen Meetings wurden in der First Redemption Church abgehalten – im Geheimjargon zwischen ihm und seinem Onkel firmierte die Erlöserkirche, schon wegen der Kürze, aber auch wegen der Anspielung auf das Raumschiff, als Redeemer One. Diese ein wenig elitären Zusammenkünfte waren ihm am liebsten. Nur selten fehlte er in dieser Runde von Anwälten, Ärzten und anderen Leuten aus den gehobenen Kreisen, die sich lieber auf den weichen Polstersofas in dem behaglichen, holzgetäfelten Versammlungsraum der Kirche zu ihrer Sucht bekannten als auf harten Metallklappstühlen im unbarmherzigen Neonlicht eines niedrigen, kalten Souterrains – dem üblichen Austragungsort von Treffen der Anonymen Alkoholiker. Ein betuchter Wohltäter der Kirche hatte einen Bruder an den Alkohol verloren, und seinen großzügigen Spenden waren die weichen Sitzgelegenheiten sowie der frische Kaffee zu verdanken. Die Redeemer One hatte etwas von einem exklusiven Club. Moth war mit großem Abstand der Jüngste.
Die trockenen Trinker und Junkies von einst, die es allabendlich dorthin zog, lebten ausnahmslos in jener fernen Welt, für die Moth, wie er ein Leben lang immer wieder zu hören bekam, ebenfalls prädestiniert war. Wer ihn eher flüchtig kannte, sah in ihm den künftigen Arzt, Anwalt oder erfolgreichen Geschäftsmann, wenn nicht mehr.
Natürlich nicht einen Arzt, der erst einmal selbst zur Spritze greift, bevor er seine Patienten fragt: »Was kann ich für Sie tun?«, oder einen Anwalt, der sein Schlussplädoyer mit schwerer Zunge vorträgt, und ebenso wenig einen Geschäftsmann, der seine Kohle in Koks investiert.
Ihm zitterte die Hand. Niemand, dachte er unwillkürlich, erzählt seinen Kindern, sie hätten eine steile Karriere als Trinker oder Junkie vor sich. Nicht in den guten alten USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nein, man hämmert ihnen ein, sie hätten das Zeug dazu, eines Tages Präsident zu werden, dabei spricht die Statistik eindeutig für die Sucht.
Harte Fakten. Nicht von der Hand zu weisen.
Mit einem schwachen Grinsen fügte er im Geiste hinzu: Wahrscheinlich sind die ein, zwei Kinder, die tatsächlich zu hören bekommen, sie würden als Säufer oder mit der Nadel im Arm auf dem Boden eines öffentlichen Klos enden, ausgesprochen motiviert, diesem Schicksal zu entrinnen, und werden irgendwann tatsächlich Präsident.
Im Bad ließ er sein Handy auf der Ablage, um das Klingeln nicht zu verpassen, und stieg in die Dusche. Mit einer halben Flasche Shampoo und brühend heißem Wasser bekam er vielleicht die vielen Schichten verkrusteter Ängste herunter.
Als das Telefon ging, hatte er sich gerade halb abgetrocknet.
»Onkel Ed?«
»Hey, Moth, mein Junge, hab gerade deine Nachricht abgehört. Gibt’s Probleme?«
»Ja.«
»Wie ernst?«
»Bis jetzt nur ein Wahnsinnsverlangen, bin praktisch davon aufgewacht.«
»War irgendwas, ich meine, ist was Besonderes vorgefallen, das es ausgelöst haben könnte?«
Sein Onkel, das wusste Moth aus Erfahrung, interessierte sich immer für das Warum, das ihm dabei helfen würde, sich ein Gesamtbild zu machen.
»Nein, keine Ahnung. Eigentlich nichts. Es war nur einfach da, als ich heute Morgen die Augen aufmachte. Als würde ich wach und da säße ein Gespenst an meinem Bett und ließe mich nicht aus den Augen.«
»Das klingt furchterregend«, sagte sein Onkel. »Auch wenn dir das Gespenst nicht ganz unbekannt sein dürfte.« Er legte eine Pause ein, in der er sich, ganz der Psychiater, jedes Wort so genau überlegte wie ein Schachmeister seine nächsten Züge. »Hältst du es wirklich für eine gute Idee, bis heute Abend zu warten? Wie wär’s mit einem früheren Treffen?«
»Ich hab fast den ganzen Tag Seminare. Ich sollte es bis …«
»Vorausgesetzt, du gehst hin.«
Moth erwiderte nichts. Wäre auch zwecklos gewesen.
»Vorausgesetzt«, spann sein Onkel den Faden weiter, »du trittst nicht aus der Haustür, wendest dich scharf nach links und landest in diesem riesigen Spirituosendiscounter in der LeJeune Road. Du weißt schon, der mit dieser riesigen blinkenden roten Neonschrift, die jeder Alkoholiker im ganzen County Dade in seinen Träumen sieht. Und dann haben sie auch noch einen gebührenfreien Parkplatz.« Die letzten Worte trieften vor Sarkasmus.
Wieder schwieg Moth, während er sich fragte: Wäre es darauf hinausgelaufen? Irgendwo in einem versteckten Winkel seines Kopfs lauerte vielleicht ein Ja, das sich nur noch nicht lautstark bemerkbar gemacht hatte, jedoch gerade Luft holte, um es ihm ins Gesicht zu brüllen. Sein Onkel kannte alle diese inneren Zwiegespräche schon im Voraus.
»Du glaubst, du schaffst es, auf das Rad zu steigen und im Eiltempo zur Uni zu fahren? Und dann hintereinanderweg deine Seminare zu absolvieren? Was hast du eigentlich heute Morgen?«
»Kolloquium zur Bedeutung von Jeffersons Prinzipien für die aktuelle Gesellschaftssituation – geht darum, ob das, was der große Mann vor zweihundertfünfzig Jahren gesagt hat, uns auch heute noch was bringt. Nach der Mittagspause eine zweistündige Pflichtvorlesung über Statistik.«
Wieder legte sein Onkel eine Schweigeminute ein, und Moth sah im Geist das wohlwollende Grinsen in seinem Gesicht. »Na ja, Jefferson ist immer verflucht interessant. Sklaven und Sex. Unglaublich kluge Erfindungen und großartige Architektur. Diese Statistikvorlesung dagegen – öde. Wieso haben sie dir denn so was aufs Auge gedrückt? Wozu braucht man das für eine Promotion in amerikanischer Geschichte? Da greift doch jeder lieber zur Flasche.«
Darüber hatten sie schon oft gewitzelt, und Moth konnte sich zu einem kurzen Lachen aufraffen. »Aber echt«, sagte er im Rückgriff auf einen längst überholten Teeniejargon, den der Historiker in ihm genoss.
»Was hältst du von einem Kompromiss?«, fragte sein Onkel. »Wir treffen uns, wie du vorschlägst, um sechs in der Redeemer One. Aber vorher gehst du zu dem Mittagskränzchen im Campuszentrum. Das ist genau um zwölf. Du rufst mich an, wenn du reingehst. Von mir aus machst du da nicht mal den Mund auf, es sei denn, dir ist gerade danach. Hauptsache, du bist da. Und dann rufst du wieder bei mir an, wenn du rauskommst. Du meldest dich erneut, wenn du in diese Statistikvorlesung gehst. Und – du hast es erraten – sobald du wieder rauskommst. Und halte das Handy jedes Mal so hoch, dass ich mitbekomme, wie der Professor im Hintergrund seinen Sermon hält. Genau das will ich hören. Sicheres, langweiliges Vorlesungshintergrundrauschen. Und keine klirrenden Gläser.«
Für den Alkoholikerveteranen gab es unter Millionen von Erklärungen und fadenscheinigen Ausflüchten, um an einen Drink zu kommen, nicht eine einzige Ausrede, die er nicht aus eigener Erfahrung kannte. Seine persönliche Strichliste an trockenen Tagen musste sich auf mehrere tausend belaufen, aus Moths Sicht eine schier unerreichbare Zahl. Onkel Ed war mehr als ein Betreuer. Für Moths betrunkenen Dante war er Vergil. Moth wusste, dass Onkel Ed ihm das Leben gerettet hatte, und zwar nicht erst einmal.
»Abgemacht«, sagte Moth. »Dann sehen wir uns also um sechs?«
»Ja. Und halt mir einen bequemen Sitz frei. Möglicherweise verspäte ich mich ein paar Minuten; musste für einen Patienten noch einen Nottermin einschieben.«
»Jemand wie ich?«, fragte Moth.
»Moth, mein Junge. Von deiner Spezies gibt es kein zweites Exemplar«, antwortete sein Onkel. »Nee, denke eher, eine Hausfrau aus der Vorstadt mit melancholisch gesenktem Blick, der die Medikamente zur Neige gehen und die Panik schiebt, weil ihr Seelenklempner gerade in Urlaub ist. Ich bin nichts weiter als ein heiß begehrter, überqualifizierter Rezeptblock. Also dann, Moth, bis heute Abend. Aber vorher ruf an. Jedes Mal. Du weißt, dass ich drauf warten werde.«
»Mach ich. Danke, Onkel Ed.«
»Keine Ursache.«
Eine maßlose Untertreibung.
Moth hielt sich an die vereinbarten Telefonate, bei denen er mit seinem Onkel jedes Mal ein paar Minuten über Trivialitäten scherzte. Moth hatte nicht vorgehabt, bei dem Treffen in der Mittagspause den Mund aufzumachen, war jedoch, auf Drängen des jungen Theologieprofessors, der die Runde leitete, am Ende doch noch aufgestanden und hatte sich zu seinen Ängsten über den starken Drang nach Alkohol am Morgen bekannt. Daraufhin hatten fast alle genickt, als sei es ihnen genauso ergangen.
Nach dem Treffen fuhr er mit seinem Trek-Mountainbike, das über stattliche zwanzig Gänge verfügte, zu den Sportanlagen der Universität. Die gummierte 400-Meter-Hightech-Rennbahn mit einem Football-Trainingsplatz in der Mitte war eingezäunt, doch trotz des Warnschilds, das Studenten untersagte, die Bahn ohne Aufsicht zu benutzen, hob er das Rad über das Drehkreuz am Eingang, blickte schnell nach links und rechts, um sich zu vergewissern, dass er unbeobachtet war, und fuhr die ersten Runden.
In kürzester Zeit hatte er sein Tempo stark beschleunigt. Er genoss das Klicken der wechselnden Gänge, die gefährliche Schräglage, mit der er in jede neue Kurve ging, den Geschwindigkeitsrausch, den Nervenkitzel unter dem azurblauen, wolkenlosen Himmel eines typischen Wintertags in Miami. Kaum trat er mit voller Kraft in die Pedale und spürte, wie sich seine Muskeln spannten und die Energie seinen ganzen Körper erfasste, registrierte er, dass das Verlangen allmählich nachließ und sich in irgendeinen Winkel verkroch. Aus vier Runden wurden im Handumdrehen zwanzig. Ihm brannte der Schweiß in den Augen. Vor Anstrengung begann er zu keuchen. Er fühlte sich wie ein Boxer, der mit einem rechten Schwinger seinen Gegner zu Fall gebracht hatte. Drisch weiter auf ihn ein, spornte er sich an. Der Sieg war mit Händen zu greifen.
Nach der achtundzwanzigsten Runde bremste er so abrupt, dass die Reifen auf dem Kunststoff quietschten. Er musste jeden Moment damit rechnen, dass ein Mann vom Campus-Wachdienst vorbeikam – ein Wunder, dass sich nicht längst einer hatte blicken lassen.
Was würde er wohl machen? Mich anbrüllen?, überlegte Moth. Mir ein Knöllchen dafür verpassen, dass ich versucht habe, nüchtern zu bleiben?
Moth hob sein Fahrrad wieder über das Drehkreuz, bevor er gemächlich die Strecke, die er gekommen war, zurückfuhr und sein Mountainbike mit einem soliden Schloss an dem gusseisernen Ständer neben dem Gebäudekomplex der naturwissenschaftlichen Fakultät sicherte, bevor er sich für die Statistikvorlesung in den Hörsaal begab. Als er an einem Wachmann in einem kleinen weißen Geländewagen vorbeikam, winkte er dem Fahrer zu, der die fröhliche Geste ignorierte. Wahrscheinlich würde er in dem klimatisierten Saal einen üblen Körpergeruch verströmen, sobald der Schweiß an ihm trocknete, doch damit konnte er leben.
Auf wundersame Weise wendete sich dieser Tag offenbar noch zum Guten, so dass sich bei ihm verhaltener Optimismus einstellte.
Auf einmal erschien ihm die Hundert nicht nur machbar, sondern wahrscheinlich.
Bis eine Minute vor sechs wartete Moth vor der Kirche, dann ging er hinein und steuerte die Lounge an, wo bereits ungefähr zwanzig Männer und Frauen in einer lockeren Kreisformation warteten, die Moth alle mit einem kurzen Nicken oder Winken begrüßten. Es hing ein schwacher Zigarettendunst in der Luft – für Alkoholiker eine lässliche Sünde, dachte Moth. Er sah sich in der Runde um: Arzt, Anwalt, Ingenieur, Professor. Dame, König, Ass, Spion. Und dann seine Wenigkeit: Doktorand. An der Rückwand standen auf einem dunklen Eichentisch ein Kaffeespender und Keramikbecher bereit. Die schimmernde Metallschüssel mit Eiswürfeln stand neben alkoholfreien Getränken und Tafelwasser.
Moth fand einen freien Platz und stellte seinen abgewetzten Studentenrucksack neben sich ab. Den regelmäßigen Besuchern war klar, dass er den Sitz für seinen Onkel frei halten wollte – der Moth überhaupt erst in die vornehme Runde in der Redeemer One eingeführt hatte.
Erst als das Gespräch schon etwa eine Viertelstunde lief und von seinem Onkel immer noch keine Spur zu sehen war, fing Moth an, unruhig die Sitzposition zu wechseln und mit den Händen herumzufuchteln. Auch wenn sich Onkel Ed schon einmal verspätete, so war auf eines hundertprozentig Verlass: Wenn er gesagt hatte, er käme, dann kam er auch. Immer häufiger wandte sich Moth vom Sprecher ab und spähte in der Hoffnung zur Tür, dass sein Onkel endlich mit einer Entschuldigung an die versammelte Runde erschien.
Der Teilnehmer, der gerade an der Reihe war, sprach mit einigem Zögern über Oxycontin und das wohlig-warme Gefühl, das es ihm gab. Moth versuchte, aufmerksam zuzuhören. Die Beschreibung war ihm längst geläufig, und zwar unabhängig davon, ob die Rede von morphiumhaltigen Pharmazeutika, von selbstgebrautem Methamphetamin oder billigem Gin aus dem Supermarkt war. Der Süchtige sehnte sich danach, vom Scheitel bis zur Sohle in diese Wärme einzutauchen und sich mit Haut und Haaren darin zu suhlen. So war es Moth in den wenigen Jahren seiner eigenen Sucht ergangen, und er hegte wenig Zweifel, dass sein Onkel aus seinen langen Jahren der Abhängigkeit ein Lied davon singen konnte.
Wärme, dachte Moth. Wie verrückt kann man sein, tagtäglich die sengende Hitze von Miami zu ertragen und sich noch nach einer anderen Form von Wärme zu sehnen?
Moth versuchte, sich auf den Mann zu konzentrieren, der gerade sprach. Er war Ingenieur, ein sympathischer Typ in mittleren Jahren, etwas untersetzt, wenig Haar auf dem Kopf, ein gutmütiger Zeitgenosse, der offenbar dem Druck als Angestellter eines der größeren Bauunternehmen der Stadt nicht gewachsen war. Der Realist in Moth fragte sich, wie viele Wolkenkratzer in der Brickell Avenue vielleicht von Leuten hochgezogen worden waren, die sich mehr für die Anzahl von Pillen interessierten, auf die sie tagtäglich angewiesen waren, als für die Maßangaben auf den Bauzeichnungen.
Als er sich gerade wieder zur Tür umdrehte, ging sie tatsächlich im selben Moment auf, doch statt seines Onkels trat eine Frau in den Raum – eine stellvertretende Staatsanwältin, mindestens zehn Jahre älter als Moth. Die dunkelhaarige, angespannt wirkende Frau trug einen adretten blauen Hosenanzug und hatte statt einer Prada-Handtasche ein ledernes Aktenköfferchen dabei; selbst am Ende eines langen Arbeitstags war sie eine äußerst gepflegte Erscheinung. In der Redeemer-One-Gruppe gehörte sie eher zu den Neuzugängen. Da sie erst an wenigen Sitzungen teilgenommen und kaum einmal etwas beigesteuert hatte, war sie für den festen Stamm die große Unbekannte. Kürzlich geschieden. Strafrecht, Dezernat für Schwerkriminalität. Droge der Wahl: Kokain. »Hallo, ich heiße Susan, und ich bin drogenabhängig«, hatte sie beim ersten Mal gesagt. Sie murmelte eine Entschuldigung für ihre Verspätung und setzte sich still in einen Sessel ganz hinten.
Als Moth an der Reihe war, geriet er ins Stottern und machte seinem Nachbarn Zeichen, dass er den Stab an ihn weitergeben wolle.
Das Treffen endete ohne seinen Onkel.
Moth verließ die Kirche zusammen mit den anderen. Auf dem Parkplatz verabschiedete er sich von manchen mit einer kurzen Umarmung, tauschte mit anderen, wie es nach den Gesprächsrunden Sitte war, Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus. Der Ingenieur fragte ihn, wo denn sein Onkel stecke, und Moth erklärte ihm, Ed habe vorgehabt zu kommen, sei vermutlich aber länger als geplant von einem Notfall in der Praxis festgehalten worden. Der Ingenieur sowie ein Herzchirurg und ein Philosophieprofessor, die in der Nähe standen und den Wortwechsel mitbekamen, nickten mit dieser unnachahmlichen Miene der Suchtkranken, die besagte, dass Moths Erklärung plausibel klang und aller Wahrscheinlichkeit nach stimmte, jedoch grundsätzlich Zweifel angebracht waren. Alle drei versicherten ihm, er könne sie jederzeit anrufen, falls irgendetwas nicht in Ordnung sei und er das Bedürfnis habe zu reden.
Alle Teilnehmer der Runde besaßen die Höflichkeit, den scharfen Schweißgeruch von seinem Fahrradtraining am Mittag zu ignorieren. Als das Küken ihrer Gruppe behandelten sie ihn auch sonst mit besonderer Nachsicht – vielleicht weil er sie auf die eine oder andere Weise an ihre eigene Jugend erinnerte – vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren. Davon abgesehen, waren sie wie alle Suchtkranken mit dem Gestank von Erbrochenem, von Ausscheidungen, nicht zuletzt dem stechenden Geruch der Angst und Verzweiflung vertraut und besaßen eine wesentlich höhere Toleranzschwelle für alle Varianten unangenehmer Körperausdünstungen als üblich.
Moth stand unschlüssig da und trat von einem Bein aufs andere, während er zusah, wie die übrigen Besucher einer nach dem anderen verschwanden. Es war immer noch warm. Die Schwüle legte sich wie eine Decke um ihn und zog sich mit jeder Minute enger. Er merkte, wie ihm zum zweiten Mal an diesem Tag der Schweiß ausbrach.
Später hätte er nicht mehr sagen können, wann bei ihm der Entschluss reifte, zu dem Haus zu fahren, in dem sein Onkel praktizierte. Er stellte einfach irgendwann fest, dass er auf seinem Rad saß, heftig in die Pedale trat und in die Richtung der Praxis fuhr.
Er hatte lediglich ein blinkendes, rotes Rücklicht an seinem Mountainbike und setzte nicht allzu großes Vertrauen in die Sicherheit, die es ihm brachte. In Miami nahmen es die Autofahrer mit der Straßenverkehrsordnung nicht allzu genau, und ein Mensch auf einem Fahrrad war sowieso kein vollwertiger Verkehrsteilnehmer; entweder grenzte es an Gesichtsverlust, ein so wehrloses Geschöpf großräumig zu umfahren, oder ein solcher Slalom brachte die Fahrer an die Grenze ihrer Fahrkunst. Moth war daran gewöhnt, dass ihm etwa alle hundert Meter jemand den Weg abschnitt oder ihn fast über den Haufen fuhr, und genoss insgeheim den Nervenkitzel der allgegenwärtigen Gefahr einer Kollision.
Sein Onkel führte seine Praxis in einem kleinen Gebäude zehn Häuserblocks von der exklusiven Einkaufsmeile entfernt – der Miracle Mile in Coral Gables, einen Katzensprung vom Universitätscampus entfernt. Am hinteren Ende des Einkaufsviertels verbreiterte sich die Straße in eine vierspurige Rennbahn – zum Frust der Mercedes- und BMW-Fahrer auf dem Heimweg von der Arbeit mit einer Phalanx an Ampeln in beiden Richtungen. Zwischen den gegenläufigen Spuren lag ein breiter Mittelstreifen mit stattlichen Palmen und knorrigen Mangroven. Im Gegensatz zu den Palmen, die in puritanischer Strenge nur himmelwärts strebten, schienen sich die uralten Mangroven mit ihren verschlungenen Ästen wie Gnome einen Heidenspaß daraus zu machen, weit über die Fahrbahnen zu wuchern, so dass die Scheinwerfer der Autos zwischen den dicht stehenden Ungetümen gerade genügend Licht in den dunklen Tunnel bringen konnten, um die Fahrer auf der Spur zu halten.
Moth dachte nicht daran, das Tempo zu drosseln. Er wich mit akrobatischem Geschick und Wagemut gefährlichen Situationen aus und fuhr ein paarmal bei Rot über die Ampel, wenn er den Eindruck hatte, dass er noch so eben über die Kreuzung zischen konnte. Immer wieder hupten ihm Autos hinterher, oft nur aus Verärgerung darüber, dass sie eine Fahrbahn mit ihm teilen mussten, auf die sie mit ihren überdimensionierten SUV alleinigen Anspruch erhoben.
Als er am Eingang des Gebäudes eintraf, keuchte er vor Anstrengung und spürte seinen rasenden Puls. Moth kettete sein Rad an einen Baum an der Vorderseite des einfallslosen roten Backsteinbaus, eines vier Stockwerke hohen Klotzes, dem man besonders in dieser Stadt, die dem Neuen, Modernen, Angesagten huldigte, deutlich ansah, dass er in die Jahre gekommen war. Der öde Ausblick, den die breiten rückseitigen Fenster der Praxis boten, stand der Fassade in nichts nach – eine Handvoll Nebenstraßen, ein Parkplatz und zum Trost eine einsame Palme. Für einen so erfolgreichen Therapeuten ein ausgesprochen bescheidenes Ambiente, über das sich Moth schon immer gewundert hatte.
Er ging um das Gebäude herum und entdeckte an der gewohnten Stelle Eds Porsche-Cabrio.
Moth wusste nicht, was er davon halten sollte. Patient? Notfall?
Er sagte sich, dass er am besten am Porsche wartete, bis Onkel Ed herunterkam, doch irgendwann rang er sich dazu durch, das Gebäude zu betreten und zu der kleinen Zimmerflucht im obersten Stock hinaufzufahren.
Was auch immer ihm dazwischengekommen ist, muss wichtig gewesen sein – dieser Nottermin, den er extra erwähnt hat, weil er sich möglicherweise bei der Selbsthilfegruppe verspäten würde. Etwas weitaus Ernsteres als ein Folgerezept für Zoloft. Vielleicht jemand in einem akuten manischen Zustand. Halluzinationen. Kontrollverlust. Todesdrohungen. Krankenwagen. So was in der Art. Liebend gerne hätte Moth weiterhin an die Version geglaubt, mit der er vor einer knappen Stunde den alten Bekannten aus dem Redeemer-Kreis Eds Fernbleiben erklärt hatte.
Moth nahm den Fahrstuhl in den dritten Stock, der ruckelnd im Dachgeschoss hielt. Im Gebäude herrschte absolute Stille. Wahrscheinlich legte keiner der anderen zehn, elf Therapeuten im Haus Überstunden ein. Nur wenige Praxen beschäftigten Empfangspersonal – ihre Klientel wusste selbst, wann sie zu erscheinen und wieder zu verschwinden hatte.
Die Praxis seines Onkels unterm Dach verfügte über ein kleines, nicht besonders behagliches Wartezimmer mit älteren Zeitschriftenausgaben in einem Halter an der Wand. In einem angrenzenden größeren Raum hatte Onkel Ed Platz für einen Schreibtisch, einen Stuhl und die gute alte Analytikercouch, die er inzwischen viel seltener benutzte als noch vor gut zehn Jahren.
Moth trat leise in die Praxis und drückte auf die vertraute Klingel direkt neben der Tür, über der ein freundliches handgeschriebenes Schild mit der Anweisung für Patienten hing: Bitte zweimal schön laut klingeln, damit ich weiß, dass Sie da sind, und im Wartezimmer Platz nehmen.
Genau das hatte Moth vor, doch als er sah, dass die Tür zum Sprechzimmer einen Spalt offen stand, schwebte sein Finger in der Luft, ohne den Klingelknopf zu berühren.
Er ging zur Tür.
»Onkel Ed?«, fragte er laut.
Dann stieß er sie auf.
Er konnte den lauten Schrei, der ihm in der Kehle saß, unterdrücken.
Er versuchte, den Leichnam zu berühren, doch beim Anblick all des Bluts und der glitschigen, zähflüssigen Gehirnmasse, die aus einer klaffenden Kopfwunde gequollen und über den Schreibtisch gespritzt war und am weißen Hemd sowie der bunten Krawatte klebte, zog er die Hand wieder zurück. Auch fasste er die kleine halbautomatische Pistole nicht an, die neben der ausgestreckten rechten Hand des Toten zu Boden gefallen war. Die starren Finger waren gekrümmt.
Er wusste, dass sein Onkel tot war, doch selbst in Gedanken brachte er das Wort nicht heraus.
Er wählte den Notruf. Mit zittriger Hand.
Wie ein unbeteiligter Zeuge hörte er seine schrille Stimme, die um Hilfe bat und die Adresse der Praxis durchgab.
Langsam ließ er den Blick durchs Zimmer schweifen, als sei es überlebenswichtig, dass er sich in diesem Moment alles, was er sah, ins Gedächtnis einbrannte – bis ihn die Vielzahl der Eindrücke erschöpfte. Nichts brachte ihm irgendeine Erkenntnis.
Er sackte auf den Boden und wartete.
Bei seiner Aussage gegenüber den Polizisten, die in wenigen Minuten vor Ort waren, hielt er mit aller Macht die Tränen zurück. Eine Stunde später erzählte er alles, was er der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, noch einmal Susan, die er gerade erst beim AA-Treffen in der Redeemer im blauen Hosenanzug gesehen hatte und die ihm jetzt in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Staatsanwältin gegenübersaß. Als sie ihm ihre Visitenkarte reichte, erwähnte sie ihre Bekanntschaft mit keinem Wort.
Er wartete, bis der Gerichtsmediziner mit seinem Kombi eintraf – eine Mischung aus Leichen- und Krankenwagen. Er sah zu, wie zwei Kriminaltechniker in weißen Overalls die Leiche seines Onkels in einen schwarzen Vinylsack packten und auf einer Trage aus der Praxis rollten. Da sie so etwas tagtäglich machten, verfuhren sie mit dem Toten unbekümmert routiniert. Kurz bevor sie über ihm den Reißverschluss zuzogen, erhaschte Moth einen einzigen Blick auf das rot geränderte Loch in der Schläfe. Er wusste, dass er diesen Anblick nie vergessen würde.
Auf die Frage eines müden Detectives: Welchen Grund könnte Ihr Onkel gehabt haben, sich das Leben zu nehmen?, antwortete er: Ich weiß nicht, und fügte hinzu: Er war glücklich, es ging ihm gut. Er hatte seine Probleme hinter sich gelassen, vor ewigen Zeiten.
Mit einiger Phasenverschiebung hatte er die Ermittler schließlich seinerseits gefragt: »Was soll das heißen, sich das Leben genommen? Das hat er mit Sicherheit nicht getan. Völlig undenkbar.« Sein heftiger Protest machte wenig Eindruck auf den Mann, der seine Frage schweigend überging. Moth hatte sich hektisch in der Praxis umgesehen. Auch wenn er nicht erklären konnte, wieso er die Möglichkeit eines Selbstmords so entschieden verwarf, sagte ihm sein Bauchgefühl, dass es hier irgendetwas geben musste, das ihm recht gab.
Das Angebot der stellvertretenden Staatsanwältin, ihn nach Hause zu fahren, lehnte er dankend ab. Während die Kriminaltechniker die Praxis eher flüchtig und routinemäßig als gründlich untersuchten, stand er draußen im Wartezimmer. Immerhin nahm die ganze Prozedur mehrere Stunden in Anspruch, in denen Moth versuchte, seine Gedanken und Gefühle auszuschalten.
Erst als das letzte Blinklicht der Streifenwagen um die Ecke verschwunden war, erfasste ihn das Gefühl völliger Hilflosigkeit wie ein Strudel, der ihn unaufhaltsam in die Tiefe zog, und ohne darüber nachzudenken, was er tat, oder vielleicht auch, weil es das Einzige war, wozu er sich imstande sah, machte sich Moth auf die Suche nach einem Drink.
2
Du bist eine Mörderin.
Nein, bin ich nicht.
Und ob! Du hast es umgebracht. Aus freien Stücken. Mörderin.
Das stimmt nicht, ich könnte so was nicht, das brächte ich niemals fertig.
Hast du aber. Du hast es getan, Mörderin.
Eine Woche nach der Abtreibung lag Andy Candy wie ein Embryo eingerollt auf der rüschenbesetzten rosa Tagesdecke, den Kopf in die Dekokissen gedrückt, auf ihrem Bett in dem kleinen Zimmer des bescheidenen Hauses, in dem sie aufgewachsen war. Sie hieß nicht wirklich Andy Candy; der Spitzname ging auf einen Abzählvers zurück, den ihr unnachahmlich liebevoller, doch verstorbener Vater in ihrer Kindheit so oft auf den Lippen gehabt hatte. Er selbst hieß Andrew, und da sie mit einem Jungen gerechnet hatten, sollte sie nach ihm benannt werden. Andrea war der beste Kompromiss gewesen, der ihnen einfiel, als die Hebamme ihnen ein Mädchen in die Arme legte, und schließlich war es bei Andy Candy geblieben. Der Name verband sie unauflöslich mit ihrem Vater, der viel zu früh an Krebs gestorben war – eine unsichtbare Last, die sie ständig mit sich herumtrug.
Mit Nachnamen hieß sie Martine, Betonung auf der zweiten Silbe, eine Hommage der Familie an ihre Vorfahren, die vor knapp hundertfünfzig Jahren aus Frankreich in die USA eingewandert waren. Eine Zeitlang hatte Andy Candy von einer Reise nach Paris geträumt, einer Pilgerfahrt zu ihren Wurzeln, und sich ausgemalt, wie sie den Eiffelturm bestieg, sich knusprige Croissants und Eclairs auf der Zunge zergehen ließ. Vielleicht würde sie sich auch auf eine Nouvelle- Vague-Romanze mit einem älteren Mann einlassen. Dies war nur einer von vielen Zukunftsträumen für die Zeit nach der Uni, mit einem glänzenden Anglistik-Abschluss in der Tasche. An ihrer Wand hing sogar ein farbenprächtiges Poster mit einem strahlend attraktiven Paar, das in der milden Oktobersonne Händchen haltend am Seine-Ufer entlangschlenderte. Das Bild vermittelte das stereotype Reisebüro-Image von Paris als Stadt der Liebe, an dem Andy Candy mit unerschütterlicher Überzeugung festhielt. In Wahrheit sprach sie ebenso wenig wie sonst irgendjemand aus ihrem Freundeskreis Französisch. Abgesehen von den wenigen Brocken, die sie bei einem Schulausflug nach Montreal zu einer Theateraufführung von Warten auf Godot aufgeschnappt hatte, verfügte sie über keine Fremdsprachenkenntnisse und hatte auch keine nennenswerten Reisen unternommen. Tatsächlich hatte sie lediglich ihren Lehrer jemals Französisch sprechen gehört.
Im Moment kannte Andy Candy nur die Sprache von Schmerzen, Seelenqualen und Tränen, einer unsäglichen Verzweiflung, der sie unablässig Nahrung gab, indem sie einmal als Büßerin händeringend um Vergebung flehte und im nächsten Moment schonungslos mit sich ins Gericht ging. Dann hatten ihre Selbstvorwürfe nichts von einer Gardinenpredigt, sondern erinnerten in ihrem vernichtenden Eifer eher an einen kaltblütigen, mittelalterlichen Inquisitor.
Ich hatte keine Wahl. Nicht die geringste. Wie denn, bitte schön? Was hätte ich denn machen sollen?
Jeder hat eine Wahl, Mörderin. In jeder Situation kann man sich so oder so entscheiden. Du hast dich falsch entschieden, und das weißt du genau.
Ist nicht wahr. Ich hatte keine Alternative. Ich habe das Richtige getan. Es tut mir leid, aber es war das einzig Richtige.
Machen wir es uns da nicht ein bisschen zu leicht, Mörderin? Allzu leicht? Vielleicht ist die Frage gestattet, für wen es das Richtige gewesen ist?
Für alle Beteiligten.
Ach ja? Alle? Bist du dir sicher? Was für ein Selbstbetrug! Lügnerin. Mörderin. Verlogene Mörderin!
Andy Candy drückte einen abgewetzten Teddybär an die Brust. Dann zog sie sich die selbstgenähte Steppdecke mit den roten Herzen und gelben Blumen über den Kopf, als könnte sie auf diese Weise vor dem immer heftigeren Für und Wider die Ohren verschließen. Doch der Zwist in ihr tobte ungehindert weiter. Es war, als hätte sie zwei Seelen in der Brust, eine weinerliche, die sich so gut es ging zu entschuldigen versuchte, und eine strenge, die jede Ausflucht in der Luft zerfetzte. Aus tiefstem Herzen sehnte sie sich in ihre Kindheit zurück. Während sie zitternd und schluchzend dalag und sich an ihr altes Stofftier klammerte, stellte sie sich vor, wie schön es wäre, eine Zeitreise in die Jahre ihrer Kindheit zu machen, als alles so viel einfacher gewesen war. Am liebsten hätte sie sich in ihrer Vergangenheit versteckt, damit ihre Zukunft sie nicht einholen und niedermachen konnte.
Wenn sie der nächste Heulkrampf packte, drückte sie das Gesicht in den falschen Pelz des Bären, um ihr Schluchzen zu dämpfen. War der schlimmste Ausbruch vorbei, schnappte sie nach Luft und hielt sich den Teddy an das eine Ohr, die Hand über das andere und hoffte, dem unablässigen mörderischen Streit wenigstens für kurze Zeit zu entkommen.
Ich konnte nichts dafür. Ich war das Opfer. Vergib mir. Bitte.
Niemals.
Andy Candys Mutter spielte nervös mit dem Kruzifix, das ihr an einem Kettchen um den Hals hing, bevor sie auf dem Klavier das eingestrichene C anschlug. Dann verharrten ihre Hände, wie sie es in ihrem Lieblingsfilm Der Pianist bei Adrien Brody gesehen hatte, so lange über den Elfenbeintasten, bis absolute Stille herrschte. Sie schloss die Augen und versenkte sich in ein Nocturne von Chopin. Sie musste die Noten nicht wirklich hören, um in die Musik einzutauchen. Ihre Hände flogen über die schimmernden Tasten, ohne sie ein einziges Mal zu berühren.
Zugleich wusste sie, dass sich ihre Tochter in ihrem Zimmer die Seele aus dem Leib heulte. Durch die Tür und den langen Flur drang kein Laut bis zu ihr, doch wie beim Stück von Chopin konnte sie jeden Ton ganz deutlich hören. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus und legte wie nach der letzten Note bei einem Konzert die Hände in den Schoß, um auf den Applaus zu warten. Kaum war das Nocturne in ihrem Kopf verklungen, hatte sie der Stimme der Verzweiflung aus dem Zimmer am Ende des Flurs nichts mehr entgegenzusetzen.
Sie zuckte die Schultern und drehte sich auf der Klavierbank um. Sie erwartete ihre nächste Schülerin erst in einer halben Stunde, und so blieb ihr ein wenig Zeit, um sich zu ihrer Tochter zu setzen und sie zu trösten. Doch das versuchte sie nun schon seit über einer Woche, und all ihr liebevolles Streicheln, ihre Umarmungen, ihre leisen, beschwichtigenden Worte hatten jedes Mal nur zu einem neuen Tränenausbruch geführt. Mit rationalen Argumenten zu helfen hatte sie längst aufgegeben: »Du kannst nichts dafür, wenn du bei einem harmlos gemeinten Date vergewaltigt wirst ...« Dann von der psychologischen Seite: »Du darfst dich nicht selbst bestrafen ...« Schließlich die praktische Seite: »Sieh mal, Andy, du kannst dich nicht ewig hier vergraben. Früher oder später musst du dich zusammenreißen und dich dem Leben stellen. Ein ungewolltes Kind auf die Welt zu bringen wäre Sünde ...«
Bei dieser letzten Behauptung war sie sich ihrer Sache selbst nicht sicher.
Ihr Blick schweifte zu dem abgewetzten Wohnzimmersofa, auf dem es sich ein Boxer-Pudel-Mischling, eine Goofy ähnliche Promenadenmischung mit blondem Fell und ein Windhund mit Hushpuppy-Blick gemütlich eingerichtet hatten und ihr gespannt entgegenschauten. Der Blick der drei Hunde sagte: Was geht? Was ist mit Gassi? Sobald sie ihnen in die Augen sah, wedelten drei unterschiedlich große, unterschiedlich geformte Schwänze.
»Kein Gassi«, sagte sie. »Später.«
Die Hunde – alle noch von ihrem Mann, einem Tierarzt mit weichem Herz, gerettet – wedelten weiter, obwohl sie wahrscheinlich den Grund für die Verzögerung auf Hundeart verstanden. Hunde haben dafür einen siebten Sinn, dachte sie. Sie wissen, wann wir glücklich und wann wir traurig sind.
Schon seit einiger Zeit wäre es niemandem in den Sinn gekommen, die Atmosphäre in ihrem Haus als glücklich zu bezeichnen.
»Andrea«, sagte Andy Candys Mutter laut, wenn auch mit einem resignierten Unterton. »Ich komme.« Doch statt aufzustehen, rührte sie sich nicht von der Klavierbank.
Das Telefon klingelte.
Ein diffuses Gefühl sagte ihr, dass sie es lieber klingeln lassen sollte, auch wenn sie keine Ahnung hatte, warum. Dennoch nahm sie ab und befahl zugleich den drei Hunden mit ausgestrecktem Finger, zu ihrer Tochter zu laufen und sie zu trösten. »Andy Candys Zimmer. Da lauft. Heitert sie ein bisschen auf.«
Die drei Tiere, deren Gehorsam für die erzieherische Gabe ihres verstorbenen Mannes sprach, sprangen von der Couch und rannten um die Wette durch den Flur zum Zimmer ihrer Tochter. Sie wusste, dass sie bellen würden, wenn sie die Tür verschlossen fanden, und dass der Pudelmischling sich auf die Hinterpfoten stellen und so lange wild kratzen würde, bis Andrea ihm öffnete. Wäre die Tür einen Spaltbreit offen, dann schöbe die Promenadenmischung, der Größte im Trio, sie mit der Schulter auf, und alle drei würden um die Wette zu Andys Bett laufen. Gute Idee, dachte sie. Vielleicht können die mehr für sie tun als ich.
Anschließend sagte Andy Candys Mutter ins Telefon: »Hallo?«
»Mrs. Martine?«
»Ja. Am Apparat.«
Die Stimme am anderen Ende klang ihr irgendwie vertraut, wenn auch ein wenig heiser. Sie versuchte, die Stimme unterzubringen.
»Timothy Warner …«
Bei der Erinnerung freute sie sich. »Moth! Na so was, Moth, was für eine Überraschung …«
Es trat eine kurze Pause ein, dann sagte er: »Ich … ehm … versuche, Andrea zu erreichen, und ich wollte Sie fragen, ob Sie mir ihre Nummer an der Uni geben können.«
Als Andy Candys Mutter nicht sofort antwortete, trat wieder Schweigen ein. Die Tatsache, dass er sie mindestens so oft Andrea wie Andy Candy genannt hatte, sprach in ihren Augen für den jungen Mann.
»Ich habe das mit Doktor Martine mitbekommen«, fügte er vorsichtig hinzu. »Ich habe Ihnen eine Karte geschickt. Ich weiß, ich hätte anrufen sollen, aber ...«
Sie wusste, dass er etwas über Darmkrebs und Tod sagen wollte, doch was gab es da schon zu sagen. »Ja, die haben wir bekommen. Das war sehr aufmerksam von Ihnen. Er hat Sie immer gemocht, Moth. Danke. Doch aus welchem Grund melden Sie sich jetzt? Wir haben seit Jahren nicht mehr von Ihnen gehört!«
»Ja. Seit vier Jahren, glaube ich. Ungefähr.«
Vier Jahre, dachte Mrs. Martine, traf es wohl in etwa – kurz bevor ihr Mann verstarb. »Und wieso jetzt?«, wiederholte sie. Sie war sich nicht sicher, inwieweit sie ihre Tochter noch beschützen sollte. Andy Candy war zweiundzwanzig Jahre alt und damit nach landläufiger Meinung erwachsen, selbst wenn die junge Frau, die im Zimmer am anderen Ende des Flurs schluchzte, sie eher an ein kleines Kind erinnerte. Der Moth von früher hatte nichts Bedrohliches an sich gehabt – andererseits waren vier Jahre eine lange Zeit, und Menschen veränderten sich nun einmal. Auf jeden Fall kam sein Anruf völlig überraschend: Würde die Wiederbegegnung mit dem ersten echten Freund ihrer Tochter mehr schaden oder guttun?
»Ich wollte nur …« Er brachte den Satz nicht zu Ende. Mit einem Seufzer gab er sich geschlagen. »Ist schon in Ordnung, wenn Sie mir ihre Nummer nicht geben wollen.«
»Sie ist zu Hause.« Die Reaktion am anderen Ende ließ ein paar Sekunden auf sich warten.
»Ich dachte, sie steckt gerade in den Semesterabschlussklausuren. Macht sie nicht im Juni Examen?«
»Sie hatte ein paar Rückschläge.« Andy Candys Mutter hielt dies für eine passend neutrale Umschreibung einer ungewollten Schwangerschaft.
»Ich auch«, sagte Moth. »Das ist auch indirekt der Grund, warum ich sie gerne sprechen würde.«
Andy Candys Mutter überlegte. In Bruchteilen von Sekunden wog sie im Kopf das Für und Wider ab – nicht wie eine mathematische Gleichung, sondern wie eine Art Partitur zur Begleitung unkontrollierbarer Emotionen. Moth hatte im Leben ihrer Tochter einmal die erste Geige gespielt, und sie hegte einige Bedenken, ob sein plötzliches Erscheinen bei Andy Candy die richtigen Saiten anschlagen würde. Sagte sie ihr nichts, konnte ihre Tochter ihr zu Recht Vorwürfe machen, wenn sie irgendwann davon erfuhr, dass ihre Mutter ihr aus einem fehlgeleiteten Beschützerinstinkt den Anruf ihres verflossenen Freundes vorenthalten hatte. Ein wenig ratlos versuchte sie es am Ende mit einem typisch mütterlichen Kompromiss. »Wissen Sie was, Moth? Bleiben Sie einfach einen Moment dran. Ich gehe zu ihr und frage sie, ob sie mit Ihnen sprechen will. Falls nicht …«
»Dann würde ich das natürlich respektieren. Schließlich haben wir uns damals nicht im allerbesten Einvernehmen getrennt. Aber trotzdem, danke. Wirklich nett von Ihnen.«
»Nicht der Rede wert. Bleiben Sie am Apparat.«
Lässt du mich in Ruhe, wenn ich hoch und heilig verspreche, nie wieder in meinem Leben irgendetwas oder irgendjemanden zu töten? Bitte!
Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Mörderin.
Auftragsgemäß drängten sich die Hunde um Andy Candys Bett. Sie versuchten, ihr das Gesicht zu schlecken, schoben die Schnauzen unter die Decke, stießen mit den Köpfen Kissen weg, um Andy Candy in ihrem Hundeeifer die Tränen abzuschlecken. Unter dem Ansturm der schnüffelnden Schnauzen, Zungen und Pfoten gab der Inquisitor erst einmal Ruhe. Andy verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln und unterdrückte ein letztes Schluchzen. Bei so viel Zudringlichkeit fiel es schwer, unglücklich zu sein.
Erst als ihre Mutter sie ansprach, bemerkte sie, dass sie im Zimmer stand. »Andy?«
Wie aus der Pistole geschossen: »Lass mich in Ruhe.«
»Da ist jemand am Telefon, der dich sprechen will.«
Erwartungsgemäß die bittere Antwort: »Ich will mit niemandem sprechen.«
»Ich weiß«, antwortete ihre Mutter freundlich. Zögern. Dann: »Es ist Moth. Dass der sich ausgerechnet jetzt bei dir meldet ...«
Andy Candy schnappte nach Luft. In Bruchteilen von Sekunden stieg eine Flut von Erinnerungen in ihr auf, gute und glückliche im Wettstreit mit dem Kummer am Ende.
»Er ist in der Leitung«, wiederholte ihre Mutter überflüssigerweise.
»Weiß er …«, fing Andy Candy an, sprach den Satz jedoch nicht zu Ende, als ihr klarwurde, dass die Antwort natürlich Nein war. Dies war einer jener seltenen Momente, in denen Andy Candy augenblicklich begriff, dass sie nicht zögern durfte. Wenn sie nicht riskieren wollte, dass sich der Grund für seinen Anruf von selbst erledigte und sie es später bereuen würde, musste sie aufstehen und ans Telefon gehen. Wenn sie ihm ausrichten ließ, er solle seine Nummer hinterlassen und sie würde sich bei ihm melden, wäre die Chance vertan. Die Vergangenheit riss sie wie eine starke Strömung mit. Sie erinnerte sich an Lachen, Liebe, ungetrübte Freude und Abenteuer, dann eine Mischung aus Glück und Kummer, schließlich Wut und abgründige Traurigkeit, als sie sich trennten. Meine erste Liebe, dachte sie. Meine einzige wirkliche Liebe. Die man niemals vergisst.
Eine warnende Stimme meldete sich sehr entschieden zu Wort: Sag ihm: Danke der Nachfrage, aber kein Bedarf, mir geht’s im Moment auch so schon dreckig genug. Sag ihm: Lass mich in Ruhe, keine weitere Erklärung. Häng einfach auf. Doch sie sagte nichts dergleichen. Genauso wenig wie die anderen Dinge, die ihr durch den Kopf schwirrten.
»Ich geh ran«, antwortete sie ihrer Mutter zu ihrer eigenen Verwunderung, stand so energisch auf, dass die Hunde vom Bett purzelten, und griff nach dem Telefon.
Den Hörer schon am Ohr, warf sie ihrer Mutter einen finsteren Blick zu. Diese verstand, zog sofort die Tür hinter sich zu und kehrte ins Wohnzimmer zurück, das außer Hörweite lag. Andy Candy holte einmal tief Luft, fragte sich in einer Schrecksekunde, ob sie überhaupt einen Ton herausbekäme, ohne dass ihr die Stimme wackelte, und flüsterte schließlich: »Moth?«
»Hi, Andy«, sagte er.
Zwei Worte wie aus der fernen Vergangenheit, bei denen sich Zeit und Raum in einer einzigen Sekunde mit geballter Energie zusammenzogen und es ihr so vorkam, als stünde Moth plötzlich vor ihr und streichelte ihr die Wange. Reflexartig hob sie ihre freie Hand, als fühlte sie seine Berührung tatsächlich an der Haut.
»Lange nichts von dir gehört«, sagte sie.
»Ich weiß. Aber ich hab oft an dich gedacht«, erwiderte Moth. »Vor allem in letzter Zeit. Und? Wie geht’s dir?«
»Nicht besonders gut«, erwiderte sie.
Er schwieg. »Mir auch nicht.«
»Weswegen rufst du an?«, fragte sie. Andy Candy traute ihren Ohren nicht. Es war nicht ihre Art, so brüsk und direkt zu sein, doch vielleicht lag sie mit ihrer Selbsteinschätzung daneben. Allein schon die Stimme ihres Freundes von damals zu hören löste einen Tumult an Gefühlen aus, darunter auch unverkennbar Freude.
»Ich habe ein Problem«, sagte er. Er sprach – anders als der impulsive, unbekümmerte Junge von damals – sehr langsam und bedächtig. Sie versuchte, aus den wenigen Worten herauszuhören, wie er sich in den Jahren seit ihrer Trennung verändert hatte. »Nein«, korrigierte er sich, »ich habe einen ganzen Haufen Probleme, kleine und große. Und ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Gibt nicht mehr viele Menschen, denen ich noch traue, und da hab ich an dich gedacht.«
Sie war sich nicht sicher, ob sie das Bekenntnis als Kompliment verstehen sollte. »Ich höre«, sagte sie und hätte es gern im selben Moment zurückgenommen. Eine unangemessene Reaktion, sie hätte ihn eindeutiger ermuntern sollen, weiterzureden. Typisch Moth – erst wenn er einen kleinen Schubs bekam, schüttete er einem sein Herz aus. »Fang doch einfach mit ...«
»Mein Onkel«, unterbrach er sie und wiederholte sich: »Mein Onkel.« Aus den zwei Worten klang so viel Verzweiflung und Bitterkeit heraus, dass es ihr bis ins Mark drang. »Ihm hab ich vertraut, aber er ist tot.«
»Das tut mir aufrichtig leid«, sagte Andy Candy. »Das war der Psychiater, nicht wahr?«
»Ja. Dass du das noch weißt.«
»Wir sind uns ein-, zweimal begegnet. Er war ganz anders als deine übrige Familie. Er war witzig, das ist mir am meisten haftengeblieben. Wie ist er denn …?« Der Rest der Frage verstand sich von selbst.
»Nicht so, wie dein Dad gestorben ist. Er war nicht krank. Keine Klinik, keine Priester. Mein Onkel hat sich erschossen. Das heißt, das behaupten alle, zum Beispiel meine ganze verklemmte Familie und die verdammten Cops.«
Andy ließ ihn weiterreden.
»Ich glaube nicht, dass es Selbstmord war.«
»Nicht?«
»Nein.«
»Aber wie …«
»Bleibt nur eine Erklärung: Ich glaube, er wurde ermordet.«
Sie schwieg eine ganze Weile.
»Wie kommst du darauf?«
»Er hätte sich niemals das Leben genommen. Das passte einfach nicht zu ihm. Er war schon mit so vielen Problemen fertig geworden, dass ihn so schnell nichts mehr umhauen konnte. Falls es neue Schwierigkeiten gab, hätte er sie angepackt. Und er hätte mich nie im Stich gelassen. Ausgerechnet jetzt. Wenn er es also nicht gewesen ist, dann war es jemand anders.«
Seine Begründung war für einen so ungeheuerlichen Verdacht etwas dürftig, stellte Andy Candy fest; sie stützte sich einzig und allein auf Moths gefühlsmäßige Einschätzung seines Onkels statt auf Fakten.
»Jetzt bleibt es an mir hängen, herauszufinden, wer es gewesen ist«, fuhr Moth fort, und plötzlich klang seine Stimme grimmig entschlossen, kaum wiederzuerkennen. »Niemand sonst wird nach dem Kerl suchen. Nur ich.«
Wieder antwortete sie nicht sofort. Nie hätte sie erwartet, dass ihr Gespräch eine solche Wendung nehmen würde, andererseits hatte sie, bevor sie nach dem Hörer griff, gar keine Zeit zum Nachdenken gehabt.
»Wieso … wie …«, fing sie an, ohne sich konkrete Antworten zu erhoffen.
»Und wenn ich ihn finde, muss ich ihn töten, egal wer der Bursche ist«, fügte Moth hinzu. Mit einer solch wilden Entschlossenheit hätte sie schon gar nicht gerechnet. Dass er auf eigene Rechnung losziehen und einen Mörder suchen wollte, statt der Polizei von seinem Verdacht zu erzählen oder sonst irgendetwas zu unternehmen, das als angemessen und sachdienlich durchgegangen wäre, verschlug ihr die Sprache. Andy Candy war schockiert und augenblicklich verängstigt. Trotzdem legte sie nicht auf.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagte Moth.
Hilfe war ein dehnbarer Begriff, doch Andy Candy zuckte wie vom Schlag gerührt auf ihrem Bett zurück.
Mörderin.
Versprich nichts, was du nicht halten kannst.
3
Er wählte einen Treffpunkt in einer unbeschwerten, sicheren Umgebung.
Zumindest würde der Ort nichts aus ihrer Vergangenheit heraufbeschwören oder einen Hinweis darauf liefern, was Moth sich von Andy für die Zukunft erhoffte – falls es eine gäbe. Er saß im Bus und hielt ein Foto von ihr in der Hand. Andy mit siebzehn Jahren. Vergnügt blickte sie von einem Burger mit Fritten auf.
Doch die Erinnerungen waren von einem Wust an Problemen überlagert.
»Hallo, ich heiße Timothy. Ich bin Alkoholiker und bin jetzt seit drei Tagen nüchtern.«
»Hi, Timothy!«, schallte es aus der Runde in der Redeemer One zurück. Wenn ihn sein Gefühl nicht trog, war die ganze Gruppe bedrückt, andererseits aufrichtig froh, dass er sich wieder bei ihnen blicken ließ. Als er sich zu Beginn der Sitzung verlegen hereingeschlichen hatte, war eine Reihe vom alten Stamm spontan aufgestanden und hatte ihn umarmt. Einige hatten ihn fest an sich gedrückt und ihm ihr Beileid ausgesprochen. Er wusste, dass es aufrichtig war. Ihm war klar, dass alle vom Tod seines Onkels erfahren hatten und sich ausmalen konnten, wie verzweifelt Timothy sein musste. Als er aufgefordert wurde, sein Bekenntnis abzulegen, und zu Boden starrte, kam ihm zum ersten Mal der Gedanke, dass er all diesen Leuten vielleicht mehr bedeutete als sie ihm, auch wenn er keine Erklärung dafür hatte.
»Drei verfluchte Tage, drei mal vierundzwanzig Stunden«, wiederholte er, bevor er sich setzte.
Moth hielt seine letzten neunzig nüchternen Stunden in einem mentalen Tagebuch fest.
Erster Tag: Im Morgengrauen auf dem roten Boden eines Baseball-Spielfelds aufgewacht. Wann er dort zusammengesackt war und wie er die übrige Nacht herumgebracht hatte, war aus seinem Gedächtnis gelöscht. Seine Brieftasche war weg, außerdem ein Schuh. Der Gestank nach Erbrochenem raubte ihm fast die Sinne. Er wusste nicht, woher er die Kraft nahm, schwankend die siebenundzwanzig Häuserblocks zu seinem Apartment zurückzulaufen, nachdem ihm irgendwann gedämmert war, wo er sich überhaupt befand. Die letzten Kreuzungen überquerte er auf einer wund gelaufenen Sohle. Zurück in der Wohnung, warf er seine Kleider ab wie eine Schlange die abgetragene Haut und unterzog sich einer gründlichen Körperpflege – heiße Dusche, Zahnbürste, Kamm. Sämtliche Sachen, die er angehabt hatte, warf er in den Müll und wurde sich in diesem Moment bewusst, dass seit dem Tod seines Onkels zwei Wochen vergangen waren und er in dieser Zeit zum ersten Mal nach Hause kam. Mit einer gewissen Erleichterung nahm er zur Kenntnis, dass er dank seinem Blackout nicht mehr wusste, auf was für Baseball-Spielfeldern er noch geschlafen hatte.
Er beschloss, wieder trocken zu werden, und verkroch sich den ganzen Tag in seiner abgedunkelten Wohnung. Ihm war speiübel, sein Magen krampfte sich zusammen, die Schweißausbrüche bei Tage gingen in nächtliches Schwitzen über, und so traute er sich nicht aus dem Haus. Es kam ihm so vor, als wartete direkt neben der Haustür eine heißblütige, unwiderstehliche Sirene, die ihn unweigerlich in den Spirituosenladen oder die nächstbeste Kneipe locken würde. Wie einst der legendäre Held Odysseus versuchte er, sich an einen Mast zu fesseln.
Zweiter Tag: Nachdem er einen ganzen Tag lang in seinem eigenen Schweiß auf dem Boden neben seinem Bett gelegen hatte, meldete er sich schließlich auf eine Reihe von Anrufen seiner Eltern zurück. Sie waren wütend und enttäuscht, wahrscheinlich auch in Sorge, die allerdings nur mäßig herauszuhören war. Sie hatten ihm Nachrichten auf dem AB hinterlassen und wussten ganz offensichtlich, wieso er verschwunden war. Und wohin. Nicht genau. Sie brauchten nicht die Adressen der Spelunken zu kennen, die ihn willkommen hießen. Außerdem erfuhr er, dass er die Beerdigung seines Onkels verpasst hatte. Die Einzelheiten hatten einen stundenlangen Heulkrampf ausgelöst.
Als er sich beruhigt hatte, staunte er selbst ein wenig darüber, dass er nicht erneut losgezogen war, um seinen Kummer zu ertränken. Auch wenn ihm die Hände zitterten, war dieser kleine Akt des Widerstands gegen die Sucht ein ermutigendes Zeichen. Ein Mantra hatte er immer wieder vor sich hergesagt: Tu, was Onkel Ed tun würde, tu, was Onkel Ed tun würde. In jener Nacht zitterte er unter einer dünnen Decke, obwohl es drückend heiß und schwül in der Wohnung war.
Dritter Tag: Als am Morgen seine rasenden Kopfschmerzen und das unkontrollierbare Zittern langsam nachgelassen hatten, rief er Susan an, die stellvertretende Staatsanwältin, die ihm ihre Karte gegeben hatte. Sie schien nicht erstaunt, noch einmal von ihm zu hören, und fand es offenbar auch nicht allzu ungewöhnlich, dass er sich mit seinem Anruf so lange Zeit gelassen hatte.
»Der Fall ist abgeschlossen, Timothy, das heißt, so gut wie«, machte sie ihm in schonungsvoller Deutlichkeit klar. »Wir warten nur noch auf einen toxikologischen Abschlussbericht. Es tut mir leid, Ihnen das so offen sagen zu müssen, aber der Fall wird als Selbstmord eingestuft.« Sie ließ sich nicht weiter darüber aus, wieso sie diesen Umstand bedauerte, und er fragte nicht nach. Kleinlaut erwiderte er: »Daran glaube ich nicht. Könnten Sie mir die Akte zu lesen geben, bevor sie im Archiv verschwindet?« Sie antwortete mit einer Gegenfrage. »Glauben Sie wirklich, dass Ihnen das von irgendeiner Hilfe ist?« So wie sie das Wort Hilfe betonte, war klar, dass sie sich nicht auf den Tod von Onkel Ed bezog. »Ja«, antwortete er kurz und bündig, wenn auch ohne Überzeugungskraft.
Nach dem Telefonat legte er sich wieder ins Bett, starrte mindestens eine Stunde lang zur Decke und hatte am Ende zwei Beschlüsse gefasst: am Abend zur Redeemer One zurückzukehren, denn das hätte sich sein Onkel so gewünscht. Andy Candy anzurufen, denn wenn er sich das Hirn nach irgendeinem Menschen zermarterte, der ihn anhören würde, ohne ihn nach einer Minute als verkommenen Säufer und Spinner mit einem zwanghaften Redebedürfnis abzutun, dann war sie die einzige Kandidatin.
Der Matheson-Hammock-Park war für Moth eine kurze Busfahrt entfernt. Er saß auf der Rückbank und hatte das Fenster einen kleinen Spaltbreit geöffnet, um den Duft der Hortensien und Azaleen einzusaugen, den die flimmernden Dunstschwaden in der Mittagshitze verbreiteten, ohne die kühle Brise der Klimaanlage zu beeinträchtigen. Der Bus war nur spärlich besetzt – eine junge schwarze Frau, vermutlich aus Jamaika, in weißer Schwesterntracht. Sie hielt ein zerfleddertes Buch mit dem Titel Spanisch für Anfänger in der Hand. Moth sah, wie sie die Lippen bewegte, während sie die Sprache einübte, die für jeden, der in Miami arbeitete, fast unumgänglich war.
Zu seinen Füßen hatte Moth einen Plastikbeutel, in dem er ein großes kubanisches Sandwich mit Käse, Schinken und Pickles, eine Flasche Mineralwasser und eine Dose mit Zitronensprudel verstaut hatte, ein Getränk, das Andy Candy bei ihren Picknickausflügen nach South Beach oder zum Bill-Baggs-Naturschutzpark auf Key Biscayne immer am liebsten gemocht hatte. Wenn ihn sein Gedächtnis nicht trog, war er mit ihr nie zum Matheson-Hammock gefahren, und genau deshalb hatte er diesen Treffpunkt ausgewählt. Der Park war nicht von ihrer Geschichte belastet – keine Erinnerungen an den ersten zarten Kuss oder das seidige Gefühl, wie sich ihre Körper im warmen Wasser berührten.
Liebesträume sollte er besser vergessen.
Er wusste nicht einmal, ob Andy Candy tatsächlich kommen würde. Sie hatte es ihm zugesagt, und jetzt, wo es seinen Onkel nicht mehr gab, war sie vermutlich der ehrlichste Mensch, den er kannte. Doch der Realist in ihm – dem er, wie er sich eingestand, nur wenig Mitspracherecht einräumte – hegte seine Zweifel. Er wusste, dass er sich am Telefon einerseits kryptisch, andererseits wenig feinfühlig geäußert und ihr höchstwahrscheinlich eine Höllenangst eingejagt hatte, als er von Mord sprach.
»Ich an ihrer Stelle würde mich nicht mit mir treffen«, flüsterte er in das Dröhnen des Dieselmotors, als der Bus seine Haltestelle ansteuerte.
Er hielt sich an einen breiten Fußweg parallel zur Einfahrt in den Park. Im Schatten der Zypressen, die den Weg säumten, kreuzten seinen Pfad mehrere Jogger. An dem Gebäude aus Korallengestein verkaufte eine junge Frau Eintrittskarten und Faltpläne des Parks, die mit anschaulichem Bildmaterial auf »Floridas gefährdetes Biotop« und den schwindenden Lebensraum für die einheimischen Tiere aufmerksam machten, doch für deren Nöte hatte er heute keinen Sinn. Er lief an ihr vorbei und machte bei einer Gruppe Palmen nahe der Biscayne Bay halt, wo ein junges Latinopaar den Probelauf seiner Hochzeitsfeier absolvierte. Der Priester lächelte und versuchte, alle Beteiligten mit seinen Witzen zu entspannen, die offensichtlich keine der beiden Mütter auch nur ansatzweise lustig fand.
Moth wartete am Ende des Parkplatzes auf einer Bank im Schatten einer einsamen Palme. Von einer seichten, künstlich angelegten Lagune, einem Tummelplatz für kleine Kinder, drang fröhliches Kreischen und Lachen herüber. Die frühe Nachmittagssonne überzog den Strand mit einem Silberglanz.
Er griff in die Hosentasche, um sein Handy herauszuholen und nachzusehen, wie spät es war, zog die Hand jedoch wieder zurück. Falls sich Andy Candy verspätete, wollte er es gar nicht so genau wissen. Wer auf jemand anderen zählt, machte er sich bewusst, geht immer ein Risiko ein. Vielleicht kommt derjenige nicht. Vielleicht, weil ihn jemand umgebracht hat.
Die gleißende Sonne blendete ihn. Er schloss die Augen und zählte seine Herzschläge als Gradmesser für seine Gefühle. Als er die Augen öffnete, sah er, wie eine kleine rote Limousine am hinteren Ende des Geländes in eine Parklücke fuhr. Wie viele Autos in Miami hatte es getönte Scheiben, doch er erhaschte einen Blick auf blonde Haare und wusste, dass es Andy war.
Bevor sie ausstieg, sprang er auf. Er winkte ihr zu, sie winkte zurück.
Stonewashed-Jeans an ihren langen Beinen, dazu ein hellblaues T-Shirt. Das Haar hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zurückgebunden, so wie früher, wenn sie joggen oder schwimmen ging. Als sie Moth erspähte, nahm sie die Sonnenbrille ab. Moth sog ihren Anblick auf und versuchte, in diesen wenigen Sekunden festzustellen, was an ihr noch wie früher war und was nicht. Dabei schwappte mit jedem Schritt, den sie auf ihn zulief, eine Woge der Gefühle über ihn hinweg.