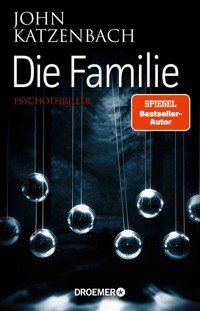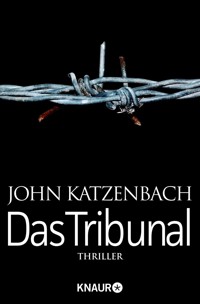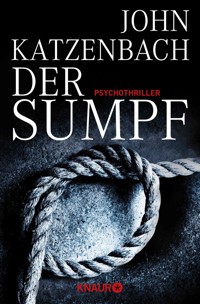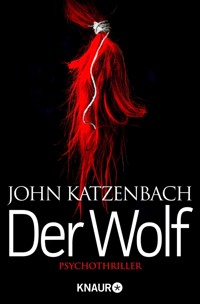9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn du bleibst, wird er dich töten. Wenn du fliehst, wird er dich finden. Du hast keine Chance – also nutze sie! Eine ahnungslose junge Frau, ein schwerreicher Psychopath – ein eiskaltes Spiel um Leben und Tod: Der Psycho-Thriller »Der Bruder« von Bestseller-Autor John Katzenbach ist ebenso raffiniert konstruiert wie meisterhaft erzählt. Für die junge Architektur-Studentin Sloane Connolly ist es ein schwerer Schlag, als ihre exzentrische Mutter spurlos verschwindet. Sloane hat sonst niemanden, ist fast völlig isoliert aufgewachsen. Zur selben Zeit erhält sie über einen Anwalt ein merkwürdiges Angebot: Ein reicher Mäzen möchte, dass Sloane Denkmäler für sechs Personen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings sind alle sechs bereits verstorben, und das nicht an Altersschwäche. Sloane nimmt den Auftrag an, um sich von der Sorge um ihre Mutter abzulenken – und ahnt nicht, auf was für ein perfides Spiel sie sich einlässt … »Der amerikanische Meister des Psycho-Thrillers« (Für Sie) beweist auch in »Der Bruder« wieder sein ganzes Können: Geschickt entwickelt John Katzenbach aus scheinbar harmlosen Alltagssituationen echte Gänsehaut-Momente. Nicht nur Sloane wird in diesem raffinierten Psycho-Thriller immer wieder in die Irre geführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
John Katzenbach
Der Bruder
Psychothriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Anke Kreutzer und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn du bleibst, wird er dich töten.Wenn du fliehst, wird er dich finden.Du hast keine Chance – also nutze sie!
Für die junge Architektur-Studentin Sloane Connolly ist es ein schwerer Schlag, als ihre exzentrische Mutter spurlos verschwindet. Sloane hat sonst niemanden, ist fast völlig isoliert aufgewachsen.
Zur selben Zeit erhält sie über einen Anwalt ein merkwürdiges Angebot: Ein reicher Mäzen möchte, dass Sloane Denkmäler für sechs Personen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings sind alle sechs bereits verstorben, und das nicht an Altersschwäche. Sloane nimmt den Auftrag an, um sich von der Sorge um ihre Mutter abzulenken – und ahnt nicht, auf was für ein perfides Spiel sie sich einlässt …
Inhaltsübersicht
Erster Prolog
Zweiter Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Eins
Zwei
Drei
Vier
Kapitel 2
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 3
Eins
Zwei
Kapitel 4
Eins
Zwei
Kapitel 5
Eins
Zwei
Kapitel 6
Eins
Zwei
Kapitel 7
Eins
Zwei
Kapitel 8
Eins
Zwei
Kapitel 9
Eins
Zwei
Kapitel 10
Eins
Zwei
Kapitel 11
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 12
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 13
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 14
Eins
Zwei
Kapitel 15
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 16
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 17
Eins
Kapitel 18
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 19
Eins
Zwei
Kapitel 20
Eins
Zwei
Drei
Teil 2
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil 3
Kapitel 30
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 31
Kapitel 32
Eins
Zwei
Drei
Vier
Kapitel 33
Eins
Zwei
Kapitel 34
Eins
Zwei
Kapitel 35
Eins
Zwei
Kapitel 36
Eins
Zwei
Kapitel 37
Eins
Zwei
Kapitel 38
Eins
Zwei
Drei
Kapitel 39
Eins
Zwei
Drei
Erster Epilog
Zweiter Epilog
Erster Prolog
Der Privatdetektiv wählte auf dem Wegwerfhandy die einzige Nummer, die der Klient ihm bei der Auftragserteilung gegeben hatte. Zu seiner Überraschung meldete sich der Klient beim zweiten Klingelton.
»Ah, der Privatdetektiv. Gut, von Ihnen zu hören. Also, was gibt’s Neues? Ich bin ganz Ohr.«
»Ich denke, Sie werden zufrieden sein«, antwortete der Detektiv prompt. »Name, Adresse, Telefonnummer. Ich habe einige Fotos, auch von der Tochter, nur dass sie, wie Sie natürlich wissen, inzwischen erwachsen ist. Zeit- und Altersangaben – passt alles zu den Eckdaten, die ich von Ihnen habe, ich bin mir also ziemlich sicher, dass ich Ihre Zielperson gefunden habe. Sobald Sie die Bilder sehen, können Sie sich selbst davon überzeugen. Die sind zwar nicht allzu toll – ich habe sie jeweils in der Menschenmenge fotografiert oder auch, wie von Ihnen gewünscht, aus einem versteckten Winkel, sodass sie mich nicht sehen konnte, trotzdem. Ich glaube nicht, dass ich aufgeflogen bin – ganz sicher lässt sich das natürlich nie sagen. Wie auch immer, ich kann Ihnen noch heute alles in Ihr Büro schicken.«
»Darf ich neugierig sein: Wie sind Sie fündig geworden? Eine ganze Reihe Ihrer Kollegen sind gescheitert.«
»Beharrlichkeit. Und ein Quäntchen Glück.«
»Glück? Welcher Art?«
»Na ja, nach allem, was ich über die Vorgeschichte von Ihnen wusste, habe ich meine Suche auf New York und Connecticut sowie vier weitere Bundesstaaten in New England konzentriert. Massachusetts, New Hampshire, Vermont. Aus naheliegenden Gründen mit Schwerpunkt auf Maine …«
»Versteht sich.«
»Jede Menge Sackgassen und Hürden. Ehrlich gesagt hatte ich selbst meine Zweifel, ob ich den Fall würde knacken können, wie wohl die anderen auch …«
»Die haben alle mein Geld eingesackt und dann irgendwann aufgegeben. Ich war ziemlich frustriert.«
»Na ja, ich habe mir sämtliche Fakten angeschaut, die Sie mir eingangs gaben, und mir kam eine Idee. Die militärische Sterbekasse. Als Nächstes musste ich mir Zugang zu den Akten der Veteranenverwaltung verschaffen, ein paar Jahrzehnte zurück. Ziemlich öde Fleißarbeit, aber ich brauchte ja einfach nur einen Namen. Ich ging davon aus, dass sie ihre Berechtigung für die Todesfallleistung zur Hinterbliebenenversorgung beweisen musste. In dem Fall würde es auch eine Papierspur geben. Ich hoffte einfach darauf, dass ein Name zum anderen weiterführt. Ich konnte auf jemanden zurückgreifen, der mir diesen Zugang verschaffte. Der Bursche schuldete mir einen großen Gefallen.«
»Einen Gefallen?«
»Na ja, sagen wir einfach, als ich ihn darum bat, konnte er es mir nicht abschlagen.«
»Konnte nicht?«
»Der Bursche hatte wirklich abnorme Vorlieben, die er vor allen verbergen konnte, nur nicht vor mir.«
Schweigen. Dann lachte der Klient laut auf.
»Na ja, sagen wir einfach, der Zweck heiligt die Mittel.«
»Das gilt in meinem Metier so gut wie immer«, erwiderte der Privatdetektiv.
»In meinem auch«, sagte der Klient. »Sie hatten also einen Namen …«
»Ja. Und der wiederum brachte mich auf einen Immobilienverkauf, der über zehn Jahre später abgewickelt wurde. Ein altes Farmhaus in Maine. Der Erlös ging damals an eine Person, die vor ein paar Jahren gestorben ist, und wurde anschließend auf das Konto einer anderen Person in einer anderen Kleinstadt im Bundesstaat New York überwiesen. Harte Nuss, aber dann – bingo!«
Schweigen. Als dächte der Klient über etwas nach.
»Ausgezeichnet. Und jetzt zum Thema Diskretion …«
»Ich führe keine Akten oder Dateien über meine Auftraggeber«, log der Privatdetektiv, wenn auch nur ein bisschen. Tatsächlich legte er zu jedem Fall eine verschlüsselte Datei an.
Der Detektiv konnte nicht genau einschätzen, ob der Klient die Lüge schluckte oder nicht. Doch er fügte mit Eifer hinzu: »Mir ist sehr daran gelegen, dass Sie mit meinen Diensten vollauf zufrieden sind.«
Was er nicht aussprach: Sie sind reich, und ich würde gerne wieder für Sie arbeiten, weil Sie mich verdammt gut bezahlen.
»Das bin ich auch. Und nun zu Ihrem Honorar – ich gehe davon aus, dass Sie auch Bargeld annehmen.«
»Selbstverständlich, danke. Und wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann, falls Sie wieder einmal Ermittlungsdienste benötigen …«
»Sind Sie der Erste, den ich anrufe. Versprochen.«
Genau das, was der Detektiv hören wollte.
»Schön. Das weiß ich zu schätzen.«
»Und wenn sich die Informationen als so akkurat erweisen, wie Sie sagen, dürfen Sie am Ende auch noch mit einem großzügigen Bonus rechnen. Sie müssen mir nur ein wenig Zeit geben, damit ich mich vergewissern kann. Ein paar Monate, schätze ich.«
Auch das war Musik in den Ohren des Privatdetektivs. Er ertappte sich dabei, wie er über die Höhe der Summe spekulierte.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
»Ich bin gerne spendabel.«
Die Auskunft erwies sich als korrekt, der Bonus fiel tatsächlich großzügig aus. Er ging drei Monate später ein. Der Privatdetektiv arbeitete gerade bis spät in die Nacht allein in seinem kleinen, unscheinbaren Büro im Gebäudekomplex eines Einkaufszentrums an einem banalen, wenn auch besonders unschön ausgefochtenen Scheidungsfall. Ein wohlsituiertes Ehepaar, das sich einst versprochen hatte, einander zu lieben, bis dass der Tod sie scheide, machte sich mit wütenden wechselseitigen Drohungen das Leben zur Hölle. Anschuldigungen, fremdzugehen. Kindesmissbrauch. Finanzielle Taschenspielertricks. Physische Gewalt. Ein paar Wahrheiten. Viele Lügen. Jede Menge Hass. In dieser Arena kannte sich der Privatdetektiv bestens aus. Die meisten seiner Fälle waren stinknormal, wenn da nicht der Hass wäre. Ehemänner, die ihren Ehefrauen drohten. Ehefrauen, die ihren Ehemännern drohten. Drohungen von beiden Seiten gegen ihn. Tatsächlich hatte er allein an diesem Tag schon eine anonyme Morddrohung bekommen. Anonym war sie allerdings nur in dem Sinne, dass er ziemlich sicher davon ausgehen konnte, binnen zehn Minuten herauszufinden, von wem sie stammte. Es war ihm nicht der Mühe wert. So etwas gehörte zum Berufsrisiko, und solche Drohungen kamen fast immer von erbosten, notorischen Verlierern, die, ohne groß nachzudenken, das Maul aufrissen. Wie auch sonst in solchen Fällen hielt er es nicht einmal für nötig, einen seiner alten Kumpel bei der örtlichen Polizei anzurufen.
Als er sein Büro verließ und in die menschenleere Dunkelheit hinaustrat, stand nur noch sein alter Chevy auf dem großen Parkplatz. Im trüben Licht der Straßenlaternen war er gerade so zu erkennen. In Gedanken noch bei dem endlosen wütenden Hin und Her zwischen den scheidungswilligen Eheleuten und nach einem langen Arbeitstag erschöpft, nahm er, als er seine Wagentür öffnete, die Schritte hinter ihm zunächst nicht wahr, doch dann schreckte er auf, und während er sich blitzschnell umdrehte, befahl ihm sein sechster Sinn, die Pistole zu ziehen, die er gelegentlich trug. Sein Instinkt nutzte ihm allerdings wenig – seine Waffe lag in seinem Büro in der Schreibtischschublade, statt in seinem Schulterholster zu stecken. Und so gab es nichts, womit er sich hätte verteidigen können, bevor ihn ein paar schallgedämpfte Schüsse im Gesicht trafen und töteten.
Zweiter Prolog
Ein Song ging ihr nicht mehr aus dem Kopf:
Bob Dylans All Along the Watchtower.
»There must be some way out of here, said the joker to the thief …«
Doch was sie dabei hörte, war die Version von Jimmy Hendrix aus ihrer Jugend: elektrisierend, ungezügelt, kraftvoll, hypnotisch, verführerisch – all das, was Rock ausmachte, was einen überwältigen und mitreißen konnte. Seit Jahren hatte sie den Song nicht mehr gehört. Zu schade, dass sie ihn nicht aufgenommen hatte, um ihn abzuspielen, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzte. Hatte sie nun einmal nicht, und so summte sie ihn leise vor sich hin.
Sie hielt an. Die Reifen ihres Kleinwagens knirschten auf dem Schotter. Sie schaltete die Scheinwerfer aus und wurde von der Stille der Nacht fast erdrückt. Sie sagte sich: Alles ist geregelt und geordnet. Wie ein Pilot vor dem Start ging sie noch einmal sämtliche Einzelheiten durch, um auch nicht das winzigste Detail zu übersehen. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der sie sich auf ihre Gabe, sowohl geheimnisvoll als auch gut organisiert zu sein, hatte verlassen können. Jetzt war sie sich da nicht mehr so sicher – dennoch hakte sie im Kopf jeden Punkt ab, bis sie ans Ende ihrer Liste kam und wusste, dass es für sie nur noch eins zu tun gab. Einen Moment lang machte es sie traurig. Wenn ich nur noch dies sagen könnte. Wenn ich nur noch jenes sagen könnte. Ich weiß, es wird wehtun, aber wenn ich nur … Und dann zog sie einen Schlussstrich unter alle diese Gedanken. Etwas geht zu Ende. Etwas fängt an. Sie holte tief Luft und schlüpfte aus ihren Schuhen. Sie öffnete die Wagentür und ließ die Schuhe stehen. Barfuß trat sie in die schwarze Mitternacht. Zum hundertsten Mal machte sie sich klar, dass es keine realistische Alternative gab. Das hier, so glaubte sie mit dem Nachhall des Songtexts im Kopf, ist der einzige Ausweg.
Teil 1
EIN PLAN FÜR SECHS TOTE
»Alone and feeling blue …
You can’t handle missing her.
Ain’t no other girl going to do.
See what a love can do?«
»Bist allein und fühlst dich mies …
Kommst nicht damit klar, dass sie dir fehlt.
Ein anderes Mädchen tut es nicht.
Siehst du, was Liebe mit dir macht?«
See What A Love Can Do
Text and music: Nils Lofgren und Grin, 1971
Kapitel 1
Eins
Zwei Wochen vor der Abschlussprüfung ihres Architekturstudiums und am Nachmittag vor dem Abend, an dem sie endgültig mit ihrem ständig untreuen Freund Schluss machen wollte, bekam Sloane Connolly einen handschriftlichen Brief von ihrer Mutter. Er war auf altmodischem, cremefarbenem Velinpapier geschrieben, wie man es gewöhnlich nur für förmliche Einladungen verwendet. Seit Monaten war es das erste Lebenszeichen von ihr. In einer plötzlichen Woge der Angst riss Sloane den Umschlag auf. Noch bevor sie den Brief, nur ein Blatt, entfaltete, stellten sich die alten, widerstreitenden Gefühle ein: viel Wut und ein letzter Rest von Liebe. In der unverwechselbaren schnörkeligen Handschrift ihrer Mutter stand in dem Brief nichts weiter als:
»Vergiss nicht, was dein Name bedeutet. Es tut mir so leid.«
Der Brief war nicht unterschrieben.
Sloane rief sofort die Festnetznummer in ihrem Elternhaus an. Ließ es zwanzig Mal klingeln. Niemand meldete sich.
Sie rief die Handynummer ihrer Mutter an.
Sofort zur Mailbox.
Sie rief bei den Nachbarn an, die sie kaum kannte. Seit rund sechs Jahren war sie nicht mehr zu Hause gewesen. Aber die Nachbarn schienen, als sie sich meldeten, nicht recht zu wissen, wo sie Sloane hinstecken sollten. Sie und ihre Mutter hatten nicht denselben Nachnamen – obwohl der ihrer Mutter genau wie Sloanes irischen Ursprungs war: Maeve O’Connor. Sloane versuchte, sich ihre Besorgnis nicht anmerken zu lassen, als sie das Ehepaar nebenan bat, zu ihrer Mutter hinüberzugehen und nachzusehen, ob mit ihr alles in Ordnung sei. Auf einiges Hin und Her, weil die Leute ihr Ansinnen offenbar für eine Zumutung hielten, folgte eine längere Wartezeit, bis sie sich, am Ende doch zu dem Nachbarschaftsdienst bereit, wieder meldeten und ihr berichteten: Das Auto sei nicht da. Offenbar sei niemand im Haus. Ansonsten keinerlei Anzeichen, dass etwas nicht stimme, kein eingeschlagenes Fenster oder dergleichen. Einfach nur dunkel. Kein einziges Licht an. Die Haustür abgeschlossen. Die Gartentür abgeschlossen. Niemand da. Alles still.
Totenstill, dachte Sloane.
Sie verabschiedete sich und überlegte, an wen sie sich als Nächstes wenden sollte.
Freunde? Nein. Ihre Mutter hatte keine. Ihres Wissens.
Kollegen? Nein. Ihre Mutter arbeitete schon seit Jahren nicht mehr.
Verwandte? Nein.
Sloane konnte sich an keinen einzigen Fall erinnern, bei dem irgendein Verwandter einmal angerufen, geschrieben, eine Karte oder E-Mail geschickt hätte oder auch nur zufällig vorbeigekommen wäre. Ihres Wissens hatte sie keine Angehörigen.
Vor hundertfünfzig Jahren wäre ihre Mutter für alle Welt die seltsame, exzentrische Witwe gewesen, die immer nur Schwarz trug, die nie viel redete, nie ausging, sich nie unter Menschen mischte, sondern ganz und gar zurückgezogen lebte. Sie wäre ihnen wie ein Gespenst erschienen, das ihre kleine Stadt in New England heimsuchte. Die Literaturbeflissenen unter ihnen hätten vollmundig erklärt: wie einem Hawthorne-Roman entsprungen. Die Kinder in der Nachbarschaft hätten sich wilde, beängstigende und furchterregende Geschichten über die Hexe am Ende der Straße ausgedacht oder auch Reime, um sie zu verhöhnen: »Siehst du die Alte mit dem schwarzen Rock? Wen sie sich schnappt, dem gibt sie’s mit dem Prügelstock.« Aber selbst in der modernen Welt war es nicht viel anders: Sloane wusste, dass die Erwachsenen in ihrer kleinen Stadt ständig über die Eremitin spekulierten, die mit ihrer Tochter, dem Bücherwurm, der offenbar genau wie sie mit niemandem etwas zu tun haben wollte, zurückgezogen lebte. An der städtischen Mülldeponie, in einem Aerobic-Kurs, in Buchklubs oder bei Fußballturnieren, auf Facebook: Was hat sie bloß zu verbergen? Nicht den leisesten Schimmer. Etwas Schreckliches, muss was Schreckliches sein; und dieses reizende Kind, so ganz allein mit ihr, also wirklich, armes Ding …
Sloane hatte sich nie als armes Ding empfunden.
Sie rief beim örtlichen Polizeirevier an, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die mürrische Frage eines Beamten nach dem Zeitpunkt, zu dem die fragliche Person – seine Worte für ihre Mutter – verschwunden sei, beschied sie mit einer Lüge. Statt es auf Minuten einzugrenzen, konnte sie ihm nur in Tagen Angaben machen. Sie log auch durch Verschweigen, indem sie dem Polizisten nichts von dem Brief erzählte. Der Brief erschien ihr – kryptisch, wie er war – zu persönlich, und so folgte Sloane dem Impuls, ihn für sich zu behalten. Sie erklärte nur, sie habe ihre Mutter telefonisch nicht erreichen können, und die Nachbarn hätten das Haus augenscheinlich leer vorgefunden.
Pflichtgemäß nahm der Mann ihre Angaben auf und versicherte, die Beamten, die sie hinzuschicken gedächten, würden das Haus gründlicher durchsuchen. Sollten sie die Feststellung der Nachbarn bestätigt finden, werde in sechs Bundesstaaten zum neun Jahre alten Toyota ihrer Mutter eine Meldung an alle Polizeistationen herausgegeben. Der Polizist bat sie um ihre Erlaubnis für die Kollegen von der Streife, die Tür aufzubrechen und das Haus zu durchsuchen. Sloane erteilte sie.
»Und Sie sind sicher, dass sie keinen Freund hatte, von dem sie Ihnen vielleicht nie erzählt hat und bei dem sie jetzt sein könnte? Oder auch eine Freundin?«
»Ja, ich bin mir sicher.«
»Vielleicht ist sie ja, ohne Ihnen Bescheid zu geben, verreist?«
»Nein.«
»Steht sie normalerweise mit Ihnen in Kontakt?«
»Ja.« Auch das war gelogen.
»Was ist mit Ihrem Vater, ihrem Ex … könnte er vielleicht …«
Sie schnitt ihm das Wort ab.
»Den habe ich nie richtig gekannt. Er starb, bevor ich zur Welt kam.«
»Tut mir leid«, sagte der Polizist.
Er versprach ihr, die Kreditkarten ihrer Mutter und ihre Anrufliste zu überprüfen. Er wies darauf hin, jeder Einsatz ihrer Kreditkarten an der Tankstelle oder für eine Mahlzeit und jede Nummer, die ihre Mutter mit ihrem Handy angewählt habe, sei über den Telefonanbieter abzurufen und sogar zum nächstgelegenen Sendemast zurückzuverfolgen. Darüber hinaus könne die Staatspolizei feststellen, ob das Kennzeichen ihres Fahrzeugs elektronische Mautschranken passiert habe. Schließlich riet er Sloane, sich nicht zu sorgen, was in der gegebenen Situation nicht den geringsten Sinn ergab.
Er fragte sie: »Haben Sie irgendeinen Grund, Fremdverschulden zu befürchten?«
Eine umschweifige Ausdrucksweise, fand sie, für eine unverblümte Frage.
»Nein.«
»Liegen bei Ihrer Mutter irgendwelche emotionalen oder mentalen Probleme vor?«
»Nein.« Auch dies entsprach nicht ganz der Wahrheit, war aber auch nicht ganz gelogen. Es war nicht zu überhören, dass der Mann ihr nicht glaubte.
»Und haben Sie irgendeine Idee, wo sie hingegangen sein könnte?«
»Nein.« Die ehrliche Antwort hätte natürlich ja gelautet, ja, da fallen mir gleich ein Dutzend Stellen ein, jede sehr versteckt und gänzlich abseits ausgetretener Pfade, doch das brachte sie nicht über die Lippen.
Sie dachte: Diesmal hat sie es wahr gemacht. Sloane holte tief Luft. Ich habe letztlich nie für möglich gehalten, dass sie es tut. Ich habe es auch letztlich nie ganz ausgeschlossen, dass sie es tut. Sloane merkte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Nicht zum ersten Mal verschwand ihre Mutter so plötzlich, die Checkliste zu einer Vermisstenanzeige, die der Polizist mit ihr durchging, war ihr daher noch vertraut. Über die Jahre hatte sie jedes Mal, wenn ihre Mutter verschwand, befürchtet, sie sei tot – auch wenn sie irgendwann wieder aufgetaucht war und dann so tat, als sei nichts gewesen. Somit war damit zu rechnen, dass der Computer, sobald der Polizist den Namen ihrer Mutter ins System einspeiste, gleich eine ganze Reihe früherer Vermisstenmeldungen ausspuckte. Einige davon standen Sloane jetzt wieder lebhaft vor Augen. Vor acht Jahren zum Beispiel, Sloane war damals kurz vor ihrem Abschluss an der Highschool, konnte sie ihre Mutter nirgends in der Aula entdecken; oder zu ihrem dreizehnten Geburtstag, da kamen ihre Schulfreunde zu ihr, aber ihre Mutter tauchte nicht auf. Oder damals, mit gerade einmal neun Jahren, als Sloane ein beängstigendes Wochenende ganz allein im Haus verbrachte, fragwürdige Essensreste und aufgeweichte Kartoffelchips aß, stundenlang vor dem Fernseher hockte und hoffte, nicht zum Waisenkind geworden zu sein. Damals war ihre Mutter putzmunter hereingefegt mit der Frage an die Polizistin: Wie kommen Sie darauf, es sei etwas passiert?, und das nur wenige Minuten, nachdem ein Sozialarbeiter und zwei Streifenpolizisten an die Tür geklopft hatten. Damals hatte der Sozialarbeiter Aufschluss darüber verlangt, was für Medikamente sie im Haus habe, und die Polizisten hatten sie gefragt, ob sie eine Waffe besitze.
»Natürlich nicht«, hatte ihre Mutter geantwortet.
Was möglicherweise gelogen war. Sloane wusste es nicht.
Nachdem der Detective ihr versprochen hatte, sich wieder bei ihr zu melden, und sie kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, sich ins Auto zu setzen und zu ihrem alten Zuhause zu fahren, trennte Sloane die Verbindung. Doch die Vorstellung, nach der zweistündigen Fahrt vor dem dunklen, verlassenen Haus zu stehen, das sie so hasste, schnürte ihr die Kehle zu. Sie begriff, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als abzuwarten – egal wo.
Obwohl sie sich immer noch fühlte wie vom Donner gerührt, beschloss sie, trotz allem ihr Vorhaben, mit ihrem Freund Schluss zu machen, nicht auf die lange Bank zu schieben. Dieser Beziehung ein Ende zu setzen, hatte in einer Welt, die ihr plötzlich zu entgleiten schien, etwas beruhigend Konkretes. Sloane hielt sich etwas darauf zugute, in jeder Situation, egal wie kompliziert sie sein mochte, pragmatisch und organisiert vorzugehen. Roger loszuwerden war vernünftig gewesen, bevor sie den Brief von ihrer Mutter bekam; daran hatte sich auch nach dem Brief nichts geändert. Allerdings wurde ihr jetzt klar, wie töricht der Plan gewesen war, Roger in ihr kleines Apartment herüberzubitten, um ihm Auge in Auge klarzumachen, der Punkt sei erreicht, an dem es zwischen ihnen unwiderruflich zu Ende sei. In einer heftigen Gefühlsaufwallung entschied sich Sloane dagegen.
Sie trat in ihrem Flur vor einen Spiegel und starrte sich einen Moment lang darin an. Schlanke, durchtrainierte Figur – viele Yogastunden. Rotbraunes Haar, das ihr in Wellen bis zur Schulter fiel, grüne Augen, die wach und lebhaft blitzten. Zarte Hände, denen ihre Kraft nicht anzusehen war – umso geschickter darin, exakte, maßstabsgetreue Modelle anzufertigen. In ein und demselben Gedanken stellte sie fest: Ich sehe gar nicht übel aus und ich kann wahrlich etwas Besseres kriegen als Roger. Und dann: Er wird mal wieder jammern und betteln, den Zerknirschten und Verliebten spielen, und du fällst wieder einmal auf den Scheiß herein. Oder aber er wird wütend und fängt an, mit Gegenständen um sich zu werfen. Wäre ja nicht das erste Mal.
Die nächste halbe Stunde brachte sie damit zu, verstreut herumliegende Sachen von ihm in einen alten Pappkarton zu werfen. Zahnbürste. Rasierzeug. Ein Set Kleider zum Wechseln. Ein Paar abgelaufene Sportschuhe und verwaschene Shorts. Ein paar Lehrbücher aus seinem ersten Jurasemester, die er jetzt für seinen Job bei einem Dienstleistungsunternehmen offensichtlich nicht mehr brauchte. Sie wickelte reichlich Klebeband darum und schrieb mit rotem Marker seinen Namen darauf. Den Karton stellte sie in den Windfang ihres alten Brownstone-Gebäudes. Es gab zwei verschließbare Türen. Sie konnte ihn also zur ersten hereinlassen – aber nicht zur zweiten, egal, wie laut er an den dicken Holzrahmen pochen mochte.
Dann beschloss sie, in ihrer Wohnung sauber zu machen.
Zuerst staubsaugte sie gründlich – das wütende Motorengeräusch übertönte ihre Gedanken. Dann weiter mit Lappen und Spray über die Bücherregale und den Sofatisch, die Arbeitsflächen in der Küche. Zuletzt energisches Schrubben der Toilette, bis das Porzellan vor Sauberkeit blitzte.
Als sie, mit schmutzigen Händen, zerzaustem Haar und Schweiß unter den Achseln, fertig war, nahm sie eine ausgiebige heiße Dusche, seifte sich zweimal von oben bis unten ein, als hoffe sie, ihren Freund mitsamt ihren Ängsten wegen ihrer Mutter so mühelos den Ausguss hinunterzuspülen wie den Dreck.
Sie wickelte sich ein Handtuch um den Kopf und schickte ihm, während sie nackt und nass in ihrem Schlafzimmer stand, eine trotzige Nachricht aufs Handy:
Bin deine Scheißlügen leid. Deine Sachen stehen unten abholbereit. Es ist vorbei. 100 %. Keine Überraschung. War abzusehen. Spar dir die Mühe, anzurufen. Such dir jemand anderes zum Vögeln.
Nicht ganz so knapp wie ihre Mutter in dem Brief, dafür unmissverständlich.
Seine Reaktion kam prompt.
Wir müssen reden.
Sie antwortete nicht.
Ich liebe dich, Sloane.
Sie dachte: Nein, tust du nicht. Jedenfalls hast du eine ziemlich kranke Art, es zu zeigen.
Ihr Handy klingelte, er versuchte, sie anzurufen. Typisch Roger, dachte sie. Was ihm nicht passt, ignoriert er einfach. Sag ihm, er soll’s lassen, und was tut er? Ruft an. Im Lauf der nächsten Stunde klingelte ihr Handy zum wiederholten Male, doch immer wenn Rogers Name und Nummer auf dem Display erschienen, drückte sie ihn weg. Auch den Anruf eines seiner Freunde ignorierte sie geflissentlich. Netter Versuch, aber allzu durchschaubar: Hey, ruf mal bei Sloane an, ich hab mit ihr zu reden, hörte sie Roger sagen. Umso gespannter wartete sie auf den Anruf von der örtlichen Polizei in ihrer Heimatstadt. Sie machte sich einen Becher starken schwarzen Kaffee.
Nach zwei Stunden meldete sich der Detective zurück.
»Sie hatten recht«, sagte er. »Es ist niemand zu Hause. Und soweit es die Kollegen vor Ort beurteilen können, sind noch alle ihre Kleider und persönlichen Sachen da. Es war aufgeräumt. Die Kleider ordentlich im Schrank. Geschirr in der Spülmaschine. Der angesammelten Post nach wurde der Briefkasten seit zwei, drei Tagen nicht geleert. Und ihr Handy lag auf dem Küchentisch. Wir haben gesehen, dass Sie angerufen haben. Wieso lässt sie ihr Handy zurück?«
»Ich weiß es nicht.«
»Na ja, das macht die Situation komplizierter«, fuhr der Detective fort.
»Und …«, fing Sloane an.
»Das Einzige, was den Kollegen aufgefallen ist, war ein Päckchen, so was wie ein Präsent, in Happy-Birthday-Geschenkpapier verpackt, das auf dem Bett im Gästezimmer lag …«
»Das war früher mein Zimmer. Aber ich bin schon seit Jahren nicht mehr da gewesen.«
»Es stand Ihr Name darauf.«
»Ich hab in ein paar Wochen Geburtstag und hoffentlich einen Studienabschluss.«
»Tja, also, Ihre Mutter hat offenbar etwas für Sie hinterlegt.«
Sloane wusste nicht, was sie davon halten sollte. Vor einem Jahr hatte ihre Mutter ihr – vollkommen überraschend – zu ihrem Geburtstag einen neuen Laptop geschickt, seit Jahren das erste Geschenk von ihr.
»Und wie geht’s jetzt weiter?«, fragte Sloane.
Der Detective wurde schweigsam; als er sich wieder meldete, wirkte sein Tonfall wie angegraut. Eine Sekunde lang fragte sich Sloane, was sie daran vermisste, dann begriff sie: Hoffnung. »Wir haben eine Suchmeldung zu ihrem Fahrzeug herausgegeben. Ich werde ihre Bank veranlassen, uns über jede Kontobewegung zu benachrichtigen, das heißt, sobald sie ihre Karte benutzt, werden wir sofort verständigt. Wir werden uns bei den Krankenhäusern umhören, für den Fall, dass es irgendwo einen Unfall gegeben hat. Haben Sie ein aktuelles Foto von ihr?«
Das einzige Foto aus jüngster Zeit, das sie von ihr hatte, war ein Handy-Schnappschuss vom letzten Sommer, den hatte ihre Mutter ihr ohne irgendeine Erklärung geschickt. Auf dem Bild stand sie an einem breiten, goldfarbenen Sandstrand – ihr dunkles Haar wehte in der leichten Brise, um ihre Lippen spielte ein verhaltenes Lächeln. Im Hintergrund das tiefblaue Meer, Wellen, die sich an einem hohen Damm aus dunklen Felsbrocken brachen, darüber ragte ein weißer Leuchtturm in den Himmel. Die Mittagssonne schien ihr ins Gesicht. Nichts an dem Foto verriet, wo genau es entstanden war. Nicht einmal, dass ihre Mutter das Meer liebte, hatte Sloane gewusst. Sie konnte sich an keinen einzigen gemeinsamen Strandurlaub erinnern. Auch fiel ihr niemand ein, der in Strandnähe wohnte. »Ich kann Ihnen etwas mailen«, sagte sie zu dem Detective. Sie hatte noch andere, ältere Fotos – drei, vier Jahre alt. Sie beschloss, ihm die zu senden und das Strandfoto für sich zu behalten.
»Ausgezeichnet«, erwiderte der Detective. Er gab ihr die E-Mail-Adresse durch. »Wir haben auch noch ihr Foto und ihre Personalien von der Kfz-Behörde – Größe, Gewicht, Haar-, Augenfarbe – das Übliche. Aber ehrlich gesagt helfen uns in den meisten Fällen dieser Art die Dinge weiter, die nicht aktenkundig sind.«
Fällen dieser Art.
»Ich werde mein Möglichstes tun«, versicherte Sloane.
»Ausgezeichnet«, sagte er wieder.
Sie hasste es, dass er dieses Wort benutzte.
»Was genau brauchen Sie von mir?«, fragte sie.
»Warten Sie erst einmal ab«, antwortete der Detective. »Vielleicht ruft sie ja an.« So tonlos, wie er es sagte, glaubte er selbst nicht daran. Und es war tatsächlich unwahrscheinlich. Das Handy ihrer Mutter lag auf dem Küchentisch. Anschließend gab ihr der Detective eine Reihe Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern durch. »Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, das uns weiterhelfen könnte, so unbedeutend es Ihnen auch erscheinen mag, melden Sie sich bitte bei einem dieser Kollegen, die nehmen dann Ihre Information auf.«
Falls war das Wort, das bei Sloane haften blieb.
»Okay«, sagte sie.
»Dann setze ich jetzt mal die Suchmeldungen ab«, sagte er. »Außerdem werde ich den Fall an die Datenbank des National Crime Information Center durchgeben. Ich schalte das FBI und unsere hiesige Kripo-Stelle ein. Sie sollten sich überlegen, ob Sie sich über die lokale Presse sowie die sozialen Medien an die Öffentlichkeit wenden wollen. Darüber hinaus gibt es auch private Initiativen wie zum Beispiel websleuths.com, die sind richtig gut darin, vermisste Personen aufzuspüren …« Er verstummte für einen Moment, bevor er sich in einem neuen Anlauf wiederholte: »Wir können morgen wieder telefonieren. Und falls Ihnen bis dahin irgendetwas einfällt, zögern Sie bitte nicht, wie gesagt, wie geringfügig es auch scheinen mag. Man weiß nie, was uns auf die richtige Fährte bringt.«
Falls war wieder das eindringlichste Wort.
Sie spürte förmlich, wie der Detective am anderen Ende wartete. Er wartete darauf, dass sie sagte: Meine Mutter ist irre. Bipolar. Schizophren. Total plemplem. Suizidal. Sie gehört in psychiatrische Behandlung. Sie braucht Medikamente. Sie ist schon oft abgehauen. Es hätte alles gestimmt, doch Sloane sagte nichts dergleichen.
Am liebsten hätte sie gesagt: Meine Mutter ist mir ein Rätsel. Schon mein ganzes Leben lang.
»Okay«, antwortete sie.
Sie trennte die Verbindung und blieb einfach nur auf ihrem Sofa sitzen. Von Zeit zu Zeit klingelte ihr Handy – jedes Mal Roger, der es offensichtlich nicht gewohnt war, sich einen Korb einzufangen. Um Mitternacht schickte er ihr eine gemeine Nachricht:
Na schön, Sloane. Geh zum Teufel. Mach’s gut.
Das war der echte Roger, so viel stand fest.
In dieser Sekunde hegte sie ernste Zweifel daran, ob sie es gut machen würde. Ein gutes Leben schien mit einem Mal in weite Ferne gerückt, nebulös. Seltsamerweise verschaffte es ihr aber auch eine gewisse Befriedigung, ihren nunmehr Ex-Freund wenigstens ein bisschen durchschaut zu haben. Bei ihrer Mutter hatte sie nie durchgeblickt.
Zwei
Zwei Tage.
Nichts Neues. Sloane hatte sich ein paarmal kurz mit dem örtlichen Kripobeamten oder einem seiner Kollegen ins Benehmen gesetzt, jedes Mal mit dem gleichen wenig hoffnungsvollen Ergebnis: Nichts Neues zu berichten, immer noch vermisst.
Plötzlich fröstelte sie ständig. Ihr war eiskalt. Sie kam sich vor wie eine Schauspielerin auf der Bühne, die nur so tut, als ob. Sie agierte mechanisch. Schlief nicht viel. Aß nicht viel. Ihre Welt schien seltsam ausgedünnt.
Sie wollte nicht wahrhaben, was sie wirklich glaubte. Doch Worte wie abwesend, verschwunden, vermisst konnten nicht länger ihre übermächtige Angst verdrängen: tot. Vor den Panikattacken nahm sie dieselbe Zuflucht wie schon immer, schon als Kind, wenn sie Kummer oder Zweifel hatte: Sie stürzte sich in Lektüre. Ein Buch nach dem anderen; Seite um Seite um Seite. Sie ackerte Trigonometrie, Geometrie, Physik und Stresstests durch. Und wenn irgendwann Sätze und Gleichungen, Formeln und Algorithmen vor ihren müden Augen verschwammen, packte sie ihre Sachen in einen Rucksack und lief im Eilmarsch zum Gestaltungs-Labor an der Uni, wo ihr Abschlussprojekt beinahe fertig war. Zwischen der Arbeit an dreidimensionalen Computerbildern und Modellbau konnte sie das Grübeln über ihre Mutter aus dem Kopf verbannen.
Sie richtete verschiedene Schubfächer ein.
In einem versuchte sie, den panischen Gedanken zu verstauen: Meine Mutter hat sich umgebracht.
In dem anderen den beruhigenden Gedanken: Ich muss für meinen Abschluss pauken.
Die Arbeit an ihrem Abschlussprojekt beruhigte sie.
Es war die imaginäre Neugestaltung eines öffentlichen Platzes, gesäumt von trendigen Geschäften und einer erweiterten Grünfläche um das Kriegerdenkmal in der Mitte. Es war vage an einen argentinischen Park in Buenos Aires angelehnt, zu Ehren von Soldaten, die bei ihrem weltfremden Kampf um jene Inseln gefallen waren, die sie Las Malvinas nannten und die Briten unbeirrt The Falkland Islands. In Sloanes Version galt das Denkmal in der Mitte den Soldaten, die in Afghanistan gefallen waren. Auf einer Reihe von Blöcken aus obsidianfarbenem Ziegel waren Namen und Lebensdaten festgehalten – pro Ziegel die Information zu einem Toten –, eine Hommage, wie sie hoffte, an Maya Lins eindrucksvolles Vietnam-Denkmal in Washington, D. C. Nicht zuletzt strebte sie auch einen Anklang an das Holocaust-Denkmal in Berlin an, wo die Menschen zwischen mehr als zweitausend Stelen aus kaltem grauem Stein umherwandern und versuchen konnten, sich das unfassliche Ausmaß des Mordens bewusst zu machen. Diese Denkmäler übten schon seit Langem eine große Faszination auf sie aus.
Sie suchte nach Ausdrucksformen dafür, die Toten zu ehren und die Lebenden zu berühren.
Ihr Projekt hatte bereits für einiges Aufsehen gesorgt.
Zwei Professoren hatten begeistert Bilder von ihren Plänen auf ihren einflussreichen Facebook-Seiten eingestellt. Eine andere hatte ihr die besten Chancen vorhergesagt, damit den renommierten Gestaltungs-Wettbewerb der gesamten Universität zu gewinnen. Dies wäre höchstwahrscheinlich mit einem überschwänglichen Artikel und einer großzügigen Fotodokumentation im Hochglanzmagazin der Alumni verbunden – wenn nicht sogar mit einem Bild auf dem Cover. Höchstwahrscheinlich brächte ihr der Preis auch ein Interview mit dem Boston Globe ein und die realistische Aussicht, dass ein auf den öffentlichen Sektor spezialisiertes Architekturbüro bei ihr klopfte, um sie anzuheuern.
Zu dem Projekt gehörten Skizzen, Entwürfe, farbige Darstellungen, Grund- und Aufrisse mit Maßangaben sowie ein tischgroßes Modell aus Pappmaschee und Faserplatte, detailgetreu bis hin zu winzigen Figürchen, die in dem fiktiven Park spazieren gehen. Bei ihrem Entwurf liefen alle Wege am Denkmal zusammen, sodass jeder, der in den Park kam, ob er nun seinen Hund Gassi führte, ein paar Schritte im Grünen genoss oder auch nur sein Sandwich in der Mittagspause, unwillkürlich zu der Stelle gelangte, an der man der Toten gedachte. Dies war die Poesie und Psychologie hinter dem Entwurf. Jedes Element – ob nun computergeneriert oder mit Zeichenstift und Klinge entworfen – erforderte Präzision und Konzentration. Es hielt sie davon ab, vor Sorge außer sich zu geraten.
Am frühen Abend des dritten Tages lief sie gerade, die Pläne im Rucksack, den Kopf gesenkt, um den Augenkontakt mit anderen Studenten zu vermeiden, über den Campus zum Studio, als ihr Handy klingelte. Sie sah auf den ersten Blick, dass es der Detective aus ihrer Heimatstadt war. Nicht Roger – der selbst nach seiner beleidigenden Nachricht noch ein Dutzend Mal versucht hatte, sie anzurufen.
Sie verließ den geteerten Weg und lief quer über den gepflegten grünen Rasen zu einer großen, uralten Eiche, um sich an den Stamm zu lehnen. Unter dem Blätterdach und unweit der Universitätsgebäude, über denen die Sonne gerade unterging, stand sie halb im Schatten, halb im Licht. Ihr war, als umarme sie der Baum.
»Ja?«, meldete sich Sloane. Mit bebender Stimme.
»Miss Connolly, ich habe traurige Nachrichten. Sitzen Sie gerade? Können Sie reden?«
»Alles bestens«, erwiderte sie, obwohl das Gegenteil der Fall war.
»Wir haben das Fahrzeug Ihrer Mutter gefunden.«
»Wo?«
»Offenbar wurde es auf einem unbefestigten Parkplatz abgestellt, in der Nähe eines Wanderwegs zum Ufer des Connecticut River in Northfield, Massachusetts. Kurz oberhalb des Wasserkraftwerks. War Ihre Mutter eine Naturliebhaberin? Ist sie gerne im Wald gewandert?«
Sloane lief es eiskalt den Rücken herunter.
»Nein.«
»Hatte sie Freunde oder auch nur Bekannte in Northfield?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, weshalb ihr Wagen dort steht?«
»Ich … nein.« Und ob sie eine hatte. Genau zu dieser Stelle hatte sie ihre Mutter einmal mitgenommen, an einem schönen Frühsommertag, mit fünfzehn. Angeblich diente der Ausflug damals dazu, mit ihr zu reden: Sloane hatte spekuliert, dass es um die Schule, um Jungen und um ihre Zukunftsvorstellungen ging. Sie irrte. Ihre Mutter hatte über eine halbe Stunde lang einfach nur in das vorbeirauschende Wasser gestarrt, während ihr die Tränen herunterliefen, bis sie schließlich herausbrachte: »Sloane, es tut mir leid. Du bist ja noch zu jung. Es ist Zeit zu gehen.« Dabei hatte sie nie gesagt, wofür Sloane zu jung sei. Dabei blieb es. Im Lauf der Jahre war ihre Mutter nie wieder darauf zu sprechen gekommen.
»Erinnern Sie sich, dass Ihre Mutter diese Stelle mal erwähnt hat? Wollte sie mal einen Ausflug dahin machen?«
Sloane zögerte.
»Ich denke, sie kannte die Stelle. Die Gegend ist schließlich ziemlich bekannt. Beliebte Wanderwege, nicht wahr?«
Sloane hatte fast das Gefühl, als höre sie zu, wie jemand anders die Fragen des Detective beantwortete. Ihr war selbst nicht ganz klar, warum sie ihm nicht die ganze Wahrheit sagte. Die richtige Antwort hätte lauten müssen: Ja. Meine Mutter kannte die Stelle. Ich kannte die Stelle. Das ist schon über zehn Jahre her, aber ich werde es nie vergessen. Und als ich ihren einzeiligen Brief bekam, fiel mir unter anderem genau diese Stelle ein, als ein Ort, zu dem sie möglicherweise wollte. Es ist ein schönes, unberührtes Fleckchen Erde, grün, so weit das Auge reicht, schattige Bäume und sprudelndes Wasser, Sonne und Natur. Es ist ein guter Ort, um seinem geheimen Kummer ein Ende zu setzen.
Der Detective antwortete nicht sofort. Seine Stimme klang angespannt.
»Ja, stimmt. Ein Wildhüter hat den Wagen entdeckt, bei einer Routinefahrt.«
»Und was heißt das?«
Sloane kannte die Antwort, stellte die Frage aber trotzdem.
Wieder zögerte er.
»Wir befürchten etwas Ernstes.«
Es war eine beschönigende Ausdrucksweise für eine schlimme Nachricht. Sloane spürte, wie ihr das Blut schneller durch die Adern pulsierte.
»Haben Sie außer dem Wagen noch etwas von meiner Mutter gefunden?«
»Also …«, fing er an, »… da war wie gesagt der Wagen. Und direkt vor der Fahrertür stand ein Paar Schuhe.«
»Ihre Schuhe?«
»Ja. Sie ist demnach wohl barfuß weggegangen.«
»Diese Gegend …«, fing Sloane an, doch der Detective fiel ihr ins Wort.
»Die ist sämtlichen Polizeistationen der umliegenden Städte bekannt. Die Stelle liegt unmittelbar über einem größeren Abschnitt des Flusses, an dem die Strömung besonders stark ist.«
Ich weiß, dachte Sloane. Sie rief sich den Ausblick ins Gedächtnis.
»Bekannt …«, wiederholte Sloane. »Weil …«
»An der Stelle hatten wir schon einige Fälle von Suizid. Die örtliche Presse hat immer mal wieder darüber berichtet. Es gibt da etwa sieben, acht Meter über dem Fluss einen Felsvorsprung, von dem sind schon einige Personen gesprungen. Gewöhnlich Jugendliche aus Liebeskummer oder verzweifelte Collegestudenten, die eine Prüfung nicht bestanden haben …«
Er verstummte, Sloane rang nach Luft. Ich habe einmal neben meiner Mutter auf diesem Felsen gesessen.
»Gab es einen Abschiedsbrief oder etwas dergleichen?«
Vor drei Tagen ist mir dieser Brief ins Haus geflattert.
»Nein.«
»Und offenbar hat sie die Autoschlüssel auf der Fahrerseite auf dem Armaturenbrett gelassen.«
Sloane schloss die Augen. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie ihre Mutter im Dunkeln barfuß dort oben über dem Fluss stand.
»Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Sloane. Sie hörte das Zittern in der eigenen Stimme.
»Morgen schicken wir ein paar Taucher runter«, antwortete der Detective. »Ich bin allerdings nicht sehr optimistisch, dass wir sie …« Er sprach nicht weiter. Es trat kurzes Schweigen ein, bevor er fortfuhr. »Ich fürchte, wir haben es an diesem Punkt nicht mehr mit einem Vermissten-Fall zu tun, Miss Connolly.«
»Und womit …«
»Mit der Bergung der Leiche.«
Drei
Es war ein beachtliches Aufgebot – drei Polizeistreifen, davon zwei vom örtlichen Revier und eine von der Staatspolizei sowie eine nicht gekennzeichnete graue Limousine, ein Krankenwagen von der Gerichtsmedizin und ein schwarzer SUV für die Ausrüstung – doch Sloane hatte nur Augen für die beiden Taucher, die sich darauf vorbereiteten, in den Fluss zu steigen. Es war ein prächtiger Vormittag, warm, mit einer leichten Brise, die in den Blättern raschelte, und einem Fluss, der in der morgendlichen Sonne glitzerte. Die Taucher brauchten einige Zeit, bis sie ihre Ausrüstung angelegt hatten. Sie erinnerten Sloane an zwei Gladiatoren, die sich für den Kampf in der Arena des Kolosseums wappneten. Sloane kam eine Abwandlung des Schwurs aus dem alten Rom in den Sinn: Wir, die wir nach den Todgeweihten suchen, grüßen euch. Nachdem sie in ihren dicken, schwarzen Taucheranzügen steckten, legten sie mit Gewichten bestückte Gürtel an und überprüften mehrmals hintereinander ihre Atemgeräte. Sie sah ihnen dabei zu, wie sie über einer Flusskarte brüteten, hörte, wie die zwei Männer über die Haupt- und die Unterströmungen redeten und sich berieten, wo sie mit ihrer Rastersuche beginnen sollten.
An ihren Wagen gelehnt, hielt Sloane Abstand zu dem geschäftigen Treiben am Fluss.
Einer der uniformierten Polizisten kam in ihre Richtung gelaufen. Er war jung, wahrscheinlich ungefähr in ihrem Alter.
»Miss Connolly, Sie brauchen nicht dabei zu sein«, sagte er. Sloane fand seine Stimme angenehm, melodisch und ruhig. »So eine Suche kann fünf Minuten oder auch ewig dauern. Wären Sie nicht woanders besser aufgehoben? Und wir rufen Sie an, sobald wir etwas wissen?«
Etwas wissen stand für die Leiche Ihrer Mutter gefunden haben.
»Solange ich Ihnen nicht im Weg bin«, erwiderte Sloane, »bleibe ich lieber noch eine Weile da.«
»Das liegt ganz bei Ihnen«, sagte der Beamte. »Ich wollte Sie nur warnen, manchmal kann der Anblick eines Leichnams, der für eine gewisse Zeit im Wasser lag, ziemlich verstörend sein.«
Sloane blickte dem Mann auf dem Weg zurück zum Ufer hinterher. Er half einem der Taucher dabei, ein Zweierschlauchboot aufzublasen. Ein weiterer Polizist schob es mit ihnen zusammen ins Wasser, während ein dritter eine Leine abspulte, die an einem Ende befestigt war. Während das Schlauchboot Kurs auf die Hauptfahrrinne nahm, zurrten die Taucher ihre Masken fest und folgten. Sloane beobachtete, wie sie unter der schwarzen Wasseroberfläche verschwanden.
Und dann wartete sie.
Eine Stunde oder auch länger.
Nichts.
Die Taucher legten eine Pause ein. Sie tranken Kaffee und sprachen mit den anderen Polizisten. Dann legten sie die Ausrüstung wieder an und machten sich erneut auf die Suche.
Noch eine Stunde.
Nichts.
Als sie diesmal wieder auftauchten und ihre Masken abnahmen, war ihnen die Frustration anzusehen. Wenig später traf ein zweites Taucherteam ein. Alle zusammen steckten sie nun die Köpfe über der Karte zusammen, dann übergab das erste Paar den Stab an das zweite, das nach dem gleichen Verfahren ins Wasser tauchte.
Sie wartete noch eine Stunde.
Sloane sprach mit niemandem, auch wenn sie von dem jungen Polizisten gelegentlich verstohlene Blicke auffing.
Wenige Minuten später kam einer der Taucher hoch. Er hatte ein schlammiges, unförmiges Kleidungsstück vom Flussbett geborgen.
Sloane sah, wie der Taucher seinen Fund einem uniformierten Polizisten übergab, der es seinerseits auf der Kühlerhaube der Limousine ausbreitete. Dann kam der junge Polizist mit der angenehmen Stimme zu Sloane herüber.
»Sie haben eine Jacke gefunden. Vielleicht wollen Sie sich die mal ansehen? Um festzustellen, ob sie Ihnen bekannt vorkommt?«
Sloane begriff, dass sie kaum in der Lage wäre, etwas aus der Garderobe ihrer Mutter zu identifizieren. Dennoch folgte sie dem jungen Beamten zum Fahrzeug. Von den anderen versammelten Beamten sagte keiner ein Wort. Sie starrte auf die Jacke. Selbst vom bräunlichen Flusswasser getränkt und von Geäst auf dem Grund zerrissen, ließ der Parka eher auf ein Kleidungsstück für winterliche Temperaturen schließen; er wies zwei Farben auf, Rot und Schwarz.
»Kommt Ihnen das …«, fing der junge Polizist an, doch Sloane fiel ihm ins Wort.
»Ja. Nein. Tut mir leid. Ich meine, der würde zu ihr passen, aber wenn ich behaupten sollte, ich hätte sie darin oder in einer Jacke dieser Art schon mal gesehen, müsste ich lügen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich …«
Sie brachte den Satz nicht zu Ende.
»Okay«, sagte der junge Polizist. »Ist das ein Vielleicht?« Sie nickte. »Gut. Wir suchen weiter. Da sammelt sich eine Menge Zeug im Fluss, es kommt häufig zu Zufallsfunden, die mit der konkreten Suche nichts zu tun haben. Ich denke, wir werden eine Weile brauchen.«
Er ließ den Blick über die Wasserfläche schweifen. An dieser Stelle war der Fluss knapp hundert Meter breit. Er schüttelte den Kopf und wiederholte: »Es ist wirklich nicht nötig, dass Sie hier warten.«
Sloane gab ihm recht. »Sie rufen mich doch an, ja? Ich meine, wenn Sie noch etwas finden. Oder vielleicht auch nur, um mich auf dem Laufenden zu halten.«
»Selbstverständlich. Ist jemand bei Ihnen? Ein Freund oder Angehöriger? Jemand an Ihrer Seite, der Ihnen Gesellschaft leistet?«
»Nein«, erwiderte Sloane. »Niemand.«
Sie bog in die schmale Einfahrt ein und starrte auf das kleine Haus. Zweistöckig, sehr bescheiden, ein gutes Stück von der Straße zurückgesetzt, hinter Bäumen versteckt, an der Rückseite gleich der Wald. Alles in ihr sträubte sich dagegen, hineinzugehen, doch sie wusste, dass ihr nichts anderes übrig blieb. Inzwischen war es später Nachmittag, die ersten abendlichen Schatten legten sich über das Viertel. Drinnen musste es noch dunkler sein, doch gewiss nicht so düster, wie es in ihr aussah. Sie hatte das seltsame Gefühl, sich wie ein Roboter zu bewegen, wie eine Cyborg-Sloane aus einem Science-Fiction-Film, während die echte Sloane im Studio in der Uni unbeschwert und munter an ein zweifellos preiswürdiges Projekt letzte Hand anlegte. Sie sah vor sich, wie diese Sloane die Gratulationen von neidischen Kommilitonen und stolzen Professoren entgegennahm. Wie diese Sloane in absehbarer Zeit einen neuen Freund fand, der sie wirklich respektierte. Wie diese Sloane vielfältige Stellenangebote und spannende Aufstiegschancen erhielt. Diese Sloane freute sich auf jeden neuen Tag, weil ihr die Zukunft zu Füßen lag.
Die künstliche, unwirkliche Stellvertreter-Sloane dagegen musste jetzt mit mechanischen Schritten dieses Haus betreten, in dem sie aufgewachsen war und beharrlich darauf hingearbeitet hatte, es hinter sich zu lassen. Das Haus, in das sie nie wieder einen Fuß hatte setzen wollen. Dabei konnte sie nicht einmal sagen, wozu sie dort hineinmusste, es ergab sich für sie einfach nur folgerichtig aus dem, was gerade mit ihr passierte.
Auch drinnen schlug ihr Dunkel entgegen. Sie hob schon die Hand zum Lichtschalter, überlegte es sich aber anders. Das Grau ihrer Umgebung passte besser zu ihrer Stimmung. Erinnerungen schwappten hoch. Bilder aus ihrer Vergangenheit, derer sie sich nicht erwehren konnte. Das Gespenst Sloane, musste sie denken. Sie sah sich zusammen mit ihrer Mutter beim Abendessen an diesem Küchentisch sitzen. Jede Erinnerung, gegen die sie sich machtlos fühlte, war von der Exzentrizität ihrer Mutter durchsetzt, von ihrem übermächtigen Bedürfnis nach Abgeschiedenheit. Wie oft hatte Sloane versucht, normal und angepasst zu sein – einfach so wie alle anderen Kinder an ihrer Schule, auf jedem Sportplatz, in jeder Mannschaft und in jedem Klassenzimmer –, und ihre Mutter hatte es ein ums andere Mal durchkreuzt.
»Vergiss nicht, Sloane, du und ich. Es wird immer nur uns beide geben. Zusammen sind wir sicher.«
So lautete das Mantra ihrer Mutter.
Und so kam es irgendwann, dass Sloane ihre Mutter in ihrem Wahn, allein, abgesondert und anders sein zu müssen, bestärkte. Sie wurde zum Abziehbild ihrer Mutter, zu einer Einzelgängerin in allen Phasen ihrer Jugend, wenn Einsamkeit eine besonders leidvolle Erfahrung ist. Keine Ausflüge mit den anderen Mädchen und vielleicht ein paar Jungen in die Shoppingmall an einem Samstagabend. Kein Ansteckbukett auf dem Weg zum Abschlussball. Den Fußball, einen Teamsport, hatte sie gegen Crosslauf getauscht. Querfeldein. Nur sie und die Natur. Aktivitäten, bei denen sich ihre Mutter von anderen Menschen absetzen und Sloane heimlich beobachten konnte.
Von der Eingangsdiele ging sie in die Küche.
Sie sah das Handy auf dem Tisch.
So wie der Detective gesagt hatte, war alles sauber und alles an seinem Platz. Erstaunlich. Ihre Mutter hatte das Chaos zur Kunst erhoben und Putzen gehasst; Durcheinander zog sie jeder Form von Ordnung vor. Das Gegenteil von mir, dachte Sloane. Sie setzte ihren Rundgang fort. Derselbe Eindruck in den anderen Räumen. Wohin sie blickte, war alles an seinem Fleck. Makellos sauber. Beinahe fühlte sie sich wie in einem sorgsam kuratierten Museum. Sie sah in den Küchenschränken nach. Mit militärischer Präzision standen Konservendosen in Reih und Glied. Im Kühlschrank fanden sich nur eine Flasche Orangensaft und ein Milchkarton. Beide hatten das Verfallsdatum noch nicht erreicht. Sloane ging in das ans Schlafzimmer ihrer Mutter angrenzende Bad. Die Zahnpastatube sorgfältig am unteren Ende aufgerollt. Die Zahnbürste in einem Halter. Haarbürste auf der Ablage. Sie öffnete den Spiegelschrank. Sie wusste, dass ihre Mutter Schlafprobleme hatte und sich Ambien verschreiben ließ. Auf dem untersten Fach fand sich ein Döschen mit den Pillen neben den Vitaminen, die ihre Mutter regelmäßig schluckte. Das Döschen war voll.
Sloane begab sich ins Schlafzimmer ihrer Mutter. In der Hoffnung, es zu merken, falls irgendetwas fehlte, sah sie sich um. Kleider im Schrank. Sonderbarer Schmuck auf der Kommode. Ein Roman von John Fowles neben dem Bett. Ein gerahmtes Foto von ihnen beiden, Sloane war darauf elf Jahre alt, erkannte sie wieder. Sie konnte nichts entdecken, was ihr ins Auge gestochen wäre – andererseits war sie seit Jahren nicht mehr in diesem Zimmer gewesen und hätte irgendeinen Unterschied vermutlich nicht bemerkt.
Das alles ergab keinen Sinn. Oder vielleicht doch?
Wenn sie sich ihre Mutter vorzustellen versuchte, in selbstmörderischer Verzweiflung, vollkommen aufgelöst, in tiefster Seelenqual auf dem Boden eingerollt oder nachts stundenlang wach und in die Kissen schluchzend, unfähig zu essen, unfähig zu funktionieren, dann müsste das Haus logischerweise in einem ähnlich desolaten Zustand sein und den inneren Aufruhr der Bewohnerin widerspiegeln.
Wer in aller Welt, fragte sie sich, putzt noch die Toilette, bevor er sich das Leben nimmt?
Sie schnappte nach Luft.
Vielleicht mehr Leute, als man meinen sollte.
Vielleicht hat sie den Entschluss gefasst und dann vorher noch einmal alles in Ordnung gebracht. Um alles sauber und adrett zu hinterlassen, wenn sie stirbt.
Sloane ging langsam durch den Flur und blieb vor dem Zimmer stehen, in dem sie aufgewachsen war. Sie griff nach der Klinke und zögerte.
Es war, als sei sie dabei, eine Tür in ihre Vergangenheit aufzustoßen, während gerade alles andere in ihrem Leben in die Zukunft wies. Eine innere Stimme drängte sie, auf der Stelle umzukehren, zu ihrem Wagen zurückzugehen und Gas zu geben, um so schnell wie möglich in ihre Wohnung, zu ihrer Universität und ihrem Leben zurückzukehren.
Sie hörte nicht darauf und drückte die Klinke.
Ihr Zimmer war noch haargenau so, wie sie es in Erinnerung hatte. Ein Regal mit ihren damaligen Büchern: von Unsere kleine Farm und Black Beauty bis zu Der Fänger im Roggen und Große Erwartungen. Da standen auch Frank Lloyd Wrights Autobiografie neben Vincent Scullys American Architecture and Urbanism. Sloane wunderte sich, dass sie diese Bücher bei ihrem Auszug vor sechs Jahren nicht mitgenommen hatte. Der Raum war wie eine Diaschau der Erinnerungen. Ein Einzelbett an der Wand. Eine mit leuchtend blauen und gelben Blumen bedruckte Tagesdecke. Dekokissen, eins davon mit Herzen verziert, ein Teddybär. An einer Wand hing ein Kinoplakat, eine Reproduktion von Clark Gables und Vivien Leighs Umarmung aus Vom Winde verweht. Ihre Mutter hatte diesen Film geliebt. Sloane hatte ihn nie gesehen. In einer Ecke stand ein kleiner Holzschreibtisch, mit einer billigen Lampe, an der Wand darüber hing ein geschnitztes Kruzifix. Sie dachte an die vielen Stunden, die sie dort gesessen hatte. Sie zog die obere rechte Schublade auf. Ganz hinten steckte ein Foto von einem Jungen, für den sie an der Highschool geschwärmt hatte, ohne je wirklich mit ihm geredet zu haben. Genau da hatte sie das Bild versteckt.
Und sie sah das Geburtstagsgeschenk.
Es war eine in buntes Happy-Birthday-Papier eingepackte Schachtel, nicht viel größer als ein Schuhkarton, ein wenig flacher und breiter. Sie stand mitten auf ihrem Bett. Darunter fand sie einen braunen Briefumschlag. Auf dem Geschenk wie auch auf dem Umschlag stand in großen Buchstaben ihr Name. Sie wunderte sich, dass der Detective den Umschlag nicht erwähnt hatte.
Im ersten Moment hätte Sloane beides am liebsten liegen gelassen. Wie ein Polizist, der einen frischen Tatort abschreitet, rührte sie besser nichts an. Ein bisschen fühlte sie sich wie ein Forscher im Labor, der mit tödlichen Substanzen experimentiert und bei jeder Bewegung weiß, dass eine einzige ungeschickte Bewegung, ein fallen gelassenes Reagenzglas eine tödliche, Ebola-artige Seuche in die Luft entlässt. Sloane wandte sich halb ab und blieb unschlüssig stehen. Wenn sie nicht nachsah, was ihre Mutter für sie hinterlassen hatte, dämmerte ihr, würde es ihr jahrelang keine Ruhe lassen. Eine andere Stimme drängte sie, beides der Polizei auszuhändigen. Sollte die es unter die Lupe nehmen, was auch immer es war. Sie sah vor ihrem geistigen Auge, wie die Spezialisten eines Bombenentschärfungskommandos daran den Zünder herausdrehten. Im nächsten Moment stürzte sie zum Bett, schnappte sich Geschenk und Umschlag, klemmte sich beides unter den Arm, eilte aus ihrem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Sloane polterte die Treppe hinunter, hastete durchs Wohnzimmer und zur Haustür hinaus. Auf halbem Weg zu ihrem Wagen beugte sie sich vornüber und gab dem Würgereflex nach.
Alles drehte sich.
Sie glaubte, sich übergeben zu müssen, doch es kam nichts.
Vier
Sloane fuhr schnell, um von zu Hause nach Hause zu kommen, als ihr Handy klingelte. Ihr Kleinwagen verfügte über eine Freisprechanlage, und so drückte sie nur einen Knopf am Lenkrad, um ranzugehen: »Sloane Connolly.«
»Miss Connolly.« Sie erkannte sofort die dröge Stimme des Detectives wieder. Ihr erster Gedanke: Sie haben sie gefunden.
Beinahe wäre sie auf die linke Fahrbahn ausgeschert.
Sie irrte.
»Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dass die Taucher für heute Schluss gemacht haben. Sie wollen morgen noch einmal in den Fluss, aber …« Er zögerte.
»Aber was? Detective …«
»Ich glaube, die Chancen, etwas zu finden …«
Etwas, dieselbe neutrale Umschreibung, die sie für ihre Mutter schon einmal zu hören bekommen hatte.
»Also«, fuhr er fort, »der Leiter des Taucherteams ist skeptisch. Falls eine Leiche mit der Strömung in die Wasserkraftanlage eingesogen und durch die Turbinen geschleust wird, nun ja, der Abgang hat eine solche Kraft, dass sie beliebig weit flussabwärts sein könnte. Da kann es Wochen dauern, bis man sie findet.«
»Aber Sie werden nicht wochenlang nach ihr suchen?«
»Nein, bedaure. Wir sind auf zwei Tage beschränkt. Budgetkürzung. Tut mir wirklich leid. Gewöhnlich wird die Leiche dann zufällig von jemandem am Wasser entdeckt, ich meine, von einem Angler oder auch von einem Kajak aus, vielleicht irgendwann im Lauf des Sommers, aber möglicherweise auch nicht …«
»Verstehe.«
Was nicht stimmte. Sie glaubte nur, dass es die angemessene Antwort war.
»Ich hätte noch eine Frage«, sagte der Detective behutsam, als stehe jedes Wort unter Strom.
»Ja?«
»Wie hat Ihre Mutter ihr Namenskürzel geschrieben?«
Sloane schnürte es die Kehle zu.
»MO’C«, erwiderte sie. »Mit einem Apostroph zwischen dem O und dem C. Wieso?«
»Als wir den Parka, den einer der Taucher gefunden hatte, genauer untersuchten, kamen an einem eingenähten Schildchen Buchstaben zum Vorschein. Sie wissen schon, da, wo man sie hinschreibt, damit man den Mantel einem Besitzer zuordnen kann.«
»Und was für Buchstaben waren das?«
»Nicht mit Sicherheit zu sagen. Sie waren ziemlich undeutlich. Die Tinte war verlaufen, und dann der ganze Dreck. Vielleicht nach der Reinigung im Labor und unter einem Mikroskop … aber der erste Buchstabe war wahrscheinlich ein M. Schätzen zumindest alle.«
Sloane verfiel in Schweigen. M für Maeve, dachte sie. Ein Buchstabe auf einem Schildchen an einem Mantel im Fluss, das soll alles sein, um mir zu beweisen, dass meine Mutter tot ist? Das ergibt ungefähr genauso viel Sinn wie M für möglicherweise.
»Ich melde mich morgen wieder«, sagte der Detective. Er wechselte den Tonfall, er klang jetzt resigniert. »Ich weiß, wie schwer das für Sie sein muss, aber es gibt Richtlinien für solche Fälle. Ich kann Sie später damit vertraut machen.«
Dieselbe Wendung wie zuvor: solche Fälle.
Nur dass er diesmal, dachte Sloane, einen Fall meint, in dem jemand tot ist, aber die Leiche nicht geborgen werden kann.
Sie trennte die Verbindung.
Sie fuhr weiter, starrte in die Scheinwerfer, die ihr entgegenkamen. Sie stand neben sich. Sie hatte nur den einen Wunsch, in ihre Wohnung zurückzukehren, in ihr neues Roger-loses Leben, sich ihren Rucksack und ihre Mappen zu greifen und ins Studio hinüberzugehen, um ihren Projektentwurf fertigzustellen. Hauptsache, etwas Greifbares, das sie gegen den Aufruhr der Gefühle wappnete.
Sie konnte nur diesen einen Gedanken fassen, immer und immer wieder, wie einen Song, den man in Dauerschleife abspielt, als Sloane, nach einstündiger Fahrt, einen zweiten Anruf bekam.
Die Nummer auf dem Display kannte sie nicht. Im ersten Moment wollte sie ihn zur Mailbox umleiten lassen, da sie wieder einen von Rogers Tricks dahinter witterte, doch dann dachte sie, es könnte auch ein Professor sein oder eins der Architekturbüros, die von ihrem Projekt eine Vorschau bekommen hatten, oder der Leiter des Taucherteams oder sogar der nette Cop am Fluss. Alle diese Möglichkeiten jagten ihr durch den Kopf, als sie den Annahmeknopf drückte.
»Sloane Connolly«, sagte sie, ebenso gefasst wie beim letzten Mal, doch entschlossen, augenblicklich aufzulegen, falls sie Rogers quengelige Stimme zu hören bekam.
»Miss Connolly?«, meldete sich eine Männerstimme, die sie nicht kannte.
»Ja.«
»Patrick Tempter, ich bin Anwalt. Es tut mir leid, so mit der Tür ins Haus zu fallen, aber ich vertrete einen Herrn, der vorerst anonym bleiben möchte, und auch dafür bitte ich Sie um Entschuldigung. Mein Mandant hat Sie für den Entwurf zu einem Projekt im Auge, für das Sie seiner Meinung nach die richtige Person sein könnten.«
Sloane war verblüfft.
»Für einen Auftrag?«
»Ganz recht.«
»Aber wie …«, fing sie an.
»Mein Mandant ist mit Ihrer Arbeit an der Universität vertraut und sehr beeindruckt.«
»Aber wie …«
»Meines Wissens verfügt er über enge Kontakte zum Lehrkörper und zur Verwaltung Ihrer Universität. Auf dem Wege hat er wohl auch Ihren Namen und Ihre Telefonnummer bekommen und an mich weitergeleitet. Und so hat er wahrscheinlich auch als Privatmann Ihre Arbeit begutachten können.«
»Hat das irgendetwas mit Roger zu tun?«
»Verzeihung, Miss Connolly? Roger?«
Sie spürte eine Woge der Verlegenheit.
»Ach, nichts. Wieso ich?«
»Sie wurden nachdrücklich empfohlen.«
Sloane holte tief Luft. »Es tut mir leid, Mr Tempter, aber das kommt in einem ungünstigen Moment. Ich stecke in einer ernsten Familienangelegenheit und kurz vor dem Diplom und mein Abschlussprojekt …«
Er fiel ihr ins Wort.
»Genau dieses Projekt hat ja das Interesse meines Mandanten geweckt. Er möchte ein Denkmal errichten. Vielleicht sogar mehrere.«
»Ein Denkmal?«
»Richtig.«
»Wem?«
»Eine Reihe von Personen haben dazu beigetragen, dass er zu dem geworden ist, was er heute ist. Lehrer. Mentoren. Menschen, die ihm auf dem Weg zum Erfolg eine Quelle der Inspiration gewesen sind. Menschen, die ihm etwas bedeutet haben. Die Einfluss auf sein Leben hatten. Und es ist ihm ein Anliegen, sie angemessen zu würdigen. Er hat schon an schlichte Gedenktafeln gedacht, an Schenkungen und Stipendien in ihrem Namen – und dies alles möglicherweise immer noch im Blick –, doch darüber hinaus schwebt ihm etwas Dauerhafteres vor. Das mit einer Gedenktafel erschien ihm dann doch ein wenig abgegriffen. Ihr Entwurf dagegen sagte ihm zu. Er ist verblüffend originell. Viel näher an seiner eigenen Vision. Etwas in diese Richtung möchte er unbedingt verwirklicht wissen.«
»Ich weiß nicht. Meine Situation …«
»Wie auch immer Ihre Situation ist, Miss Connolly, mein Klient ist sicher gewillt, Ihnen da entgegenzukommen. Sollten Sie zum Beispiel mehr Zeit benötigen, wäre das akzeptabel. Mehr Geld, selbstverständlich. Die Kosten spielen für ihn keine Rolle. Der Entwurf schon. Er ist ein geduldiger Mann. Aber was Sie für ihn schaffen sollen, nun ja, denkwürdig war das Wort, das er gebrauchte.«
»Wer sind die Leute …«
»Ah, tut mir leid, Miss Connolly. Genaueres werden Sie erfahren, wenn Sie den Auftrag angenommen und die Verträge unterzeichnet haben.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mr Tempter. Das kommt vollkommen überraschend. Ich habe im Moment wirklich eine Menge um die Ohren …«
»Bitte, Miss Connolly, Sie brauchen sich nicht sofort zu entscheiden. Denken Sie über das Angebot nach. Bedenken Sie auch, dass sich Ihr Honorar im sechsstelligen Bereich bewegen wird, wenn nicht noch höher. Und ziehen Sie auch in Erwägung, dass Sie sich mit dieser Arbeit einen Namen machen können – ein Meilenstein für Ihre Karriere. So eine Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage. Das ist wie ein Lotteriegewinn. Denken Sie also bitte in Ruhe darüber nach.«
Bestechende Argumente. Darauf fiel ihr nur eine Antwort ein.
»In Ordnung«, sagte sie. »Ich überlege es mir.«
»Ausgezeichnet. Wissen Sie was?«, fuhr der Anwalt fort. »Ich bestelle uns einen Tisch in einem netten Restaurant. Ich schicke Ihnen eine Nachricht mit dem Namen und der Uhrzeit. Dann können wir uns über alles Weitere persönlich unterhalten. So viel angenehmer, als wenn man hinterm Lenkrad sitzt.«
Eine Sekunde lang glaubte Sloane, der Anrufer beobachte sie. Erst dann kam ihr zu Bewusstsein, dass sie mehr als ein Auto hupend überholt hatte.
»In Ordnung«, wiederholte sie. »Warum nicht. Aber nicht morgen. Kommendes Wochenende, denke ich. Das lässt mir genügend Zeit. Bis dann.«
»Selbstverständlich, Miss Connolly. Ich möchte nur wiederholen: Das ist eine riesige Chance für Sie. Mein Mandant ist sehr großzügig. Und sehr zielstrebig. Und er verfügt über beste Kontakte. Nach meiner Erfahrung machen Persönlichkeiten von seinem Format, wenn sie sich dazu entschließen, wichtige Wegbegleiter zu ehren, keine halben Sachen. Deshalb wäre mein Rat an Sie, zuzugreifen, ungeachtet persönlicher Herausforderungen, denen Sie sich momentan gegenübersehen mögen.«
»Ich werde allerdings mehr über dieses Projekt erfahren müssen.«
»Selbstverständlich. Aber dazu werden wir beide den nächsten Schritt unternehmen müssen, denke ich. Und der nächste Schritt ist nichts Komplizierteres als ein Dinner.«
Sogar am Telefon klang die Stimme des Anwalts überzeugend, bestechend. In keiner Weise bedrohlich. Sloane hatte schon einen verzweifelten Stoßseufzer auf den Lippen: Aber meine Mutter ist verschwunden, und ich glaube, sie ist tot!
Doch sie riss sich zusammen. Sie fühlte sich am Scheideweg – einer führte nach vorn, der andere machte eine Schleife zurück.
»Okay, Mr Tempter. Dann höre ich wieder von Ihnen.«
»Gut, Miss Connolly.«
Sie trennte die Verbindung. Wer hätte gedacht, dass sich der Strudel der Gefühle an diesem Tag noch schneller drehen könnte, doch genau das geschah.