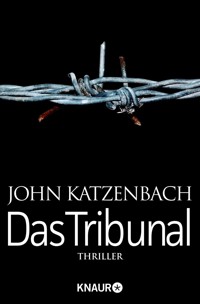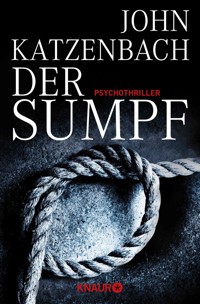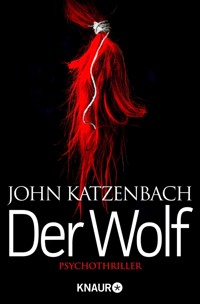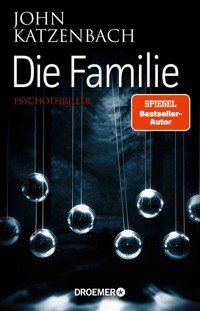
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dr. Frederick Starks
- Sprache: Deutsch
Ein Toter, der nicht tot ist. Ein Fluch, der nicht aufhört. Eine mörderische Jagd bis zum Letzten. Im Thriller »Die Familie« von Bestseller-Autor John Katzenbach wird der Psychiater Frederick »Ricky« Starks von seiner Vergangenheit heimgesucht - in Gestalt von Zerberus. In Miami hat sich Dr. Frederick Starks ein neues Leben aufgebaut – zum zweiten Mal. Denn bereits zwei Mal wurde Starks von psychopathischen Killern in ein tödliches Spiel verwickelt, das er selbst nur knapp überlebt hat. Seine Widersacher hält der Psychiater für tot und wähnt sich endlich in Sicherheit. Doch als die Polizei den Selbstmord eines seiner Patienten meldet, argwöhnt Starks sofort, dass der Mann in Wirklichkeit umgebracht wurde. Kurz darauf hackt ein Unbekannter, der sich Zerberus nennt, Starks' Computer und trägt ihm ein Rätsel auf: Binnen vierzehn Tagen muss Starks den Selbstmord eines der zwölf Patienten verhindern, die Zerberus ihm aufzählt. Scheitert er, sterben die beiden liebsten Menschen, die ihm noch geblieben sind. Atemraubend genialer Nervenkitzel bis zur letzten Seite: »Die Familie« ist der hoch spannende Abschluss der Thriller-Reihe um den Psychiater Frederick Starks aus »Der Patient« und »Der Verfolger«. Der 18. Psychothriller des amerikanischen Bestseller-Autors John Katzenbach kann auch als Stand alone gelesen werden. »Ein Meister seines Fachs.«WDR »Bereits seit über 30 Jahren steht John Katzenbach für Psychothriller auf höchstem Niveau.«Krimi-couch.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
John Katzenbach
Die Familie
Psychothriller
Übersetzt von Anke Kreutzer und Eberhard Kreutzer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dr. Frederick (»Ricky«) Starks ist Psychiater in Miami. Und weiß, dass seine psychopathischen Widersacher nicht mehr am Leben sind. Zweimal hat er sie aus dem Weg räumen müssen. Beide Male ist er selbst nur knapp mit dem Leben davongekommen. Also müsste jetzt Ruhe sein.
Doch alles andere als das. Als die Polizei den Selbstmord eines seiner Patienten meldet, argwöhnt Starks sofort, dass der Mann in Wirklichkeit umgebracht wurde. Kurz darauf hackt ein Unbekannter, der sich Zerberus nennt, Starks’ Computer und trägt ihm ein Rätsel auf: Verhindert er nicht binnen vierzehn Tagen den Selbstmord eines der zwölf Patienten, die er ihm aufzählt, wird er die beiden liebsten Menschen umbringen, die Starks noch geblieben sind.
Geht das tödliche Katz-und-Maus-Spiel wieder von vorne los?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
MOTTO
PROLOG
Die erste Begegnung …
ERSTER TEIL
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
ZWEITER TEIL
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG
KAPITEL SECHSUNDZWANZIG
KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG
KAPITEL ACHTUNDZWANZIG
KAPITEL NEUNUNDZWANZIG
KAPITEL DREISSIG
KAPITEL EINUNDDREISSIG
KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG
KAPITEL DREIUNDDREISSIG
DRITTER TEIL
KAPITEL VIERUNDDREISSIG
KAPITEL FÜNFUNDDREISSIG
KAPITEL SECHSUNDDREISSIG
KAPITEL SIEBENUNDDREISSIG
KAPITEL ACHTUNDDREISSIG
KAPITEL NEUNUNDDREISSIG
KAPITEL VIERZIG
KAPITEL EINUNDVIERZIG
KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG
EPILOG
»Schön, Sie zu sehen, Professor Falken…«
»Hallo, Joshua.«
»Merkwürdiges Spiel. Der einzig erfolgreiche Schachzug ist, nicht zu spielen.«
WarGames – Kriegsspiele,1983
PROLOG
FÜNFZEHN JAHRE ZUVOR …
Die erste Begegnung …
… Für Dr. Frederick Starks fing alles an, als er an seinem dreiundfünfzigsten Geburtstag diesen Brief empfing, in dem stand:
Willkommen am ersten Tag deines Todes.
… Mit diesen Worten wurde Ricky zur Zielscheibe eines ausgeklügelten, perversen Racheplans, den vier Menschen ausgeheckt hatten:
Sein einstiger Mentor, ein hoch angesehener Psychoanalytiker aus New York, der seine bösartigen Neigungen fast sein ganzes Leben lang erfolgreich verheimlicht hatte.
Dr. Lewis.
Und:
Die drei Kinder einer verarmten Frau, Opfer häuslicher Gewalt, der er einst seine Hilfe versagt hatte. Als junger, unerfahrener Therapeut hatte er, als sie sich damals an ihn wandte, ihre verzweifelte Lage und die wahre Gefahr, in der sie sich befand, unterschätzt. Er hätte ihr helfen müssen. Er hätte sie an Zufluchtsorte vermitteln müssen, an Einrichtungen, in denen sie emotional und auch körperlich Sicherheit gefunden hätte. An vielfältigen Angeboten hätte es nicht gemangelt. Doch er hatte die Dringlichkeit verkannt und die nötige Tatkraft vermissen lassen. Was er naiverweise für einen Routinefall gehalten hatte, war alles andere als das, und so kam es zur Tragödie. Sein Versagen kostete sie das Leben und machte ihre drei Kinder zu Waisen. Sie wuchsen bei ihrem Adoptivvater auf, jenem Mann, den Rick fälschlicherweise für seinen Freund und Lehrer gehalten hatte und der sie nach seinem Bilde formte:
Mr R. – ein äußerst gewiefter Psychopath. Ein professioneller Killer.
Merlin – ein wohlhabender Wall-Street-Anwalt, überaus versiert darin, das Leben anderer Menschen zu ruinieren.
Virgil – eine umwerfende Schauspielerin, die Ricky versprochen hatte, ihm auf seinem Abstieg in die Hölle als persönliche Begleiterin zur Seite zu stehen.
Diese drei Menschen kannten nur einen einzigen, alles verzehrenden Antrieb im Leben:
Rache.
Zusammen mit dem älteren Arzt, der sie aufzog, bildeten sie die Familie, die ihn für seine Fehler mit dem Tod bestrafen wollte. Ihre erste Ansage:
Machen Sie Ihrem Leben selbst ein Ende, Dr. Starks. Oder ein Unschuldiger wird an Ihrer Stelle sterben …
Diese erste Konfrontation hatte er nur mit knapper Not überstanden – indem er seinen eigenen Selbstmord vortäuschte und untertauchte, sich mehrmals neu erfand und zugleich sämtliche bürokratischen Hürden überwand, um die Vergangenheit seiner Widersacher aufzudecken und ihre gegenwärtigen Rollen zu entlarven. Als Analytiker hatte er alle Register gezogen, um sie zu überlisten, sie schließlich allem Anschein nach auch besiegt, wenngleich zu einem furchtbar hohen Preis: Nicht nur seine New Yorker Praxis, sondern auch sein Ansehen als Therapeut war ruiniert. Zusammen mit seinem geliebten Ferienhaus auf Cape Cod war sein bisheriges Leben bis auf die Grundfesten niedergebrannt. Bis er sich von dem Rückschlag erholt hatte, sollten Jahre vergehen – anfänglich an wechselnden Aufenthaltsorten, dann in einer neuen Stadt, mit einer neuen Praxis und einer neuen Existenz. Fünf Jahre harte Arbeit, um endlich wieder er selbst zu sein. Um erneut von der Vergangenheit eingeholt zu werden …
Zum zweiten Mal kreuzten sich ihre Wege …
… als die drei noch lebenden Familienmitglieder eine Forderung an ihn richteten …
Sie sind der Einzige, der uns helfen kann. Jemand will uns umbringen – und wir können nicht zur Polizei. Wenn Sie uns helfen, herauszufinden, wer es ist, lassen wir Sie für immer in Ruhe …
Sie wetteten darauf, dass er – als Psychoanalytiker und Arzt – ein Hilfsgesuch, das, so schien es, einer echten Notlage entsprang, nicht abschlagen konnte. Nicht zuletzt auch, weil es mit vorgehaltener Waffe an ihn herangetragen wurde.
Die Notlage war erstunken und erlogen.
Wie sich zeigte, ging es ihnen um dieselbe alte Rache, der er schon einmal knapp entkommen war, und sonst nichts.
Ihre »Bitte« war Teil eines ausgeklügelten Plans, eines perfiden Spiels mit psychologischer Manipulation. Durch Bestechung hatten sie einen unheilbaren kranken Mann dazu überredet, ihn zu ermorden, während sie sich auf ihrem Olymp, unverdächtig und unangreifbar, die Hände rieben. Das perfekte Verbrechen. Eine (aussichtslose) wilde Verfolgungsjagd auf Leben und Tod brachte ihn von seinem neuen Lebensmittelpunkt in Miami zurück nach New York, von dort ins kleinstädtische Connecticut und schließlich ins ländliche Alabama.
Die Bestechung: Töte Dr. Starks für uns, und im Gegenzug sichern wir deinem einzigen Kind Erfolg und Reichtum zu, damit du in Frieden sterben kannst …
Eine weitere Lüge, die sich Krankheit und Verzweiflung zunutze machte.
Und ihr Plan wäre aufgegangen, wären da nicht die folgenden Umstände gewesen:
… ein Fehlschuss dank zittriger Hände
… ein dreizehnjähriges Mädchen, das bei einem Mord nicht mitspielen wollte und dann in Sicherheit gebracht werden musste
… ein zweiundzwanzigjähriger ehemaliger Patient, der an bipolaren Halluzinationen litt und Ricky davor bewahrte, in eine zweite, nicht minder tödliche Falle zu tappen
… eine resolute siebenundachtzigjährige Witwe mit einer großkalibrigen Handfeuerwaffe in der Handtasche, die als Einzige die Gefahr erkannte, in der er schwebte, im richtigen Moment zur Pistole griff und mit einem einzigen Schuss einen Mörder zur Strecke brachte.
Mit diesem einzigen Schuss sah er sich für immer aus den Fängen der Familie befreit, die ihm nach dem Leben trachtete.
In all den darauffolgenden Tagen, Monaten und Jahren, die ohne besondere Vorkommnisse verstrichen, war ihm nie in den Sinn gekommen, dass er von der ersten Minute an gewaltig irrte, wenn er glaubte, frei zu sein.
ERSTER TEIL
DIE DREIZEHNTE HERKULESARBEIT
KAPITEL EINS
Zwei, von denen Dr. Starks
nicht sofort erfuhr.
Und ein dritter, von dem er wusste.
Bevor er vor den versammelten Medizinern und Fachstudenten mit seinem flammenden Plädoyer für die ungebrochene Bedeutung der Psychoanalyse zum Ende kam, legte Dr. Frederick Starks eine wirkungsvolle Pause ein. Im grellen Licht auf dem Podium konnte er unter den Zuhörern nur schwer Gesichter erkennen, doch er wusste, dass Roxy irgendwo in der Nähe saß, wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Reihe, inmitten seiner Kollegen und ihrer Kommilitonen. Er wusste, dass sich Charlie an diesem Tag wahrscheinlich etwas früher freigenommen, aber im vollen Hörsaal wohl nur noch auf den hintersten Rängen Platz gefunden hatte. Gerade weil er dem Auditorium wichtige Einsichten vermitteln wollte, fürchtete er, in offensichtliche Klischees zu verfallen. Vor allem richtete er seine Worte an die beiden jungen Menschen, die zu einem wichtigen Teil seines Lebens geworden waren. Zehn Jahre zuvor – mitten in seinem zweiten Kampf mit der Familie, die ihn tot sehen wollte – hatte Charlie, ein immer wiederkehrender Patient, der mit einer bipolaren Erkrankung kämpfte, ihm das Leben gerettet, und Roxy, damals ein verängstigtes und verwaistes dreizehnjähriges Kind, war sein Mündel geworden. Mehr als irgendjemand sonst lagen Ricky diese beiden jungen Menschen am Herzen.
An die Frage, wer sonst noch zur Vorlesung gekommen sein könnte, verschwendete er keinen Gedanken.
»Ich fasse zusammen«, sagte er, hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Es mag Ihnen antiquiert erscheinen in dieser schnelllebigen, hoch technisierten Welt mit ihrer Sensationsgier und Reizüberflutung – doch an einer Wahrheit ist nicht zu rütteln, sie bildet das Fundament der Psychoanalyse …«
Wieder blickte er schweigend in den Saal.
»… Ich spreche von der Erkenntnis, dass wir die Vergangenheit, ob gut oder schlecht, niemals gänzlich hinter uns lassen können. Sie begleitet uns weiter und gibt die Richtung für die Zukunft vor. Wenn wir uns unsere früheren Schritte vor Augen halten und verstehen, wie über die Jahre jeder davon in uns nachhallt, dann wird jeder Schritt nach vorn wesentlich leichter und hoffnungsvoller. Dies gilt auch im Umkehrschluss: Wenn wir unsere persönliche Geschichte nicht begreifen, werden wir wahrscheinlich stolpern und straucheln. Und emotional gefährdet bleiben.«
Ricky lächelte die Menschen an, die er vom Podium aus nicht sehen konnte, und klappte den Notizblock mit seinem Vortrag zu. Der Beifall war nicht ohrenbetäubend, kam jedoch von Herzen, mit Ausnahme zweier Personen, die er nicht auf Anhieb erkannt hätte, und von zwei weiteren, die er umso besser hätte einordnen können, hätten sie sich nicht davongeschlichen, bevor das Licht im Saal anging.
Er spürte, wie ihn die vertrauten, widerstrebenden Gefühle beschlichen: lähmende Angst und grenzenlose Energie. Erstere lauerte irgendwo tief in seiner Erinnerung. Letztere drängte ihn einzutreten, wie ein übereifriger Türsteher vor einer gewagten Sexshow. Die Manie beginnt mit einem wohligen Erregungskitzel – Ich brauche nicht zu schlafen. Alles, was ich will, kann ich in kürzerer Zeit erreichen als jeder andere auf der Welt. Ich bin unschlagbar. Ich mach das mit links. Charlie hatte sich beigebracht, derlei Gedanken als das zu entlarven, was sie waren: Hochstapler, mythische Sirenen, die ihn auf die Überholspur in den Wahnsinn lockten. Die unzähligen Stunden, die er in Dr. Starks’ Praxis verbracht hatte, um über ebendiese Anzeichen zu sprechen, die Dosierung seiner Medikamente abzustimmen und seine bipolare Störung in Schach zu halten, hatten Charlie für seine lebenslange Gratwanderung gewappnet.
Es war, als bekriegten sich in seinem Kopf zwei Engel, ein guter und ein böser. Tu dies. Tu das. Setz die Medikamente ab, sie machen dich nur träge, dumm und fett. Du brauchst sie nicht, um toll zu sein.
Oder:
Gib nicht nach. Sei kein Narr. Nimm die Tabletten weiter, sie sorgen dafür, dass du bei klarem Verstand bleibst und froh bist, dazuzugehören. Nur mit den Tabletten hast du einen Job. Hast du Freunde. Hast du eine Zukunft.
Als sich an diesem Tag die ersten Anzeichen der Krankheit bemerkbar machten und gegen die Vernunft Sturm liefen, blieb Charlie länger an seinem Arbeitsplatz. In der Abteilung für digitale Grafik der kleinen Werbeagentur in Miami war er einer von nur vier Angestellten, und er registrierte, wie sie ihm einer nach dem anderen zuwinkten und »Bis morgen!« sagten, bevor sie ihren Schreibtisch verließen. Von seinem Platz aus konnte er sehen, wie auch die anderen Mitarbeiter der Firma Feierabend machten, die smarten Führungskräfte in ihren eleganten Leinenanzügen ebenso wie die langhaarigen Kollegen in Jeans aus der Produktion. Vor dem Fenster zog die Dunkelheit herauf, doch Charlie rührte sich nicht vom Fleck. Die Manie schwappte über ihn hinweg wie eine Brandungswoge. In seinem klimatisierten Kokon wurde ihm noch heißer als anderswo. Er griff nach seinem Handy in der Hosentasche.
Ruf Dr. Starks an.
Geh zu ihm in die Praxis und sag ihm, was los ist. Er hilft dir. Macht er doch immer.
Er legte das Handy vor sich auf den Tisch.
Vergiss es.
Dir geht’s gut.
Du schaffst das auch allein.
Charlie wusste sehr wohl, dass sich irgendwo in seinem Kopf Lügen als Wahrheit tarnten und ihm Wahrheiten wie Lügen erschienen. Er verstand, dass ihm das eigentlich hätte zu denken geben müssen.
Tat es aber nicht.
Charlie wandte sich wieder seinem Schreibtisch zu, drehte sich auf seinem Stuhl mal links-, mal rechtsherum, lehnte sich vor, dann zurück, fuhr seinen Computer hoch und stürzte sich in das Projekt, an dem er und die anderen in der Agentur gerade arbeiteten. Er ging so nah heran, als wollte er jede Linie auf dem Bildschirm mit Händen greifen, und zeichnete mit der Maus so schnell, dass es unter seinem rechten Zeigefinger nur so klickte. Vor seinen Augen entfaltete sich ein verführerischer Tanz aus Farben und Formen.
Um 21:00 Uhr glaubte er, das Pensum des Teams für den Rest der Woche erledigt zu haben. Um Mitternacht schienen neben seiner eigenen Arbeit auch die Aufgaben seiner Kollegen fertig zu sein. Aus seiner Sicht war alles brillant. Weitblickend. Originell. Um ein Uhr nachts starrte er auf seinen Monitor und stellte ein wenig enttäuscht fest, dass es nichts mehr zu tun gab. Widerstrebend stand er auf.
Die Büros waren dunkel, nur bei ihm war noch Licht. Charlie überlegte, ob er direkt zu seiner Wohnung fahren oder vielleicht erst noch bei einer Pizzeria am Rande von Coconut Grove haltmachen sollte, die um diese Zeit noch geöffnet war, obwohl er zu seiner Verwunderung keinen großen Hunger hatte. Er könnte natürlich auch den Rest der Nacht im Bayside Park verbringen und spazieren gehen, überlegte er. Bevor er sich entschieden hatte, beschlich ihn jedoch ganz plötzlich das Gefühl, nicht allein zu sein. Er fuhr herum und starrte in die Dunkelheit rings um den Lichtkegel seiner Lampe.
Er reckte das Ohr in die Richtung, aus der er schweren Atem zu hören glaubte. Und Fauchen?
Da ist einer.
Jemand beobachtet mich.
Er war starr vor Schreck, bis ihm dämmerte, dass er seinen eigenen Atem hörte.
Charlie hielt die rechte Hand vors Gesicht. Er wollte sehen, ob sie zitterte. Er war sich nicht sicher. Einen Moment wirkte sie ruhig, dann wieder schien sie zu beben. Ihm lief der Schweiß in die Augen.
»Wer ist da?«, fragte er leise.
»Wer ist da?«, wiederholte er laut und deutlich.
Keine Antwort.
»Wer ist da?«, brüllte er.
Das Echo seiner eigenen Stimme schlug ihm aus jeder Ecke des verlassenen Büros entgegen.
Er blickte nach links und rechts. Oben und unten. Überall schienen Schatten aus der Dunkelheit zu treten, immer größer und bedrohlicher. Unwillkürlich duckte sich Charlie weg.
Reiß dich zusammen!, befahl er sich und konnte nicht sagen, ob laut oder leise. Wieder griff er nach seinem Handy. Ruf Dr. Starks an!
Aber anstatt zu wählen, starrte er auf die Zeitanzeige. Er wusste, es war schon nach ein Uhr früh, und doch fragte er sich plötzlich, ob es vielleicht ein Uhr nachmittags sei. Obwohl er beim Blick durchs Fenster die dunkle Nacht von Miami vor sich hatte, brauchte er einige Sekunden, um sich bei der Tageszeit sicher zu sein.
Nichts wie weg!, sagte er sich und wusste diesmal wenigstens, dass es nur in Gedanken war. Er griff zu seinem Rucksack und eilte zum Fahrstuhl. Er drückte mehrmals auf den Rufknopf. »Komm schon, komm schon«, murmelte er. »Ich muss hier raus …«
Vor wem oder was er fliehen musste, wusste er nicht, sondern nur, dass die Bedrohung sehr real war und irgendwo unsichtbar im Dunkeln lauerte.
Er stürzte in den Lift, drückte auf den Knopf zum Erdgeschoss und spürte einen kalten Luftzug, als sich etwas oder jemand zu ihm in den Fahrstuhl schlich. Eine Präsenz.
»Los, los«, sagte er. Das war laut. Der Fahrstuhl gehorchte. Die Türen zischten zu, und er fuhr die drei Stockwerke hinunter. Einen Moment lang fürchtete er, irgendwer hätte den Notknopf gedrückt und der Fahrstuhl sei stecken geblieben. Es schien viel länger zu dauern als sonst. Sobald sich die Türen öffneten, stürzte Charlie in den Flur und zum Parkplatz hinaus, als sei ein Rudel Wölfe hinter ihm her.
Sein Kleinwagen war das einzig verbliebene Fahrzeug weit und breit. Das spärliche Licht aus den nahe gelegenen, verlassenen Gebäuden spiegelte sich matt in der Karosserie, doch ihm stach es wie Blitze in die Augen. Das hintere Ende des Parkplatzes markierte eine Reihe Palmen, deren Wedel in der leichten Brise raschelten. Miamis nächtliche Schwüle drückte auf die Brust. Charlie wusste nicht, wohin, sondern nur, dass er schnell wegkommen wollte. Mit wenigen Sätzen war er am Wagen.
Er drückte ein paar Mal vergeblich auf den Schlüssel.
»Komm schon, komm schon …«, sagte er.
Als endlich die Verriegelung aufschnappte, hörte er eine Stimme hinter sich.
»Charlie…«
Starr vor Schreck, kratzte er den letzten Rest an rationalem Denken zusammen. Es ist eine Halluzination! Dir passiert nichts. Hör nicht darauf!
»Charlie, du hast mich heute Nacht lange wach gehalten.«
Hatte er das nur in seinem Kopf gehört?
Langsam drehte er sich zu der Stimme um und schloss vor Angst dabei die Augen.
Dann hörte er ein seltsames Geräusch:
Wumm! Wumm! Wumm!
Es fühlte sich an, als hätte ihm jemand drei Mal in die Brust geschlagen.
Er taumelte rückwärts.
Jemand hat auf mich geschossen. Ich bin tot.
Hinter seinen zusammengekniffenen Augen drehte sich alles und zog ihn in einen schwarzen Strudel hinab. Er spürte die harten Konturen seines Wagens im Rücken, während er wider besseres Wissen versuchte, sich aufrecht zu halten. Langsam öffnete er die Augen und senkte den Blick auf die Brust.
Blut.
Er sah, wie es heraussickerte und sich in einem roten Fleck über sein Hemd ausbreitete.
Aber da stimmte etwas nicht.
Es müsste wehtun.
Tut es aber nicht.
Ich dürfte keine Luft bekommen.
Ich atme aber.
Fühlt sich Sterben so an?
Wohl eher nicht.
Vielleicht doch. Vielleicht ist es genau so: Man kann den Tod nicht fühlen, riechen oder hören, aber man weiß, dass es passiert.
Er tastete nach dem Zeug. Dickflüssig wie Blut.
Er hielt sich den verschmierten Finger an die Nase.
Also doch nicht. Was anderes.
Das Wort Farbe fiel ihm nicht ein.
Er sackte langsam zu Boden. Zusammengekauert, presste er die Schenkel an die Brust und schlang die Arme um die Knie. Er hielt die Tränen nicht länger zurück, sondern schluchzte laut und ungehemmt, bis er keine Luft mehr bekam, bis ihm alles wehtat und ihn alle Kraft verließ. Der letzte Rest manischer Energie war verbraucht, und so kauerte er reglos an seinem Wagen, bis der Morgen dämmerte. Unter Aufbietung aller Willenskraft zog er sein Handy aus der Tasche und machte den Anruf …
Die rätselhafte Nachricht des Dekans der medizinischen Fakultät, mit dem offiziellen Briefkopf der Universität, wurde ihr per Einschreiben postalisch zugestellt. Bisher war noch jede Mitteilung der Verwaltung oder der Fakultät elektronisch bei ihr eingegangen. Dieser Brief wirkte gleichermaßen antiquiert wie autoritär:
Sehr geehrte Ms Allison:
Gegen Sie wurde glaubhaft der Vorwurf erhoben, sich bei Ihrer letzten Klausur in Innerer Medizin unlauterer Mittel bedient zu haben. Dieser Vorwurf gefährdet Ihren weiteren Verbleib an der Fakultät. Eine erste Anhörung in dieser Angelegenheit wurde für morgen, 9:00 Uhr, in meinem Büro angesetzt.
Darüber hinaus steht gegen Sie die Anschuldigung im Raum, widerrechtlich auf elektronische Patientenakten der psychiatrischen Abteilung des Universitätskrankenhauses zugegriffen zu haben. Sollte sich dieser Vorwurf erhärten, behält sich die Fakultät vor, die Angelegenheit an die zuständige Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.
Sie schnappte nach Luft, als drückte ihr jemand die Kehle zu. Sie las den Brief zweimal durch. Ihr wurde schwindlig. Die Worte verschwammen vor ihren Augen, sie konnte keinen Buchstaben mehr entziffern. Sie bekam einen staubtrockenen Mund. Ihr zitterten die Hände.
Ihr erster Gedanke: Es kann sich nur um einen ungeheuren Irrtum handeln.
Ihr zweiter Gedanke: Das ist absurd. Das ist gelogen. Das ist vollkommen verrückt.
Roxy ging die fragliche Prüfung im Kopf noch einmal durch. Es war eine Fernklausur ohne vorgegebenes Zeitfenster, jedoch mit strengen Regeln zur Verwendung von Lehrbüchern oder einschlägigen Fachzeitschriften gewesen. Die Fragen waren direkt über den – angeblich sicheren – E-Mail-Server der medizinischen Fakultät gekommen, ihre Antworten über denselben verschlüsselten Kanal zurück an den Professor gegangen.
Vor allem aber wusste sie, dass sie nicht gegen die Prüfungsregeln verstoßen hatte.
Es war Roxys erstes Studienjahr in Medizin. Am College hatte sie Biologie und Englische Literatur gewählt und wie von ihrem inzwischen verstorbenen Vater prophezeit, mit Bestnoten geglänzt.
Wie fast alle Medizinstudenten im ersten Jahr litt Roxy unter Schlafmangel. Zwischen den Kursen, dem Lernpensum und ihren täglichen Aufgaben in der Psychiatrie – meist banale Dokumentationsarbeiten, da sie den Ärzten bei der Behandlung psychisch schwer Kranker nur zusehen durfte –, schlief sie im Durchschnitt weniger als fünf Stunden pro Nacht. Das hinterließ Spuren. Sie war chronisch erschöpft.
Ringe unter den Augen. Gewichtsverlust – nicht gut, denn sie brachte auch so schon kein Gramm zu viel auf die Waage, sodass sie auf der Station gelegentlich den besorgten Blick eines Arztes auf sich zog – und gezielte Fragen zu Magersucht oder Bulimie. Manchmal weinte sie, bevor sie ein paar Stunden Nachtruhe fand. Gelegentlich betete sie darum, irgendwann ihr gutes Aussehen zurückzubekommen. Ich war mal hübsch. Ich weiß, dass ich wieder hübsch sein kann. Der Stress brachte zuweilen ihren Zyklus durcheinander, doch gelegentlich ein Burger oder ein Bier mit Kommilitonen, mehr Sozialleben war nicht drin. Sie machte sich nichts vor, sie wusste, wie sehr ihr Wohlbefinden unter der Einsamkeit litt, sah jedoch für die Dauer ihres Studiums keinen Ausweg. Ihr Mentor und Vormund Dr. Starks hatte sie früh genug vor der Gefahr gewarnt.
Er hatte ihr auch einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verschrieben. Xanax, das Mittel der Wahl für Menschen, die zu Überängstlichkeit neigen.
Sie dachte: Ruf ihn an. Hol dir Rat bei ihm ein.
Sie hatte seine Nummer schon halb gewählt, hielt dann aber inne.
Ihr traten die Tränen in die Augen. Bei der Vorstellung, dem Mann, der ihr so sehr geholfen hatte, schluchzend mitzuteilen, ihr werde Betrug zur Last gelegt, stieg eine Woge der Scham in ihr auf.
Aber ich habe doch nichts getan, hielt sie dagegen. Ich habe noch nie bei irgendetwas geschummelt.
Selbstmitleid machte es keinen Deut besser. Sie war gerade mal Anfang zwanzig, und plötzlich stand, so schien es, ihr ganzes Leben auf dem Prüfstand und wurde möglicherweise für mangelhaft befunden. Ungebeten fanden sich die Geister der Vergangenheit in ihrer kleinen Wohnung ein: ihre Mutter, bei einem Autounfall umgekommen, ihr Vater, an Krebs gestorben. Mrs Heath, die ihr ein stattliches Stipendium vermacht und sie zusammen mit Dr. Starks zum Medizinstudium ermuntert hatte, bevor sie hochbetagt verstarb. Und noch andere Gespenster drängten sich dazwischen, eines unfreundlich, eines beharrlich: der Mörder, der sie und Dr. Starks ein Jahrzehnt zuvor durch das ländliche Alabama verfolgt hatte, und schließlich ihre ermordete Freundin aus der achten Klasse. »Hallo, Joanie«, flüsterte sie dem Gespenst ihrer Freundin aus der Kindheit zu und wiederholte ihr Versprechen von damals: »Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich schwör’s.«
Wieso, dachte sie, machst du dich nur wegen eines Briefs verrückt?Wenn du von der Uni fliegst, wirst du eben …
Sie kämpfte gegen den Gedanken an.
Sie holte tief Luft.
Reiß dich zusammen.
Sie redete sich ein, solange sie die Wahrheit auf ihrer Seite hätte, könne ihr nichts passieren. Dabei wusste sie nur zu gut, dass ausgeklügelte Lügen eine virale Dynamik entfalten können und dass es für viele einfacher und bequemer war, an eine gut verpackte Falschmeldung als an Fakten zu glauben.
Ob der Dekan zu dieser Gruppe zählte?
Schwer zu sagen.
Sie wusste nur, dass in den wenigen Stunden, die ihr blieben, an Schlaf nicht zu denken war. Statt erholt würde sie gerädert in den Morgen starten. Sie hoffte, dass ihr die schiere Wut über die Anschuldigung dabei half, den anberaumten Termin beim Dekan durchzustehen.
Sie brauchte Adrenalin, einen ordentlichen Stoß, und überlegte, ob ihr dabei eine Pille Ritalin – ein Amphetamin, das bei ADHS verschrieben wird – helfen könnte. Ihr Nachbar konnte ihr eine abgeben, und sie war schon auf halbem Weg zur Tür, um ihn zu wecken, überlegte es sich jedoch anders.
Eine Nacht voller Angst und Zweifel würde sie auch so überstehen. Sicher, sie war bis ins Mark getroffen. Sie hätte einen emotionalen Rettungsring gebraucht, doch es war keiner zur Hand, jedenfalls keiner, nach dem sie greifen mochte. Kein Hilferuf bei Dr. Starks. Auch nicht beim Krisentelefon der Fakultät. Bei einem der Ärzte, die ihr für ihre Arbeit so regelmäßig Komplimente machten. Sie empfand zu viel Scham, um irgendeine Nummer zu wählen.
Selbst die von Charlie. Sie wusste, dass er ihr mit seinen üblichen, halb spaßig, halb ernst gemeinten Ratschlägen die Angst nehmen würde. Doch entweder konnte oder wollte sie nicht, und so blieb sie die ganze Nacht, mit dem Kopf auf dem Schreibtisch, sitzen und fragte sich, wie sie den kommenden Tag überstehen sollte.
Am nächsten Morgen erschien Roxy zwei Minuten vor neun im Dekanat der medizinischen Fakultät. Gewappnet war sie nur mit ihrem Laptop und dem Rest an Empörung, den sie zusammenkratzte, um die erdrückende Angst zu kaschieren, ihre Zukunft könne den Bach runtergehen.
»Hallo, Roxanne«, sagte die Sekretärin freundlich. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Der Dekan hat mich für neun Uhr herbestellt«, antwortete Roxy mit zittriger Stimme. Sie stellte sich darauf ein zu kämpfen, zu weinen oder zu betteln. Wie ein Boxer kurz vor dem Gongschlag spannte sie jeden Muskel an, doch die unbekümmerte Begrüßung der Sekretärin kam ebenso überraschend wie entwaffnend.
»Wirklich? Hab ich auf seinem Terminkalender gar nicht gesehen. Ich frag mal eben nach …«
Sie griff zum Telefon.
»Geht es Ihnen gut, meine Liebe?«, fragte sie plötzlich besorgt. »Sie sehen …« Sie ließ den Satz in der Schwebe. »Brauchen Sie Hilfe?«
Die Frau war es gewohnt, gestresste Erstsemester zu einfühlsamen Therapeuten zu lotsen.
Roxy schüttelte den Kopf, obwohl ihr die ehrliche Antwort anzusehen war.
Die Sekretärin meldete sie über die Gegensprechanlage bei ihrem Chef.
Roxy wartete und trat von einem Fuß auf den anderen.
»Er kommt gleich. Hat heute wirklich viel um die Ohren …«
Roxy fuhr mit dem Kopf herum, als eine Tür aufging und der Dekan ins Vorzimmer trat. Von zarter Statur, mit Brille und Glatze, war er der Typ, der sich von der Highschool an für seine notorischen Bestnoten ein dickes Fell gegen den Spott der Neider zugelegt hatte, einer, der auch bei seinem weiteren akademischen Werdegang immer durch überragende Leistungen glänzte.
»Hallo, Roxy«, sagte er jovial. »Ich stehe heute wirklich unter Strom. Und müssten Sie nicht eigentlich zu Ihrer Pathologievorlesung unterwegs sein? Was ist los?«
Als er ihr verblüfftes Gesicht sah, verstummte er.
Statt einer Erklärung reichte sie ihm nur den Brief und sah zu, wie er ihn las.
»Aber …«, fing er an. »Aber …«
Er hielt inne, las den Brief ein zweites Mal.
»Das ist nicht meine Unterschrift«, sagte er. »Und das kommt nicht von mir.«
Wie vom Schlag gerührt, taumelte Roxy zurück.
Das nächste »Aber …« kam von ihr.
»Ich denke, da ist eine Untersuchung angebracht«, sagte er und hielt den Brief hoch. »Kann ich den behalten?«
Sie nickte.
Der Dekan überlegte.
»Das ist nicht einfach nur ein dummer Streich«, sagte er. »Jemand wollte Ihnen damit ernstlich schaden. Ich weiß nicht, wie derjenige sich in unser System eingehackt hat und wie er an den offiziellen Briefkopf gekommen ist. Und diese Behauptung mit den Krankenakten. Das wäre ein Straftatbestand, dem muss ich nachgehen, dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«
Wer hasst mich? Sie überlegte.
Ein wütender Ex-Freund? Verschmähter Liebhaber? Eine eifersüchtige Kommilitonin? Ein Wichtigtuer?
Ihr fiel niemand ein. »Nein«, sagte sie mit bebender Stimme. Sie hätte Erleichterung verspüren müssen. Es war alles nur ein Schwindel. Sie fragte sich allerdings, warum jemand so etwas tat. Und in dieser Sekunde ahnte sie, dass sie soeben eine wichtige persönliche Lektion gelernt hatte, die auf keinem Studienlehrplan stand: Sie war sehr schutzlos und ausgeliefert.
Gegen sieben Uhr morgens, bevor sein erster Patient eintraf, erhielt Ricky einen unerwarteten Anruf. Auf dem Display seines Telefons stand »Morddezernat Miami«.
Er ging sofort ran.
»Dr. Starks …«
»Doktor, hier spricht Detective Eduardo Gonzalez, Mordkommission Miami …«
»Ja?«
»Mr Alan Simple ist Ihr Patient, richtig?«
»Ja, stimmt.«
»Und Sie haben ihm Medikamente verschrieben?«
»Ja. Aber dazu darf ich Ihnen keine weiteren Auskünfte erteilen. Worum geht’s?«
Ricky holte schon zu einer Belehrung über die ärztliche Schweigepflicht aus, als ihn der Detective unterbrach.
»Er ist tot.«
»Was?«
»Er ist gestern Abend zum Bill Baggs State Park auf Key Biscayne gefahren, ist zu Fuß bis ans Wasser gelaufen und hat sich erschossen.«
»Was?«
»Selbstmord, wie’s aussieht.«
»Aber …«
Es zog ihm die Brust zusammen. Sein Puls raste. Ihm drehte sich alles im Kopf. Als hätte ihn plötzlich eine heimtückische exotische Krankheit befallen. Der Detective fuhr fort:
»Hatte er, ich meine, hatte er so schwere Depressionen? Haben Sie das kommen sehen?«
»Nein, eigentlich nicht, aber nein …«
»Sie haben nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass er sich das Leben nehmen könnte?«
»Nein. Nein. Natürlich nicht. Kein bisschen.«
»In Ordnung«, sagte der Detective in einem Ton, der das Gegenteil andeutete. »Er hat eine Nachricht für Sie hinterlassen.«
»Eine Nachricht?«
Ricky verschlug es die Sprache. Er war bestürzt, ihm wurde flau im Magen. Ihm brach der kalte Schweiß aus. Mit der freien Hand hielt er sich an der Kante seines Schreibtischs fest. Er führte sich seinen Patienten vor Augen: Mitte vierzig, verheiratet, zwei kleine Kinder. Erfolgreicher Geschäftsmann. Von anhaltenden Ängsten geplagt, die von einem Kindheitstrauma herrührten – von einem gewalttätigen Vater, der in seinem Beisein seine Mutter geschlagen hatte, und von der Furcht, seine eigenen plötzlichen, nur mühsam zu beherrschenden Wutausbrüche könnten einmal in dieselbe Richtung führen. Aber er machte echte Fortschritte. Stellte sich seinen Gedanken. Hatte seine Gefühle unter Kontrolle. Zeigte äußerlich keine Anzeichen von Selbsttötungsabsichten, von abgrundtiefer Verzweiflung, von Ausweglosigkeit nach dem Muster: Die Welt ist ohne mich besser dran. Oder auch: Ich kann den Schmerz nicht länger ertragen. Nein, resümierte Ricky: definitiv kein schwerer, sondern ein Routinefall. Interessant, gewiss. Intensive Therapie, aber aussichtsreich.
»Ja«, fuhr der Detective fort. »Er hat sie auf dem Armaturenbrett seines Wagens hinterlegt. Schönes Auto, nebenbei. Nagelneuer Mercedes. Sie können ihn in ein paar Tagen in meinem Büro abholen, wenn Sie wollen. Nicht den Mercedes. Den Zettel.«
Dies in beißend sarkastischem Ton.
Ricky fühlte sich, als wäre er von ebendiesem Auto überfahren worden. Was entgeht mir hier? All die Sitzungen, stundenlanges Reden, seine Notizen und Überlegungen schwirrten ihm durch den Kopf. Er spürte, wie er ins Schleudern geriet. Seine Welt bot ihm nirgends festen Halt.
»Wollen Sie wissen, was da drinsteht, Doktor?«, fragte der Detective.
»Ja«, antwortete Ricky halbherzig.
»Nur eine Zeile: Das hier ist ganz und gar Ihre Schuld, Dr. Starks. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.«
Ricky schnappte nach Luft.
»Und, stimmt das, Doktor?«, hakte der Detective nach. Es war eine rhetorische Frage, auf die er keine ehrliche Antwort erwartete.
KAPITEL ZWEI
Auf seltsame Weise, dachte Ricky, war es, als würde er seiner eigenen Beerdigung beiwohnen – als läge ein Teil von ihm selbst mit in diesem Sarg.
Er saß allein.
Er wusste, dass er nicht willkommen war.
Mehr als einmal drehte sich die Witwe des toten Patienten von ihrem Platz aus zu ihm um und starrte ihn wütend an, wobei sie ihre zwei Kinder an sich zog, als drohe von Ricky auch für sie Gefahr. Und dann ihr Blick, der ihm sagte: Ich habe den Abschiedsbrief gesehen, ich weiß, du bist schuld. Nicht er. Nicht ich. Oder sonst irgendjemand. Du. Vielleicht lag sie ja nicht einmal ganz falsch. Der schlimmste Moment kam, als die zwölfjährige Tochter des toten Patienten aufstand, sich an die versammelte Menge wandte und stockend eine kurze, doch tränenreiche Trauerrede »An meinen Daddy« verlas, mit der sie die verzweifelten Großeltern zum Schluchzen brachte.
Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich Ricky alt. Und müde.
Als er auf den braunen Mahagonisarg starrte, der unter einem silbernen Kelch und einem Kruzifix mit weißen Blumen geschmückt war, wurde ihm klar: Heute bin ich dem Ende ein gutes Stück näher gekommen als dem Anfang.
Bei den folgenden Reden hörte er kaum noch hin. Jede Menge Plattitüden: in der Blüte seiner Jahre und so viel, wofür es sich zu leben lohnte, und Wie sehr Alan gelitten hat, werden wir nie erfahren.
Dieser letzte Satz machte ihm bewusst, dass er es mehr als jeder andere in der Kirche hätte wissen müssen. Er versuchte, den Gedanken mit einer lahmen Entschuldigung zu verbannen: In jedem Fachbereich verlieren Ärzte Patienten. Die OP misslingt. Die Chemotherapie tötet nicht alle Krebszellen ab. Das Beatmungsgerät kommt gegen den Zerfall der Lunge nicht an. Ricky versetzte sich in seine eigene Studienzeit zurück und rief sich Hunderte von Möglichkeiten ins Gedächtnis, wie Patienten sterben können. Fehldiagnosen. Falsche Medikation. Vernachlässigung. Dummheit. Auf dem EKG, dem Blutbild oder dem Ultraschall wurde etwas Entscheidendes übersehen.
Als Psychoanalytiker war er vor solchen Fehlern gefeit, schließlich behandelte er weder Lungenkrebs noch Herzinsuffizienz.
Dafür waren andere Gefahren allgegenwärtig. Der Umgang mit der Psyche und mit Emotionen barg seine eigenen Risiken. Sie lagen in Erinnerungen viel tiefer verborgen als in einem Schatten auf einem Röntgenbild oder einer Farbe auf einem MRT. Unter Medizinstudenten, die sich für die Psychiatrie interessieren, ist eine scherzhafte Redensart geläufig: Es gibt zwei Arten von Psychiatern: diejenigen, bei denen sich schon ein Patient das Leben genommen hat, und diejenigen, bei denen sich kein Patient das Leben genommen hat.Bis jetzt.
Er sah sich in der Kirche um. Das Sonnenlicht fiel durch moderne Buntglasfenster ein – abstrahierte Darstellungen, bei denen man nur raten konnte, welche biblische Szene man vor sich hatte: den heiligen Christophorus, der das Jesuskind über einen reißenden Fluss trägt? Vielleicht. Sehr modern – so wie Miami selbst. Eine Kirche, die sich nicht auf angestaubte Traditionen besann, sondern cool und hip daherkam. Das Farbspiel aus Rot, Blau und Gold, in das der Innenraum getaucht war, täuschte über den langsamen, doch stetigen Anstieg der Hitze draußen, unter einer weiß glühenden Sonne, hinweg. Trauerfeiern waren eine düstere, unheilvolle Angelegenheit und sollten nach Rickys Geschmack an einem trostlosen Novembertag in Neuengland stattfinden, bei schneidend kaltem Wind statt unter sengender Sonne, blauem Himmel und wiegenden Palmen in Südflorida.
Sein anthrazitfarbener Anzug fühlte sich eng an, ihm trat der Schweiß aus allen Poren, und er wischte sich von Zeit zu Zeit mit einem rasch durchnässten Taschentuch die Stirn. Der Schlips schnürte ihn ein wie eine Schlinge um den Hals. Als Letzter betrat der jüngere Bruder des toten Patienten das Podium. Er sah kurz in Rickys Richtung, bevor er den Blick auf das Blatt senkte, das er in den Händen hielt. Der vorgetragene Text war so kurz wie elegant, und als die ersten Worte des Bruders in der Kirche widerhallten, erkannte Ricky, was es war: John Donnes berühmtes Sonett Tod, sei nicht stolz.
Zuletzt ein stilles Gebet, und die Feier war zu Ende.
Als Ricky sich erhob, versammelte sich die Familie auf dem Mittelgang. Beieinander untergehakt, strebten sie mit festem Schritt und aufgewühlter Miene zum Ausgang.
Sein letzter Kirchenbesuch war zehn Jahre her. Zehn lange Jahre. Zehn glückliche Jahre. Ein Jahrzehnt zuvor hatte er bei der Beerdigung von Roxys Vater in Alabama auf einer Kirchenbank gesessen und geglaubt, am Ende doch noch von der Hand jener Familie zu sterben, die ihn für die Umstände verantwortlich machte, welche Jahrzehnte zuvor zum Tod ihrer Mutter geführt hatten, weshalb sie von der Rachsucht gegen ihn besessen war. Der Selbstmord jener Mutter hatte nahezu Rickys gesamtes privates und berufliches Leben beherrscht, und direkt hinter ihm saß, eine halbautomatische Pistole in der Hand, der Profikiller Mr R. – immer noch auf freiem Fuß. Er war der älteste Sohn der Frau, der Ricky tragischerweise und aus Nachlässigkeit die Therapie versagt hatte. »Wir gehen jetzt besser, Ricky, damit du sterben kannst …« Mr R., treu ergebener Bruder von Merlin, dem wohlhabenden Wall-Street-Anwalt, und Virgil, der erfolgreichen Theaterschauspielerin. Selten kamen sie ihm unter ihren Klarnamen in den Sinn, sondern immer nur unter den Pseudonymen, unter denen sie ihn als mörderisches Trio verfolgten. In ihrem Wahn hatten die Geschwister ihre Zeit, ihre Energie und ihre vielfältigen Talente gebündelt, um Rickys Leben ein Ende zu setzen. Er erinnerte sich noch an das Lied, das der Chor gerade sang: »Ein jegliches hat seine Zeit …«, während er selbst sich innerlich auf seine Ermordung einstimmte.
Und ohne jeden Zweifel wäre es so gekommen, wäre da nicht die betagte Mrs Heath gewesen – reiche Witwe aus Miami und einstige Lieblingspatientin, an die er sich gewandt hatte, als er finanzielle Hilfe brauchte. In jener Kirche hatte im entscheidenden Moment allein sie die Gefahr erkannt, in der er schwebte, und war, wie der Erzengel Gabriel mit dem flammenden Schwert, den Gang entlang nach hinten geeilt, hatte ihre Magnum .357 gezückt und Ricky das Leben gerettet, indem sie den Killer erschoss. Zuerst glaubte er, seit Jahren nicht mehr an diesen Augenblick gedacht zu haben, doch dann wurde ihm klar, dass er ihm wahrscheinlich immer gegenwärtig war. Als ihm jetzt jene andere Trauerfeier, bei der ihm derart unverhofft seine ganze Existenz und seine Zukunft zurückgegeben wurden, so lebhaft in Erinnerung kam, hatte er das spontane Bedürfnis, Roxy anzurufen. Sie hatten seit über einer Woche nicht mehr telefoniert. Wahrscheinlich war sie mit dem Studium zu sehr beschäftigt. Und auch Charlie, sagte ihm sein nächster Impuls. Er braucht einen Anruf und einen Termin, nur um sicherzugehen, dass es ihm gut geht und er mit seinen Medikamenten zurechtkommt. Wir sollten uns alle drei zum Essen verabreden, um miteinander zu plaudern, zu lachen und zu entspannen.
Liebend gerne hätte er auch Mrs Heath dabeigehabt, doch ihre Asche trieb seit vier Jahren in der Biscayne Bay. Mit einem Achselzucken und dem tröstlichen Gedanken, dass der Tod zuweilen beim Timing auch richtigliegt, reihte sich Ricky in die Menschentraube ein und ging hinaus in den Sonnenschein.
Draußen, auf den Eingangsstufen der Kirche, bezog die Familie Stellung, um die Beileidsbekundungen entgegenzunehmen.
Ricky ging auf die Witwe zu, um sich bei ihr zu entschuldigen, auch wenn er nicht wusste, was er sagen sollte, um ihr Trost zu spenden.
Doch als er die Hand ausstreckte, wandte sie sich wortlos ab.
Die übrigen erwachsenen Angehörigen taten es ihr gleich, während ihn die Kinder, die ihn umstanden, nur verständnislos beäugten.
Ricky stammelte etwas und verstummte mitten im Satz.
Hier halfen keine Worte.
Was immer er sagte, würde unaufrichtig klingen und als Anbiederung empfunden werden.
Es würde nur noch mehr Wut erzeugen. Mehr Hass.
Kein Verständnis. Keine Versöhnung.
Vielleicht würden Worte etwas ausrichten, nachdem sie etwas Zeit zum Verarbeiten gehabt hatten. Aber nicht jetzt.
Er trat den Rückzug an und kam sich dabei wie ein Feigling vor, doch in Momenten wie diesem war Nachgeben die klügere Wahl. Für die Familie war es die angenehmere Option, ihm die Schuld an der Tragödie zu geben. Die Abschiedsnotiz des toten Patienten ersparte es ihnen, ihr eigenes Gewissen zu befragen. Es war so viel leichter, die ohnmächtige Wut auf einen äußeren Sündenbock zu richten, statt in sich zu gehen. Das brauchte man einem Psychoanalytiker nicht zu sagen.
Die Sonne brannte ihm auf den Schädel, das gleißende Licht blendete ihn, als richte sich auf dunkler Bühne plötzlich ein Scheinwerferkegel auf ihn und er stünde da, ohne seinen Text zu können. Auf dem Weg zu seinem Wagen hielt er sich die Hand über die Augen; der Bürgersteig fühlte sich an, als liefe er über heiße Kohlen. Tief in Gedanken, ging er in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf Suizidgedanken zu finden, noch einmal alle Gespräche durch, die er mit dem toten Patienten geführt hatte, als er hinter sich laut seinen Namen rufen hörte.
»Entschuldigen Sie, Dr. Starks?«
Ein untersetzter Mann mit lateinamerikanischer Erscheinung in einem schlecht sitzenden Anzug kam im Eiltempo hinter ihm hergelaufen.
»Ja?«
»Ich bin Detective Gonzalez. Wir haben telefoniert …«
Ricky schüttelte dem Polizisten die Hand.
»Waren Sie bei der Trauerfeier?«, fragte Ricky.
»Ja.«
Etwas unpassend, wie Ricky fand.
»Und wozu? Fällt das in Ihren Aufgabenbereich, Detective?«
»Nicht wirklich, aber ich hatte darauf spekuliert, Sie dort anzutreffen. Ich war mir nicht sicher, ob Sie den Mut aufbringen, sich dort blicken zu lassen, aber wie ich sehe …«
Ricky nickte. Die Beleidigung, seinen Mut infrage zu stellen, überhörte er geflissentlich. Wenn du wüsstest, dachte er nur.
»Wie auch immer, das hier dürfte Sie interessieren«, fuhr der Detective fort. »Erspart Ihnen den Weg in mein Büro. Und umgekehrt.« Er reichte Ricky ein gefaltetes Blatt Papier.
Der Abschiedsbrief.
»Das hier ist das Original. Wir haben eine Kopie davon in unserer Akte.«
»Danke«, sagte Ricky und fragte sich, wofür.
Er wusste nicht recht, was er damit anfangen sollte. Wegwerfen? Verbrennen? Für immer in irgendeiner Schreibtischschublade vergraben? Oder einrahmen und an die Wand hängen – als Mahnung, niemals zu vergessen, dass bei jedem Patienten auf die kleinste emotionale Regung zu achten und ihr nachzugehen war.
Er wollte gerade zu seinem Wagen zurückkehren, als ihn ein Gedanke anflog, ein düsterer Gedanke an weit zurückliegende Jahre, an seine ersten Begegnungen mit der Familie, die es auf seinen Tod abgesehen hatte.
»Sind Sie hundertprozentig sicher, dass es Suizid war?«
Der Detective zögerte nur eine Sekunde.
»So steht es in unserer Akte.«
Das war kein Ja. Vor fünfzehn Jahren, dachte Ricky, stand genau das auch in meiner Akte, nachdem ich meinen Selbstmord fingiert hatte, um mich vor der mörderischen Familie zu retten.
»Wie meinen Sie das?«, hakte Ricky nach.
»Also: eine einzige Schusswunde. Nicht registrierte Waffe, wahrscheinlich illegal erworben, in dieser Stadt nicht allzu schwer. Den Lauf an den Gaumen gedrückt. Die Waffe neben der Leiche im Sand. Computerausdruck mit der Unterschrift des Verstorbenen auf dem Armaturenbrett seines Wagens. Damit ist eigentlich alles gesagt«, erklärte der Detective. »Alle Kriterien sind erfüllt. Der Fall ist abgeschlossen. Was bleibt, ist eine Witwe, zwei kleine Kinder und eine Handvoll weiterer Angehöriger, ein paar Streitereien darüber, wer welche Geschäftsteile erbt, was wiederum ein paar gierige Anwälte beschäftigt hält, die am Ende das meiste von allem absahnen …«
Bei all den kategorischen Feststellungen hörte Ricky ein Aber heraus.
»Aber irgendetwas daran …«
»Na ja, nennen Sie es einfach den sechsten Sinn eines Cops, Doc. Das war mir alles ein bisschen zu glatt, wissen Sie. Nicht unbedingt inszeniert, aber alles war genau an der Stelle, wo man es erwarten würde – abgelegener Ort, keine Überwachungskameras, Waffe hier, Abschiedszeilen dort. Und meiner Erfahrung nach geht es nie so geordnet zu, nicht einmal bei Suizid. Dinge gehen schief. Andauernd.«
Nach meiner Erfahrung auch, pflichtete Ricky ihm innerlich bei, sagte es aber nicht.
Das betont langsame Achselzucken des Detectives passte nicht zu seinem Redetempo. »Deswegen wollte ich Sie ja ein zweites Mal sprechen«, sagte er. »Wenn nicht noch etwas Unerwartetes ans Licht kommt, wird der Fall abgeschlossen. Ich frage Sie, von Angesicht zu Angesicht: Hat Ihr Patient jemals etwas über Geschäftskonkurrenten oder Partner gesagt, die er bestohlen hat, oder mal erwähnt, dass er wegen irgendwelcher Nebengeschäfte um sein Leben fürchte? Hat er vielleicht Koks verkauft, um über die Runden zu kommen, weil er über seine Verhältnisse lebte? Oder hatte er Feinde, ich meine, ernst zu nehmende Feinde? Hat er vielleicht seine Frau betrogen, und irgendwo lacht sich ein eifersüchtiger Ehemann ins Fäustchen, weil er glaubt, er wäre ungeschoren davongekommen? Keine Ahnung, irgendetwas, Doc, das entgegen allem Anschein auf einen Mord hindeutet?«
Ein bisschen viele Szenarien, mit denen der Ermittler Ricky bombardierte.
»Ich müsste meine Sitzungsnotizen durchgehen …«
Der Detective grinste.
»Haben Sie das nicht direkt nach meinem Anruf getan?«
Hatte er.
»Sie würden sich aber auch so erinnern, wenn er etwas erwähnt hätte, das in eine dieser Richtungen geht, nicht wahr, Doktor?«
Ricky nickte. »Ja. Das wüsste ich auch so.«
»Er hat also nie irgendwelche Ängste geäußert, dass da draußen jemand herumläuft, der ihm nach dem Leben trachtet?«
»Nicht, dass ich wüsste. Auch in meinen Notizen habe ich nichts dergleichen entdeckt.«
»Und Sie würden es mir sagen, wenn es doch so wäre?«
»Ja, selbstverständlich. Die ärztliche Schweigepflicht hat ihre Grenzen.«
»Sicher. Also … Ihnen fällt wirklich nichts ein? Nicht die geringste Kleinigkeit? Etwas, das Ihnen komisch vorkam, etwas, das Sie stutzig gemacht hat? Manchmal genügt schon ein winziges Detail, um uns die Richtung zu weisen.« Der Mann war hartnäckig, das musste man ihm lassen.
»Auch in meinem Beruf genügt oft schon ein kleiner Anstoß, Detective.«
Der Polizist lächelte. »Das glaube ich. Also, gab es da irgendetwas, Doc?«
Ricky ging schweigend im Schnellverfahren seine Erinnerungen noch einmal durch.
»Tut mir leid, aber ich muss passen.« Vielleicht lag es nur an der unbarmherzigen Hitze.
»Ganz sicher?«
»Ja«, antwortete Ricky, obwohl ein diffuser Zweifel blieb.
»Er hat Sie auch nicht noch einmal angerufen, kurz bevor er sich umgebracht hat?«
»Nein.«
Der Detective verzog das Gesicht zu einem ungläubigen, schiefen Grinsen.
»Wir haben sein Handy neben der Waffe im Sand gefunden. Die letzte Nummer auf seiner Anrufliste war Ihre.«
»Diesen Anruf habe ich nie bekommen.«
Der Detective nickte, aber offensichtlich nicht, weil er ihm glaubte. »Vielleicht hat er aufgelegt, bevor Sie rangegangen sind«, sagte er. »Sie waren in der Nacht zu Hause? Hatten Sie Ihr Handy griffbereit?«
»Zu beiden Fragen: ja.«
»Und Sie haben kein Klingeln überhört? So gegen elf Uhr abends?«
»Nein, nicht, dass ich wüsste.«
»Schauen Sie«, sagte der Detective, »genau das meine ich mit Dingen, die nicht ins Bild passen, die mich zum Nachdenken bringen. Solche kleinen Details.«
»Kann ich nachvollziehen«, bestätigte Ricky. »Aber ich habe diesen Anruf nie erhalten.«
»Okay. Also, Doc, wenn Ihnen doch noch etwas einfällt, rufen Sie mich an.« Er reichte Ricky seine Visitenkarte. »Ach ja, da war noch eine Kleinigkeit, die mich gestört hat.«
»Die da wäre?«
»Er hatte eine Schnittwunde am Arm. Ziemlich tief sogar. Und prämortal. Aber es war weit und breit kein Messer zu finden. Vielleicht wollte er sich die Pulsadern aufschneiden, hat es sich dann anders überlegt, das Messer ins Wasser geworfen, sich gesagt: Was soll’s, dann tut’s auch der Revolver. Schönes Teil, nebenbei gesagt.Hat ihn ’ne Stange Geld gekostet. Ist Ihnen das schon mal untergekommen? Dass jemand erst eine Art von Selbstmord versucht, es sich dann anders überlegt und dennoch in derselben Nacht auf andere Art macht?«
»Nein. Das ist ungewöhnlich. Davon habe ich noch nie gehört. Auch nicht in der Fachliteratur gelesen. Ich meine, schon möglich, dass es jemand mit einer bestimmten Methode versucht, irgendwie scheitert und es irgendwann später auf andere, effektivere Weise wiederholt …«
Ricky ertappte sich beim Dozieren.
Der Detective lächelte. Er deutete auf den Abschiedsbrief. »Schon interessant, Doktor, finden Sie nicht? Sie und ich, wir sind beide in der Branche der Schuldzuweisung tätig. Oder vielleicht sollte man besser sagen: in der Ursachenforschung. Sie suchen nach psychologischen Gründen, um für Ihre Klientel einen Ausweg zu finden, richtig? Und ich suche nach den Verursachern physischer Schäden. Von Verbrechen. Jemanden, den ich anklagen kann. Allzu weit liegen wir gar nicht auseinander, denke ich.«
Ricky antwortete nicht, obwohl an dem, was der Ermittler sagte, mehr als ein Körnchen Wahrheit war. Der lauernde Unterton in jedem Wort des Gesetzeshüters entging ihm nicht.
»Haben Sie noch andere Souvenirs zu Hause, so wie den da, Doc?«, erkundigte sich der Detective.
Sosehr Ricky diese Ausdrucksweise hasste, er gab sich Mühe, seine Gefühle zu verbergen. Er sah dem Mann direkt ins Gesicht. »Wenn dem so wäre, würde ich es Ihnen bestimmt nicht sagen.«
»Hätte mich auch gewundert«, entgegnete der Polizist. »Bleiben Sie in Reichweite, Doktor. Ich habe vielleicht noch Fragen. Je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln.« Er schwieg, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, drehte sich um und ging die Straße entlang zurück. Ricky blieb eine Weile reglos stehen. So einen Tag wie diesen möchte ich nicht noch einmal erleben, dachte er.
Ricky starrte auf den Abschiedsbrief, und die Worte aus John Donnes Sonett, die der Bruder des toten Patienten bei der Feier verlesen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn: Tod, sei nicht stolz, obwohl einige dich mächtig und furchtbar nannten, doch bist du nicht so, …
Ricky hatte schon viel vom Tod gesehen, und ihn beschlich das Gefühl, dass jeder einzelne Tod ein Vorbote für weitere war, die in nicht allzu weiter Ferne lauerten. Dieses mulmige Gefühl verfolgte ihn nicht nur bis zu seinem Auto, sondern hielt auch auf der Heimfahrt an, als wäre die erbarmungslose Sonnenglut von Miami in Wirklichkeit der Novemberkälte von Neuengland gewichen.
Als Ricky nach Hause kam, wurde es schon Abend. Kaum tippte er am Tor den Sicherheitscode ein, gab ihm der Anblick des dichten Laubes, das sein Haus von der Straße abschirmte, ein Gefühl von Geborgenheit. Die üppigen Gärten in Miami erinnerten einen stets daran, dass der Dschungel nicht weit war und nur darauf wartete, zurückzuerobern, was einst ihm gehörte.
Er fuhr zu seinem Stellplatz und hielt an. Noch immer gingen ihm tausend Fragen zum plötzlichen Tod seines Patienten durch den Kopf. Was, wenn …
Sein erster Impuls sagte ihm, er sollte noch einmal in sein Sprechzimmer gehen und abermals seine Notizen sichten. Doch eine andere Stimme hielt dagegen: Du weißt, dass da nichts ist.
Auf beide Gedanken folgte ein dritter: Und selbst wenn, was nützt das jetzt noch?
Mit seinen Sitzungsnotizen ging er seit seinem Berufseinstieg überaus sorgsam um. Er hatte ein feines Gespür für Tonfall und Wortwahl seiner Patienten entwickelt und konnte beides aus dem Gedächtnis abrufen. Hatte er seine Protokolle anfangs noch in Notizbüchern festgehalten, so in späteren Jahren, bis auf den heutigen Tag, in Computereinträgen. Da kamen viele Geheimnisse zusammen, mit seinen Kommentaren und Diagnosen.
Er führte sich seinen toten Patienten vor Augen: Hat er sich in irgendeiner Form von seiner Frau und seinen Kindern verabschiedet? Nicht, dass ich wüsste. Das ergibt keinen Sinn. Nicht einmal für einen ernst gemeinten Selbstmord. Er stellte sich vor, wie der Mann zu dem abgelegenen Ort auf Key Biscayne hinausfuhr.
Er hätte mich telefonisch erreichen müssen. Warum hat es bei mir nicht geklingelt?
Ich sollte die Antwort auf diese Frage kennen.
Er hatte eine Frau, die er liebte.
Er hatte Kinder, die sein Ein und Alles waren.
Er hatte einen Beruf, der ihn erfüllte.
Er hatte Geld. Er hatte Anerkennung. Er blickte in eine rosige Zukunft.
Er kam zu mir, weil er nicht jemand werden wollte, den er hasste. Das zeugt von Stärke. Von Einsicht. Er hat sich mit seiner Angst auseinandergesetzt. Er war auf einem guten Weg.
Woher also der Drang, sich umzubringen?
Sieh dir die Notizen noch einmal an, sagte er sich.
Die einzige Erklärung wäre, dass er sich nicht zutraute, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen, und glaubte, früher oder später so zu werden, dass er sich dafür hasste. In diesem Fall wollte er die Menschen, die er liebte, vor sich schützen, indem er aus dem Leben schied.
Ricky erkannte, dass dies eine bequeme Erklärung war, die ihn vom Haken ließ und wahrscheinlich nicht sehr nahe an die Wahrheit herankam.
Er schaltete den Motor aus und sah auf.
Die Angst durchzuckte ihn so heftig, dass ihm die Luft wegblieb.
Seine Haustür stand weit offen.
Seine Alarmanlage müsste schrillen, blieb aber stumm. Die Sicherheitsfirma, die sie überwachte, hätte ihn anrufen oder ihm eine SMS schicken müssen. Hatte sie aber nicht. Er überlegte, ob er in der Eile, zur Beerdigung zu kommen, einfach vergessen hatte, die Tür hinter sich zuzuziehen. Das Älterwerden ging mit Vergesslichkeit einher.
Unmöglich.
Nicht in Miami.
Verriegeln, Alarmanlage einschalten. Das war ihm so wie jedem hier ins Muskelgedächtnis übergegangen.
Sein erster Impuls war, den Motor anzuwerfen und wegzufahren. Von einem sicheren Ort aus die Polizei zu rufen. Auf die Ankunft eines Streifenwagens zu warten, zwei stämmigen, gut bewaffneten Polizisten in sein Haus zu folgen und auf der Suche nach Einbrechern alle Zimmer abzuschreiten.
Das wäre eine kluge Vorgehensweise, sagte er sich, tat jedoch nichts dergleichen.
Stattdessen stieg Ricky aus und begab sich langsam zur Haustür.
Er spähte in die dunkle Eingangsdiele.
In jedem Winkel glaubte er, eine Gestalt auszumachen.
Er tastete nach dem Schalter und machte Licht.
Die Helligkeit vertrieb die Gespenster. Er sah sich alles genau an, um festzustellen, ob etwas gestohlen worden war. Er bewahrte kein Bargeld im Haus auf, und er besaß keine Waffe mehr, für die sich ein Einbrecher interessieren könnte. Vielleicht, überlegte er, wusste irgendein Junkie, dass er Arzt war, und hoffte, irgendwo im Haus Medikamentenproben zu finden. Die gab es bei ihm aber nicht zu holen. Egal was, die Ausbeute konnte den Dieb nur enttäuschen.
Trotzdem horchte er angestrengt. Schritte? Nein. Atemgeräusche? Nein. Das leise Klicken beim Entsichern einer Pistole oder beim Drehen einer Revolvertrommel? Nein. Er wollte sich davon überzeugen, dass er allein war, auch wenn ihm sein Gefühl etwas anderes sagte.
Wieder redete er sich gut zu, die Polizei zu rufen.
Wieder tat er es nicht.
Er ging von Zimmer zu Zimmer.
Küche. Niemand da.
Wohnzimmer. Niemand da.
Schlafräume. Niemand da. Schranktüren geschlossen.
Esszimmer, Wintergarten. So wie er sie an diesem Tag verlassen hatte. Niemand da.
Sein Sprechzimmer, das Refugium, in dem er seine psychoanalytische Privatpraxis betrieb, hob er sich bis zum Schluss auf. Für seine Patienten war es, als einziger Raum im Haus, nüchtern gehalten und verriet lediglich durch gerahmte Diplome und Ehrungen sowie das ikonische Porträtfoto des weißhaarigen Sigmund Freud mit Zigarre an der Wand sowie ein Bücherregal mit medizinischer Fachliteratur seinen Zweck.
Er stellte sich darauf ein, hier Chaos vorzufinden, aufgerissene Schreibtischschubladen, verstreute Papiere, umgeworfene Regale, einen Haufen Bücher auf dem Boden – das Werk eines Einbrechers, der sich auf der Suche nach Wertgegenständen, die er verkaufen konnte, um seinen Drogenbedarf zu decken, um seinen Lohn betrogen sah.
Doch so kam es nicht.
Der Raum war – allem Anschein nach – unberührt. Genauso, wie er ihn bei seinem Aufbruch zur Trauerfeier hinterlassen hatte.
Sein Blick wanderte von der nur selten benutzten Couch des Psychoanalytikers zu den beiden einander gegenüberstehenden Sesseln, auf denen die meisten seiner Therapiegespräche stattfanden, ein, zwei, drei Mal pro Woche – je nach Schwere des Leidens. Die klassischen Freudschen fünf Tage auf der Couch, die fünfzigminütige Stunde, galten als antiquiert und waren selten geworden – für Selbstzahler zu teuer, für Versicherungen ein ungerechtfertigter Aufwand und für die Ungeduldigen ein zu hoher Zeitaufwand. Ein Jahrzehnt zuvor, als Vertreter der alten Schule, hatte sich Ricky bereits als Dinosaurier gesehen, der in einer Jetset-Welt vor sich hin trottete, doch wenn er jetzt in den Himmel blickte und den Kondensstreifen hinterhersah, fand er die Vorstellung verlockend, sogar noch älter und antiquierter zu sein, weil er nicht sicher war, ob ihm gefiel, was er vom Stil der neuen Schule mitbekommen hatte. Ein nostalgischer Dinosaurier, dachte er und starrte in das leere Zimmer. Er sah sich und seinen toten Patienten einander gegenübersitzen. Gerade mal eine Woche war das her. Er hatte noch ihr Gespräch im Ohr. Eine Routinesitzung. Es ging bergauf und beinahe heiter zu. Wo war da der Tod?
Immer noch darauf gefasst, etwas verändert vorzufinden, begab er sich langsam zu seinem Schreibtisch und sondierte jedes Detail, doch selbst der Stifthalter in der Ecke schien unberührt.
Ricky entspannte sich. Es war beruhigend, alles an Ort und Stelle vorzufinden. Er versuchte, sich in einen Einbrecher hineinzuversetzen, der sich die Mühe gemacht hatte, die Überwachungsanlage auszumanövrieren, ins Haus zu gelangen, und dann nichts Verwertbares in die Finger bekam. Fast hätte er über den Pechvogel lachen können. Er hatte den falschen Arzt aufgesucht. Mit einem orthopädischen Chirurgen und seinem Musterkoffer an Opioiden gegen Schmerzen oder einem Onkologen und einer ganzen Schublade voller Fentanyl wäre er besser beraten gewesen.
Glücklich gab er seine Suche auf und dankte dem Himmel dafür, dass er so glimpflich davongekommen war, als er etwas sah, das nicht so war, wie es sein sollte. Ihm blieb fast das Herz stehen.
Seine Computertastatur glänzte.
Rotbraun auf hellen Tasten.
Ein Sprühnebel aus Blut.
Mit Bedacht genau dort hinterlassen.
Er streckte die Hand danach aus, berührte die Tröpfchen und betrachtete das Rot an seiner Fingerkuppe.
Unverkennbar.
Sein Blick wanderte zu seinem Schreibtischstuhl.
Er versuchte, sich vorzustellen, wer dort gesessen hatte, doch die Gestalt blieb schattenhaft. Dieser Schatten hatte alle anderen Räume unberührt gelassen und das Blut auf die Tastatur gespritzt. Eine Einladung, sich zu setzen und den Platz des Schattens einzunehmen. Er war gegangen, ohne die Tür hinter sich zu schließen.
Ricky zog sein klammes Taschentuch aus der Anzugtasche und wischte die Tastatur notdürftig ab.
Er wusste nicht, wessen Blut es war, und ebenso wenig, was die Spritzer dort sollten.
Lange blickte er auf den dunklen Computerbildschirm, bevor er, unter einer Woge der Angst, nach seiner Maus griff und doppelklickte.
Er rechnete mit dem vertrauten Bildschirmschoner: ein Erinnerungsfoto von seiner verstorbenen Frau und ihm vor dem Ferienhaus auf Cape Cod, Arm in Arm, die Sonne im Gesicht, eine Brise im Haar, beide in jungen Jahren, als ihnen die Welt noch zu Füßen lag – ein Bild, das ihn mit Wehmut erfüllte, aus einer Zeit, bevor der Krebs ihrer beider Leben veränderte. Und lange bevor Mr R. und seine mörderischen Geschwister in sein Leben traten und ihm erneut eine Wendung gaben, die er sich nie hätte vorstellen können. Bevor sie unter dem Einfluss des Sadisten, den Ricky lange für seinen Freund und Mentor gehalten hatte, seine Existenz ruinierten. Als er sich gezwungen sah, sein Haus auf Cape Cod niederzubrennen, um den eigenen Tod vorzutäuschen. Lange bevor ihm in einer Kirche um ein Haar sein zweites Leben genommen und dann von einer Sekunde zur anderen wiedergegeben wurde – nicht durch himmlische Fügung, sondern durch einen gezielten Schuss.
Er wippte auf seinem Stuhl zurück.
Statt des Fotos aus glücklicheren Tagen erschien etwas anderes auf seinem Display.
Ein neuer Bildschirmschoner mit der Aufnahme einer Leiche.
Er brauchte eine Sekunde, bis er mit einem eisigen Schauder erkannte, wer es war:
Sein Patient. Alan Simple.
Hingestreckt im Sand.
Die Beine unnatürlich abgewinkelt, fast verdreht, die Arme seitlich ausgebreitet.
Es war eine Mischung aus einem abstrakten Helmut-Newton-Noir-Foto und einer klassischen Tatortdokumentation.
Unter Schock brach es aus ihm heraus: »Sie haben ihn umgebracht!«
In Rickys Vorstellung stand der Begriff Mord für drei Menschen – und einer davon war tot. Seit zehn Jahren tot.
Doch bevor er auf dem schmalen Grat zwischen Suizid/offiziell und Mord/inoffiziell einen einzigen klaren Gedanken fassen konnte, zog es ihn mit Macht in das Foto hinein, so wie ein Schaulustiger dem Sog des Grauens in der Nähe eines tödlichen Autounfalls nichts entgegenzusetzen hat.
Das Bild war in der Dunkelheit vom Meeressaum aus aufgenommen, was wohl das leichte Glitzern unter dem Blitzlicht erklärte. Da die Leiche mit den Füßen zum Wasser lag, war vom Gesicht des Mannes wie auch von der Austrittswunde am Schädel kaum etwas zu sehen. Ein großer dunkler Fleck breitete sich im hellen Sand unter seinem Kopf aus. Die Waffe lag – genau wie es der Detective beschrieben hatte – neben der Hand des Toten. Der schicke Mercedes, dessen Frontscheinwerfer auf die Szene gerichtet waren, bildete den fernen Hintergrund.
Ricky war wie hypnotisiert.
Offensichtlich war das Foto Sekunden nach dem Tod entstanden, das Blut war noch nicht im Sand versickert. So viel zum Wann. Für das Warum brauchte er länger. Auch für die Frage, wie es auf seinen Computer gelangt war. In seinem Kopf herrschte Aufruhr, sein Atem wurde kurz und flach.
In der Mitte des Bildschirms, direkt über dem Kopf des Toten, befand sich das gewohnte Fenster für die Passworteingabe.
Zitternd tippte er es ein. Miamishrink1.
Das Kästchen und die Punkte wackelten. Eingabefehler.
»Verdammt«, murmelte er.
Beim zweiten Versuch konzentrierte er sich und achtete darauf, sich bei Groß- und Kleinschreibung nicht zu vertippen.
Zweiter Fehlversuch.
Das konnte nicht sein. Er hatte sein Passwort seit Jahren nicht geändert.
»Warum funktionierst du nicht?«, fragte er den Computer. Das Gerät blieb ihm die Antwort schuldig.
Er versuchte es mit einem viel älteren Passwort: Freudfollower!
Kein Glück. Noch mehr Rütteln.
Er kramte in seinem Gedächtnis und probierte ein paar Kombinationen aus. Er versuchte es mit seinem Geburtstag. Mit seinem Hochzeitstag. Mit dem Namen seines ersten Hundes aus der Kindheit. Er versuchte es mit dem Mädchennamen seiner längst verstorbenen Mutter. Widerwillig ging er ein paar Varianten mit dem Namen seiner Frau durch, in seiner Verzweiflung sogar mit ihrem Todestag.
Nichts funktionierte.
Er griff in seine Schreibtischschublade und suchte nach einem billigen Notizbuch. Neben Telefonnummern, Adressen und anderen Angaben zu Patienten und Kollegen enthielt es die Passwörter zu seinen Bankkonten, Kreditkarten, Zeitungsabonnements, Kabelfernsehen, Streaming-Diensten und allen anderen digitalen Komponenten, die ein Passwort erforderten. In einer Welt, in der Sicherheit an erster Stelle stehen sollte, war Rickys digitales Leben in einem alten, in Kunstleder gebundenen Notizbuch aufbewahrt.
Es war weg.
Von Frustration und Angst erschöpft, lehnte er sich zurück. Er versuchte, sich der ungeheuerlichen Wahrheit zu stellen. Jemand hat sich in meinen Computer eingehackt.Jemand hat Änderungendaran vorgenommen. Jemand hat diesen neuen Bildschirmschoner hochgeladen. Doch, ich wurde bestohlen.
Vom Schock über die Verletzung seiner Privatsphäre kribbelten ihm die Fingerspitzen. Er murmelte ein paar Obszönitäten.
Kopfschüttelnd tippte Ricky Zimmerman in das Passwortfeld.