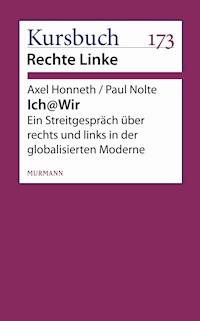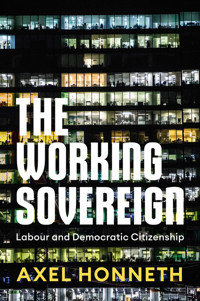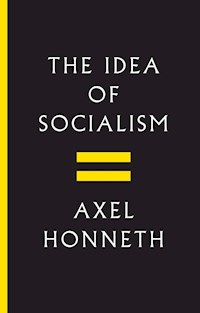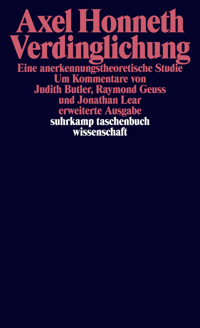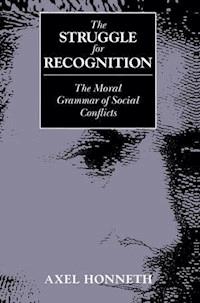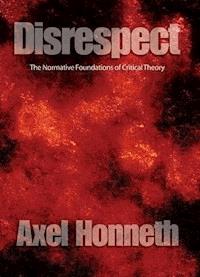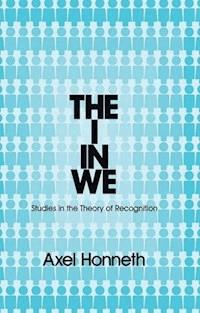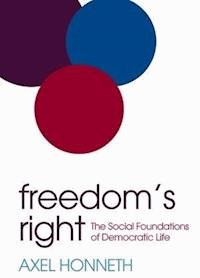25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Theorie der Gerechtigkeit gehört zu den am intensivsten bestellten Feldern der zeitgenössischen Philosophie. Allerdings haben die meisten Gerechtigkeitstheorien ihr hohes Begründungsniveau nur um den Preis eines schweren Defizits erreicht, denn mit ihrer Fixierung auf rein normative, abstrakte Prinzipien geraten sie in beträchtliche Distanz zu jener Sphäre, die ihr »Anwendungsbereich« ist: der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Axel Honneth schlägt einen anderen Weg ein und gewinnt die heute maßgeblichen Kriterien sozialer Gerechtigkeit direkt aus jenen normativen Ansprüchen, die sich innerhalb der westlichen, liberaldemokratischen Gesellschaften herausgebildet haben. Zusammen machen sie das aus, was er »demokratische Sittlichkeit« nennt: ein System nicht nur rechtlich verankerter, sondern auch institutionell eingespielter Handlungsnormen, die moralische Legitimität besitzen. Zur Begründung dieses weitreichenden Unterfangens weist Honneth zunächst nach, daß alle wesentlichen Handlungssphären westlicher Gesellschaften ein Merkmal teilen: Sie haben den Anspruch, einen jeweils besonderen Aspekt von individueller Freiheit zu verwirklichen. Im Geiste von Hegels Rechtsphilosophie und unter anerkennungstheoretischen Vorzeichen zeigt das zentrale Kapitel, wie in konkreten gesellschaftlichen Bereichen – in persönlichen Beziehungen, im marktvermittelten Wirtschaftshandeln und in der politischen Öffentlichkeit – die Prinzipien individueller Freiheit generiert werden, die die Richtschnur für Gerechtigkeit bilden. Das Ziel des Buches ist ein höchst anspruchsvolles: die Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse neu zu begründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Recht der Freiheit ist der Versuch, eine andere Theorie der Gerechtigkeit zu schreiben: eine, die nicht auf abstrakte normative Prinzipien fixiert ist, sondern die heute maßgeblichen Kriterien sozialer Gerechtigkeit direkt aus jenen normativen Ansprüchen gewinnt, die sich innerhalb der westlichen, liberaldemokratischen Gesellschaften herausgebildet haben. Zusammen machen sie das aus, was Axel Honneth »demokratische Sittlichkeit« nennt. Im Geiste von Hegels Rechtsphilosophie und unter anerkennungstheoretischen Vorzeichen zeigt er, wie in konkreten gesellschaftlichen Bereichen die Prinzipien individueller Freiheit generiert werden, die die Richtschnur für Gerechtigkeit bilden. Das Ziel des Buches ist ein höchst anspruchsvolles: die Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse neu zu begründen.
Axel Honneth ist Professor für Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main sowie geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Sozialforschung. Zuletzt erschienen im Suhrkamp Verlag: Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie (stw 1959), Pathologien der Vernunft. Zur Geschichte und Gegenwart der Kritischen Theorie (stw 1835) und Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie (2005).
Axel Honneth
Das Recht der Freiheit
Grundriß einerdemokratischen Sittlichkeit
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-74680-6
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Vorwort
Einleitung: Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse
A. Historische Vergegenwärtigung: Das Recht der Freiheit
I. Die negative Freiheit und ihre Vertragskonstruktion
II. Die reflexive Freiheit und ihre Gerechtigkeitskonzeption
III. Die soziale Freiheit und ihre Sittlichkeitslehre
Übergang: Die Idee der demokratischen Sittlichkeit
B. Die Möglichkeit der Freiheit
I. Rechtliche Freiheit
1. Daseinsgrund der rechtlichen Freiheit
2. Grenzen der rechtlichen Freiheit
3. Pathologien der rechtlichen Freiheit
II. Moralische Freiheit
1. Daseinsgrund der moralischen Freiheit
2. Grenzen der moralischen Freiheit
3. Pathologien der moralischen Freiheit
6C. Die Wirklichkeit der Freiheit
III. Soziale Freiheit
1. Das »Wir« persönlicher Beziehungen
(a) Freundschaft
(b) Intimbeziehungen
(c) Familien
2. Das »Wir« des marktwirtschaftlichen Handelns
(a) Markt und Moral. Eine notwendige Vorklärung
(b) Konsumsphäre
(c) Arbeitsmarkt
3. Das »Wir« der demokratischen Willensbildung
(a) Demokratische Öffentlichkeit
(b) Demokratischer Rechtsstaat
(c) Politische Kultur – ein Ausblick
Sachregister
7Für Christine Pries-Honneth
in Dankbarkeit für zwanzig Jahre
der Liebe, Freundschaft und
Auseinandersetzung
9Vorwort
Die Arbeit an dem vorliegenden Buch hat nahezu fünf Jahre in Anspruch genommen; und an keinem der Tage, an denen ich mit dem Schreiben beschäftigt war, hatte ich am Ende nicht das Gefühl, künftig noch viel mehr an Argumenten und empirischen Belegen über das hinaus beisteuern zu müssen, was ich zu Papier gebracht hatte. Dieser Eindruck des trotz aller Anstrengung noch Unfertigen ist bis heute nicht verflogen, ohne daß ich wüßte, wie ich dem allein hätte beikommen sollen. Wahrscheinlich hängt der verspürte Mangel mit dem recht maßlosen Anspruch zusammen, den ich mir mit meinem Vorhaben von Anfang an gestellt hatte. Ich wollte dem Vorbild der Hegelschen »Rechtsphilosophie« in der Idee folgen, die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit direkt in Form einer Gesellschaftsanalyse zu entwickeln; wie ich mir einige Jahre zuvor an seiner Schrift klargemacht hatte,[1] konnte das nur gelingen, wenn die konstitutiven Sphären unserer Gesellschaft als institutionelle Verkörperungen bestimmter Werte begriffen werden, deren immanenter Anspruch auf Verwirklichung als Hinweis auf die jeweils sphärenspezifischen Gerechtigkeitsprinzipien dienen kann. Ein solches Vorgehen verlangt freilich, sich zunächst einmal Klarheit über die Werte zu verschaffen, die in den verschiedenen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens verkörpert sein sollen.
Meine »Einleitung« versucht darzulegen, auch hierin wieder Hegel folgend, daß diese Werte in den modernen liberaldemokratischen Gesellschaften auf einen einzigen zusammengeschmolzen sind, und zwar auf den der individuellen Freiheit in der Vielzahl der uns vertrauten Bedeutungen. Jede 10konstitutive Sphäre unserer Gesellschaft verkörpert mithin institutionell, so lautet die Ausgangsprämisse meiner Studie, einen bestimmten Aspekt unserer Erfahrung von individueller Freiheit. Die eine, moderne Idee der Gerechtigkeit splittert sich dann in ebenso viele Gesichtspunkte auf, wie es solche institutionalisierten Sphären eines legitimationswirksamen Freiheitsversprechens in unseren zeitgenössischen Gesellschaften gibt; denn in jedem dieser Handlungssysteme bedeutet es etwas anderes, sich untereinander »gerecht« zu verhalten, weil zur Realisierung der versprochenen Freiheit jeweils besondere soziale Voraussetzungen und wechselseitige Rücksichtnahmen erforderlich sind. Von dieser Grundidee aus bedurfte es nun im eigentlich zentralen und umfangreichsten Schritt der Analyse einer, wie ich es nennen werde, »normativen Rekonstruktion«, um im typisierenden Nachvollzug der historischen Entwicklung der einzelnen Sphären zu prüfen, bis zu welchem Grade die hier jeweils institutionalisierten Freiheitsverständnisse inzwischen bereits zur sozialen Verwirklichung gelangt sind.
An dieser Stelle meiner Untersuchung, genauer gesagt also dort, wo ich mit dem Versuch einer normativen Rekonstruktion beginne, setzten dann die Schwierigkeiten ein, die mit dem erwähnten Gefühl des unvermeidlich Unvollständigen einhergingen. Unterschätzt hatte ich nämlich die Tatsache, daß Hegel gewissermaßen ganz am Anfang der Herausbildung der ausdifferenzierten modernen Gesellschaften stand, so daß er die den jeweiligen Sphären zugrundeliegenden Legitimationsprinzipien ziemlich unbekümmert um deren zukünftige Folgen und nur im Rückgriff auf einige wenige Einzelwissenschaften bestimmen konnte; ich dagegen befand mich inmitten eines schon zweihundert Jahre andauernden Prozesses der konflikthaften und gewiß nicht geradlinigen Verwirklichung dieser Prinzipien, den ich nun normativ rekonstruieren mußte, um an den Punkt unserer Gegenwart zu gelangen, von dem aus ich die Chancen, Gefährdungen und Pathologien 11unserer sphärenspezifischen Freiheiten ermessen konnte. Von der Disziplin einer strengen Geschichtswissenschaft unterscheidet sich diese stärker soziologisch-typisierende Vorgehensweise zwar durch einen größeren Spielraum gegenüber dem historischen Material; aber ich war gleichwohl mit der Aufgabe konfrontiert, aus verschiedenen Wissensgebieten immerhin so viel an Befunden und Belegen beizubringen, daß die von mir behauptete Entwicklungsrichtung und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen auch den weniger normativ gesinnten Leserinnen und Lesern plausibel erscheinen würden. Hier bleibt, wie ich im Rückblick sagen muß, noch vieles zu tun, weil alle vermuteten Entwicklungsverläufe mit weiteren Differenzierungen von nationalen Sonderwegen versehen werden müßten und auch die Gegenwartsdiagnose sicherlich der Vertiefung bedürfte. Trotzdem hoffe ich, daß in der Summe der Analysen der verschiedenen Freiheitssphären als Ergebnis meiner Studie zutage tritt: Wir werden uns über die zukünftigen Erfordernisse sozialer Gerechtigkeit heute nur dann ein klares Bewußtsein verschaffen können, wenn wir uns in einer gemeinsamen Rückerinnerung an die auf dem normativen Boden der Moderne ausgetragenen Kämpfe der Ansprüche versichern, die im historischen Prozeß des sozialen Einklagens institutionalisierter Freiheitsversprechen noch nicht abgegolten sind.
Ohne die bereitwillige Hilfe einer Reihe von Personen und ohne die großzügige Unterstützung durch verschiedene Institutionen hätte ich das vorliegende Buch nicht schreiben können. Da die deutsche Universität, ein bekanntes Lamento, wenig Zeit für die Forschungsarbeit läßt, war ich auf gelegentliche Freisetzungen von der normalen Semesterroutine angewiesen. Den Anfang machte ein Forschungsfreisemester, das mir im Rahmen eines von der VW-Stiftung großzügig geförderten und am Institut für Sozialforschung durchgeführten interdisziplinären Forschungsprojekts zum Thema »Der 12Strukturwandel der Anerkennung im 21. Jahrhundert« gewährt wurde; erheblich profitiert habe ich anschließend von jeweils einmonatigen Gastaufenthalten an der Université Sorbonne, Paris 1, und an der École Normale Supérieure in Paris, wo ich dank der freundlichen und zurückhaltenden Atmosphäre in relativ kurzer Zeit meine Überlegungen weit vorantreiben konnte; und hilfreich war mir jetzt zum Abschluß der Studie ein weiteres Forschungsfreisemester, das ich dem Exzellenzcluster »Die Herausbildung normativer Ordnungen« an der Frankfurter Goethe-Universität verdanke. Mehr noch als von solchen Freisetzungen habe ich aber wahrscheinlich von den Workshops profitieren können, in denen ich Teile meiner Arbeit über mehrere Tage hinweg einer von Kollegen und Studierenden vorbereiteten Diskussion aussetzen konnte; als besonders fruchtbar habe ich das von Christoph Menke und Juliane Rebentisch ausgerichtete Seminar am Institut für Philosophie der Universität Potsdam und den vom Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover veranstalteten Meisterkurs in Goslar in Erinnerung; sehr ergiebig war auch das Kolloquium, das das Institut für Philosophie der Universität Marburg im Anschluß an meine Christian-Wolff-Vorlesung veranstaltet hat. Allen Personen, die an der Vorbereitung und Durchführung sei es der Gastaufenthalte oder der Workshops beteiligt waren, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Mehr noch gilt das natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, die mir mit kritischen Einwänden, Literaturhinweisen und theoretischen Ratschlägen zur Seite gesprungen sind. Allen voran habe ich Titus Stahl zu nennen, wissenschaftlicher Assistent am Institut für Philosophie der Goethe-Universität, der mich mit seiner analytischen Intelligenz und Hartnäckigkeit über zwei Jahre hinweg unter einen äußerst lehrreichen Druck gesetzt hat; nicht alles, was er an Differenzierungen eingeklagt hat, habe ich am Ende umsetzen können. Darüber hinaus ist mir die Mithilfe folgender Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten besonders wichtig gewesen: Martin Dornes, Andreas 13Eckl, Lisa Herzog, Rahel Jaeggi, Christoph Menke, Fred Neuhouser und, bei vielen Gesprächen über literarische Quellen, Barbara Determann und Gottfried Kößler. Mit dem Arbeitsumfeld, in dem ich dieses Buch habe schreiben können, habe ich außerordentliches Glück gehabt: Frauke Köhler hat ohne viel Aufsehen ihr Bestes gegeben, um meine Handschrift zu entziffern, den Überblick über die verschiedenen Teile zu bewahren und das alles in eine korrekte Form zu bringen. Stephan Altemeier ist mir bei der Besorgung wichtiger Literatur äußerst behilflich gewesen und hat überdies gemeinsam mit Nora Sieverding das Sachregister erstellt – allen dreien danke ich für die gute Kooperation. Eva Gilmer danke ich für Jahre der intensivsten und beglückenden Zusammenarbeit; in ihr habe ich eine Lektorin gefunden, von der ich dachte, es gäbe sie nur noch in den Briefwechseln oder Autobiographien älterer Autoren – sie hat das Manuskript Zeile für Zeile gelesen, mir viele Vorschläge zur Verbesserung gemacht und mich schließlich zum rechten Zeitpunkt zur Abgabe gedrängt. Den Dank an meine Frau, die mit mir viele Stunden diskutiert und sich in das Manuskript vertieft hat, kann ich nicht genügend in Worten abstatten – ihr ist das Buch gewidmet.
Axel Honneth, im April 2011
14 Einleitung: Gerechtigkeitstheorieals Gesellschaftsanalyse
Eine der größten Beschränkungen, unter denen die politische Philosophie der Gegenwart leidet, ist ihre Abkoppelung von der Gesellschaftsanalyse und damit die Fixierung auf rein normative Prinzipien. Nicht, daß es nicht Aufgabe einer Theorie der Gerechtigkeit wäre, normative Regeln zu formulieren, an denen sich die moralische Legitimität der gesellschaftlichen Ordnung bemessen ließe; aber diese Prinzipien werden heute zumeist in Isolation von der Sittlichkeit gegebener Praktiken und Institutionen entworfen, um dann erst sekundär auf die gesellschaftliche Realität »angewendet« zu werden. Die darin zum Ausdruck kommende Entgegensetzung von Sein und Sollen oder, anders gesprochen, die philosophische Herabsetzung der moralischen Faktizität ist Resultat einer weit zurückreichenden Theorieentwicklung, die nicht unerheblich mit dem Schicksal der Hegelschen »Rechtsphilosophie« verknüpft ist. Nach dem Tod des Philosophen war seine Absicht, aus den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit die vernünftigen, nämlich freiheitsverbürgenden Institutionen normativ zu rekonstruieren, auf der einen Seite nur im Sinne einer konservativen Restaurationslehre und auf der anderen Seite allein im Sinne einer Revolutionstheorie verstanden worden; diese Aufspaltung in eine Hegelsche Rechte und eine Hegelsche Linke[1] ermöglichte es späteren Generationen, nachdem beinah alle revolutionären Ideale verschlissen waren, die politische Philosophie Hegels im ganzen dem Konservatismus zuzuschlagen. Überlebt hat daher im öffentlichen Bewußtsein 15von der Hegelschen Idee, die Gerechtigkeitstheorie auf ganz neue, gesellschaftstheoretische Füße zu stellen, nur die recht primitive Vorstellung, den gegebenen Institutionen die Aura moralischer Legitimität zu verleihen. Damit aber war der Siegeszug einer letztlich an Kant (oder, angelsächsisch, an Locke) orientierten Theorie der Gerechtigkeit nahezu besiegelt: Die normativen Prinzipien, an denen sich die moralische Legitimität der sozialen Ordnung bemessen sollte, durften nicht aus dem existierenden Institutionengefüge heraus, sondern nur von ihm unabhängig, freistehend, entwickelt werden – und an dieser Lage hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert.
Gewiß, gegen die Vormachtstellung des Kantianismus auf dem Feld der Gerechtigkeitstheorie hat es stets Einsprüche und Gegenentwürfe gegeben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in der politischen Philosophie des britischen Neohegelianismus, die in Deutschland aus politisch-kulturellen Gründen nie Anklang gefunden hat, der Versuch einer Wiederbelebung Hegelscher Motive für die Zwecke einer Theorie der Gerechtigkeit unternommen worden;[2] und aus der jüngsten Vergangenheit lassen sich immerhin die Arbeiten von Michael Walzer, David Miller und Alasdair MacIntyre anführen, um zu belegen, daß der Impuls zur Überwindung rein normativer Gerechtigkeitstheorien und damit Anstrengungen zur Wiederannäherung an die Gesellschaftsanalyse nie wirklich erlahmt sind.[3] Aber gerade diese 16Unternehmungen machen auch deutlich, wie weit wir uns heute vom Vorbild der Hegelschen »Rechtsphilosophie« doch tatsächlich entfernt haben; was gegenwärtig betrieben wird, um die Mängel einer kantianischen, institutionenvergessenen Gerechtigkeitstheorie zu überwinden, besteht fast immer in der hermeneutischen Rückanpassung der normativen Prinzipien an existierende Institutionengefüge oder herrschende Moralüberzeugungen, ohne daß dabei der zusätzliche Schritt unternommen würde, deren Gehalt selbst als vernünftig oder gerechtfertigt auszuweisen. Machtlos und ohne Biß stehen solche Versuche daher heute aufgrund ihrer Tendenz zur Akkommodation den offiziellen Theorien gegenüber, die zwar nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit, so aber doch die moralische Vernunft auf ihrer Seite haben. Hegel hingegen wollte in seiner »Rechtsphilosophie«[4] beides zu einer Einheit zusammenbringen: die institutionelle Realität seiner Zeit als in entscheidenden Zügen bereits vernünftig darlegen und umgekehrt die moralische Vernunft als in den modernen Kerninstitutionen schon verwirklicht nachweisen; der Begriff des Rechts, den er dabei verwendete, sollte all das an der gesellschaftlichen Wirklichkeit namhaft machen, was dadurch moralischen Bestand und Legitimität besitzt, daß es der allgemeinen Ermöglichung und Verwirklichung der individuellen Freiheit dient.[5]
Wenn ich an diesen Hegelschen Entwurf heute, nach zweihundert Jahren, noch einmal anknüpfe, so natürlich in dem Bewußtsein, daß sich nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern auch die philosophischen Argumentationsbedingungen 17erheblich gewandelt haben. Eine bloße Wiederbelebung von Absicht und Gedankengang der »Rechtsphilosophie« ist inzwischen zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden. Auf der einen Seite ist die soziale Realität, von der heute gezeigt werden müßte, welche ihrer Institutionen und Praktiken den Status moralischer Faktizität besitzen, eine vollkommen andere als die der frühindustriellen, konstitutionell-monarchistischen Gesellschaft des beginnenden 19. Jahrhunderts; alle institutionellen Verhältnisse, auf deren normative Stabilität Hegel noch wie selbstverständlich vertrauen konnte, haben im Zuge einer sich beschleunigenden, »reflexiv« genannten Modernisierung ihre ursprüngliche Gestalt verloren und sind zum großen Teil durch neue, ungleich verhaltensoffenere Gebilde und Organisationen ersetzt worden. Zudem hat die Erfahrung eines »Zivilisationsbruchs«, nämlich die Vergegenwärtigung der Möglichkeit des Holocausts inmitten zivilisierter Gesellschaften, jenen Hoffnungen einen entscheidenden Dämpfer versetzt, die Hegel noch in die kontinuierliche, vernünftig eingehegte Fortentwicklung moderner Gesellschaften setzen konnte. Auf der anderen Seite haben sich aber auch die theoretischen Prämissen der philosophischen Diskussion, die Rahmenbedingungen des letztlich Denkmöglichen, gegenüber den Zeiten Hegels erheblich verschoben: Die Voraussetzung eines idealistischen Monismus, in den er seinen dialektischen Begriff des Geistes verankert hat,[6] ist für uns, die Kinder eines materialistisch aufgeklärten Zeitalters, nicht mehr recht vorstellbar, so daß auch für seine Idee eines objektiven, in den sozialen Institutionen verwirklichten Geistes eine andere Grundlage gesucht werden muß.
Gleichwohl scheint es mir sinnvoll, die Hegelsche Absicht noch einmal aufzugreifen, eine Theorie der Gerechtigkeit aus den Strukturvoraussetzungen der gegenwärtigen Gesellschaften selbst zu entwerfen. Die Prämissen, die notwendig sind, 18um ein solches Unternehmen durchzuführen, lassen sich nicht ohne weiteres im vorhinein begründen; sie müssen sich vielmehr erst im Laufe der Untersuchung als gerechtfertigt erweisen. Andererseits ist es nahezu unvermeidlich, schon jetzt abstrakt die Voraussetzungen zu umreißen, die den Aufbau und den Gang der Studie verständlich machen; es wäre etwa gar nicht angemessen zu verstehen, warum ich den Entwurf einer solchen Gerechtigkeitstheorie im ganzen unter die Idee der Freiheit stellen würde, wenn nicht zuvor zumindest die allgemeinen Prämissen durchsichtig gemacht würden, von denen ich mich im folgenden leiten lasse. Die Absicht, eine Theorie der Gerechtigkeit als Gesellschaftsanalyse durchzuführen, steht und fällt mit der ersten Prämisse, daß die Reproduktion von Gesellschaften bis heute an die Bedingung einer gemeinsamen Orientierung an tragenden Idealen und Werten gebunden ist; solche ethischen Normen legen nicht nur von oben, als »ultimate values« (Parsons), fest, welche sozialen Maßnahmen oder Entwicklungen überhaupt als vorstellbar gelten können, sondern bestimmen auch von unten, nämlich als mehr oder weniger institutionalisierte Erziehungsziele, mit, woran sich der Lebensweg des einzelnen innerhalb der Gesellschaft auszurichten hat. Das beste Beispiel für eine derartige Auffassung von Gesellschaft bietet bis heute das handlungstheoretische Systemmodell Talcott Parsons’, das ausdrücklich in der Nachfolge des Deutschen Idealismus, also von Hegel, Kant, Marx und Max Weber steht. Parsons zufolge fließen die ethischen Werte, die die »letzte Realität« jeder Gesellschaft bilden, über das kulturelle System in die untergeordneten Teilbereiche ein, indem sie hier über die Mechanismen von Rollenerwartungen, impliziten Verpflichtungen und einsozialisierten Idealen, kurz: einem Gefüge sozialer Praktiken, die Handlungsorientierungen der Mitglieder prägen; diese, die Parsons durchaus im Sinne von Freud als konflikthaft integrierte Subjektivitäten versteht, richten ihr Handeln im Normalfall an denjenigen Normen aus, die sich in den unterschiedlichen Subsystemen 19in Form einer bereichsspezifischen Objektivierung der höchsten Werte niedergeschlagen haben; von einer solchen »ethischen« Durchdringung aller gesellschaftlichen Sphären nimmt Parsons im übrigen auch das ökonomische Subsystem nicht aus, das er im Unterschied zu Luhmann oder Habermas als eine normativ integrierte, heute nämlich über das Leistungsprinzip verbindlich gemachte Handlungssphäre begreift. Das Besondere an diesem Gesellschaftsmodell, das, was es für die Aktualisierung der Hegelschen Absichten besonders geeignet macht, ist die Tatsache, daß es alle sozialen Ordnungen ausnahmslos an die Voraussetzung einer Legitimierung durch ethische Werte, durch erstrebenswerte Ideale, bindet: »Keine normative Ordnung [d.h. Gesellschaft, A.H.] ist durch sich selbst legitimiert in dem Sinn, daß gebilligte oder verbotene Lebensformen einfach richtig oder falsch wären und keiner Hinterfragung bedürften. Auch ist sie niemals zureichend legitimiert durch die auf den niedrigeren Stufen der Kontrollhierarchie bestehenden Notwendigkeiten – z.B. daß etwas in spezifischer Weise geschehen muß, weil die Stabilität oder gar das Überleben des Systems auf dem Spiel steht.«[7]
Auch die Tatsache »heterogener« Gesellschaften, also ethnisch oder religiös diversifizierter Gemeinwesen, ändert an dieser »transzendentalen« Voraussetzung des Zwangs zur normativen Integration wenig. Zwar entsteht damit ein Druck, die ethischen Werte umfassender und genereller werden zu lassen, um auch die Ideale der Minderheitenkulturen beherbergen zu können, aber es bleibt bei der Unvermeidbarkeit, die materielle Reproduktion und die kulturelle Sozialisation an den Vorgaben gemeinsam geteilter Normen auszurichten. In einem derartigen, zunächst nur schwachen Sinn ist jede Gesellschaft bis zu einem gewissen Grade eine Verkörperung des objektiven Geistes: In ihren Institutionen, in ihren sozialen Praktiken und Routinen hat sich niedergeschlagen, 20welche normativen Überzeugungen die Mitglieder darüber teilen, worin die Ziele ihres Kooperationszusammenhangs bestehen. Später hätte sich zu zeigen, daß dieser Begriff des »objektiven Geistes« noch weiter angereichert werden muß, um tatsächlich all die Absichten begründen zu können, die ich mit der Idee einer Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse verknüpfe.
Mit dieser Idee geht nun als zweite Prämisse der Vorschlag einher, als moralischen Bezugspunkt einer Theorie der Gerechtigkeit nur diejenigen Werte oder Ideale heranzuziehen, die als normative Ansprüche zugleich Reproduktionsbedingungen der jeweils gegebenen Gesellschaft bilden. Für Hegel, aber auch für andere Autoren in seiner Tradition, wie etwa Marx, ist die Idee der Gerechtigkeit gar keine unabhängige, aus sich selbst heraus erläuterbare und insofern freistehende Größe; das mag auch der Grund dafür sein, daß sich bei diesen Denkern nur selten ein nichtpolemischer, konstruktiver Gebrauch dieses Begriffs finden läßt. Im klassischen, aus der Antike überlieferten Wortsinn bezeichnet »Gerechtigkeit« die »verbindliche und dauerhafte Absicht, jedem das Seine zu geben« (Justinian, Cicero, Thomas von Aquin); im Kern ist damit die Anforderung gemeint, jede andere Person auf die ihrer individuellen Persönlichkeit angemessene Weise zu behandeln, was sowohl auf eine gleiche wie auch ungleiche Behandlung verschiedener anderer hinauslaufen kann. Hegel ist nun der Überzeugung, daß es für die Art dieser Angemessenheit, die die Gerechtigkeit fordert, gar keinen unabhängigen, im Begriff der Gerechtigkeit selbst angelegten Maßstab geben kann; wir können gewissermaßen nicht einen neutralen Standpunkt einnehmen, von dem aus wir die zu berücksichtigenden Eigenschaften der anderen Person analysieren könnten, weil unsere Beziehung zu ihr immer von den Praktiken geprägt sein wird, in die wir gemeinsam verstrickt sind. Insofern ergibt sich für Hegel das, was es heißt, »jedem das Seine zu geben«, jeweils nur aus dem internen Sinn von 21bereits etablierten Handlungspraktiken; da dieser Sinn, oder diese Bedeutung, sich aber wiederum nur aus dem ethischen Wert ergibt, den die entsprechende Sphäre im idealen Gesamtgefüge der Gesellschaft besitzt, lassen sich die Maßstäbe der Gerechtigkeit letztlich allein unter Bezug auf die Ideale analysieren, die in jener Gesellschaft faktisch institutionalisiert sind: Als »gerecht« muß mithin gelten, was in den verschiedenen sozialen Sphären dazu angetan ist, einen angemessenen Umgang im Sinne der ihnen tatsächlich zugedachten Rolle in der ethischen Aufgabenteilung einer Gesellschaft zu fördern.
Mit der Forderung nach einer immanent ansetzenden Analyse ist freilich der Unterschied zu den konventionellen, von mir als »kantianisch« bezeichneten Versionen einer Gerechtigkeitstheorie noch nicht hinreichend markiert, da auch diese sich häufig bemühen, ihre »konstruktiv« gewonnenen Prinzipien zugleich als Ausdruck der gegebenen Wertorientierung darzustellen; sowohl die Rawlssche Theorie der Gerechtigkeit[8] als auch die Habermassche Rechtstheorie[9] sind gute Beispiele für Ansätze, die von einer historischen Kongruenz zwischen unabhängig gewonnenen Gerechtigkeitsprinzipien und den normativen Idealen moderner Gesellschaften ausgehen. Die Differenz zu derartigen Theorien besteht darin, daß im Anschluß an Hegel darauf verzichtet werden muß, der immanent ansetzenden Analyse den Schritt einer freistehenden, konstruktiven Begründung von Gerechtigkeitsnormen vorzuschalten; ein solcher zusätzlicher Rechtfertigungsschritt ist überflüssig, wenn sich im Nachvollzug der Bedeutung der herrschenden Werte bereits nachweisen läßt, daß sie den historisch vorausliegenden Gesellschaftsidealen oder »ultimate 22values« normativ überlegen sind. Sicherlich läuft ein derartiges, immanentes Verfahren am Ende darauf hinaus, erneut ein Element geschichtsteleologischen Denkens in Anspruch zu nehmen; aber diese Art von Geschichtsteleologie ist genau bis zu dem Maße unvermeidbar, in dem sie auch von jenen Gerechtigkeitstheorien vorausgesetzt wird, die von einer Kongruenz praktischer Vernunft und existierender Gesellschaft ausgehen.
Auch der damit umrissene Unterschied reicht allerdings noch nicht aus, um tatsächlich die Eigentümlichkeit der Idee zu charakterisieren, eine Theorie der Gerechtigkeit direkt auf dem Weg einer Gesellschaftsanalyse zu entwickeln; denn auch die bloß immanent gewonnenen Gerechtigkeitsprinzipien könnten ja so verstanden werden, daß sie erst sekundär auf die gesellschaftliche Realität angewendet werden, indem sie als Richtschnur der Überprüfung der moralischen Qualität von Institutionen und Praktiken dienen. In diesem Fall bliebe insofern alles beim alten, als wiederum nur eine von dritter Seite aufbereitete und bestimmte Realität vorausgesetzt würde, auf die dann erst im nachhinein die normativen Maßstäbe appliziert werden; die Arbeitsteilung zwischen Sozialwissenschaften und normativer Theorie, zwischen empirischer Einzelwissenschaft und philosophischer Analyse würde in derselben Weise aufrechterhalten, wie wir es von den herkömmlichen Gerechtigkeitskonzeptionen schon kennen. Hegel hingegen wollte sich in seiner »Rechtsphilosophie« gerade nicht von außen vorgeben lassen, wie die soziale Wirklichkeit beschaffen ist, deren gerechte Ordnung er zu bestimmen suchte; ebensowenig wie Marx, der in dieser Hinsicht sein getreuer Schüler war, ist er bereit gewesen, einfach den empirischen Sozialwissenschaften (Staatswissenschaften, politische Ökonomie) das Geschäft der Gesellschaftsanalyse zu überlassen. Was Hegel der überkommenen Arbeitsteilung als ein methodisches Verfahren entgegensetzte, ist aufgrund der idealistischen Prämissen, die er dabei zugrunde legte, nur mit großem Aufwand 23zu verstehen;[10] ich werde für diese notorisch verkannte Strategie hier, um mir die Wiedergabe komplizierter Diskussionen zu ersparen, stets nur den Ausdruck der »normativen Rekonstruktion« verwenden. Darunter ist ein Verfahren zu verstehen, welches die normativen Absichten einer Gerechtigkeitstheorie dadurch gesellschaftstheoretisch umzusetzen versucht, daß es die immanent gerechtfertigten Werte direkt zum Leitfaden der Aufbereitung und Sortierung des empirischen Materials nimmt: Die gegebenen Institutionen und Praktiken werden auf ihre normativen Leistungen hin in der Reihenfolge analysiert und dargestellt, in der sie für die soziale Verkörperung und Verwirklichung der gesellschaftlich legitimierten Werte von Bedeutung sind. »Rekonstruktion« soll im Zusammenhang dieses Verfahrens also heißen, daß aus der Masse der gesellschaftlichen Routinen und Einrichtungen nur diejenigen herausgegriffen und vorgestellt werden, die für die soziale Reproduktion als unverzichtbar gelten können; und weil die Ziele der Reproduktion im wesentlichen durch die akzeptierten Werte festgelegt sein sollen, muß »normative« Rekonstruktion dementsprechend bedeuten, die Routinen und Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt in der Darstellung aufzureihen, wie stark ihr arbeitsteiliger Beitrag zur Stabilisierung und Umsetzung jener Werte ist.
Auch wenn es den Anschein haben mag, als sei dieses von Hegel gewählte Verfahren weit davon entfernt, den Erfordernissen einer Gesellschaftstheorie Rechnung zu tragen, weist es doch überraschende Überschneidungen mit den Entwürfen einiger klassischer Vertreter der Soziologie auf. Sowohl Durkheim als auch Parsons, um nur zwei der bedeutendsten Autoren zu nennen, sortieren das Material ihrer Studien zu 24modernen Gesellschaften nicht einfach nach Gesichtspunkten, die mit den materiellen oder technischen Zwängen der sozialen Reproduktion zu tun haben; vielmehr konzentrieren sie sich auf diejenigen Sphären oder Subsysteme, denen eine erhöhte Bedeutung deswegen zukommt, weil sie zur Sicherung und Verwirklichung der in der Moderne maßgeblich institutionalisierten Werte beitragen.[11] Beide Soziologen bedienen sich, wenn man so will, eines Verfahrens der normativen Rekonstruktion, weil sie den Kreislauf der gesellschaftlichen Reproduktion daraufhin untersuchen, wie sich durch ihn bestimmte, sozial bereits akzeptierte Werte und Ideale erhalten; ähnlich wie Hegel in seiner »Rechtsphilosophie« reihen sie die sozialen Sphären entsprechend dem funktionalen Stellenwert auf, den diese für die Stabilisierung und Verwirklichung der modernen Werthierachie besitzen. Allerdings sind natürlich weder Durkheim noch Parsons daran interessiert, mit ihren soziologischen Strukturanalysen direkt eine Gerechtigkeitstheorie zu entwerfen; sie beschränken sich darauf, den Verlauf und die möglichen Gefährdungen der normativen Integration zu untersuchen, während Hegel in diesen Prozessen die sozialen Bedingungen ausfindig zu machen versucht, die zusammengenommen in der Moderne das Prinzip der Gerechtigkeit konstituieren.
Als eine dritte Prämisse bei dem Versuch, eine Gerechtigkeitstheorie in Form einer Gesellschaftsanalyse zu entwickeln, muß daher das methodische Verfahren der normativen Rekonstruktion gelten. Um der Gefahr zu entgehen, die immanent gewonnenen Prinzipien der Gerechtigkeit doch wieder nur auf die gegebene Wirklichkeit anzuwenden, sollte die gesellschaftliche Realität selbst nicht als ein schon hinreichend analysiertes Objekt vorausgesetzt werden; vielmehr müßten deren wesentliche Züge und Eigenschaften erst eigenständig 25herauspräpariert werden, indem im Verlauf der Analyse gezeigt wird, welche sozialen Sphären welchen Beitrag zur Sicherung und Verwirklichung der gesellschaftlich bereits institutionalisierten Werte leisten. Das Bild, welches auf diesem Weg von den zeitgenössischen, hochmodernen Gesellschaften entsteht, mag in vielem von dem abweichen, das heute in den offiziellen Sozialwissenschaften verbreitet ist; denn es treten Einrichtungen und Praktiken hervor, die im allgemeinen vielleicht wenig Aufmerksamkeit genießen, während zugleich andere Vorkommnisse, denen größeres Interesse gelten mag, gänzlich in den Hintergrund gedrängt werden. Aber solche Verschiebungen zwischen Vorder- und Hintergrund, zwischen Bedeutendem und Vernachlässigbarem sind innerhalb der Sozialwissenschaften, einer Disziplin, die im Grunde nur umkämpfte Begriffe kennt,[12] keine Seltenheit; im Zusammenhang der vorliegenden Studie verdanken sie sich der Absicht, nur diejenigen sozialen Praktiken und Institutionen überhaupt zur Darstellung zu bringen, deren normative Verfassung der Verwirklichung gesellschaftlich institutionalisierter Werte dient.
Mit dem Versuch, derartige Strukturbedingungen zeitgenössischer Gesellschaften hervortreten zu lassen, entsteht eine systematische Skizze dessen, was Hegel für seine Zeit »Sittlichkeit« genannt hat. Gemeinsam mit seiner »Rechtsphilosophie« im Ganzen ist auch dieser Begriff bald nach Hegels Tod in Mißkredit geraten; in aufgeklärten, progressiv gesinnten Kreisen galt er schnell als deutlicher Indikator für die Absicht, an den gegebenen Gesellschaften nur diejenigen eingespielten Praktiken und moralischen Einrichtungen zu erhalten, die dazu angetan schienen, die herrschende Ordnung zu bewahren. Hegel hingegen hatte ihn zunächst gewählt, um gegen die vorherrschende Tendenz der Moralphilosophie auf jenes Netzwerk von institutionalisierten Routinen und Verpflichtungen 26aufmerksam zu machen, in dem moralische Einstellungen nicht in Form der Orientierung an Prinzipien, sondern in der Gestalt von sozialen Praktiken eingelassen waren; für ihn, der in Zusammenhängen der praktischen Philosophie methodisch weitgehend Aristoteliker blieb, stand es außer Frage, daß intersubjektiv praktizierte Gewohnheiten, und nicht kognitive Überzeugungen, die Heimstätte der Moral bildeten.[13] Allerdings hat Hegel seinen Begriff der Sittlichkeit nicht im Sinne einer bloßen Deskription vorfindlicher Lebensformen verstanden wissen wollen; schon das von ihm gewählte Verfahren, also jene zuvor geschilderte »normative Rekonstruktion«, macht ja deutlich, daß er viel selektiver, typisierender und normativer vorzugehen versuchte, als es ein aristotelischer Positivismus erlauben würde. Für Hegel sollte von der Vielfalt sittlicher Lebensformen nur dasjenige unter dem Begriff »Sittlichkeit« in seine »Rechtsphilosophie« aufgenommen werden, was nachweislich dazu dienen konnte, den allgemeinen Werten und Idealen moderner Gesellschaften zur Verwirklichung zu verhelfen; alles, was diesen normativen Erfordernissen widersprach, alles, was also partikulare Werte repräsentierte oder rückständige Ideale verkörperte, wurde erst gar nicht für berechtigt gehalten, zum Gegenstand der normativen Rekonstruktion zu werden.
Auch mit dieser Einschränkung scheint das Konzept der Sittlichkeit freilich noch eine Tendenz zur Affirmation des bereits Bestehenden zu besitzen; denn als »sittlich« kann offensichtlich nur das an den sozialen Lebensformen gelten, was in dem Sinn einen allgemeinen Wert verkörpert, daß die zu dessen Verwirklichung geeigneten Praktiken gesellschaftlich schon Gestalt angenommen haben. Wird das Hegelsche Verfahren jedoch genauer betrachtet, so zeigt sich, daß er damit über die bekräftigenden, affirmativen Absichten hinaus auch korrektive und verändernde Zielsetzungen verknüpfte: 27Im Vollzug der normativen Rekonstruktion kommt das Kriterium, dem zufolge an der gesellschaftlichen Wirklichkeit als »vernünftig« gilt, was der Umsetzung allgemeiner Werte dient, nicht nur in Form einer Freilegung bereits existierender Praktiken zur Geltung, sondern auch im Sinne der Kritik existierender Praktiken oder des Vorausentwurfs noch nicht ausgeschöpfter Entwicklungspfade. Es ist schwer, für diese korrektive oder, besser, kritische Seite des Hegelschen Sittlichkeitsbegriffs eine angemessene Charakterisierung zu finden; denn es soll ja nicht einfach darum gehen, einen bestimmten, gewünschten Soll-Zustand zu skizzieren, also bloß normativ zu verfahren, sondern die bestehende Wirklichkeit auf Praxispotentiale hin auszudeuten, in denen die allgemeinen Werte besser, das heißt umfassender oder getreuer, zur Verwirklichung kommen könnten. Auf keinen Fall will Hegel mit derartigen Vorgriffen oder Korrekturen den Kreis der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit einfach nur hinter sich lassen; die existierenden Formen der Sittlichkeit sollen in dem Sinn stets Richtschnur aller normativen Erwägungen bleiben, daß nicht abstrakt irgendwelche, kaum erfüllbare Forderungen an das Sozialverhalten gerichtet werden. Wo Hegel daher im Namen der Gerechtigkeit Kritik übt oder aber, und ebenso häufig, Reformen avisiert, da verfährt er in seiner normativen Rekonstruktion derart, daß er nur knapp über den Horizont der existierenden Sittlichkeit hinwegschaut, um Spielräume für so viele Veränderungen zu eruieren, wie bei realistischer Berücksichtigung aller Umstände erwartbar sind; nicht falsch wäre es daher wahrscheinlich, hier an jenen Begriff der »objektiven Möglichkeit« zu erinnern, den Max Weber methodisch umriß, als er empirisch kontrollierte Wege des Vorausentwurfs sozialer Entwicklungen beschreiben wollte.[14]
Eine weitere, vierte Prämisse des hier unternommenen 28Versuchs, eine Gerechtigkeitstheorie in Form einer Gesellschaftsanalyse zu entfalten, muß also in der These bestehen, daß das Verfahren der normativen Rekonstruktion stets auch die Chance einer kritischen Anwendung bietet: Es kann nicht nur darum gehen, auf rekonstruktivem Weg die Instanzen der bereits existierenden Sittlichkeit freizulegen, sondern es muß zugleich auch möglich sein, diese im Lichte der jeweils verkörperten Werte zu kritisieren. Die Maßstäbe, auf die sich eine derartige Form der Kritik stützt, sind keine anderen als diejenigen, die auch der normativen Rekonstruktion als Richtschnur dienen; wenn nämlich als eine Instanz von Sittlichkeit gilt, was allgemeine Werte oder Ideale durch ein Bündel von institutionalisierten Praktiken repräsentiert, dann können dieselben Werte auch dazu herangezogen werden, jene gegebenen Praktiken als noch nicht angemessen in Hinblick auf ihre repräsentativen Leistungen zu kritisieren. In einer solchen »rekonstruktiven Kritik« werden mithin den gegebenen Institutionen und Praktiken nicht einfach externe Maßstäbe entgegengehalten; vielmehr werden dieselben Maßstäbe, anhand derer jene überhaupt erst aus der Chaotik der sozialen Wirklichkeit herausgehoben wurden, dazu genutzt, um ihnen eine mangelhafte, noch unvollständige Verkörperung der allgemein akzeptierten Werte vorzuhalten. Dementsprechend besitzen die normativen Urteile, die in diesem Zusammenhang gefällt werden, nicht einen kategorischen, sondern einen graduellen Charakter: Kritisiert wird jeweils, daß eine als »sittlich« begriffene Institution noch besser, vollständiger oder umfassender die Werte repräsentieren könnte, die der Rekonstruktion der Sittlichkeit überhaupt als übergreifende Richtschnur dienen. Ein gutes Beispiel für diese »kritische« Absicht, die Hegel mit seinem Konzept der Sittlichkeit verbindet, bietet seine Darstellung der Korporationen, die sich am Ende des Teils über die »bürgerliche Gesellschaft« befindet. Hegel ist der Überzeugung, daß solche Korporationen im arbeitsteiligen Geschäft der Realisierung der übergreifenden 29Werte die institutionelle Aufgabe übernehmen, die gewerbetreibenden Schichten mit einem sittlichen Bewußtsein ihres konstitutiven Beitrags zur marktvermittelten Reproduktion auszustatten; dazu sind eine Reihe von sozialen Praktiken nötig, deren Funktion es ist, nach innen die Standesehre zu stiften und nach außen die Absicht allgemeiner Wohlfahrt kundzutun. In § 253 seiner »Rechtsphilosophie« macht Hegel nun auf Erscheinungen des sittlichen Verfalls aufmerksam, die er dadurch im Entstehen begriffen sieht, daß die Korporationen ihre Aufgabe nicht umfassend genug erfüllen: »Wenn über Luxus und Verschwendungssucht der gewerbetreibenden Klassen, womit die Erzeugung des Pöbels zusammenhängt (§ 244), Klagen zu erheben sind, so ist bei den anderen Ursachen (z.B. das immer mehr mechanisch Werdende der Arbeit) der sittliche Grund, wie es im Obrigen liegt, nicht zu übersehen. Ohne Mitglieder einer berechtigten Korporation zu sein […], ist der einzelne ohne Standesehre, durch seine Isolierung auf die selbstsüchtige Seite des Gewerbe reduziert, seine Subsistenz und Genuß nichts Stehendes. Er wird somit seine Anerkennung durch die äußerlichen Darlegungen seines Erfolgs in seinem Gewerbe zu erreichen suchen; Darlegungen, welche unbegrenzt sind, weil seinem Stande gemäß zu leben nicht stattfindet, da der Stand nicht existiert.« Diese Kritik des ostentativen Konsums bürgerlicher Schichten ist ersichtlich in der These begründet, daß die sittliche Institution des Zunftwesens nicht in dem Maße Mitglieder inkludiert, wie es ihre arbeitsteilige Funktion verlangt; hier wird kein äußerer Maßstab herangezogen, sondern nur »rekonstruktiv« kritisiert, indem auf ein vernachlässigtes Entwicklungspotential bereits bestehender Einrichtungen aufmerksam gemacht wird.
Mit diesen vier Prämissen sind nur die ganz allgemeinen, methodologischen Voraussetzungen der vorliegenden Untersuchung umrissen: Bei dem Versuch, auf gesellschaftstheoretischem Wege eine Konzeption der Gerechtigkeit zu entwickeln, muß in einer ersten Prämisse zunächst vorausgesetzt wer30den, daß die jeweilige Form der sozialen Reproduktion einer Gesellschaft durch gemeinsam geteilte, allgemeine Werte und Ideale bestimmt ist; sowohl die Ziele der gesellschaftlichen Produktion als auch die der kulturellen Integration werden letztlich durch Normen reguliert, die insofern einen ethischen Charakter besitzen, als sie Vorstellungen des gemeinsam geteilten Guten enthalten. In der zweiten Prämisse wird im Sinne einer ersten Annäherung behauptet, daß der Begriff der Gerechtigkeit nicht unabhängig von diesen gesellschaftlich übergreifenden Werten verstanden werden kann: Als »gerecht« hat zu gelten, was innerhalb einer Gesellschaft an Institutionen oder Praktiken dazu angetan ist, die jeweils als allgemein akzeptierten Werte zu verwirklichen. Erst mit der dritten Prämisse kommt nun aber ins Spiel, was es des näheren bedeuten soll, auf der Basis der beiden vorangegangenen Bestimmungen eine Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse durchzuführen; gemeint ist damit, aus der Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit diejenigen Institutionen oder Praktiken herauszudestillieren oder, methodisch gesprochen, normativ zu rekonstruieren, die tatsächlich als geeignet gelten können, die allgemeinen Werte sicherzustellen und zu verwirklichen. Mit der vierten Prämisse soll schließlich gewährleistet werden, daß die Anwendung eines solchen methodischen Verfahrens nicht dazu führt, jeweils nur die bereits bestehenden Instanzen der Sittlichkeit zu affirmieren; bei strikter Durchführung wird die normative Rekonstruktion vielmehr bis zu dem Punkt entwickelt werden müssen, an dem gegebenenfalls deutlich werden kann, inwiefern die sittlichen Institutionen und Praktiken die durch sie verkörperten allgemeinen Werte nicht umfassend oder vollständig genug repräsentieren.
Freilich reicht es nicht aus, diese vier Prämissen zusammenzuziehen, um erkennen zu können, was in der folgenden Studie unter »Gerechtigkeit« verstanden werden soll; die Vorbemerkung hat lediglich den theoretischen Rahmen umrissen, 31in dem es sinnvoll ist, eine Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse zu entwerfen. Immerhin ist aber bereits deutlich geworden, daß ein solches Projekt vom ersten bis zum letzten Schritt davon abhängt, wie die allgemeinsten Werte unserer gegenwärtigen Gesellschaften bestimmt werden müssen; erst nachdem die damit bezeichnete Aufgabe gelöst worden ist, kann ernsthaft mit dem Geschäft der normativen Rekonstruktion unserer heutigen, posttraditionalen Sittlichkeit begonnen werden.
33 A.Historische Vergegenwärtigung:Das Recht der Freiheit
35Unter all den ethischen Werten, die in der modernen Gesellschaft zur Herrschaft gelangt sind und seither um Vormachtstellung konkurrieren, war nur ein einziger dazu angetan, deren institutionelle Ordnung auch tatsächlich nachhaltig zu prägen: die Freiheit im Sinne der Autonomie des einzelnen. Alle anderen Vorstellungen des Guten, angefangen mit dem Deismus der natürlichen Ordnung bis hin zum romantischen Expressivismus,[1] haben zwar seit mehr als zweihundert Jahren die Erfahrungen des Selbst und seiner Beziehungen um stets neue Akzente bereichert; aber wo sie sozial wirkmächtig werden sollten, wo sie den engen Kreis von ästhetischen oder philosophischen Avantgarden verlassen und den Imaginationsraum der Lebenswelt beflügeln konnten, gerieten sie schnell in das Fahrwasser des Autonomiegedankens, dem sie am Ende nur weitere Tiefenschichten verliehen. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist es beinah unmöglich, einen dieser anderen Werte der Moderne zu artikulieren, ohne ihn nicht sogleich als Facette der konstitutiven Idee der individuellen Autonomie zu verstehen; ob es sich nun um die Beschwörung einer natürlichen Ordnung handelt oder um die Idealisierung der inneren Stimme, um den Wert der Gemeinschaft 36oder den Lobpreis der Authentizität, stets wird es dabei inzwischen nur noch um zusätzliche Bedeutungskomponenten dessen gehen, was es heißt, von der individuellen Selbstbestimmung zu sprechen. Wie durch magische Anziehung sind alle ethischen Ideale der Moderne in den Bannkreis der einen Vorstellung der Freiheit geraten, vertiefen sie bisweilen, verleihen ihr neue Akzente, aber setzen ihr nicht mehr eine selbständige Alternative entgegen.[2]
Diese ungeheure Sogwirkung des Autonomiegedankens erklärt sich aus seiner Fähigkeit, zwischen dem individuellen Selbst und der gesellschaftlichen Ordnung eine systematische Verknüpfung herzustellen. Während alle anderen Werte der Moderne sich entweder auf den Orientierungshorizont des einzelnen oder den normativen Rahmen der ganzen Gesellschaft beziehen, bringt einzig die Idee der individuellen Freiheit eine Verbindung zwischen beiden Bezugsgrößen zustande: Ihre Vorstellungen davon, was für das Individuum das Gute ist, enthalten zugleich Anweisungen für die Einrichtung einer legitimen Gesellschaftsordnung. Mit dem sich nur allmählich durchsetzenden Gedanken, daß der Wert des menschlichen Subjekts in seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung liegt, ändert sich nämlich gleichzeitig auch die Perspektive auf die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens; deren normative Legitimität wird nun zunehmend davon abhängig gemacht, ob sie so vorgestellt werden können, daß sie die individuelle Selbstbestimmung entweder in ihrer Summe zum Ausdruck bringen oder in ihren Voraussetzungen angemessen verwirklichen können. Seither ist von der Vorstellung sozialer Gerechtigkeit, von Überlegungen darüber, wie die Gesellschaft eingerichtet werden soll, um den Interessen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder gerecht zu werden, das Prinzip der individuellen Autonomie nicht mehr abzutrennen; so groß auch der Stellenwert all dessen sein mag, was zusätzlich 37noch an ethischen Gesichtspunkten in den Diskurs über Gerechtigkeit eingebracht wird, stets wird all das von der Bedeutung des Wertes überragt, den die Freiheit des einzelnen in der modernen Gesellschaftsordnung genießt. Die Verschmelzung von Gerechtigkeitsvorstellung und Freiheitsgedanken ist im Laufe der Zeit so weit fortgeschritten, daß heute im Detail manchmal gar nicht mehr recht zu erkennen ist, wo bestimmte Entwürfe den Verweis auf den zentralen Wert der individuellen Freiheit untergebracht haben; erst eine mühsame Rekonstruktion muß dann im nachhinein sichtbar machen, daß auch diese Gerechtigkeitstheorien in der Vielzahl ihrer anderen ethischen Bezüge die individuelle Autonomie in den Mittelpunkt gerückt haben.[3] So hat es Jahre gebraucht, bis sich auch von den vermeintlich subjektkritischen Ethiken der »postmodernen« Generation zeigte, daß sie letztlich nur eine tiefergelegte Variante der modernen Freiheitsidee darstellen: Was bislang für eine natürliche Grenze der individuellen Selbstbestimmung gehalten wurde, die biologische Identität der Geschlechter oder bestimmte Auffassungen des menschlichen Körpers, soll durch den Nachweis der Herkunft aus kulturellen Setzungen bloß eingerissen werden.[4] Keine Sozialethik, keine Gesellschaftskritik scheint heute mehr den Denkhorizont transzendieren zu können, der sich mit der Koppelung der Gerechtigkeitsvorstellung an den Autonomiegedanken seit mehr als zweihundert Jahren in der Moderne eröffnet hat.
Was für die philosophische Seite der sozialethischen Bemühungen gesagt werden kann, gilt nicht minder auch für die nach Gerechtigkeit strebenden Sozialbewegungen der Neuzeit. Kaum eine der gesellschaftlichen Gruppierungen, 38die nach der Französischen Revolution in Kämpfe um soziale Anerkennung verstrickt waren, hatte sich nicht das Losungswort der individuellen Freiheit auf ihre Fahnen geschrieben. Die Anhänger der nationalrevolutionären Bewegungen und die Verfechterinnen der Frauenemanzipation, die Mitglieder der Arbeiterbewegung und die Kombattanten des civil rights movements, sie alle kämpften gegen rechtliche und soziale Formen der Mißachtung, die sie als unvereinbar mit Ansprüchen auf Selbstachtung und individuelle Autonomie erlebten; bis in die Sensorien ihrer moralischen Wahrnehmung hinein waren die Anhänger dieser sozialen Bewegungen davon überzeugt, daß es die Gerechtigkeit verlangt, jeder Person die gleichen Chancen auf Freiheit zu gewähren; und selbst dort, wo es sich der Zielsetzung nach um eine Einschränkung individueller Freiheit handeln sollte, mußte noch das Freiheitspostulat dazu herhalten, den Zielen der Bewegung den Anschein der Gerechtigkeit zu verleihen. In der gesellschaftlichen Moderne ist die Forderung nach Gerechtigkeit öffentlich nur zu legitimieren, wenn in der einen oder anderen Weise auf die Autonomie des einzelnen Bezug genommen wird; nicht der Wille der Gemeinschaft, nicht die natürliche Ordnung, sondern die individuelle Freiheit bildet den normativen Grundstein aller Gerechtigkeitsvorstellungen.
Diese Verzahnung von Gerechtigkeit und individueller Freiheit ist freilich mehr als nur ein historisches Faktum. Zwar kommt in der Verschmelzung der beiden Konzepte das Resultat eines weit zurückreichenden Lernprozesses zum Tragen, in dessen Verlauf das klassische Naturrecht zunächst aus seinem theologischen Rahmen befreit werden mußte, um das individuelle Subjekt in die Rolle eines gleichberechtigten Autors aller gesellschaftlichen Gesetze und Normen einsetzen zu können; von Thomas von Aquin über Grotius und Hobbes bis zu Locke und Rousseau verläuft der schwierige, konfliktreiche Weg, auf dem so allmählich die individuelle Selbstbestimmung zum Bezugspunkt aller Vorstellungen von Gerechtigkeit 39wurde.[5] Aber im Ergebnis stellt diese ethische Legierung doch mehr dar als bloß den glücklichen Zufall einer Zusammenkunft von zwei unabhängigen Begriffsgeschichten; in ihr kommt vielmehr in irreversibler Weise zur Geltung, daß der Entwurf gerechter Normen auf keine anderen Kräfte vertrauen darf, als sie dem menschlichen Geist je individuell gegeben sind. Zwischen unserem unablässigen Insistieren darauf, daß eine gesellschaftliche Ordnung »gerecht« zu sein hat, und der individuellen Selbstbestimmung besteht insofern ein unauflösliches Band, als bereits die Orientierung an Gerechtigkeit nur Ausdruck unseres subjektiven Vermögens zur Rechtfertigung ist. Die individuelle Fähigkeit, Gesellschaftsordnungen zu hinterfragen und nach ihrer moralischen Legitimation zu verlangen, ist Bodensatz des Mediums, in dem die Perspektive der Gerechtigkeit ihrer ganzen Struktur nach beheimatet ist. Daher hat der menschliche Geist in der individuellen Selbstbestimmung, der Kraft, zu eigenen Urteilen zu gelangen, nicht irgendeine kontingente Eigenschaft, sondern das Wesen seiner praktisch-normativen Tätigkeit entdeckt: Nach Gerechtigkeit zu fragen, den entsprechenden Gesichtspunkt auch nur geltend machen zu wollen bedeutet, selbst (mit)bestimmen zu wollen, welchen normativen Regeln das gesellschaftliche Zusammenleben gehorchen soll.[6] Sobald dieser interne Zusammenhang aber einmal entdeckt ist, sobald also ein Wissen darüber besteht, daß Gerechtigkeit und individuelle Selbstbestimmung zirkulär aufeinander verweisen, muß jeder Rückgriff auf ältere, vormoderne Legitimationsquellen sozialer Ordnung wie eine Auslöschung der Gerechtigkeitsperspektive selbst erscheinen; es ist von nun an nicht mehr verständlich, was es heißen soll, nach einer gerechten Ordnung zu verlangen, ohne simultan auch individuelle Selbstbestimmung einzuklagen. Insofern stellt die Verschmelzung der Gerechtigkeitsvorstellung mit dem Autonomiegedanken eine irreversible, nur um den Preis der kognitiven Barbarisierung noch einmal rückgängig zu machende Errungenschaft der Moderne dar; und dort, wo sich eine derartige Regression tatsächlich ereignet, wird sie »in den Gemütern aller Zuschauer (die nicht selbst in dieses Spiel mit verwickelt sind)«[7] moralische Empörung erregen.
Mit dieser teleologischen Perspektive, die ein unvermeidliches Element des Selbstverständnisses der Moderne bildet,[8] verliert das bislang umrissene Faktum seinen historisch-kontingenten Charakter. Als normativen Bezugspunkt aller Konzeptionen von Gerechtigkeit in der Moderne können wir nun aus Gründen, die universelle Geltung beanspruchen, die Idee der individuellen Selbstbestimmung betrachten: Als »gerecht« muß gelten, was den Schutz, die Förderung oder die Verwirklichung der Autonomie aller Gesellschaftsmitglieder gewährleistet. Allerdings ist mit dieser ethischen Bindung der Gerechtigkeit an ein oberstes Gut noch nicht das mindeste darüber ausgesagt, wie eine soziale Ordnung tatsächlich beschaffen sein soll, die das Prädikat »gerecht« verdient; alles, aber auch alles, hängt für die weitere Bestimmung der Gerechtigkeit 41nun davon ab, wie der Wert der individuellen Freiheit des näheren gefaßt wird. Die Idee der Autonomie ist als solche viel zu heterogen und vielschichtig, als daß sie von sich aus festlegen könnte, worin das Maß der Gerechtigkeit bestehen soll; weder die methodische Form noch die inhaltlichen Bestimmungen einer solchen Konzeption werden schon dadurch hinreichend fixiert, daß sie bloß ethisch auf die Gewährleistung von individueller Freiheit bezogen wird. Zwar mag das Gut der Freiheit den »Punkt« oder das »Ziel« der Gerechtigkeit bilden,[9] aber damit ist das Verhältnis zwischen dem ethischen Ziel und den Gerechtigkeitsgrundsätzen, zwischen dem Guten und dem Richtigen noch in keiner Weise bestimmt; dazu bedarf es erst einer rationalen Klärung nicht nur des Umfangs, sondern auch der Vollzugsweise jener individuellen Freiheit, die dem Entwurf im ganzen als Richtschnur dienen soll.
Seit den Tagen von Hobbes muß die Kategorie der individuellen Freiheit, ihre inhaltliche Füllung ebenso wie ihr logischer Aufbau, als einer der am stärksten umkämpften Begriffe der gesellschaftlichen Moderne gelten; an den Auseinandersetzungen um seine semantische Bestimmung beteiligten sich von Anfang an nicht nur Philosophen, Juristen und Gesellschaftstheoretiker, sondern auch die Aktivisten von sozialen Bewegungen, denen es um die öffentliche Artikulation ihrer spezifischen Erfahrungen von Diskriminierung, Degradierung und Ausschluß ging.[10] Im Verlauf dieser unabgeschlossenen 42Debatte ist deutlich geworden, daß sich mit der propagierten Idee von Freiheit stets auch das Bild, ja die methodische Vorstellung von Gerechtigkeit wandelt: Eine Ausweitung all dessen, was zum »Selbst« der individuellen Selbstbestimmung gehören soll, ändert nicht nur die inhaltlichen Grundsätze, sondern auch die Konstruktionsgesetze der gerechten Ordnung; denn je mehr Fähigkeiten und Voraussetzungen für nötig befunden werden, um tatsächlich die Autonomie des einzelnen ermöglichen zu können, desto stärker muß in die Festlegung der Prinzipien auch der Blickwinkel derer einfließen, für die jene Prinzipien gelten sollen. Um also begründen zu können, von welcher Idee von Gerechtigkeit im folgenden ausgegangen werden soll, bedarf es zunächst einer Unterscheidung von verschiedenen Modellen individueller Freiheit; im Lichte solcher Differenzierungen dürfte sich dann auf dem Weg eines eliminativen Verfahrens das Freiheitsmodell herausschälen, an dem sich unsere Konzeption von Gerechtigkeit zu orientieren hat. Als Ausgangspunkt kann dabei die Beobachtung gelten, daß sich im moralischen Diskurs der Moderne, jenen erbittert geführten Konflikten um die Bedeutung von Freiheit, drei deutlich voneinander abgrenzbare Modelle herausgebildet haben; bei genauerer Analyse wird sich zeigen, daß die Unterschiede zwischen diesen historisch wirkmächtigen Ideen individueller Freiheit im wesentlichen mit verschiedenen Vorstellungen darüber zusammenhängen, wie jeweils die Verfaßtheit und der Charakter individueller Absichten aufgefaßt werden muß.[11] Entlang ihres zunehmenden Komplexitätsgrades 43aufgereiht können wir von einem negativen (I.), einem reflexiven (II.) und einem sozialen (III.) Modell der Freiheit sprechen; nur indirekt spiegelt sich in der damit vorgenommenen Dreiteilung jene berühmt gewordene Unterscheidung, in der Isaiah Berlin eine bloß »negativ« bestimmte Freiheit einer »positiv« begriffenen Freiheit entgegengesetzt hat.[12]
44 I .Die negative Freiheit und ihreVertragskonstruktion
Die Geburtsstunde der Idee einer negativen Freiheit des Subjekts fällt in die Zeit der religiösen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts. Obwohl der Konfliktstoff in den erbittert geführten Auseinandersetzungen schon damals den Blick auf die Reflexivität der Freiheit hätte lenken können, also darauf, daß Subjekte allein wollen können, was sie reflexiv für richtig halten, dirigiert Hobbes die streitenden Parteien geschickt auf das Gleis einer nur negativen Vorstellung von individueller Selbstbestimmung: »Die Freiheit des Menschen«, so behauptet er an einer berühmten Stelle des , »bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand, wobei […] unter Widerstand äußere Beweggründe« verstanden werden sollen. Auf der elementarsten Stufe besteht »Freiheit« für Hobbes in nichts anderem als der Abwesenheit von äußeren Widerständen, die natürliche Körper an der möglichen Bewegung hindern könnten; innere Hemmnisse, wie sie im Fall von einfachen Körpern aus der Beschaffenheit ihrer Materie stammen können, dürfen deswegen nicht als Einschränkungen von Freiheit gelten, weil sie den individuellen Dispositionen angehören und daher, so ließe sich sagen, selbstverursacht sind. Von dieser ersten, noch rein naturalistischen Bestimmung aus schließt Hobbes nun auf die Freiheit von Wesen, die wie die Menschen im Unterschied zu bloßen Körpern einen »Willen« besitzen; deren Freiheit besteht dementsprechend darin, nicht durch äußere Widerstände daran gehindert zu werden, ihre selbstgesetzten Ziele zu realisieren: »ein Freier« ist, so lautet, was sich geradewegs wie eine Definition verstehen läßt, »wer nicht daran gehindert ist, Dinge, die er auf Grund seiner Stärke und seines Verstands tun kann, seinem Willen entsprechend auszuführen«. Auch hier, also bei menschlichen Wesen, dürfen innere Hemmnisse wiederum nicht als Beeinträchtigungen von Freiheit gelten; denn solche psychischen Faktoren, wie sie etwa Angst, Willensschwäche oder mangelndes Selbstvertrauen bilden mögen, können erneut nur dem individuellen Vermögen zur Last gelegt werden, so daß sie nicht auf die Seite der Widerstände geschlagen werden dürfen. Vor allem aber möchte Hobbes verhindern, daß bei der Frage, ob wir eine bestimmte Handlung als »frei« qualifizieren können, die Art der individuell verfolgten Ziele eine Rolle spielt; als diejenigen Absichten, von deren Durchführung Menschen durch äußere Freiheitseinschränkungen abgehalten werden können, dürfen alle Zwecksetzungen gelten, die sie »auf Grund ihrer eigenen Vernunft für das Vorteilhafteste halten«.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!