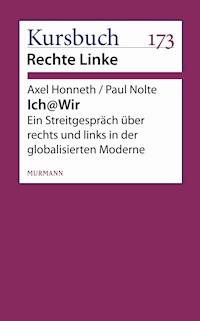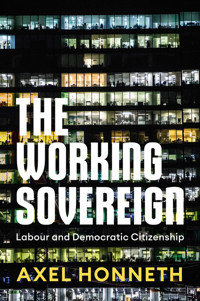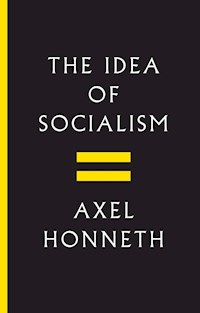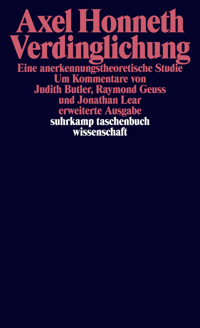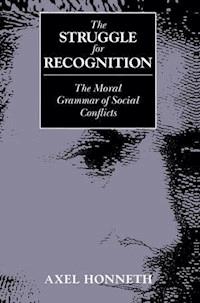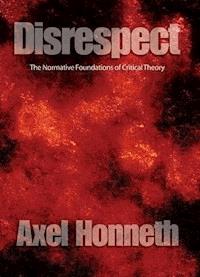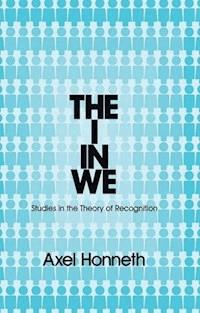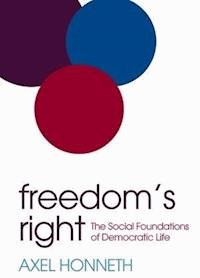21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch zeigt Axel Honneth, was es aus der philosophischen Tradition über einen vernünftigen Begriff der Freiheit noch zu lernen gibt, was sich heute der Realisierung einer solchen Freiheit in den Weg stellt und woher schließlich die Anregungen für eine weitere Verwirklichung von Freiheit stammen können. In einem ersten Schritt unternimmt er eine zwischen Hegel und Marx vermittelnde Begriffsklärung, während sich der zweite Teil sozialen Problemfeldern zuwendet, in denen die gegenwärtigen Hindernisse einer Realisierung von Freiheit besonders deutlich ins Auge fallen. Abschließend wird der Versuch unternommen, Triebkräfte zu bestimmen, die dem Kampf für die Freiheit heute neuen Aufschwung verleihen könnten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Axel Honneth
Die Armut unserer Freiheit
Aufsätze 2012-2019
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort: Die Armut unserer Freiheit
I
. Spielarten sozialer Freiheit
Untiefen der Anerkennung. Das sozialphilosophische Erbe Jean-Jacques Rousseaus
Von der Armut unserer Freiheit. Größe und Grenzen der Hegelschen Sittlichkeitslehre
Die Normativität der Sittlichkeit. Hegels Lehre als Alternative zur Ethik Kants
Hegel und Marx. Eine Neubewertung nach 100 Jahren
Wirtschaft oder Gesellschaft? Größe und Grenzen der Marxschen Theorie des Kapitalismus
Drei, nicht zwei Begriffe der Freiheit . Zur Reaktualisierung einer verschütteten Tradition
II
. Deformationen sozialer Freiheit
Die Krankheiten der Gesellschaft. Annäherungen an einen nahezu unmöglichen Begriff
Erziehung und demokratische Öffentlichkeit. Ein vernachlässigtes Kapitel der politischen Philosophie
Demokratie und soziale Arbeitsteilung. Noch ein vernachlässigtes Kapitel der politischen Philosophie
Kindheit . Unstimmigkeiten unserer liberalen Vorstellungswelt
III
. Quellen sozialer Freiheit
Denaturierungen der Lebenswelt. Vom dreifachen Nutzen der Geisteswissenschaften
Gibt es ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse? Versuch der Beantwortung einer Schlüsselfrage kritischer Theorie
Eine Geschichte moralischer Selbstkorrekturen. Auf den Spuren europäischer Solidarität
Nachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
261
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
316
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
7Vorwort: Die Armut unserer Freiheit
Die Mehrzahl der Aufsätze, die in dem vorliegenden Band versammelt sind, verdankt sich dem Versuch, einige mir später klargewordene Lücken meines Buches Das Recht der Freiheit[1] nachträglich zu füllen; als 2012 die ersten ausführlicheren Reaktionen auf meine Studie erschienen und mich auf gewisse Mängel meiner Überlegungen hinwiesen, habe ich damit begonnen, offengebliebene Fragen zu klären und nicht hinreichend bestimmte Thesen weiterzuentwickeln. Im Rückblick auf diese über einen Abstand von sieben Jahren entstandenen Beiträge bin ich zu dem Entschluss gelangt, sie in einem Band zu versammeln, der um den Begriff der »sozialen Freiheit« kreist; denn in kaum einem der hier versammelten Aufsätze unternehme ich nicht den Versuch, entweder durch Auseinandersetzung mit der Tradition eines solchen Freiheitsbegriffs, durch Aufweis einer mangelnden Realisierung seines normativen Gehalts in der sozialen Gegenwart oder schließlich durch Benennung seiner nach wie vor bestehenden Impulse einen weiteren Schritt in Richtung einer Aufhellung seiner Bedeutung zu unternehmen. Den Titel, den ich dann dem ganzen Band geben konnte, Die Armut unserer Freiheit, habe ich in leichter Abänderung einem der hier veröffentlichten Beiträge entnommen, in dem ich anhand von Hegels Konzept der Sittlichkeit die Idee der sozialen Freiheit weiter habe aufklären wollen: Dass wir heute unter einer Armut an Freiheit leben, soll heißen, dass es uns bislang in dem Bemühen um eine Realisierung der normativen Versprechen moderner Gesellschaften nicht gelungen ist, die Prinzipien sozialer Freiheit dort zu verwirklichen, wo sie am dringlichsten erforderlich wären.
Wie diejenigen wissen, die meine Studie gelesen haben, bildete die Sittlichkeitslehre Hegels das theoretische Rückgrat von Das Recht der Freiheit; insofern steht sie auch im Zentrum der Aufsätze des I. Teils dieses Sammelbandes, in dem ich vornehmlich in der Beschäftigung mit der philosophischen Spannung zwischen Hegel 8und Marx den Begriff der sozialen Freiheit noch einmal weiter zu erläutern versuche. Was mir über die besondere Bedeutung hinaus, welche die intellektuelle Konstellation von Hegel und Marx für das Projekt einer kritischen Gesellschaftstheorie als solche besitzt, an dieser Rückschau auf eine konstitutive Debatte des 19. Jahrhunderts von besonderem Gewicht zu sein scheint, ist die Selbstverständlichkeit, mit der damals die Idee der sozialen Freiheit als eine eigenständige Auffassung davon behandelt wurde, was es für uns heißt, tatsächlich frei zu sein: Sowohl Hegel als auch Marx waren der Überzeugung, dass individuelles Frei-Sein letztlich nur in geglückter Intersubjektivität gegeben sein kann, weil es dem Einzelnen ohne die anerkennende Bestätigung durch den Anderen nicht zu gelingen vermag, seine Absichten und Impulse zwanglos zu realisieren – nur dass beide Denker dann sehr unterschiedliche Vorstellungen davon entwickelten, welche sozialen Einrichtungen vorhanden sein müssen, um eine derartige Form von geglückter Intersubjektivität gesellschaftlich zu ermöglichen. Meine Beiträge im I. Teil des vorliegenden Bandes gehen diesen von Hegel und Marx entwickelten Alternativen in beiden Richtungen nach, um zu einer Einschätzung ihres jeweiligen Wertes für unser heutiges gesellschaftliches Selbstverständnis zu gelangen. Im letzten Aufsatz dieses Teiles unternehme ich hingegen den Versuch, den systematischen Kern der Idee sozialer Freiheit in Auseinandersetzung mit konkurrierenden Freiheitsbegriffen der neuzeitlichen Tradition zu umreißen – ohne mit dem Ergebnis allerdings schon vollkommen zufrieden zu sein.
Der Titel des II. Teils – »Deformationen sozialer Freiheit« – soll signalisieren, dass es hier um Bemühungen geht, genauer zu erkunden, warum und wieso es uns heute in vielen Hinsichten an sozialen Chancen zur Realisierung einer solchen Form von Freiheit fehlt. Den Auftakt macht dabei allerdings der Versuch,[2] einen Schlüsselbegriff meiner Gegenwartsdiagnose, den der »sozialen Pathologie«, noch einmal unabhängig von der ihm in Das Recht der Freiheit zugewiesenen Bedeutung zu bestimmen; dabei schlage ich neue Wege ein, deren Weiterverfolgung einigen Überlegungen in 9meiner Studie eine andere, radikalere Wendung geben würde. Der Rest der Aufsätze beschäftigt sich mit drei sozialen Arenen, in denen der Mangel an ernsthaften Anstrengungen, soziale statt bloß »negative« Freiheit zu verwirklichen, heute besonders augenfällig ist. Am Anfang steht dabei die Beschäftigung mit einer sozialen Instanz der »Sittlichkeit«, deren Bedeutung ich beim Schreiben jenes Buches aus Gründen vollkommen übersehen habe, die möglicherweise mit einer dann doch zu sklavischen Bindung an Hegels Vorlage zusammenhingen: Mit ihm, der in dieser Hinsicht Kant unterlegen war, lasse ich dort weitgehend außer Acht, welche enorme Bedeutung den öffentlichen Bildungseinrichtungen für die Entwicklung und Stabilisierung demokratischer (bei Hegel »staatsbürgerlicher«) Einstellungen und Dispositionen im Ganzen zukommt.[3] Der Aufsatz zur Rolle der schulischen Erziehung im demokratischen Prozess, der neben Kant vor allem an John Dewey und Émile Durkheim anschließt, ist ein kleiner Versuch, diesen misslichen Fehler nachträglich zu beheben. Die beiden abschließenden Beiträge zum II. Teil, die einen zunehmend experimentellen Charakter haben, verfolgen ebenfalls das Ziel, sich zu fragen, was an unseren Vorstellungen über zentrale Sphären des gesellschaftlichen Zusammenlebens eigentlich geändert werden müsste, wollten wir im Ernst darangehen, sie als Orte der Verwirklichung sozialer – und nicht bloß »negativer« – Freiheit zu verstehen: In dem Aufsatz über die soziale Rolle der Arbeit lege ich weit über das im Buch Gesagte hinaus dar, warum eine demokratische Willensbildung in elementarer Weise auf Bedingungen einer fairen, inklusiven und transparenten Arbeitsteilung angewiesen ist, in dem Aufsatz über die Kindheit versuche ich mich in tastender Weise zu fragen, welche tiefsitzenden Prämissen unserer liberalen Vorstellungen über Kinder möglicherweise ungeeignet sind, um diesen die Entwicklung einer eigenen Stimme und damit von demokratischer Autonomie zu ermöglichen.
Der Titel, unter den ich die Beiträge im III. Teil versammelt habe, »Quellen sozialer Freiheit«, mag zunächst ein wenig gewollt wirken; hier sind nämlich drei Aufsätze zusammengeführt, die sich nicht nur ganz unterschiedlichen Anlässen verdanken, sondern auch Fragestellungen verfolgen, die auf den ersten Blick kaum mit10einander zusammenzuhängen scheinen. Gleichwohl behandeln sie alle, wenn auch an sehr verschiedenen Wurzeln ansetzend, individuelle oder kollektive Erfahrungen, die, richtig verstanden, uns über die Notwendigkeit aufklären müssten, den Schritt von einer bloß individualistisch verstandenen zu einer wirklich sozialen, in zwangloser Wechselseitigkeit begründeten Freiheit zu vollziehen: An der Logik der Geisteswissenschaften zeigt der erste dieser Aufsätze, dass uns die Beschäftigung mit der geistigen Verfassung unserer sozialen Welt dazu nötigt, uns als Mitglieder einer aktiven, gegen naturhaft scheinende Abhängigkeiten ankämpfende Interpretationsgemeinschaft zu begreifen; der zweite Aufsatz macht in Wiederaufnahme der alten Frage, ob es ein emanzipatorisches Interesse geben mag,[4] auf den Umstand aufmerksam, dass auch unterdrückte Gruppen ihre Befreiung nur auf dem Weg einer kognitiven Mobilisierung gegen naturalisierende, hegemonial festgefrorene Deutungssysteme gesellschaftlicher Ordnung in Gang setzen können; und der letzte Aufsatz in diesem III. Teil unternimmt schließlich den Versuch, uns Europäer daran zu erinnern, dass wir zu einem solidarischen Miteinander nur zurückfinden können, wenn wir uns im Geist sozialer Freiheit mit der Aufgabe befassen, das von den europäischen Staaten bis in die jüngste Vergangenheit hinein weltweit begangene Unrecht und Unheil gemeinsam aufzuarbeiten und durch Errichtung von normativen Selbstschutzmechanismen zu bezwingen – ein Text, der aus dem Rahmen des vorliegenden Bandes zu fallen scheint, den ich aber unbedingt einbezogen wissen wollte, weil er vielleicht die politische Aktualität einiger der hier angestellten Überlegungen unter Beweis stellen kann.
Wie immer habe ich Eva Gilmer zu danken, die mich auf dem Weg zu diesem Aufsatzband mit der für sie charakteristischen Sorgfalt, Umsicht und Hilfsbereitschaft begleitet hat. Dank schulde ich darüber hinaus Jan-Erik Strasser, der den gesamten Text im letzten Stadium mit großem Sachverstand durchgesehen und korrigiert hat.
Axel Honneth, im Januar 2020
11I. Spielarten sozialer Freiheit
13Untiefen der Anerkennung
Das sozialphilosophische Erbe Jean-Jacques Rousseaus*
Als Ernst Cassirer im Jahre 1932 seinen großen Essay über »Das Problem Jean-Jacques Rousseau«[1] publizierte, war er sich wohl sicher, endgültig den Schlüssel zu einem integralen Verständnis des zerklüfteten Werks des Philosophen gefunden zu haben; heute jedoch, achtzig Jahre später, wenn weltweit Rousseaus 300. Geburtstag gefeiert wird, ist der Vorschlag von Cassirer beinah schon wieder vergessen, so dass die Forschung weiterhin darüber rätselt, wo, wenn überhaupt, die Einheit in den verschiedenen, sich scheinbar widersprechenden Schriften des großen Denkers zu suchen ist. Kein anderer philosophischer Autor der Moderne, vielleicht mit der Ausnahme Nietzsches, hat schroffer entgegengesetzte Deutungen seines Werkes hervorgerufen, kein anderer ist deswegen aber auch so konstant der ewig junge, erneut provozierende und beunruhigende Zeitgenosse geblieben. In Rousseau konnte man, je nach Gesinnung und zeitgeschichtlicher Lage, den sich auf das Vorbild der menschlichen Natur berufenden Anthropologen, den wie die Engländer das »Gefühl« hervorhebenden Moralphilosophen oder den Kant vorbereitenden Theoretiker der demokratischen Selbstbestimmung entdecken; verlangte die Zeit nach anderen philosophischen Gewichtungen, so war in Rousseau aber auch der Wegbereiter einer totalitären Demokratieauffassung, der glühende Verfechter republikanischer Gleichheit oder der Advokat eines Ideals der persönlichen Authentizität ausfindig zu machen. Alle diese Deutungen, so heterogen sie auch sein mochten, hatten mit demselben großen Problem zu kämpfen, sich nur auf bestimmte Teile des Werkes beziehen zu können und andere, entgegenstehende in den Hintergrund treten zu lassen; nur den wenigsten gelang es wie Ernst Cassirer, einen Vorschlag zu unterbreiten, der die verschiedenen Schriften und Gedanken des Philosophen als Stufen der Realisierung einer einzigen Grundidee zu deuten vermochte.
14Sah Cassirer einen solchen Fluchtpunkt des Werkes in der Idee eines trotz aller sozialen und politischen Gefährdungen zur Selbstbestimmung fähigen Willens des Menschen,[2] so hat ihm darin allerdings schon bald die sich anschließende Forschung mit großem Nachdruck widersprochen; nicht nur schienen bei einer derartigen Deutung, die Rousseau zum direkten Vorläufer Kants machte, die kollektivistischen Züge im Contrat Social zu kurz zu kommen, vielmehr blieb vor allem auch unberücksichtigt, was in den anderen Schriften über die wechselseitige Abhängigkeit der Subjekte, ja über deren Ausgeliefertsein an den je Anderen zu lesen war.[3] Dieses Element des Werkes, das in dem für den Zweiten Diskurs[4] und den Émile[5] konstitutiven Begriff der »amour propre«, der »Eigenliebe«, wurzelt, wurde daher in den neueren Interpretationen zunehmend in den Vordergrund gerückt; aber damit war so lange kein Schlüssel für die Identifikation eines vereinheitlichenden Grundgedankens gewonnen, wie nicht geklärt war, in welcher Weise Rousseaus pessimistische Diagnose einer wachsenden Abhängigkeit des modernen Menschen von der Wertschätzung anderer mit den zuversichtlichen Zügen seines Entwurfs eines Contrat Social[6] zusammenhängen mochte – immerhin war dort, wo die »amour propre« thematisiert wurde, erkennbar nur von der Gefahr einer totalen Außensteuerung der Subjekte die Rede, während hier, im konstruktiven Teil des Werks, denselben Subjekten plötzlich eine unverletzbare Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung attestiert wurde. Der Durchbruch zu einer Verknüpfung beider Elemente und damit zu einer integralen Deutung des Werkes kam in der Forschung erst zustande, als der Begriff der »amour propre« derart aufgefächert wurde, dass er von nun an neben einer negativen auch eine positive Variante zu umfas15sen vermochte; mit diesem Vorschlag, den wir wohl der bahnbrechenden Studie von N. J. H. Dent verdanken,[7] war zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, Rousseaus Idee einer konstitutiven Abhängigkeit vom Anderen insofern als eine Klammer zwischen den beiden Teilen seines Werkes zu betrachten, als sie in der Kulturkritik in ihrer negativen, in den Entwürfen eines Gesellschaftsvertrags aber in ihrer positiven Version ausbuchstabiert wurde.
Mit dieser neuen Gesamtdeutung war freilich weitaus mehr erreicht, als es Dent selbst zunächst vor Augen gestanden haben dürfte; gab man seiner Interpretation nämlich nur eine weitere, kleine Drehung, so ließ sich aus ihr unschwer die Annahme entwickeln, dass Rousseau mit seinem zweipoligen Begriff der »amour propre« zugleich auch zum Begründer der gesamten Tradition der Anerkennungstheorie geworden war. Den Schritt zu der damit angedeuteten These, die geistesgeschichtlich von geradezu umstürzlerischer Bedeutung ist, hat wohl zum ersten Mal Frederick Neuhouser in seiner großen Studie vollzogen;[8] ihm zufolge geht die Einsicht, dass menschliche Subjekte ihre soziale Handlungsfähigkeit der Anerkennung durch andere Subjekte verdanken, nicht, wie bislang angenommen, auf Hegel, sondern auf Rousseau zurück. Das Gewicht dieser Auffassung und das Maß der durch sie bewirkten Neuverortung des Werks lässt sich vollständig nur dann ermessen, wenn man sich den Abstand zu der von Cassirer vorgelegten Gesamtdeutung noch einmal zu Bewusstsein zu bringen versucht: Während bei Cassirer Rousseau deswegen zum einsamen Vorläufer Kants erklärt werden konnte, weil ihm ein lebenslanges Bemühen um die Herausarbeitung der aktiven, selbstgesetzgeberischen Seite des menschlichen Willens unterstellt wurde, wird der 16innere Zusammenhang seiner Schriften in den neueren, an Dent anschließenden Deutungen in der genau entgegengesetzten These gesehen, der zufolge der menschliche Wille im Guten wie im Schlechten auf die Bestätigung und Wertschätzung durch andere Subjekte angewiesen ist.
Ich will im Folgenden an diese zweite Auffassung anschließen, um zunächst ihre Berechtigung, im weiteren Fortgang dann aber auch ihre Grenzen aufzuzeigen; zeitlebens war Rousseau sich nämlich, so möchte ich darlegen, über den tatsächlichen Stellenwert der intersubjektiven Anerkennung im gesellschaftlichen Gefüge zu unsicher, als dass er sie unzweideutig zum Fundament seiner gesamten Theorie hätte machen können. Im Einzelnen will ich so vorgehen, dass ich in einem ersten Schritt Rousseau zunächst in seiner theoretischen Entwicklung bis zu dem Punkt folge, an dem ihm vor der Kontrastfolie der schädlichen Realisationsgestalten der »amour propre« die Erfordernisse einer sozialverträglichen, egalitären Form der wechselseitigen Anerkennung bewusst werden (I). Von hier aus ist dann ohne Mühe zu überblicken, welchen enormen Einfluss Rousseaus zweipolige Idee der sozialen Anerkennung auf den philosophischen Diskurs der Moderne genommen hat; deren negative Variante, das tiefsitzende Bedürfnis menschlicher Wesen, die jeweiligen Mitsubjekte im Grad der sozialen Wertschätzung zu übertreffen, wird von Kant in seinen geschichtsphilosophischen Entwürfen in eine Triebkraft des kulturellen und gesellschaftlichen Fortschritts umgedeutet, deren positive Variante, der wechselseitige Respekt unter Gleichen, wird von Fichte und Hegel in Richtung einer Anerkennungstheorie des Rechts und der Sittlichkeit weiterentwickelt (II). Erst im dritten Schritt werde ich dann dazu übergehen, die Skepsis zu thematisieren, mit der Rousseau stets, mit wachsender Intensität aber vor allem gegen Ende seines Lebens die in der »amour propre« angelegte Abhängigkeit vom Anderen betrachtet hat; in den späten Schriften spielt er noch einmal, wie schon im Zweiten Diskurs, mit dem Gedanken, ob es nicht insgesamt für den Seelenfrieden des Menschen von Vorteil wäre, sich von der Berücksichtigung intersubjektiver Anerkennung vollkommen unabhängig zu machen. Insofern liegen im Werk von Rousseau zwei große philosophische Motive im ständigen Streit miteinander, die stoische Idee einer persönlichen Unabhängigkeit von aller Fremdeinschätzung und die intersub17jektivistische Idee einer tiefsitzenden Abhängigkeit vom Anderen (III).
I.
In keinem anderen Thema kommt das Motiv, aus dem heraus Rousseau zunächst zu seinem zentralen Begriff der »amour propre« findet, plastischer zum Vorschein als in seiner frühen Kritik am Theater; schon im Ersten Diskurs wird das, was er häufig abschätzig nur als »Schauspielerei« bezeichnet, einer äußerst negativen Analyse unterzogen,[9] zur Vollendung gelangt diese kritische Auseinandersetzung aber erst in dem essaylangen »Brief an d’Alembert«.[10] Das Theater stellt für Rousseau nicht eine kulturelle Einrichtung unter anderen dar, in denen ein aufgeklärtes Publikum sich betrachtend oder engagiert mit Werken der Kunst auseinanderzusetzen lernt; die Bühne und der Theatersaal bilden für ihn vielmehr insofern einen Sonderfall, als hier das von den Schauspielern an den Tag gelegte Verhalten auf das Publikum überspringen und den Einzelnen mit dem Virus des »bloßen Scheinens« infizieren kann. Im Unterschied zum Museum oder zum Konzerthaus, in denen die Rezipienten im dargebotenen Kunstwerk immerhin die authentische Absicht des jeweiligen Künstlers erahnen können, ist für Rousseau der Zuschauer im Theater zunächst einmal nur mit Verhaltensweisen konfrontiert, mittels derer die Schauspieler offenbaren wollen, mit welcher Kunstfertigkeit sie »einen anderen als den eigenen Charakter anzunehmen«[11] vermögen; dadurch aber wird das noch unschuldige Publikum dazu angehalten, sich selbst in Gesten und Ausdrucksformen einzuüben, die nichts anderem als der Selbstverstellung dienen. Aus diesen kritischen Überlegungen zieht Rousseau den weitreichenden Schluss, dass die Einrichtung von Theaterstätten von großem Schaden für ein jedes republikanisches Gemeinwesen sei; denn was an Gesinnungen und Verhaltensweisen für solche auf den politischen Volkswillen gegründete 18Staatsgebilde erforderlich sei, Pflichterfüllung, Aufrichtigkeit und Bürgerstolz, würde durch die im Theater feilgebotenen Verstellungskünste gerade unterminiert – der Schauspieler bildet, so heißt es dementsprechend im »Brief an d’Alembert«, »die Fähigkeit, Menschen zu täuschen, für alle Berufe« aus.[12]
Allerdings glaubt Rousseau, dass die Ansteckungsgefahr, die von der Schauspielerei auf der Bühne ausgeht, nur eine kulturelle Tendenz noch zusätzlich verstärkt, welche zu seiner Zeit an den verschiedensten Orten schon vehement um sich greift. Bereits in seinem drei Jahre vor dem Brief über das Theater veröffentlichten Zweiten Diskurs, der Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit, hatte er ja den Versuch unternommen, jene neuen Verhaltensweisen des prätentiösen Verstellens und der Geltungssucht genealogisch zu analysieren, die ihm in Paris besonders drastisch vor Augen standen; in dem Bemühen, für derartige, durch das Theater nur intensivierte Formen des individuellen Prestigegehabes die anthropologischen Wurzeln zu finden, war er in seiner Schrift auf eine besondere Art des menschlichen Selbstverhältnisses gestoßen, die er zwar nicht für natürlichen Ursprungs hielt, ihm aber doch aufgrund ihrer kulturellen Verbreitung geradezu naturhafte Züge zu tragen schien. Der Begriff, den Rousseau wählt, um diese zur zweiten Natur gewordene Verhaltensweise zu benennen, lautet »amour propre«; er bildet nicht nur die Grundlage seiner gesamten Gesellschaftskritik, sondern auch den Schlüssel zu einem Verständnis all dessen, was er zur Begründung einer Theorie der intersubjektiven Anerkennung beitragen wird.
In der genealogischen Gedankenführung des Zweiten Diskurses taucht die »amour propre« längst nicht an so prominenter Stelle auf, wie es ihre zentrale Bedeutung für die gesamte Konstruktion der Studie eigentlich verlangt hätte; gewiss erwähnt Rousseau den Begriff gelegentlich, wenn es um die Identifizierung der tiefer liegenden Ursachen für die Entstehung sozialer Ungleichheit geht,[13] aber im Grunde genommen behält er dessen Erläuterung doch einer einzigen längeren Anmerkung vor, deren Gewicht daher aber auch kaum zu überschätzen ist. Hier, in der Anmerkung XV des 19Textes,[14] wird die Bedeutung der »amour propre« aus ihrem Gegensatz zur »amour de soi-même«, zur Selbstliebe, heraus umrissen, wobei alle Aufmerksamkeit auf die Differenzen im jeweils vorausgesetzten Beurteilungsmaßstab gelenkt wird: Während es sich bei der »amour de soi«, die Rousseau als eine natürliche Anlage des Menschen begreift, um eine Art Selbstinteressiertheit handelt, die das Überleben des Einzelnen dadurch sichert, dass sie ihn einzig und allein auf die je eigenen, vitalen Kriterien des Guten und Richtigen vertrauen lässt, verschiebt sich in der erst später hinzutretenden, insofern künstlichen »amour propre« dieser Maßstab der Selbstinteressiertheit dahingehend, dass nun die Meinung der anderen zur Richtschnur des opportunen Verhaltens wird. Am prägnantesten erläutert Rousseau diesen Unterschied in seiner Anmerkung wohl dann, wenn er die wohl der Moraltheorie Humes entnommene, aber bereits auf Adam Smith vorverweisende Formulierung verwendet, dass im Gefühl oder Streben der »amour de soi« das Subjekt nur »sich selbst als den einzigen Zuschauer« kennt, wohingegen es in dem der »amour propre« die Anderen als »Richter« über sein Tun und Lassen betrachtet.[15] Werden die Differenzen zwischen den beiden Weisen der Selbstinteressiertheit auf eine derartige Weise erläutert, so ist freilich vorläufig noch vollkommen unklar, warum mit der zweiten Einstellung, die der »amour propre«, überhaupt eine Tendenz zum Negativen oder Problematischen verknüpft sein soll; im Gegenteil, aus der Perspektive von Adam Smith ließe sich ja sagen, dass eine Orientierung des eigenen Handelns am verinnerlichten Urteil der zunächst nur äußerlich Anderen einem bloß selbstbezüglichen Tun an Umsicht und Angemessenheit weit überlegen sei.[16] Aber Rousseau hebt in seinem Kommentar auf eine ganz andere Komponente dieser intersubjektiv vermittelten Selbsteinschätzung ab, die mit den heilsamen Wirkungen des 20»unparteiischen Beobachters« in der »Theory of Moral Sentiments« kaum mehr vereinbar zu sein scheint: Nicht eine Instanz der Korrektur eigener Urteile, nicht eine förderliche Kraft der kognitiven und moralischen Dezentrierung ist für Rousseau der zum »Richter« gewordene Andere, sondern eine ständige Quelle des Antriebs, sich als überlegen gegenüber seinen Mitmenschen beweisen zu müssen. Wofür die »amour propre« im Zweiten Diskurs zunächst einmal steht, ist eine Form der Selbstinteressiertheit, die dadurch zum Stachel eines sozialen Geltungsdrangs geworden ist, dass sie das fürs eigene Fortbestehen erforderliche Handeln von der Begutachtung durch andere Personen abhängig macht.
Allerdings ist es auch bei genauerem Hinsehen gar nicht leicht, exakt den Punkt auszumachen, an dem Rousseau in seiner Beschreibung des Stellenwerts des verinnerlichten Beobachters von der durch Adam Smith nur wenige Jahre später gelieferten Analyse abweicht; denn beide wollen ja insofern zunächst auf das Gleiche hinaus, als sie für den vergesellschafteten Menschen behaupten, dass er sich in der Einschätzung der Angemessenheit seines Verhaltens in der Regel am präsumtiven Urteil eines generalisierten Anderen orientiert. Ein in der Konsequenz schließlich aber gravierender Unterschied besteht darin, dass Rousseau diese duale Beziehung zwischen Subjekt und innerem Beobachter noch einmal um eine weitere Beziehung anreichert, die sich ergeben soll, weil zusätzlich auch die real anwesenden Personen das sich an seinem intersubjektiven »Richter« orientierende Subjekt beobachten; mit beiden Perspektiven konfrontiert, wird Rousseau zufolge dann das betreffende Subjekt dazu angehalten, sich vor seinem inneren Beobachter in einer Weise zu präsentieren, die es vor seinen anwesenden Mitsubjekten als überlegen oder höherrangig dastehen lässt. Insofern ist »amour propre« im Unterschied zur Selbstbeurteilung durch das Hineinversetzen in die Perspektive eines »unparteiischen Beobachters« der Ausdruck für ein dreigliedriges Beziehungsgefüge des vergesellschafteten Menschen: Sobald der Einzelne infolge dichter werdender Interaktionsverhältnisse gelernt hat, sein Verhalten am Urteil des verallgemeinerten Anderen auszurichten, wird er zugleich darum bemüht sein, sich diesem gegenüber möglichst vorteilhaft darzustellen, um nach eigener Einschätzung in den Augen seiner Zeitgenossen mehr gelten zu können. Das Perfide an dieser Abhängigkeit vom Urteil Anderer stellt für Rousseau nicht, 21wie er immer wieder deutlich macht, der bloße Umstand dar, dass hier jemand Eigenschaften vortäuscht, über die er faktisch nach eigener Kenntnis gar nicht verfügt; fatal ist aus der Sicht Rousseaus an der »amour propre« vielmehr, dass sie den Einzelnen sich über sich selbst täuschen lässt, weil er sich ja nicht nur nach außen, vor seinen Mitmenschen, sondern vor seinem inneren Richter als eine Person mit möglichst vorteilhaften Attributen präsentieren können muss – wonach es dem Individuum verlangt, wenn es seine »amour propre« zu befriedigen sucht, ist nicht einfach soziale Wertschätzung, sondern Selbstwertschätzung, also ein Bewusstsein des eigenen Werts.[17]
Alles, was Rousseau im Zweiten Diskurs über die sozialen Pathologien seiner Zeit aussagt, hat ihm zufolge in dieser aus der »amour propre« erwachsenen Geltungssucht seine Wurzeln: Die Menschen sind in der bürgerlichen Gesellschaft rastlos damit beschäftigt, Attribute zu erlangen, die ihnen aus der Sicht ihres verinnerlichten Beobachters einen Status verleihen, der dem der anderen Zeitgenossen überlegen ist. Einmal in Gang gekommen, kennt die »ungestüme Aktivität unserer Eigenliebe«, die »pétulante activité de nôtre amour propre«,[18] keine Grenzen mehr, weil sie aufgrund ihres bloß relativen Charakters jedes distinktionsverschaffende Merkmal schnell verbraucht sein lässt und daher zu immer neuen Anstrengungen zwingt, die eigene Überlegenheit glaubhaft zu demonstrieren: Was gestern noch in Bezug auf Reichtum, Macht oder Schönheit als Zeichen einer individuellen Höherrangigkeit gelten konnte, muss heute infolge sozialer Verbreitung schon wieder übertrumpft werden, so dass auf allen Feldern der Statuskonkurrenz eine Tendenz zum ständigen Höherschrauben des Distinktionsgebarens herrscht.[19] Das Theater übernimmt in diesem kulturellen Prozess, wie wir gesehen haben, nur die verstärkende Rolle einer Anstalt des Raffinements; es ist Rousseau deswegen so verhasst, weil die Bürgerinnen und Bürger hier Verhaltensweisen erlernen, mit denen sie derart überzeugend Eigenschaften und Statusmerkmale vortäuschen können, dass sie am Ende selbst noch von deren Authentizität überzeugt sind.
Schon der Émile, mit dessen Abfassung Rousseau bereits wenige 22Jahre nach der Veröffentlichung des Zweiten Diskurses beginnt, macht nun aber deutlich, dass er es bei der bloß kritischen Diagnose der »amour propre« nicht einfach bewenden lassen will; hier taucht nämlich derselbe Begriff mehrfach wieder auf, ohne sofort und automatisch mit all den negativen Konnotationen behaftet zu sein, die ihm im Rahmen der Kulturkritik noch zukommen. Nimmt man zu dieser Schrift noch den etwa zeitgleich entstehenden Contrat Social hinzu, in dem zwar nicht direkt von der »amour propre«, aber doch von verwandten Einstellungen die Rede ist, so zeichnet sich im Denken Rousseaus ein Weg ab, der ein wachsendes Bemühen um eine Differenzierung des ihn leitenden Begriffes verrät; unzufrieden damit, keinen Ausweg aus den dargestellten Pathologien der bürgerlichen Gesellschaft aufzeigen zu können, ringt der Philosoph ab den frühen 1760er Jahren mit der Möglichkeit, neben der schädlichen Gestalt auch eine heilsame, sozialverträgliche Form der »amour propre« behaupten zu können. Nun ist es für Rousseau aber gar nicht leicht, von der zunächst nur negativen Formbestimmung der »amour propre« einen Weg zu bahnen zu einer Bestimmung, in der diese plötzlich in einem positiven Licht erscheint; was erforderlich wäre, um das zu erreichen, müsste in einer Skizzierung der Bedingungen bestehen, unter denen an der intersubjektiv vermittelten Selbstbeurteilung die Nötigung wegfiele, sich den Mitsubjekten gegenüber als höherrangig zu erweisen. Im Émile finden sich eine Reihe von Formulierungen, die anschaulich deutlich machen, wie Rousseau sich mit der schwierigen Aufgabe einer Fixierung solcher Bedingungen erst nur abmüht; überall dort, wo er auf die unvermeidliche Herausbildung der »amour propre« bei seinem Zögling zu sprechen kommt, erkundet er sogleich wie in einer experimentellen Versuchsanordnung, was unternommen werden müsste, um der Gefahr der sich daraus zumeist ergebenden Geltungssucht vorzubeugen.[20] Die Lösung, die Rousseau für sein Problem schließlich bereithält, besteht in einem Ratschlag, der auf den ersten Blick noch sehr rätselhaft klingt: »Dehnen wir die Eigenliebe [amour propre, A. H.] auf andere aus«, so heißt es, »verwandeln wir sie in Tugend. Es gibt kein Menschenherz, in dem diese Tugend nicht ihre Wurzeln hätte.«[21] Einen Sinn ergibt diese 23Formulierung, wenn man sich klarmacht, dass eine »Ausdehnung« der »amour propre« bedeuten würde, jeden Anderen in der gleichen Weise sein eigenes Handeln am Urteil eines verallgemeinerten Beobachters ausrichten zu sehen; erfolgt ein solcher Perspektivenwechsel, so scheint Rousseau sagen zu wollen, erkennen wir also in allen Mitsubjekten dasselbe Ringen um Bewährung vor ihrem inneren Richter, so entfällt auch der Antrieb, sie an Ansehen und Status übertrumpfen zu wollen. Dieser Gedankengang lässt sich noch klarer fassen, wenn statt vom »inneren Richter« davon gesprochen wird, dass die Subjekte gleichermaßen auf eine generalisierte Zustimmung von Seiten der sie umgebenden Gesellschaft angewiesen sind; von einer Ausdehnung der »amour propre« zu reden, heißt dann nämlich nichts anderes, als den Subjekten die Einsicht nahezulegen, dass sie wechselseitig der sozialen Anerkennung bedürfen und daher auf ein konkurrenzhaftes Streben nach höherem Ansehen verzichten sollten. Rousseau versucht eine Vergiftung der »amour propre« bei seinem Zögling Émile dadurch zu verhindern, dass er ihm beizubringen versucht, sich angesichts der Verwiesenheit aller Menschen auf gesellschaftliche Anerkennung mit einem sozialen Ansehen zu bescheiden, in der genau diese wechselseitige Abhängigkeit zum Ausdruck kommt; die Formel, auf die sich eine derart temperierte Form der sozialen Anerkennung bringen lässt und die auch Rousseaus Lösungsvorschlag angemessen wiedergibt, lautet Respekt unter Gleichen.[22]
Fasst man die pädagogische Kur der »amour propre« im Émile auf diese Weise zusammen, so lässt sich nun zum ersten Mal auch verstehen, warum Rousseau heute überhaupt als ein Theoretiker der Anerkennung in Erscheinung treten kann. Von Beginn an, also schon im Zweiten Diskurs, war mit dem Begriff der »amour propre« offenbar mehr gemeint als nur die menschliche Leidenschaft, sich anderen gegenüber als sozial überlegen zu erweisen und daher beständig um ein höheres Maß an Wertschätzung zu kämpfen; solchen Formen der Geltungssucht liegt als Triebfeder ihrerseits noch einmal das Bedürfnis zugrunde, in den Augen der Gesellschaftsmitglieder überhaupt als jemand zu gelten und damit 24eine Art von sozialem Wert zu genießen. Bevor die »amour propre« zum Verlangen nach Prestige und besonderer Hochachtung wird, besitzt sie mithin die ganz unschuldige Gestalt, die später auch der Perspektivübernahme des »inneren Beobachters« bei Adam Smith zukommen wird;[23] ihr Wesen besteht darin, uns in unserer Selbsteinschätzung und unserem Selbstbild abhängig sein zu lassen von der sozialen Anerkennung der uns umgebenden Gesellschaft. Die negative Form eines zwanghaften Sich-Vergleichens und Überlegenheitsdrangs nimmt diese Abhängigkeit vom »generalisierten Anderen« für Rousseau erst dann an, wenn das begleitende Bewusstsein entfällt, dass wir alle dieselbe Bedürftigkeit nach sozialer Bestätigung und Befürwortung teilen; dann nämlich gerät uns aus dem Blick, dass wir selbst es sind, die mit all den anderen Gesellschaftsmitgliedern jene Instanz eines »inneren Richters« bilden, von der wir uns Zustimmung für unser Verhalten erwarten. Insofern ist es nur konsequent, wenn Rousseau in seiner Erziehungsschrift zu pädagogischen Maßnahmen rät, mit deren Hilfe Heranwachsenden schon früh ein Bewusstsein sozialer Gleichheit zu vermitteln ist; denn nur wenn der Einzelne sich als Gleicher unter Gleichen zu verstehen lernt, kann er sich zugleich als Mitwirkender an jenem »generalisierten Anderen« begreifen, von dessen Urteilsfindung er in der Befriedigung seiner »amour propre« abhängig ist.
Nun ist diese letzte Formulierung ersichtlich schon im Vorgriff auf die Konstruktion gewählt, mit der Rousseau in seinem Contrat Social das Problem der »amour propre« zu lösen versucht. Im Émile findet sich zwar bereits der Gedanke, das Begehren nach sozialer Anerkennung durch einen Respekt unter Gleichen zu befriedigen, aber noch nicht die viel weiter gehende Idee, dass sich dadurch der Einzelne zugleich auch als Mitautor der gesellschaftlichen Urteile begreifen kann, von denen er in seinem Selbstverständnis fortan abhängig bleibt. Im Begriff der »volonté générale«, mit dem Rousseau seinen Entwurf eines Gesellschaftsvertrags krönt, versucht er ganz offensichtlich, die Vorstellung eines solchen durch die Betroffenen selbst erzeugten Beurteilungsmaßstabs sozialer Anerkennung zu umreißen. Die Bürger (und Bürgerinnen) eines republikani25schen Gemeinwesens sind diesem Gedankengang zufolge in ihrem Selbstwertgefühl deswegen nicht mehr einer ihnen fremden Instanz des »generalized other« unterworfen, weil sie sich zuvor in einem spontanen Akt der Zusammenstimmung auf einen Gemeinwillen geeinigt haben, in dessen Licht sie sich von nun an wechselseitig in einer Weise anerkennen können, wie sie es kollektiv für richtig halten.[24] Aus einer derartigen Form von Gesellschaft, so scheint Rousseau zu glauben, sind all jene unkontrollierbaren, dem Einzelnen bloß aufgezwungenen Maßstäbe des individuellen Werts verschwunden, die bislang für die lasterhaften Anstachelungen der »amour propre« verantwortlich waren; was statt dessen übrig bleibt, sind rein selbstauferlegte, transparente Quellen der sozialen Anerkennung, die letztlich nur beinhalten können, dass die Gesellschaftsmitglieder sich untereinander ausschließlich als Freie und Gleiche respektieren.
Allerdings weisen die abschließenden Kapitel im Contrat Social auch darauf hin, dass Rousseau von einer vollständigen Befriedigung der »amour propre« bloß im wechselseitigen Respekt selbst nicht ganz überzeugt war; denn die Ausführungen zur »Zivilreligion« und zum republikanischen Patriotismus scheinen doch besagen zu wollen, dass es dem Einzelnen stets nach einem stärkeren Gefühl des eigenen Selbstwerts verlangt, als es allein durch die Anerkennung als freier und gleicher Bürger zu gewinnen ist.[25] In der »amour propre«, dem Bedürfnis, in den Augen der anderen Gesellschaftsmitglieder als von Wert zu gelten, wuchern selbst bei egalitärer Befriedigung noch überschießende, schwer zu befriedigende Ansprüche, die es für Rousseau offenbar erforderlich machen, innerhalb eines republikanischen Gemeinwesens nach zusätzlichen Ressourcen der sozialen Anerkennung Ausschau zu halten;[26] auch 26diese dürfen keinerlei Anhaltspunkte für die leicht entzündliche Gefahr der Geltungssucht bieten, müssen also gesellschaftlich hinreichend verallgemeinerbar sein, sollten aber nach Möglichkeit doch dem Einzelnen die Chance geben, sich tugendhaft einer besonderen Wertschätzung zu erfreuen. Die Zivilreligion, der demokratische Patriotismus, ja überhaupt alle Formen eines kollektiven Verfassungsstolzes stellen für Rousseau solche den »Gemeinwillen« ergänzende Kraftquellen der sozialen Anerkennung dar; wie andere namhafte Vertreter der republikanischen Tradition auch – etwa Montesquieu oder Tocqueville, um nur zwei von ihnen zu nennen – geht er davon aus, dass selbst demokratische Gesellschaften vor der permanenten Aufgabe stehen, dem individuellen Bedürfnis nach Reputation und Wertschätzung genügend Spielräume der Befriedigung zu eröffnen.[27] Bevor ich aber auf diese weitere Komplizierung der Anerkennungstheorie von Rousseau zu sprechen komme, will ich zunächst kurz darstellen, welche enorme Bedeutung seine Thematisierung der »amour propre« für die sich anschließenden Diskussionen in der Philosophie der Moderne hatte; viele der Aspekte, die er an seinem Schlüsselbegriff im Laufe der Zeit unterschieden hatte, werden von den ihm folgenden Denkern wieder aufgenommen und in eigenständiger Weise weiterentwickelt.
II.
Führen wir uns die sehr verschiedenen Bedeutungsaspekte vor Augen, die wir an Rousseaus Begriff der »amour propre« bislang schon kennengelernt haben, so kann es nicht überraschen, dass aus ihm im weiteren Verlauf der philosophischen Entwicklung die unterschiedlichsten Konsequenzen gezogen wurden; je nachdem, ob man sich eher auf den negativen Pol der bloßen Geltungssucht oder auf den positiven Pol der egalitären Anerkennung stützte, war er dazu angetan, Diagnosen mit geradezu entgegenstehenden Interessen zu begründen. Das große Heer der Rousseau-Nachfolger schloss si27cherlich an die politische Programmatik des »Contrat Social« an, ohne freilich deren Herkunft aus der komplizierten Umdeutung des zunächst nur pejorativ verwendeten Begriffs der »amour propre« zu durchschauen; andere Nachfolger des französischen Philosophen wiederum knüpften ausschließlich an den Zweiten Diskurs an, wobei ihnen dann allerdings in ihren pessimistischen Zeitdiagnosen jede Aussicht auf jene therapeutischen Gegenmittel fehlten, die sich erst in den späteren Schriften entwickelt fanden. Aber es gab auch Denker, die sich intuitiv der ganzen Spannbreite des für Rousseau zentralen Begriffs bewusst waren und daher wohl auch den inneren Zusammenhang zwischen seinen schwer zu vereinheitlichenden Schriften schon vorausahnen konnten. Zu diesen eher raren Ausnahmen in der Wirkungsgeschichte Rousseaus dürfte Immanuel Kant gezählt haben. In dessen Werk taucht je nachdem, welche philosophische Erkenntnisabsicht verfolgt wird, der Begriff der »amour propre« sowohl in seiner positiven wie in seiner negativen Bedeutung auf, wobei die Differenzen schon in der Wortwahl markiert werden; ob Kant dabei tatsächlich die systematische Verknüpfung beider Bedeutungsaspekte in der Anerkennungsbedürftigkeit des Menschen bereits angemessen durchschaut hat, ist hier von geringerer Bewandtnis als der erstaunliche Umstand, dass ihm die zwei Verwendungsweisen vertraut genug waren, um sie gezielt für seine Zwecke einsetzen zu können.
Hinlänglich bekannt ist natürlich, wie viel an theoretischen Anregungen Kant in seiner Moralphilosophie der von Rousseau entwickelten Vorstellung verdankt, dass nur solche allgemeinen Gesetze als gültig betrachtet werden dürfen, die jeder Einzelne je für sich als selbstgesetzt begreifen kann; selbst noch die sich daraus ergebende Konsequenz, wonach eine solche gemeinsame Prozedur der Selbstgesetzgebung zu einem Verhältnis der egalitären Anerkennung unter den Beteiligten führt, hat Kant mit seinem lebenslangen Vorbild geteilt und im Begriff der »Achtung« festgehalten.[28] Weniger bekannt ist allerdings die Tatsache, dass Kant nicht nur an 28Rousseaus positive Umdeutung der »amour propre« anknüpft, sondern auch für deren ursprünglich nur negative Fassung einen exakt bestimmten Verwendungsort vorsieht; neben vielen Hinweisen auf die anthropologische Rolle der vergleichenden Selbstliebe, die deutlich den begrifflichen Stempel Rousseaus tragen,[29] kommt vor allem innerhalb seiner geschichtsphilosophischen Entwürfe eine Idee des sozialen Geltungsdrangs systematisch zum Tragen, für die er die Anregung nur aus einer intensiven Lektüre des Zweiten Diskurses erhalten haben kann. Die Aufgabe, die der dort entwickelte, rein pejorative Begriff der »amour propre« in der Geschichtsphilosophie Kants erhält, ergibt sich aus dem Ziel, welches er sich mit ihr in seinem Gesamtwerk gesetzt hat: Sie soll uns an der nur transzendentalen, also empirisch wirkungslosen Geltung der Sittengesetze nicht verzweifeln lassen, indem sie mit Hilfe der Urteilskraft tentativ ein Bild der menschlichen Geschichte entwirft, das genügend Anhaltspunkte eines Fortschritts zum Besseren enthält, um uns bei unseren moralischen Anstrengungen trotz allem motivieren und beflügeln zu können.[30] Allerdings muss Kant nun, um den damit umrissenen Zweck erreichen zu können, seine hypothetische Skizze des Geschichtsverlaufs mit immerhin so vielen Indikatoren eines tatsächlichen Fortschritts im Moralischen ausstatten, dass sie für seine Zeitgenossen nicht jede Glaubwürdigkeit verliert; und genau an dieser Stelle seiner Geschichtsphilosophie, dort, wo es also um die empirische Plausibilisierung einer moralischen Progression in der Geschichte geht, kommt nun in geradezu paradoxer Weise Rousseaus negative Konzeption der »amour propre« zum Tragen. Kant versucht nämlich, ganz gegen die Absicht des Zweiten Diskurses, der auch von ihm hier als konstitutiv für die menschliche Gattung angesehenen Geltungssucht eine Wendung zu geben, die es verständlich machen soll, warum aus ihr am Ende doch Wirkungen in 29Richtung einer sittlichen Verbesserung hervorgehen: Die menschlichen Subjekte, so lautet der Gedankengang in Kants Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, streben aufgrund ihrer »ungeselligen Geselligkeit« stets danach, sich durch Leistungen hervorzutun, für die sie die Anerkennung der sozialen Gemeinschaft finden können; ab einer bestimmten Schwelle in der Geschichte hat dieser in Eitelkeit begründete Distinktionskampf aber einen Stand erreicht, an dem den wetteifernden Subjekten keine andere Möglichkeit des Prestigegewinns bleibt, als sich auch an besonderen Leistungen im moralischen Verhalten und Unterscheidungsvermögen zu versuchen;[31] insofern führt für Kant das, was am Anfang nur bloße Sucht nach öffentlicher Wertschätzung war, im längeren Verlauf der menschlichen Entwicklung schließlich auch zu einem Fortschritt in den sittlichen Verhältnissen, so dass wir trotz aller empirischen Bedenken den Mut zu weiteren Verbesserungen im Moralischen fassen können. Auf geradezu ingeniöse Weise hat Kant damit die zwei Bedeutungspole der »amour propre«, um deren innere Verknüpfung im Werk von Rousseau er womöglich gar nicht wusste, in der Systematik seiner Theorie vereinigt: Dem positiven Begriff kommt in der Bedeutung der reziproken Achtung unter Gleichen die Aufgabe zu, den normativen Gesichtspunkt des Moralischen zu erläutern, während dem negativen Begriff die Funktion zufällt, eine hypothetische Erklärung für den Weg dorthin, also zum Standpunkt der Moral, zu liefern. Man könnte auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass Kant die sich aus der Doppelung der »amour propre« ergebenden Schwierigkeiten einfach ontologisch gelöst hat, indem er deren zwei Bedeutungen den unterschiedlichen Sphären einmal der empirischen Wirklichkeit, das andere Mal des Noumenalen zugeordnet hat: In der kausalen Welt der menschlichen Geschichte besitzt die menschliche Selbstinteressiertheit dann die Gestalt des sozialen Geltungsdrangs, in der rationalen Welt der sittlichen Gesetze demgegenüber hat sie die Gestalt der moralischen Achtung angenommen.
Allerdings konnte von einer solchen schlichten Lösung schon Kant selbst nicht ganz überzeugt sein, bemühte er sich in seinen ge30schichtsphilosophischen Entwürfen doch gerade darum, zwischen der faktischen Geschichte und dem Ideellen eine theoretische Brücke zu schlagen und damit die Kluft zwischen den zwei Welten nicht zu groß werden zu lassen; insofern liegt es viel näher, ihm eine generelle Unkenntnis darüber zu unterstellen, dass zumindest für Rousseau die beiden Strebungen des Geltungsdrangs und der reziproken Achtung aus ein und der gleichen motivationalen Quelle, der »amour propre« nämlich, stammen sollten. Kant hätte sich, wäre ihm diese innere Verknüpfung bei Rousseau tatsächlich verschlossen geblieben, um eine Aufklärung der Ursachen für die Verschiebung der zugrundeliegenden Bedürftigkeit des Menschen entweder in die eine oder in die andere Richtung gar keine Gedanken machen müssen; vielmehr hätte er zwei Begriffe in den Schriften seines großen Vorbildes aufgelesen, die ihm unabhängig voneinander philosophisch jeweils so erklärungskräftig schienen, dass er sie an verschiedenen Stellen seines Werkes zum Einsatz zu bringen versucht hat.
Noch schwieriger gestaltet sich die Einschätzung der Abhängigkeit von Rousseaus Begriff der »amour propre« aber bei den Denkern, die die philosophische Theorie Kants unmittelbar nach dessen Tod mit der Absicht überwinden wollten, eine Kluft zwischen den zwei Welten der empirischen Kausalität und der noumenalen Vernunft erst gar nicht entstehen zu lassen. Zumindest für Hegel, wohl aber auch für Fichte kann gelten, dass sie sich der Herkunft ihrer eigenen Anerkennungstheorien aus der Erbmasse des Rousseauschen Denkens intuitiv bewusst waren; zwar erwähnt Hegel den Begriff der »amour propre« nach meiner Kenntnis an keiner Stelle und übernimmt auch die ganze Terminologie der Anerkennung eher von Fichte, aber viele Bemerkungen in seiner »Rechtsphilosophie« lassen doch darauf schließen, dass er sich die Sittlichkeit nach dem Muster von Rousseaus »volonté générale« als das Resultat einer wechselseitigen Anerkennung unter sich in ihrer Subjektivität einschränkenden Individuen vorgestellt hat.[32] 31Macht man sich darüber hinaus klar, dass auch Hegel die »Eitelkeit« oder »Heuchelei« auf eine Verkennung dessen zurückführt, was an gemeinsamer Anerkennungsbedürftigkeit die Subjekte verbindet, so dürfte eine solche wenn nicht direkte, so doch gedanklich-atmosphärische Abhängigkeit vom Denkhorizont Rousseaus auf der Hand liegen: Wie der große Franzose, so nimmt auch der deutsche Philosoph den subjektiven Geltungsdrang und die wechselseitige Anerkennung, die Eitelkeit und die gleiche Achtung, als zwei Seiten eines Bestrebens der menschlichen Subjektivität wahr, in den Augen der Mitsubjekte als eine Person von sozialem Wert zu gelten.[33] Im Einzelnen ist allerdings auch bei Hegel, nicht anders als bei Kant, äußerst schwer zu durchschauen, wie weit diese Kenntnis der doppelten Bedeutung der »amour propre« im Werk Rousseaus tatsächlich gereicht hat; obwohl in der »Rechtsphilosophie« zwischen Verfallsformen und gelungenen Gestalten der Anerkennungsbedürftigkeit ähnliche Unterschiede gemacht werden wie bei Rousseau, ist doch eher zu bezweifeln, dass diese Differenzierungen sich direkt einer Adaption des Begriffs der »amour propre« verdanken. Ein Grund für die Schwierigkeiten der nachfolgenden Generationen, sich die ganze Spannbreite von Rousseaus Schlüsselbegriff bewusst zu machen, mag nicht zuletzt darin gelegen haben, dass dieser selbst gegenüber dem damit bezeichneten Selbstverhält32nis eine gewisse Reserve nie losgeworden ist; bis an das Ende seines Lebens hat er nämlich damit gerungen, ob es im Ganzen für ein gutes Leben nicht ratsamer wäre, die Abhängigkeit von Anderen als solche geistig zu überwinden.
III.
Blicken wir zurück auf das, was wir vor dieser theoriegeschichtlichen Zwischenbetrachtung über die »amour propre« bei Rousseau in Erfahrung gebracht haben, so fällt daran neben der enormen Spannweite des Begriffs auch der ihm gleichzeitig innewohnende Zug einer durchgängigen Beunruhigung ins Auge: Die durch die Anderen vermittelte Selbstinteressiertheit, die die »amour propre« im Unterschied zur bloßen »amour de soi« darstellt, verliert für Rousseau auch dann nicht ihre Maßlosigkeit und Ungesättigtheit, wenn sie dank der Einsicht in die gemeinsame Abhängigkeit die Form einer wechselseitigen Achtung unter Gleichen angenommen hat. Es macht den anthropologischen Realismus Rousseaus aus, wie vor allem Frederick Neuhouser herausgearbeitet hat,[34] dass er den Einzelnen nach dem Verlust der genügsamen Selbstliebe auch ein stetes Verlangen beibehalten lässt, als ein besonders ausgezeichnetes Individuum im Kreis seiner Gemeinschaft anerkannt zu werden; daher kann der vergesellschaftete Mensch sich nicht damit zufrieden geben, nur als ein Gleicher unter Gleichen im republikanischen Gemeinwesen zu zählen, sondern muss darüber hinaus nach einer sozialen Wertschätzung streben, die Fähigkeiten und Eigenschaften gilt, die ihn von allen anderen wiederum unterscheiden.[35] Der Grund für diesen Überschuss im Anerkennungsstreben, der Rousseau dazu nötigt, im Contrat Social noch nach zusätzlichen Quellen der persönlichen Bewährung und Reputation Ausschau zu halten, 33hängt letztlich mit der Struktur des Selbstverhältnisses zusammen, durch die die »amour propre« charakterisiert sein soll: Weil wir in einer solchen Einstellung alle Maßstäbe der Selbstbeurteilung verloren haben, die quasi aus unserer natürlichen Bedürftigkeit stammen, können wir unsere wahren Verdienste und Vorzüge nur noch im Spiegel derer einschätzen, die zusammengenommen die »öffentliche Meinung« oder den »generalized other« bilden; die Unsicherheit darüber, ob im Lichte solcher öffentlicher Urteile unsere Leistungen tatsächlich angemessen gewürdigt werden, wird selbst dann noch bestehen bleiben, wenn wir als Miturheber der »volonté générale« am Zustandekommen der allgemeinverbindlichen Wertmaßstäbe beteiligt sind; um möglichen Fehleinschätzungen unserer Persönlichkeit vorzubeugen, sind wir daher auch unter Bedingungen gleicher Achtung noch dazu genötigt, nach einer Anerkennung zu streben, die uns allen anderen gegenüber herausgehoben sein lässt. Im Unterschied zu Adam Smith, der sich den externen Beobachter als so weit verallgemeinerbar hat vorstellen können, bis er alle Züge des Willkürlichen verliert und sogar mit der Vernunft als solcher zusammenfällt,[36] kann Rousseau an eine derartig vollständige Rationalisierbarkeit des allgemeinen Richters nicht glauben; für ihn birgt das Fremdurteil, dem der Einzelne im Selbstverhältnis der »amour propre« ausgesetzt ist, stets so stark die Gefahr der Verkennung in sich, dass er ein vorsorgliches Streben nach besonderer Wertschätzung nicht nur für weitverbreitet, sondern auch für kulturell gerechtfertigt hält.
Andererseits bleibt für Rousseau dieses Risiko der Verkennung, womit nicht einfach eine Missachtung individueller Verdienste, sondern deren kognitive Nicht-zur-Kenntnisnahme gemeint ist, auch ein ständiger Stachel der Beunruhigung; dass die soziale Umwelt sich über die wahre Natur des Einzelnen täuschen kann und besondere Anlagen erst gar nicht zu erkennen vermag, hält er für die 34eigentliche Gefahr, die mit dem zivilgeschichtlichen Übergang von der »amour de soi« zur »amour propre« heraufbeschworen wird.[37] In dieser Diagnose, die ein leicht zu übersehendes, sich erst später deutlicher herausschälendes Herzstück der Anerkennungstheorie Rousseaus bildet, haben sich die Bezugspunkte der Abhängigkeit vom Anderen unmerklich vom Moralischen ins Epistemische verschoben: Die verinnerlichte Instanz der öffentlichen Meinung, von der der Einzelne in seiner Selbstbewertung abhängig ist, tritt jetzt nicht länger als ein moralischer, sondern als ein theoretischer Richter auf, der darüber zu urteilen hat, welche Eigenschaften ein Subjekt tatsächlich besitzt. Mit dieser Verschiebung ändert sich natürlich auch die Art des Verhaltens, zu der der Mensch in der Einstellung der »amour propre« jeweils angestachelt wird: Muss er seinen sozialen Wert und seine individuellen Fähigkeiten demonstrieren können, solange der »generalized other« eine moralische Instanz bildet, so hat er bei der Verinnerlichung eines epistemischen Richters zu beweisen, über welche Verdienste und Anlagen er in Wirklichkeit verfügt.
Es kann mit Blick auf seine Schriften als eher unwahrscheinlich gelten, dass Rousseau sich über dieses Oszillieren zwischen einem moralischen und einem epistemischen Verständnis der »amour propre« selbst hinreichend Rechenschaft abgelegt hat; überall dort, wo er den Virus der Geltungssucht behandelt und als Therapie eine republikanische Gesinnung des egalitären Respekts empfiehlt, überwiegt gewiss eine normative Vorstellung des generalisierten Anderen, sobald er jedoch auf das eigentliche Unheil der Abhängigkeit vom Anderen zu sprechen kommt, schiebt sich häufig unversehens das epistemische Modell in den Vordergrund. In dieser Gestalt einer verinnerlichten Instanz nicht der moralischen Bewertung, sondern der theoretischen Beurteilung hat die »amour propre« Rousseaus auf die Entwicklung der französischen Philoso35phie eine enorme Wirkung ausgeübt; bis hin zu Sartre und Lacan finden sich hier Reste der Vorstellung, dass mit der Angewiesenheit auf soziale Anerkennung unverbrüchlich der Umstand verknüpft ist, im Kern der eigenen Subjektivität »kognitiv« verkannt zu werden.[38] Für Rousseau aber bietet die epistemische Vorstellung eines »inneren Richters« immer wieder den Anlass, sich theoretisch mit der radikalen Alternative zu beschäftigen, das Selbstverhältnis der »amour propre« im Ganzen zu überwinden; vor allem seine autobiographisch getönten Schriften kreisen beständig um die Möglichkeit, eine individuelle Haltung zurückzugewinnen, für die die soziale Anerkennung der eigenen Verdienste und Fähigkeiten jede existentielle Bedeutung verloren hat. In solchen Überlegungen kommt im Denken Rousseaus ein stoizistisches Motiv zum Tragen, das unverkennbar im Widerspruch zu seiner bislang dargestellten Auffassung steht, nach der wir als vergesellschaftete Wesen zwangsläufig der Anerkennung unseres sozialen Werts bedürfen.
Schaut man sich die Schriften an, in denen Rousseau das eigene Selbstverhältnis thematisiert, weniger die »Bekenntnisse« als vor allem die schon vom Titel her verräterische Studie Rousseau richtet über Jean-Jacques und die Träumereien eines einsamen Spaziergängers,[39] so fällt daran zunächst ins Auge, wie sehr in ihnen jeder Abhängigkeit vom Urteil Anderer abgeschworen wird; das gute und richtige Leben wird hier derart charakterisiert, dass es in der beständigen Suche nach einer inneren Ausgeglichenheit besteht, die nur zustande kommen kann, wenn dem begutachtenden Verhalten der sozialen Umwelt keine Aufmerksamkeit mehr 36geschenkt wird.[40] Schon dass der Autor Rousseau nur noch selbst über sein Alter Ego richten möchte, besagt ja, dass als erstrebenswertes Ziel ein Zustand gilt, in dem ich von Fremdzuschreibungen und mir selbst unverfügbaren Beurteilungen unabhängig geworden bin; meine Selbstachtung und mein Selbstbild sollen sich, will ich in Frieden mit mir leben, nur noch Charakterisierungen meiner Person verdanken, als deren Autor ich allein mich selbst begreifen kann. Als Gefährdung eines solchen Ideals der richterlichen Autarkie erscheint nicht an erster Stelle die Abhängigkeit von den moralischen Bewertungen der öffentlichen Meinung, sondern die von deren Urteilen über unsere Eigenschaften und Betätigungen; denn diese verleiten uns dazu, uns über unsere wahre Natur zu täuschen und damit zu verkennen, was wir an wertvollen Anlagen tatsächlich in uns tragen. Insofern kann es auch nicht verwundern, dass Rousseau im berühmten Fünften Spaziergang seiner Träumereien als Inbegriff existentiellen Glücks einen Zustand schildert, in dem der Autor in der bloß passiven Beobachtung natürlicher Vorgänge in Erfahrung bringt, welche Eigenschaften ihm wahrlich zukommen und welche Sorgen ihn wirklich umtreiben; weil die Natur nicht sprechen, keine Urteil über uns fällen kann, ist hier jeder Regung der »amour propre« der Nährstoff entzogen, so dass wir unbekümmert um Andere uns selbst zu erkennen vermögen.[41]
Rousseau hat zeit seines Lebens, wie vor allem seine späten Selbstbetrachtungen deutlich machen, zwischen einer entschiedenen Befürwortung und einer radikalen Zurückweisung der existentiellen Abhängigkeit vom Anderen geschwankt; in seinem Werk wird einerseits der Einsicht zum Durchbruch verholfen, dass menschliche Wesen ihr Selbstbewusstsein und ihre Handlungsfähigkeit der intersubjektiven Anerkennung verdanken, andererseits aber auch schon festgehalten, welche Gefährdungen mit diesem Ausgeliefertsein an die Urteilsfindung der sozialen Umwelt ver37knüpft sind. Auch wenn seine Unentschiedenheit letztlich damit zusammenhängen mag, dass er zwischen einem moralischen und einem epistemischen Verständnis der Anerkennung nicht klar genug unterschieden hat, so hat er mit ihr doch eine philosophische Debatte eröffnet, die bis heute nicht zum Abschluss gekommen ist; für beide der von ihm vertretenen Positionen, die der Überführung der »amour propre« in die symmetrische Anerkennung und die der Zurückweisung aller Abhängigkeit vom »generalized other«, finden sich immer wieder beherzte Parteigänger. Das Erbe, das Rousseau einer Theorie der Anerkennung hinterlassen hat, ist daher im höchsten Maße zweischneidig; wie bei einem Danaergeschenk holen sich die, die es annehmen und fortzusetzen versuchen, stets auch den Feind ins eigene Haus.
38Von der Armut unserer Freiheit
Größe und Grenzen der Hegelschen Sittlichkeitslehre
Keine andere normative Leitvorstellung besitzt heute größere Selbstverständlichkeit und Anziehungskraft als die Idee der individuellen Freiheit. Verfolgt man nur regelmäßig, wie Hegel es tat, die Berichterstattung in den Tageszeitungen, so wird einem schnell klar, welche Bedeutung dieser Wert gegenwärtig für die Motivierung oder Begründung sozialen Handelns besitzt: Mit Verweisen auf den Vorrang der individuellen Freiheit werden heute die Programme fast aller politischen Parteien ausgestattet, Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt legitimiert, rechtliche Reformen öffentlich gerechtfertigt, soziale Bewegungen aus der Taufe gehoben und selbst lebenswichtige Entscheidungen in persönlichen Beziehungen begründet. Gewiss, fast immer treten zu solchen Berufungen auf die Freiheit ergänzend noch andere Werte hinzu, die entweder als ihre zuträgliche Bedingung oder, seltener, als ihr Worumwillen gedacht werden – Freiheit ist nur unter Gleichen möglich oder setzt allgemeine Sicherheit voraus, so heißt es, weswegen Gleichheit oder sicherheitspolitische Maßnahmen notwendige, ermöglichende Voraussetzungen von Freiheit bilden, Liebe verlangt ungezwungene, freiwillige Zuwendung, so heißt es auch, weswegen die individuelle Freiheit um der Liebe willen geschätzt wird und dieser also als Voraussetzung dient; aber stets spielt in derartigen Argumentationen die Freiheit doch insofern die Schlüsselrolle, als ohne sie die ergänzend genannten Werte entweder gänzlich ihre anziehende Bedeutung verlieren oder aber in ihrer Attraktivität normativ unverständlich würden. Machen wir uns diese Zentralstellung des Werts der individuellen Freiheit für unser kulturelles und soziales Selbstverständnis deutlich, so kann nur immer wieder überraschen, wie wenig Klarheit über ihre begriffliche Bedeutung in gesellschaftlichen Zusammenhängen heute nach wie vor besteht; von der Freiheit wird öffentlich gesprochen, als existierte sie nur im Singular einer einzigen Vollzugsweise, obwohl wir doch wissen, ja förmlich sehen können, dass etwa zwischen der Freiheit der politischen Stellungnahme, der Freiheit des Vertragsschlusses auf dem Arbeitsmarkt und der, sagen wir, Freiheit der spontanen 39Vereinigung in der Liebesbeziehung gravierende Unterschiede bestehen.
Alle philosophischen Anstrengungen, hier begrifflich Abhilfe zu schaffen, indem zwischen verschiedenen Formen der Freiheit unterschieden wird, haben bislang ihr selbstgestecktes Ziel nicht erreicht; das gilt vor allem für die berühmte, von Isaiah Berlin getroffene Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit, die zwar philosophisch einigen Wirbel erzeugt hat, aber die für unser Selbstverständnis erforderlichen Differenzierungen schon deswegen nicht hat liefern können, weil sie in Hinblick auf die positive Seite phänomenologisch zu vage und missverständlich blieb.[1] Meine These in den folgenden Überlegungen wird es sein, dass Hegels Sittlichkeitslehre gegenüber solchen Versuchen die bis heute bessere und überzeugendere Alternative darstellt; sie bildet eine philosophische Quelle, die nach wie vor die Mittel bereithält, um uns über die verschiedenen Formen der von uns nicht nur praktizierten, sondern auch wertgeschätzten Freiheit begrifflich Klarheit zu verschaffen. Hegel hat seiner Konzeption der modernen Sittlichkeit neben vielen anderen Funktionen, über die zu sprechen sein wird, auch die theoretische Aufgabe zugewiesen, die Mitglieder moderner Gesellschaften über notwendige Differenzierungen in ihrem Freiheitsgebrauch zu unterrichten; ja, seine in der »Rechtsphilosophie« entwickelte Theorie des freien Willens lässt sich sogar als eine Unterweisung darüber verstehen, wie verschiedene Formen der individuellen Freiheit so unterschieden werden können, dass sie den ihnen angemessenen Platz im institutionellen Gefüge funktional differenzierter, moderner Gesellschaften erhalten können. Im Einzelnen will ich so vorgehen, dass ich in einem ersten Schritt zunächst darzulegen versuche, inwiefern Hegel mit seiner in der »Rechtsphilosophie« entwickelten Sittlichkeitslehre überhaupt die Absicht einer Differenzierung von verschiedenen Freiheitsformen verknüpft hat; schon das ist an sich keine leichte Aufgabe, weil Hegel ja mit seiner Idee der Sittlichkeit zuvorderst den Zweck zu verbinden scheint, eine gegen die aus der modernen, »freien« Sub40jektivität hervorgehende Dauerbefragung und -reflexion immune Sphäre institutioneller Verlässlichkeiten zu benennen, so dass der Zusammenhang mit der menschlichen Freiheit nicht ohne Weiteres auf der Hand liegt (I). Im zweiten Schritt will ich dann entwickeln, wie Hegel im Ausgang von seiner Willenstheorie zu den Bestimmungen gelangt, die ihn innerhalb der modernen Sittlichkeit verschiedene Formen individueller Freiheit unterscheiden lassen; hier hat sich zu beweisen, ob es tatsächlich gerechtfertigt ist, Hegels Sittlichkeitslehre eine auch heute noch wirksame Kraft zu unterstellen, die von uns praktizierten und erstrebten Freiheitsverständnisse begrifflich zu sortieren und jedem von ihnen einen institutionellen Ort zuzuweisen (II). Freilich besitzt die Hegelsche Sittlichkeitslehre auch einige Defizite, die sich zumeist daraus ergeben, dass er in ihr seine eigenen Absichten nicht immer konsequent genug beherzigt hat; auf diese Grenzen seiner Sittlichkeitskonzeption will ich im dritten und letzten Schritt zu sprechen kommen, um auch daran noch einmal die Frage nach Hegels Aktualität aufzuwerfen (III).
I.
Wie durchgängig in seiner »Realphilosophie«, also den auf die Erklärung von »Wirklichkeit« zugeschnittenen Teilen des ausgereiften Systems, führt Hegel auch in der Rechts- und Staatslehre, seiner Theorie des »objektiven Geistes«, die Begriffe in einer Doppelung von logischen Bestimmungen und phänomennahen Charakterisierungen ein, die bis heute zu den attraktivsten Zügen des von ihm entwickelten Unternehmens gehört. Schon Dieter Henrich hat darauf aufmerksam gemacht,[2] dass eine der herausragendsten Begabungen von Hegel darin bestand, bei allen Anstrengungen einer formalontologischen Erschließung der Realität die jeweiligen Entsprechungen in unserer natürlichen und sozialen Umwelt derart prägnant und erfahrungsgenau herauszuarbeiten, dass der Nachvollzug auch für den mit der »Logik« unvertrauten Leser möglich bleibt. Diese Fähigkeit, zugleich höchst abstrakt und doch konkret-diagnostisch zu denken, hat Hegel in seiner Rechts- und Staatslehre 41zum Soziologen avant la lettre gemacht; noch bevor überhaupt die Disziplin existierte, ist er zum großen, bis heute kaum übertroffenen Gesellschaftstheoretiker der Moderne geworden.
Bei dem Versuch, uns die Absicht und den Sinn der Idee der »Sittlichkeit« vor Augen zu führen, können wir uns die Doppelbedeutung aller von Hegel in seiner »Realphilosophie« verwendeten Begriffe zunutze machen. Zu ihrer logischen Seite hin stellt die Hegelsche Rechts- und Staatsphilosophie bekanntlich den Versuch dar, den Prozess der Realisierung oder Selbstverwirklichung der Bestimmungen der Vernunft auf der Stufe darzulegen, auf der sie sich in der Objektivität der gesellschaftlichen Wirklichkeit niedergeschlagen haben;[3] zur phänomenologischen oder Erfahrungsseite hin verknüpft Hegel mit dieser Darlegung aber die Absicht, uns diejenigen Phänomene unseres sozialen Daseins zu Bewusstsein zu bringen, die uns verstehen lassen, dass wir mit unseren Praktiken als Söhne und Töchter der Moderne aktiv an der Hervorbringung der vernünftigen Bestimmungen in der Gesellschaft beteiligt sind. Wollte man ein zeitgenössisches Programm der Gesellschaftstheorie bemühen, um den damit verbundenen Vorsatz deutlich zu machen, so ließe sich vielleicht sagen, dass Hegel an unseren »kollektiven« Status- und Funktionszuweisungen diejenigen hervortreten lassen möchte, in denen Entsprechungen der allgemeinen, organismusartigen Eigenschaften der übergreifenden Vernunft zu erkennen sind.[4] Nun setzt Hegel allerdings, wie wir wissen, bei seiner doppelseitigen Analyse der modernen Gesellschaft einen langwierigen Prozess der geschichtlichen Entwicklung schon voraus, der überhaupt erst dazu geführt haben soll, dass wir zum damaligen Zeitpunkt, also um 1800, mit institutionellen Voraussetzungen rechnen können, in denen sich die Bestimmungen der Vernunft widerspiegeln; insofern muss man, will man die Absicht seiner Rechts- und Staatsphilosophie verstehen, stets mitbedenken, dass sie erst an dem historischen Punkt mit der Erklärung einsetzt, an 42dem durch vorausgegangene Gärungsprozesse die gesellschaftliche Wirklichkeit schon soweit vernünftig geworden ist, dass in ihr die sozialen Praktiken und Institutionen als Verkörperungen von logischen Bestimmungen des Geistes begriffen werden können.[5]