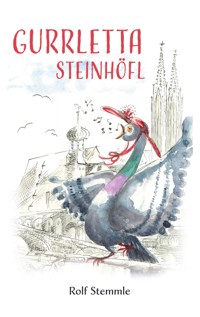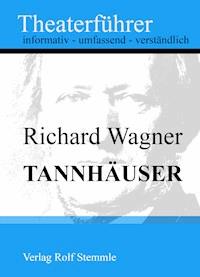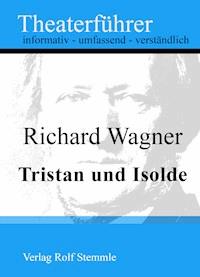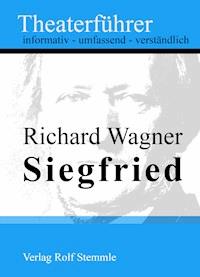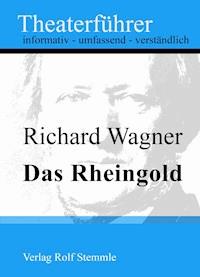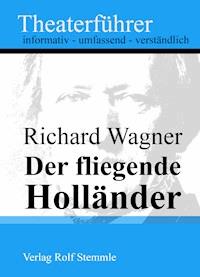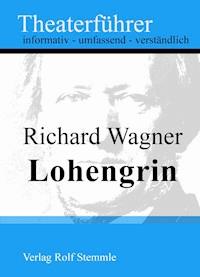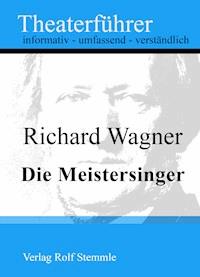Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Rennplatz-Geheimnis Spurensuche in der Vergangenheit 1969. Das wild-idyllische Gelände des Rennplatzes im Regensburger Westen ist für den 16-jährigen Gymnasiasten Jürgen ein kreativer Rückzugsort. Und er macht sich hier Gedanken über den Ursprung von unbegreiflichen Konflikten, die seine Familie überschatten. Denn niemand spricht darüber. Sein Heim ist von Wohlstand und Behaglichkeit ummantelt. Als er hört, dass vor gut zwei Jahrzehnten eine Fabrik für Kampfflugzeuge an das Gelände grenzte, beginnt er sich für die Kriegsjahre zu interessieren. Der Stallbursche Alois, mit dem er sich anfreundet, hat 1943 einen verheerenden Bombenangriff miterlebt und dabei seine Freundin verloren. Alois hängt an dem Glauben, die Leiche der jungen Frau liege noch in einem versteckten Keller. Verbirgt sich auch der Ursprung der Familienkonflikte in der Kriegsvergangenheit? Um die Geheimnisse aufzudecken, begibt er sich mit Alois auf Spurensuche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Kapitel 19.
Kapitel 20.
Kapitel 21.
Kapitel 22.
Kapitel 23.
Kapitel 24.
Kapitel 25.
Kapitel 26.
Kapitel 27.
Über den Autor
1.
Zwischen der zweiten und dritten Strophe von „Behind the Curtain“ hatte ich ein Solo. Der Song stammte aus meiner Feder, und mit meiner Bassgitarre konnte ich nun eine Minute lang zeigen, dass in mir ein echter Profi schlummerte. Ich bog mich mit dem Sound, als sei ich John Lennon höchstpersönlich.
Haralds Vater feierte seinen Geburtstag. Ich glaube, es war sein 42ster.
Die Fröhlichs besaßen ein Reihenhaus in der Kurt-Schumacher-Straße im Regensburger Westen, nur ein paar hundert Meter entfernt vom Einfamilienhaus meiner Familie. Im Keller hatten sie einen Partyraum eingerichtet; mit einer Bar, die einem italienischen Strandkiosk ähnlich sehen sollte. Auf der Fototapete im Hintergrund blickte man hinaus aufs Meer der Adria.
Haralds Vater war interessiert an dem, was sein Sohn und dessen Freunde auf die Beine stellten. Und ihm gefiel die Musik, die in den Hitparaden gespielt wurde; die Beatles natürlich, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival, deutsche Schlager von Roy Black, Michael Holm und Peter Alexander. Heintjes „Mama“ und Heinos „Die Sonne von Mexiko“ hingegen fand er schnulzig. Damit lag er auf meiner Linie.
Anstatt irgendwelche Schallplatten aufzulegen, hatte er uns engagiert – die „Bonanzas“. Für zehn Mark pro Nase. Das war die erste Gage, die ich je in meinem Leben bekommen habe!
Harald spielte seit zwei Jahren Schlagzeug und besaß ein sicheres Rhythmusgefühl, das uns zwei Gitarristen in kritischen Momenten einfing und in den herrschenden Takt zurückbrachte. Roland war der erste Gitarrist, der auch sang; ich lieferte mit meiner Gitarre die Bassstimme.
Wir waren schon da und dort bei Schulfeiern und Geburtstagen von Kameraden aufgetreten und verfügten über ein beachtliches Repertoire, das wir ständig erweiterten. An diesem Abend erklang erstmals „Seemann, weit bist du gefahren“ von Freddy Quinn; außerdem unser neuer Song „Flieg wie die Wolken“, zu dem ich, als Songwriter der Band, den Text geschrieben hatte.
Den Partykeller kannten wir bestens. Jeden Mittwoch fanden hier die Bandproben statt. Dazu durften wir uns so viel Limo, wie wir wollten, aus dem Speisekellerraum holen. Harald hatte aber hinter allem möglichen Gerümpel ein geheimes Bierflaschen-Lager eingerichtet, aus dem wir uns sehr viel lieber bedienten.
Eigentlich hätte das an diesem Abend ein starker Auftritt werden können. Er begann auch so. Allerdings konnten wir uns von Anfang an nicht so locker geben wie sonst. Ich dachte, das läge an unserer Aufregung, vor 20 Erwachsenen zu spielen.
„Flieg wie die Wolken“, das wir am Ende der ersten Tanzrunde als eine Uraufführung ankündigten und tadellos spielten, erhielt großen Applaus.
In der folgenden kleinen Pause ging ich an die Adria-Strandbar, um mir von Haralds Schwester Andrea eine Cola einschenken zu lassen. Ich redete mit ihr ein bisschen. Sie gefiel mir, besonders ihre rehbraunen Augen. Dazu kam ihr meist ironischer Tonfall. Ich konnte nie recht einschätzen, was sie von mir hielt. Sie sprach herzlich mit mir; aber womöglich nur deshalb, weil ich ein enger Freund ihres Bruders war.
Sie besuchte die Judenstein-Realschule, 8. Klasse. Im Westen wohnten viele Lehrer. Ihr Erdkundelehrer war mein Nachbar. Gmeiner hieß er. Wir mochten ihn beide nicht, daher rissen wir eine Weile böse Witze über ihn.
„Nächste Klasse werde ich ihn Gott sei Dank nicht mehr haben“, erzählte Andrea schließlich.
Ich scherzte: „Das kannst du nicht wissen! Der ist ein Zeck, den kriegst du nicht so leicht los!“
„Nein! Hat dir das Harald nicht gesagt?“
„Was?“
Sie schenkte sich selbst eine Cola ein und verzog ihr Gesicht. „Wir ziehen weg.“
Das schlug in meinen Magen wie ein Meteorit. „Also doch!“. Harald hatte vor etwa drei Monaten davon gesprochen, dass sein Vater möglicherweise eine neue Stelle in München bekommen würde. Er arbeitete bei der Polizei. Da Harald das Thema nie wieder angesprochen hatte, meinte ich, es sei vom Tisch. Jetzt also plötzlich doch nicht!
„Nein, Harald hat nichts erzählt!“, sagte ich knapp.
„Mein Vater wird befördert, muss dafür aber nach München.“
Tja, das war’s dann, dachte ich. Damit hatten die letzten Stunden der Band geschlagen. Harald spielte so gut, dass er nicht zu ersetzen war.
Andrea wusste, was durch meinen Kopf wanderte. „Mann, lass dich davon nicht unterkriegen. Roland und du, ihr findet doch wieder einen Schlagzeuger!“
„Na ja, hoffentlich.“ Mehr brachte ich nicht hervor. Ich verabschiedete mich mit einem kurzen Nicken von Andrea und ging zurück zu meinen Bandkollegen.
Harald hatte offenbar mein Gespräch mit seiner Schwester aus der Ferne beobachtet. Er wusste sofort, wie er meine düstere Miene interpretieren musste, und versuchte, mich zu beschwichtigen. „Da finden wir schon eine Lösung!“
„Schöne Scheiße!“ Ich war sauer auf ihn, weil ich die Neuigkeit von seiner Schwester hatte hören müssen.
Roland kam von der Toilette. „Was ist denn los?“
„Ich hätte es euch früher sagen sollen“, stammelte Harald, „aber ich wollte euch den Auftritt nicht versauen.“
„Hast du aber!“, fauchte ich.
Roland zischte: „Kann ich jetzt bitte mal erfahren, was passiert ist?“
„Mein Vater wird befördert. Er kriegt eine besser bezahlte Stelle – in München allerdings. Irgendwann im Sommer. – Ihr findet doch garantiert einen Ersatz für mich. Ich kenn einen irre Schlagzeuger aus der Parallelklasse, den Sebastian.“
Ich rollte mit den Augen. Diesen Sebastian kannte ich! Der war ein unerträglicher Angeber und ein vollkommener Idiot. Es grenzte an eine Beleidigung, dass Harald ausgerechnet ihn vorgeschlagen hatte. Aber einen anderen gab es wohl nicht!
„Sebastian!“, schimpfte ich, „Das ist doch nicht dein Ernst!“
Roland war unterdessen still und rot geworden. Hatte er ebenfalls was zu beichten? Ja, hatte er.
„Na ja“, begann er zögernd. „Es ist so: Ich hab die letzte Schulaufgabe in Englisch in den Sand gesetzt. Mein Vater hat Panik, dass ich durchfliege. Und dann ist ja auch noch Margit.“ Roland hatte seit kurzem eine Freundin. „Wir brauchen natürlich ein bisschen Zeit füreinander ...“
Harald grinste. Er stellte sich wohl gerade vor, wofür Roland und Margit die gemeinsame Zeit verwendeten. Ich hingegen kämpfte gegen Tränen, die hervorquellen wollten.
„Jedenfalls hat mein Vater gesagt, ich müsse mich entscheiden. Schule, Freundin und Band sei einfach zu viel!“
„Na klar!“, sagte ich leise. „Man kann sich nicht gegen die Schule und die Freundin entscheiden.“ Das verstand ich, obwohl ich noch keine Freundin gehabt hatte.
Roland zuckte verlegen mit den Schultern. „Ja, klar, das geht halt nicht.“
Auch Harald zuckte mit den Schultern. Er zeigte seine Ratlosigkeit.
Wir spielten schließlich die zweite Tanzrunde, dann die dritte, die vierte und so weiter. Unsere Stimmung war am Boden. Aber die Partygäste merkten nichts davon. Wir gaben uns große Mühe und wir waren bereits erfahren genug, um nach außen wie eine Profiband wirken zu können.
2.
Ich bin unschlüssig, was ich jetzt tun soll. Eine ältere Frau mit einem Dackel geht vorüber. Ich stehe auf dem Hauptplatz des Rennplatz-Einkaufszentrums. Es wurde vor ein paar Wochen eröffnet, und ich bin zum ersten Mal hier. Linkerhand das Chinesische Restaurant, rechts eine Metzgerei, vor mir die Parkplätze, hinter mir eine Ladenpassage samt Ärztehaus. 1995. Kaum zu glauben: 26 Jahre sind seit jenem Abend im Partyraum in der Kurt-Schumacher-Straße vergangen, und gerade eben war der Schmerz dieses Tiefschlages so stark zu spüren, als habe er mich erst vor wenigen Minuten getroffen.
Seit seinem Wegzug hatte ich Harald nicht mehr gesehen. Bis gestern, Samstagabend, beim Klassentreffen im Brandlbräu in der Ostengasse. Wir hatten uns völlig aus den Augen verloren. Aus ihm ist ein Münchner geworden. Unverkennbar. Er folgte seinem Vater zur Polizei und bekleidet mittlerweile ein hohes Amt im Innenministerium. Über weitreichende Entscheidungen und Maßnahmen erzählt er so selbstverständlich, wie man es nur tun kann, wenn man an einem zentralen Ort arbeitet.
Heute, am Sonntag, sind wir zu zweit zum Mittagessen gegangen, zum Chinesen im Rennplatzzentrum. Er liegt nur ein paar hundert Meter entfernt von Haralds ehemaligem Elternhaus. Darum wollte er speziell in dieses Restaurant – nachdem er gehört hatte, was aus dem Rennplatz von damals geworden war. Für einen Verdauungsspaziergang war seine Zeit zu knapp. Er musste nach dem Essen rasch zurück nach München. Morgen ist eine Konferenz, für die er noch einen Tagesordnungspunkt vorzubereiten hat.
Nach dem Abschiedshandschlag stehe ich nun seit einer Weile vor einer Litfaßsäule und lese die Veranstaltungshinweise. Endlich lasse ich davon ab und wandere mit meinem Blick hinüber zur schmalen Allee am Rennweg, durch die früher die Hauptstraße führte. Längst wurde sie so sehr verbreitert, dass sie neben den Baumreihen verlaufen muss. Dann schaue ich zur Ladenpassage: ein Supermarkt, ein Zeitschriftenladen, eine Apotheke, ein Drogeriemarkt. Die Fassaden bestehen aus Glas, Metall und Stein, aber sie wirken freundlich und einladend. Ich bin erleichtert, dass man hier keinen Klotz aus düsterem Beton errichtet hat. Das hätte in diesen Stadtteil, dem jeder eine hohe Wohnqualität bescheinigt, auch nicht gepasst. Und vielleicht ist auch noch ein Hauch der Noblesse zu spüren, die von diesem ehemals fürstlichen Areal ausging.
Das Leben auf dem Rennplatz hatten über Jahrzehnte hinweg der Adel, die Stadtoberen und Spitzensportler bestimmt. Unzählige Trabrennen und Springturniere waren hier ausgetragen worden. Es wurde auf Siege gewettet, man überreichte Pokale und genoss die Reiterfeste in einer prächtig geschmückten Grünanlage. 1971, zwei Jahre nach jenem Partyabend, stellte das Haus Thurn & Taxis den Betrieb am Rennplatz ein. Die Gebäude wurden dem Verfall überlassen, später riss man sie ab.
Ich hatte das langsame Verschwinden des Rennplatzes beim regelmäßigen Vorbeifahren mitverfolgt. Über Jahre hinweg ragte noch der Schiedsrichtertum aus einem Weizenfeld. Dann rückten die Baufahrzeuge an und ein Wohngebiet entstand, das an seiner Südseite mit diesem Einkaufszentrum abschließt.
Ich habe an diesem Sonntagnachmittag Zeit, und das Wetter ist sonnig. Warum also nicht die neue Wohnanlage erkunden? Also spaziere ich los, durch die Ladenpassage, bleibe vor dem Schaufenster der Bücherwurm-Buchhandlung stehen, betrachte die Covers und folge dann weiter dem Weg. In der Mitte des „neuen“ Rennplatzes haben die Architekten einen länglichen Park mit Ahornalleen angelegt, umrahmt von einem Ring aus Mehrfamilienhäusern. Die Form zeichnet die ehemalige Rennbahn nach. Außerhalb dieses Ringes schließen sich kleinere Straßen mit weiteren Gebäuden, Gärten, Gehwegen und Grünflächen an.
In den späten Sechzigern, als das Ende des Rennplatzes abzusehen war und nur das Nötigste instandgehalten wurde, entwickelte das Gelände den Zauber des Morbiden, das einen Jugendlichen auf der Suche nach seinem richtigen Lebensweg in den Bann ziehen musste.
Auf meinem Sonntagsspaziergang entspanne ich mich immer mehr, löse mich vom Alltag. Die Erinnerungen, die beim Mittagessen mit Harald in Fluss gekommen sind, laufen weiter.
Immer, wenn ich nachdenken oder in Abgeschiedenheit einen Songtext schreiben wollte, verzog ich mich in die hölzerne Haupttribüne, die bei Turnieren den Eigentümern, der Familie Thurn und Taxis, und ihren Gästen vorbehalten war. In diesem überdachten Tribünenhaus mit seinen charakteristischen beiden Türmen traf ich mich auch regelmäßig mit Roland und Harald, um neue Songs zu planen oder einen Tag entspannt ausklingen zu lassen.
Aber an diesem Nachmittag hockte ich alleine da. Ich wollte niemanden sehen. Erst vor zwei Monaten, im Februar 1969, an meinem 16. Geburtstag, hatten wir gemeinsam große Pläne geschmiedet. Jetzt im April war der wichtigste Teil meines Lebens eingestürzt. Plötzlich und unwiederbringlich. Ich konnte Harald keinen Vorwurf machen. Niemand kann was dafür, wenn die Familie wegzieht? Und Roland konnte ich ebenfalls nicht böse sein. Er litt ja selber an den Zwängen und dem Dilemma, in das er geraten war.
Erst vor ein paar Tagen hatte ich mich mit Harald und Roland am Fuß der Haupttribüne getroffen, um ihnen einen neugeschriebenen Songtext vorzulesen.
Meine Texte handelten von Lagerfeuern, Freundschaft und Abenteuern, die immer wieder mit Ritten in glühende Sonnenuntergänge endeten. Die Liebe kam nur selten vor und sie war dann lediglich eine angenehme und vorübergehende Begleiterscheinung des Heldenlebens.
Sofort griff Roland die ersten Zeilen auf und improvisierte eine Melodie. Solche Melodien lagen meist sehr nahe an den Schlagern und Songs der Hitparade und den aktuellen Singles oder Langspielplatten. Harald begann mit den Zeigefingern auf das Tribünengeländer zu trommeln, und ich imitierte meine Gitarre und sang eine jazzige Basslinie. Und im Nu stand das Grundgerüst für eine neue Nummer. Tolles Material für die nächste Bandprobe.
Befriedigt verzogen wir uns schließlich in die oberen Bankreihen der Tribüne, wo wir etwas versteckter sitzen konnten. Roland brachte nämlich regelmäßig Zigaretten mit, die er über einen Klassenkameraden bezog. Und manchmal erhielt Harald von seinem volljährigen Bruder eine Flasche Rotwein, wenn er das gemeinsame Zimmer ein paar Stunden für sich und seine Freundin brauchte. Wir pafften Camels, tranken dazu den Wein – alle drei aus einer Flasche. Wir waren ja enge Kumpels, die „Bonanza-Band“, deren Hits man bald in allen Plattenläden kaufen können sollte.
Auf der Rennbahn galoppierte mehrmals ein Reiter mit seinem Pferd vorbei, und einer der Pferdepfleger, die hier allesamt „Stallburschen“ genannt wurden, flickte in der Nähe einen Zaun. Wir kümmerten niemanden. Außerhalb der Pferderennen des fürstlichen Hauses von Thurn und Taxis war das Gelände ein Freiraum, ein Paradies für spielende Kinder und träumende Jugendliche.
An diesem Tag nach der Geburtstagsparty von Haralds Vater, ein ereignisloser Sonntag, war alles plötzlich anders. Die Fürsten-Tribüne und die beiden Publikumstribünen standen zwar noch am selben Ort, die Holzgebäude warfen ihre Schatten auf die Wiese vor der Sandbahn, der Schiedsrichterturm auf der Grasfläche im Rennbahnring wartete geduldig auf das nächste Turnier, aber für mich hatte sich der Globus auf den Kopf gestellt.
Natürlich würde ich mich hier weiter mit Roland treffen können. Die Bezugsquelle von Camels gab es weiter. Wein war bestimmt auch über einen anderen Weg als Haralds Bruder zu bekommen. Doch wenn sich an die Gespräche keine gemeinsame Band-Arbeit mehr anschließen sollte, würde diesen Zusammenkünften der Sinn und die Kraft fehlen. Ja, wir waren Freunde, aber wollte ich denn die Geschichten über Rolands Beziehung mit Margit hören und womöglich um Rat gefragt werden? – Wo ich doch selbst keine Ahnung von dem Thema hatte. Oder wollte ich mit Roland Englischvokabeln lernen?
Ich saß auf der obersten Bankreihe und zerrupfte ein Blatt, das ich im Vorbeigehen von einem Strauch gerissen hatte. Ich blickte auf die Rennbahn, den Schiedsrichterturm und die Bäume und Werkshallen, die das Gelände Richtung Osten, Richtung Stadt, begrenzten. Zwischen zwei Bäumen waren die beiden Domtürme zu erkennen.
Ich hatte das Gefühl, mein Leben würde nicht mehr weitergehen. Dass nach dem Schulabschluss eine Unzahl von Studienfächern und Berufen auf mich warteten, dass jede Menge Mädchen auf der Suche nach einem Freund waren und dass für ein gutes Hobby immer Platz im Alltag ist, hielt ich für irrelevant. Für einen leidenschaftlichen Songschreiber und Gitarristen, dessen Begeisterung gerade mit der Band zu Grabe getragen werden musste, geriet das Leben an einem solchen Tag unweigerlich in eine Krise.
Bestimmt zwei Stunden hockte ich auf der Tribüne. Ein klarer Gedanke war nicht zu fassen.
Irgendwann fiel mir ein, dass es auf sechs Uhr zuging. Kurz nach sechs lief „Bonanza“ im ZDF. Sonntagabend. Ich wollte die Folge unbedingt sehen. Und meine Eltern sollten nicht bemerken, dass dieser Tag von anderen Tagen abwich. Das ging sie nichts an! Also brach ich auf und radelte nach Hause.
3.
Die heutige Folge von Bonanza hieß „Lynchjustiz“. Die Serie wurde in Farbe gedreht und seit etwa zwei Jahren auch in Farbe ausgestrahlt; aber wir hatten noch keinen Farbfernseher. Gelegentlich konnte ich die Abenteuer von Ben Cartwright und seinen drei Söhnen bei Harald anschauen. Die hatten immer die neuesten technischen Geräte. Doch die Familie von Harald war sicher nach dem Partyabend mit Aufräumen beschäftigt; und außerdem wollte ich heute keinem von der Band begegnen. Mein Vater hatte fest vor, zu Weihnachten einen Farbfernseher zu kaufen. Meine Eltern liebten die Samstagsshow „Einer wird gewinnen“ mit Hans Joachim Kulenkampff. Da immer mehr Nachbarn und Kollegen von den farbenprächtigen Kulissen schwärmten, wollten sie nicht länger als die Rückständigen gelten.
Die Bonanza-Episode zog an mir vorbei, ohne dass sie mich mitriss. Das lag nicht an der Geschichte, die war gut! Es lag an meiner Laune. Ich fläzte in der Couchgarnitur und glotzte unbewegt auf den Bildschirm. Ich hoffte, die Folge würde ewig dauern, denn mir stand das Abendessen mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester Birgit bevor.
Untertags war ich ihnen glimpflich ausgekommen. Meine Eltern waren schon um zehn Uhr zu einer Wanderung mit ihren Freunden Siegbert und Ruth aufgebrochen. Natürlich hätte ich mitwandern können und sollen, aber sie mussten hinnehmen, dass ich nach dem gestrigen Bandauftritt ausschlafen wollte. Birgit machte Abitur und lernte unentwegt. Den Nachmittag verbrachte sie bei einer Freundin, um mit ihr gemeinsam Mathe-Aufgaben zu lösen.
Inzwischen waren alle zurück, und der gewohnte Ruf meiner Mutter schallte durch das Haus: „Abendessen ist fertig!“ Sie wusste, wie lange „Bonanza“ dauerte, und nahm auf meine sonntägliche Fernsehgewohnheit Rücksicht. Die Schlussmusik setzte soeben ein, ich quälte mich von der Couch und schaltete den Fernseher ab.
Meine Schwester sprang die Treppe vom ersten Stock herab, mein Vater kam aus dem Keller. Er saß oft stundenlang im Hobbyraum bei seinen Modell-Bausätzen. Gerade klebte er die Plastikteile eines deutschen U-Bootes aus dem Zweiten Weltkrieg zusammen.
Wir verteilten uns auf unsere Stammplätze am Küchen-Esstisch. Ich hatte meinen Platz auf der kürzeren Seite der Eckbank, also an der hinteren Breitseite des Tisches. Birgit kümmerte sich um die Getränke, brachte Vater eine Flasche Bier und für uns Jugendliche weißes Limo. Meine Mutter trank Mineralwasser.
Sie hatte Bratkartoffeln mit Spiegeleiern gemacht. Es war ungewöhnlich, dass es am Sonntagabend warmes Essen gab, aber meine Eltern hatten sich bei ihrer Wanderung mit Ruth und Siegbert nur mit Käse- und Wurstbroten verpflegt. Damit hatten sie die Einkehr in ein Wirtshaus eingespart. Onkel Siegbert verdiente als Bahn-Schaffner wenig, und unsere Familie hatte sich für unser neues Haus verschuldet. Eine hohe Summe, wie Vater beteuerte, die hohe Tilgungsraten nach sich zog.
Meine Eltern erzählten von ihrem Ausflug durch den „Fürstlichen Thiergarten“ östlich von Donaustauf. Bis nach Altenthann waren sie gekommen. Onkel Siegbert hatte wie üblich sein Pflanzenbestimmungsbuch dabei, und tatsächlich waren sie da und dort auf seltene Blumen gestoßen. Sie zählten einige auf. Ihre Namen sagten mir nichts, und ich habe sie mir auch nicht gemerkt.
Birgit und ich nannten Ruth und Siegbert „Tante“ und „Onkel“, obwohl wir nicht mit ihnen verwandt waren. Onkel Siegbert war ein Jugendfreund von Vater, und der Kontakt war nie abgerissen. Als er das erste Mal in meinen Kinderwagen geschaut hat, wird mein Vater wohl zu mir gesagt haben: „Schau, das ist Onkel Siegbert!“ Seitdem war er dem Namen nach mein Onkel. Und Ruth, die er bald nach meiner Geburt geheiratet hatte, wurde ganz selbstverständlich zu meiner „Tante“.
„Und, wie ist es mit dem Lernen gegangen?“, wollte mein Vater schließlich wissen. Die Frage richtete sich an meine Schwester.
Birgit antwortete: „Ich war bei Ute.“
„Wie geht es dem Pythagoras?“
„Den haben wir im Griff!“
„Sehr gut! Der ist wichtig!“
Es drängte auch mich, irgendeinen Lernerfolg kundzutun. „Ich habe Latein gebüffelt.“ Das war natürlich gelogen. In Wahrheit war ich ewig nicht aus dem Bett gekommen und hatte über das Ende der Band nachgedacht. Zu-nächst zuhause, dann auf dem Rennplatz. Dabei hätte ich mich auf den Hosenboden setzen sollen. Latein war immer mein Horror gewesen. Mir drohte im Jahreszeugnis eine Sechs.
Mein Vater nickte anerkennend.
„Mag noch jemand Kartoffeln?“, rief meine Mutter. Mein Vater hielt ihr den Teller entgegen, und auch ich hatte noch Hunger. Während sie meinen Teller entgegennahm, fragte sie: „Wann hast du die nächste Schulaufgabe?“
„Irgendwann übernächste Woche.“
Mein Vater sah mich an. „Das ist kein gutes Zeichen, wenn du es nicht genau weißt.“
„Doch, ich weiß es“, behauptete ich. „Am Donnerstag.“
Meine Mutter reichte Vater den Teller zurück.
Mein Vater bohrte weiter: „Hast du dazwischen noch einen Auftritt mit deiner Band?“
Das Thema kam ungünstig. „Nein“, sagte ich rasch und empfing den Teller mit der zweiten Portion Bratkartoffeln aus der Hand meiner Mutter. „Wieso?“, wollte ich unwillkürlich wissen.
„Dann kannst ja den Mittwochabend statt für die Bandprobe für Latein nützen“, meinte mein Vater.
Ich antwortete nichts. Ich nickte nur betroffen.
Birgit grinste. Sie war der Meinung, ich sei faul. Daher gab sie wortlos meinem Vater Recht.
Meine Mutter setzte sich an den Tisch. „Wir haben heute mit Ruth und Siegbert über deine Situation gesprochen ...“ Sie wusste, weshalb Vater so nachdrücklich an mir herumnörgelte. Nun kapierte ich es ebenfalls.
„Welche Situation?“, fragte ich verärgert zurück.
Meine Mutter versuchte, mich zu besänftigen: „Wir haben nur zufällig über das Thema Schule geredet.“
Mein Vater übernahm erneut das Wort: „Aber es ist gut, dass wir darauf gekommen sind. Ich habe mir über deine berufliche Zukunft natürlich immer wieder Gedanken gemacht, aber Siegbert hatte heute ganz Recht. Er meinte, wir sollen einen Plan B entwickeln und in Angriff nehmen.“
„Es ist ja nur zu deinem Besten“, sagte meine Mutter sanft.
Ich stocherte in den Bratkartoffeln herum. „Und wie soll so ein Plan B ausschauen?“
„Jürgen“, erklärte mein Vater, „wenn du wegen Latein durchfällst, dann ist für mich klar, dass du für das Gymnasium nicht geeignet bist. Dann werden die Jahre bis zum Abitur eine Quälerei für Mutter, mich und dich. Es ist dann gescheiter, wenn du eine Lehre machst.“
„Versicherungskaufmann ist ein guter Beruf!“, meinte meine Mutter.
Ich warf die Gabel auf den Teller.
Meine Mutter reagierte sofort. „Jürgen, pass auf den Teller auf.“
„Ich habe mir anfangs auch nicht vorstellen können, in einer Versicherung zu arbeiten“, sagte Vater, „aber dein Opa hat gewusst, dass ich mich dort zu meiner Zufriedenheit einleben und bewähren würde. Und, Jürgen, wir haben einen Trumpf in der Hand. Noch! Dr. Leber geht im Dezember in den Ruhestand. Er wird die Personalentscheidung unterstützen. Diesen Vorteil sollten wir nicht verfallen lassen!“
Meine Mutter merkte, wie mir jetzt zumute war. „Natürlich sollst du weiter versuchen, das Gymnasium zu schaffen“, sagte sie. „Ich denke, du wärst ein großartiger Lehrer! Aber wenn nicht, dann hast du einen Plan B. Schau dir das doch mal an!“
„Ich werde morgen Dr. Leber fragen, ob du dich vorstellen darfst.“
„Ich weiß, du bist ein musischer Mensch“, fügte Mutter hinzu. „Ich bin davon überzeugt, dass du nebenbei noch genügend Freizeit hast.“
Mein Vater mahnte: „Unterschätzt das nicht!“
„Aber sicher sehr viel mehr als in den Jahren vor dem Abitur!“
Die Augenpaare von Mutter und Vater waren gegen mich gerichtet wie die Pistolen von Bankräubern. Sie erwarteten eine Antwort von mir, und zwar die gewünschte.
Ich hatte keine Gegenargumente, weil ich im Grunde an mein Abi selbst nicht mehr glauben konnte. Also nickte ich ein wenig. Das reichte meinen Eltern, um eine einsichtige Zustimmung herauszulesen.
„Also, ich rede morgen mit Dr. Leber!“, resümierte mein Vater. Und meine Mutter überraschte uns mit Rhabarberkompott aus Onkel Siegberts Schrebergarten.
4.
Ich genoss das Alleinsein. Seit wir vor vier Jahren aus einer engen Altstadtwohnung hierher in unser Haus in der Annahofstraße gezogen waren, besaß ich ein eigenes Zimmer. Vorher hatte ich das Zimmer mit Birgit teilen müssen. Ich kann heute gar nicht mehr glauben, dass wir das über viele Jahre hinweg ausgehalten haben!
Mein neues Zimmer hatte bescheidene Ausmaße, bot jedoch einen schönen Ausblick in unseren Garten. Auch der war nicht besonders groß, doch zumindest konnten durch ihn die neugierigen Blicke von Erdkundelehrer Gmeiner und seiner Frau auf Abstand gehalten werden. Die jungen Sträucher und Obstbäume taugten noch nicht als wirksamer Sichtschutz. Meine Schwester träumte bereits vom Oben-Ohne-Sonnenbaden. Meine Eltern wären vor Entrüstung explodiert, wenn sie das gewusst hätten.
Meine Gitarre lag gewöhnlich irgendwo im Zimmer; auf dem Bett, auf dem Boden vor dem Kleiderschrank, quer über dem Schreibtisch, oder sie lehnte am Nachtkästchen oder am Schallplattenregal mit dem Plattenspieler. Nach meiner Rückkehr gestern Nacht hatte ich sie auf den Kleiderschrank geschoben. Ihr Anblick hätte mich gequält, und so war ich heute froh, dass ich sie nicht sehen konnte. Ich legte die „Help!“-LP der Beatles auf, warf mich aufs Bett und starrte gegen die Decke.
Ein Scheißtag! Ein richtiger Scheißtag! Die Bonanza-Band im Graben, die Schulaufgabe in Latein drohte wie eine schwarze Wolkenwand nach einem schwülen Sommertag, und mein Vater wollte morgen mit Dr. Leber sprechen! Versicherungskaufmann! Wenn ich mir einen Beruf vorstellen konnte, dann war das Gitarrist in einer Band, notfalls auch Tontechniker. Und wenn es unbedingt sein sollte: Musiklehrer. Aber meine Vorstellung von einem Versicherungskaufmannsleben zwängte mich in einen grauen Anzug weit unterhalb meiner Konfektionsgröße, die Krawatte schnürte mir die Kehle ab.
Aus den Boxen meiner Stereoanlage tönte unterdessen die himmlische Musik der Beatles.
Das durfte alles nicht wahr sein!
Es dauerte nicht lange, da klopfte es an der Tür und sofort danach steckte meine Mutter den Kopf herein. Sie machte es immer so. Aus Höflichkeit klopfte sie, wartete aber niemals eine Antwort ab, öffnete, forschte ins Zimmer, blieb dann von der Schulter abwärts vor der Tür, um zu demonstrieren, dass sie meine Privatsphäre achtete.
„Hast du die Zähne schon geputzt?“, fragte sie.
„Nein, mache ich gleich“, gab ich mürrisch zurück.
„So meine ich das nicht. Es ist Kompott übrig! Magst du den Rest haben? Aufheben lohnt sich nicht.“
Ich nickte.
Sie verschwand aus der Tür. Die Schüssel hatte sie auf dem Flurschränkchen abgestellt und brachte sie kurz darauf herein. Nun stand Mutter im Zimmer und hielt mir die Schüssel samt Löffel entgegen. Ich setzte mich auf und nahm ihr die Speise ab.
„Wieso hast du die Gitarre auf den Schrank gelegt?“
Unglaublich, mit welchem Spionageblick sie das Zimmer so rasch inspiziert hatte! Das geübte Auge einer Mutter, die jede Veränderung innerhalb der Familie unverzüglich erkennen wollte, war wieder erfolgreich gewesen! Ihre Fähigkeit löste in mir widersprüchliche Gefühle aus. Als Jugendlicher musste ich diese Aufmerksamkeit als lästige Neugierde verteufeln, an manchen Tagen aber, an solchen Scheißtagen, war ich doch auch froh, dass es eine Mutter gab, die meine Missstimmung bemerkte und darauf reagierte. Ihr Spionageblick entsprang ja in den allermeisten Fällen ihrem Begehren, für die Familie und ihre Mitglieder alles zum Guten zu wenden.
Ich stellte die Kompottschüssel auf mein Nachtkästchen, wo „Der Schatz im Silbersee“ lag.
„Die Bonanzas werden sich auflösen“, erklärte ich. Ich schaffte es nicht, eine weinerliche Färbung aus meiner Stimme herauszuhalten.
„Habt ihr euch gestritten?“
„Nein. Der Papa von Harald bekommt eine Stelle in München.“ Ich hätte gerne verschwiegen, dass auch Roland aus Zeitgründen aufhören musste, weil man es ja als minderjähriger Sohn vermeiden will, strenge Erziehungsentscheidungen anderer Eltern ins eigene Elternhaus einzuschleppen, aber meine Mutter hatte ein subtiles Gespür, solche Erzähllücken zu erkennen.
„Dann mach doch erst mal mit Roland weiter. Oder gibt es da auch ein Problem?“
Der liebevolle Tonfall meiner Mutter öffnete meine Schleuse: „Der hat ja jetzt eine Freundin, und sein Vater meint, dass ihm Band und Freundin neben der Schule zu viel werden könnten.“
Mutter setzte sich neben mich auf die Matratze. Sie fuhr durch mein Haar, wie sie das immer tat, wenn sie eine besonders vertrauensvolle Atmosphäre schaffen wollte. „Ja, um eine Freundin muss man sich kümmern, sonst ist sie gleich wieder weg. Das wirst du noch lernen, und dann wirst du auch Herrn Urban verstehen, dass er Roland nur vor Ärger mit der Freundin bewahren will. Und vor schlechten Schulnoten.“
„Aber ich habe keine Freundin, und die Bonanzas sind mir eben sehr wichtig!“
„Komm, Jürgen!“ Sie griff erneut in meine Scheitelhaare und rüttelte meinen Kopf. „Das verstehe ich doch! Ich hatte mal eine gute Freundin, die war eine Meisterin im Stricken. Bald war ich ebenfalls ganz versessen auf das Stricken. Aber dann musste sie ins Internat, und ich hatte niemanden mehr, mit dem ich meine Leidenschaft teilen konnte. Also habe ich mich umgesehen und eine andere Freundin gefunden, die voller Begeisterung Kuchen und Plätzchen backte und schließlich sogar Konditormeisterin wurde.“ Sie lachte. „Du profitierst heute noch davon, was ich damals gelernt habe!“
„Ja, das weiß ich schon ...“