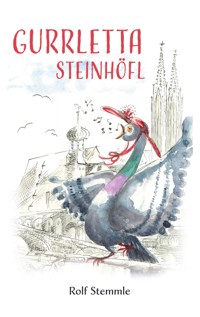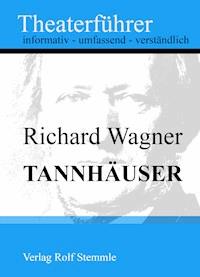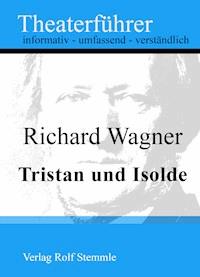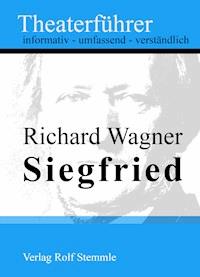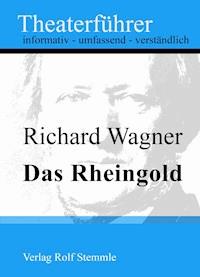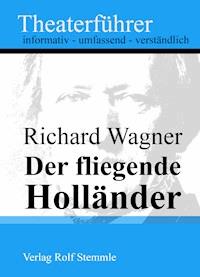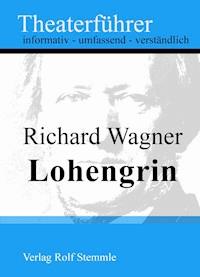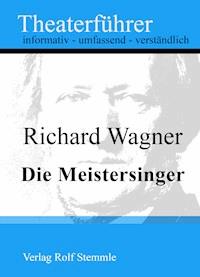Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenige Tage nach der Beerdigung von Joseph Haydn gelingt es ein paar selbsternannten Gelehrten, den Kopf des berühmten Komponisten zu stehlen. Sie untersuchen den Schädel entsprechend der wissenschaftlichen Lehre der Craniologie und verwahren ihn wie eine Reliquie in einem Schauschrank. Das Entsetzen ist groß, als der Leichnam Haydns umgebettet werden soll ... Der Roman erzählt die Geschichte und die Hintergründe des ungeheuerlichen Vorfalls. Eine spannende und schaurige Lektüre für alle, die sich für das Zeitalter Napoleons und der Komponisten der Wiener Klassik interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
1
Schon zum dritten Mal kratzte sich Joseph Haydn am Hinterkopf. Es juckte unter der Perücke. Er zog ein klein wenig daran. Aber so unauffällig wie möglich. Hier in der ersten Stuhlreihe, inmitten einer großen Zuhörerschaft, waren immer wieder Augenpaare auf ihn gerichtet. Die Perücke saß sicherlich korrekt. Der Gedanke beruhigte Haydn ein wenig. Sein Sekretär Johann Elßler hatte beim Ankleiden mit der üblichen Zuverlässigkeit sein Äußeres geprüft. Und trotzdem: Sie juckte heute. Haydn fühlte sich nicht wohl. Womöglich war das Backhuhn, das er mittags gegessen hatte, zu fett gewesen. Er ging auf sein vierundsiebzigstes Lebensjahr zu. Da war es kein Wunder, dass die Verdauung Schwächen zeigte. Doch als Ehrengast des Abends musste er Haltung bewahren.
Im Redoutensaal der Wiener Hofburg erlebte sein Oratorium Die Schöpfung eine exzellente Aufführung. Die Künstler der drei Hoftheater musizierten mit Leidenschaft und Hingabe. Haydn spürte ihre ehrliche Begeisterung. Es sangen drei Solisten sowie ein hundertköpfiger Chor. Der geschätzte Hofkapellmeister Antonio Salieri spielte am Cembalo und dirigierte. Immer wieder sprang er auf und fuchtelte mit den Armen, um die Musiker anzufeuern.
Soeben brillierte ein Bassist vom Kärntnertortheater in einer Arie. Die Zuhörer hielten den Atem an. Ausdrucksstark meisterte er die kraftfordernden Passagen, mit denen die Entstehung der Gewässer beschrieben wurde. „Rollend in schäumenden Wellen bewegt sich ungestüm das Meer.“ Wild schossen die Figuren der Violinen auf, dazu brodelten die Linien der tiefen Streicher. Allmählich beruhigte sich der musikalische Fluss, und der Bass besang mit einer lyrischen Melodie das friedliche Dahinströmen eines Baches.
Haydn freute sich. Er hatte tatsächlich die Perücke und seinen Magen für eine ganze Weile vergessen. Bei aller Bescheidenheit: Ja, die Arie war ihm gelungen! Sein Blick zur Seite traf auf die leuchtenden Gesichter der Zuhörer. Seine Musik hatte alle eingefangen! Oh ja, die Arie war ihm besonders gut gelungen!
Zuletzt sah er zu seinem Sitznachbarn: Peter Freiherr von Braun, der Veranstalter dieses Konzertes und Pächter der Hoftheater. Auf seinen Lippen lag ein leises Lächeln. Das Konzert war ausverkauft, also waren alle Kosten gedeckt. Haydn vermutete, dass er gerade daran dachte.
Baron Braun bemerkte, dass der Meister zu ihm herüberblickte. Er nickte Haydn freundlich zu.
Haydn wusste, dass die Komponisten inzwischen zunehmend auf zufriedene Veranstalter angewiesen waren. Diese mussten die Partien ihrer Werke hochkarätig besetzen und in öffentlichen Konzerten einem breiten Publikum präsentieren. Die Zeit, in der die Musikpflege ausschließlich in den Händen von kunstliebenden Aristokraten und Kirchenvätern lag, ging zu Ende. Haydn hatte daher allen Grund, Freiherr von Braun dankbar zu sein. Und dessen Zufriedenheit beruhigte ihn.
Haydn lehnte sich wieder zurück. Die nächste Arie hatte begonnen. Darin wurde vom Aufsprießen der Pflanzenwelt erzählt.
Während er lauschte, blickte er hinauf zu den funkelnden Lüstern, die den Saal mit einer Unzahl von Kerzen erleuchteten. Ein wundervoller, festlicher Abend! Und dennoch ärgerte Haydn erneut das Jucken der Perücke. Sie saß nicht korrekt! Es musste so sein! Auch wenn sein Sekretär Elßler gewiss ihren Sitz sorgfältig geprüft hatte. Haydn konnte nicht anders: Er kratzte sich.
Doch plötzlich wurde ihm bewusst, dass seine Handbewegungen von der Person, die hinter ihm in der zweiten Stuhlreihe saß, unwillkürlich beobachtet werden mussten. Und es fiel ihm wieder ein, wer den Platz eingenommen hatte: Joseph Carl Rosenbaum.
Haydn kannte ihn seit schier unendlich langer Zeit. Auch er war am Fürstenhaus der Esterházys angestellt gewesen und hatte Therese geheiratet, Therese Gassmann, nunmehr Therese Rosenbaum. Haydn traf den sympathischen, fünfunddreißigjährigen Mann in nahezu jedem Konzert und jeder Opernaufführung. Er würde sein Kratzen gewiss mit besonderer Aufmerksamkeit registrieren, dachte Haydn. Nun fand er sein Verhalten peinlich und wollte das Jucken regungslos ertragen.
Joseph Carl Rosenbaum war nichts entgangen. Von der Perücke hatte sich etwas Puder gelöst. Ein wenig war auf Haydns Rock gefallen, ein größerer Teil lag nun vor Rosenbaums Füßen.
Er hatte Die Schöpfung, die vor beinahe sieben Jahren erstmals in Wien erklungen war, schon einige Male gehört. Daher tat er sich schwer, alle Einzelheiten interessiert mitzuverfolgen. Dass sich der Meister gekratzt hatte, war eine willkommene Unterhaltungszugabe gewesen.
Rosenbaum trug keine Perücke. Er zeigte seine dunklen, kurzgeschnittenen Locken, und zwar aus Überzeugung. Die Gesellschaft verabschiedete sich gerade von diesem Symbol der absolutistischen Herrschaften. Personen, die sich in gepflegten Kreisen bewegten, stellten zunehmend ihr eigenes Haar zur Schau. Und sogar viele der Aristokraten, mit denen Rosenbaum täglich zu tun hatte, trugen keine Perücken mehr; insbesondere, wenn sie der jüngeren Generation angehörten. Dass Haydn an der Mode der scheidenden Epoche festhielt, war für ihn nachvollziehbar. Der gealterte Meister war immer ein gefügiger Hofmusiker gewesen, der komponierte und dachte, was sein Dienstherr von ihm verlangte. Er war aber intelligent genug, um sich in das neue, bürgerlich-geprägte Musikleben fügen zu können. Das wusste Rosenbaum zu würdigen. Haydns innerer Anker jedoch lag auf dem Grund einer vergangenen Zeit.
Ungeachtet dessen war seine Musik, vor allem Die Schöpfung, lebendige, moderne und höchst fantasievolle Kunst. Meisterhaft traditionell gearbeitet und zugleich voller kühner Effekte, frei und leichtatmend erzählte sie in Arien, Duetten und Chören die Schöpfungsgeschichte.
Rosenbaum kannte auch die geistliche Musik Haydns. Sie strömte tief empfunden, gottesfürchtig wie ein Gebet und klar wie ein Morgen im Gebirge.
Unwillkürlich erinnerte er sich an die Aufführung des Oratoriums Die sieben letzten Worte auf Schloss Esterházy in Eisenstadt. Damals stand er noch im Dienst des Fürsten, dem derzeit herrschenden Fürst Nikolaus II. An diesem Nachmittag vor acht Jahren hatte er sich in Therese verliebt. Und sie in ihn. Therese sang die Sopran-Partie so engelsgleich, dass er glaubte, nach diesen Klängen schon immer gesucht zu haben.
Wie war es möglich, Musik zu schreiben, die solche Töne aus einer Seele locken konnte? Dieses Wunder war in diesem Kopf geboren worden. Haydns Kopf, Haydns Gehirn, verborgen unter einer Perücke, verborgen im Korpus seines Schädels.
Neben Rosenbaum saß Catharina, die jüngste Tochter von Hofkapellmeister Antonio Salieri, ein siebzehnjähriges, schwarzhaariges Mädchen, das von ihrem Vater in Gesang unterrichtet wurde und eine vorzügliche Stimme besaß. Für sie und Rosenbaum hatte Salieri kostenlose Freibilletts besorgt. Angespannt verfolgte sie die Aufführung. Sie hatte etwas Parfüm aufgetragen. Ein feiner Duft umgab sie, wie von Zitrusfrüchten. Er unterstrich, dass sie zur Hälfte italienischer Abstammung war.
Rosenbaum ließ ab von Haydns Hinterkopf. Der Duft zog ihn an. Er sah hinüber zu Catharina, erhaschte mit seinem Blick ihr hellblaues Kleid und ihren schlanken Hals. Allzu lange konnte er nicht darauf verweilen. Er wollte sie nicht irritieren und einen falschen Eindruck erwecken. Also wanderten sein Blick weiter durch die Stuhlreihen. Alle Aufmerksamkeit war auf die Musiker gerichtet. Einige Zuhörer hatten die Augen geschlossen, um die Klänge noch intensiver aufnehmen zu können. Ein alter Mann mit hagerem Gesicht schlief vermutlich, denn sein Kopf war nach vorne gesunken. Nur ein paar Plätze weiter saß der Wiener Magistrat. Rosenbaum entdeckte noch diesen und jenen, denn er kannte beinahe jeden, der regelmäßig am Wiener Kulturleben teilnahm.
Vom Hof war niemand von höherem Rang anwesend. Das Gegenteil hätte Rosenbaum verwundert – in dieser aktuellen politischen Lage.
Die Gegenwart von einem Dutzend französischer Militärs war hingegen ungewöhnlich. Die Herren saßen auf guten Plätzen in den vorderen Reihen. Haydns Ruf drang bis nach Frankreich, und so nützten sie die Gelegenheit, das Werk des Meisters an seiner Wirkungsstätte zu hören.
Rosenbaum erforschte die Reihen, ob sich ein kleiner Gruß oder gar ein Lächeln anbringen ließ. Aber niemand sah zu ihm herüber. Das enttäuschte ihn. Sein Blick zog daher wieder nach vorne zum Orchester, zu den Solisten und dem Chor – links in seinem Blickfeld der Hinterkopf Haydns mit der Perücke, die jetzt offenbar ordentlich saß; zumindest hatte Haydn aufgehört, daran zu ziehen und unter den weißen Haaren zu kratzen.
Das Oratorium beschrieb weiter in Rezitativen, Arien und Chören die Schöpfungstage. Es folgte der dritte, vierte, fünfte und sechste Tag, an dem schließlich Adam und Eva dem Herrn für die Vollendung des großen Werkes dankten und ihre Zuneigung füreinander entdeckten. „Doch ohne dich, was wäre mir ...“, sangen sie voller Hingabe. „Mit dir ist Seligkeit des Lebens, dir sei es ganz geweiht!“ Das Werk gipfelte in einem enthusiastischen Chor. „Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit!“, jubelten die Stimmen. Antonio Salieri sprang von seiner Cembalo-Bank und dirigierte im Stehen. Trompeten schmetterten. „Amen! Amen!“
Dann brach euphorischer Beifall aus den Zuhörern. Auch die Franzosen klatschten begeistert. Die Künstler verneigten sich und genossen den Applaus. Salieri ging zu Haydn und bat ihn, vor das Publikum zu treten. Haydn zögerte kurz in seiner üblichen Bescheidenheit, doch als sich alle Blicke auf ihn richteten und die Ovation weiter anschwoll, folgte er schließlich der Einladung des Hofkapellmeisters. Die Orchestermusiker und Sänger empfingen den alten Mann. Die Gesangssolisten und Salieri nahmen Haydn in ihre Mitte und badeten im Jubel.
Dann gab Salieri ein Zeichen, und die Solisten verließen das Podium. Der Applaus endete, Chor und Orchester lösten sich auf. Haydn blieb in der Mitte des Saales, denn sofort kamen Leute aus dem Publikum auf ihn zu. Sie nutzten die Gelegenheit, ihm voller Verehrung die Hände zu drücken.
Rosenbaum wandte sich zu Catharina Salieri. Ihre Hände waren noch rot vom heftigen Applaudieren. „Ein großartiges Werk, nicht wahr? Und dein Papa ist ein großartiger Kapellmeister! Das hat er heute wieder gezeigt.“
Er durfte die junge Dame duzen, denn er hatte sie als zwölfjähriges Mädchen kennengelernt. Seit seiner Heirat mit Therese gehörte er im weitesten Sinn zur Familie Salieri.
Thereses Vater, Leopold Gassmann, war Salieris Vorvorgänger im Amt des Hofkapellmeisters gewesen. Leopold Gassmann hatte den Vollwaisen Antonio Salieri im Knabenalter von Italien nach Wien geholt und ausgebildet. Einige Monate vor Thereses Geburt war Gassmann an den Spätfolgen eines Kutschenunfalles gestorben. Aus Pflichtgefühl und Dankbarkeit hatte Salieri die Vormundschaft über das neugeborene Mädchen Therese und die ältere Schwester Ninna übernommen.
„Ich möchte die Eva so bald wie möglich selber singen“, schwärmte Catharina.
„Ach, das wird bestimmt nicht mehr lange dauern.“
„Ich gehe hinüber zu Papa.“
„Und bitte bestell ihm meinen herzlichen Dank für mein Freibillett.“
„Mache ich! Und bestellen Sie Therese meine Grüße.“
„Kommt bald mal wieder zum Kaffee! Therese backt wundervollen Nusskuchen!“
Catharina nickte kurz und bahnte sich dann einen Weg gegen die Menschen, die auf den Ausgang zustrebten.
Rosenbaum schaute sich um, ob er jemand entdeckte, mit dem er ein paar Worte wechseln konnte. Bei einer Säule stand Georg Werlen. Offenbar genoss er die Stimmung im Saal und ließ das Gehörte im Geiste nachklingen.
Werlen arbeitete in der Wiener Buchhaltungskanzlei des Fürsten Esterházy. Lediglich als Gehilfe. Deshalb konnte er sich nur Billetts für eine der hinteren Reihen leisten. Rosenbaum kannte den zwanzigjährigen, dicklichen Mann mit stets rotem Gesicht seit dessen Anstellung beim Fürsten und von unzähligen Theater- und Konzertabenden. Werlen war im höchsten Grad kunstbesessen, investierte sein gesamtes, karges Gehalt in Billetts. Für seine Garderobe verwendete er nur so viel, wie nötig war, um sich unbeanstandet auch in Veranstaltungen im Großen Redoutensaal der Hofburg sehen lassen zu können.
Werlen entdeckte nun auch Rosenbaum und kam sofort auf ihn zu.
„Ah, Herr Rosenbaum, schön, Sie zu sehen! Wunderbar die Musik, gell? Wunderbar!“ Werlen zog ein zerknittertes Taschentuch hervor und trocknete seine feuchten Augen.
Rosenbaum pflichtete Werlen bei: „Ein Geschenk, dass wir den Haydn haben!“
„Und ein Glück für ihn, dass die Wiener zu schätzen wissen, was sie für eine Perle besitzen! In London ist ihm die Welt zu Füßen gelegen und in Wien wird er jetzt auf Händen getragen.“
Rosenbaum begann zu grinsen: „Was beweist: Die verdiente Wertschätzung bekommt man nur jenseits von den Fürsten Esterházy!“
„Na ja, leicht ist es nicht im fürstlichen Haus!“ Werlen schmunzelte. „Davon kann ich ein Lied singen.“
Rosenbaum machte eine Geste, den Saal verlassen zu wollen.
„Darf ich Sie ein Stück begleiten?“, fragte Werlen.
„Es ist mir ein Vergnügen“, antwortete Rosenbaum, ohne sich tatsächlich über die Bitte zu freuen. Gerade nämlich hatte ihn im Vorübergehen ein Herr, ein Chemiker, begrüßt. Kürzlich war er ihm vorgestellt worden, und sie hatten ein interessantes Gespräch über dessen Forschungen geführt.
Aber nun war es zu spät. Werlen schlug den Weg zur Garderobe ein, und Rosenbaum musste folgen, wollte er den jungen Mann nicht brüskieren.
Es hatte während des Konzerts ein wenig geschneit. Spuren von Kutschen und Pferden durchzogen die dünne Schneeschicht. Auf dem Stück gemeinsamen Weges diskutierten sie über Napoleon und den verlorenen Krieg.
Napoleon hielt seit einigen Wochen Wien besetzt, er selbst residierte in Schloss Schönbrunn. Kaiser Franz hatte die Stadt beim Heranrücken der französischen Truppen verlassen.
Im September 1805 war die österreichische Armee nach Bayern, bis nach Ulm vorgedrungen. Frankreich erklärte daraufhin Österreich den Krieg und marschierte Richtung Wien. Napoleon, der sich ein Jahr zuvor selbst zum Kaiser gekrönt hatte, zog kampflos in die österreichische Hauptstadt. Die Armeen trafen Anfang Dezember in der Schlacht bei Austerlitz, nahe Brünn, aufeinander. An der Seite Österreichs kämpfte Russland. Napoleon entschied die Schlacht für sich, und Kaiser Franz musste einen Waffenstillstand nach den Bedingungen Napoleons akzeptieren. Darin wurde Russland zum Rückzug verpflichtet. Österreich verlor einen starken Bündnispartner. Ein Friedensvertrag sollte in Kürze geschlossen werden.
Rosenbaums Verdruss, dass er sich von Werlen hatte einfangen lassen, war rasch verflogen, denn Werlen war ein politisch gebildeter Mensch, der stets über brandneue Informationen verfügte. Werlen erzählte über die Schlacht bei Austerlitz, was er von einem Freund, einem beteiligten Soldaten, erfahren hatte. Kaiser Franz habe vor der Schlacht geweint, und seine Soldaten hätten sich geweigert, in die Hölle des Kampfes zu ziehen. „Der Zar Alexander“, sagte Werlen, „hat Goldstücke unter seine Truppen geworfen, und die sind dann begeistert losgerannt und haben unsere Leute mit Fuchteln ins Feuer gegen die Franzosen getrieben. Und später hat mein Kumpan gesehen, wie über tausend Russen von den Franzosen bis in einen Teich verfolgt worden und viele darin ersoffen sind.“
Rosenbaum war schweigsam und traurig geworden. „Hoffen wir, dass sie bald einen Friedensvertrag unterschreiben.“
Aus einer Gasse näherte sich eine französische Patrouille. Die Soldaten marschierten an den beiden vorbei, ohne von ihnen Notiz zu nehmen. Sie bogen in die nächste Gasse und verschwanden. Ihre harten Schritte hallten in der Häuserschlucht.
„Und es wird Zeit, dass die Franzosen wieder abhauen aus Wien!“, fügte Rosenbaum hinzu.
„Dass Napoleon geschlagen wird!“ Werlen ballte seine Rechte zur Faust und hielt sie in die Richtung, in welche die Patrouille gezogen war. „Solang Napoleon nicht endgültig besiegt wurde, wird kein dauerhafter Friede sein. Der gibt nicht auf, bis er ganz Europa hat!“
„Da mögen Sie Recht haben, Werlen.“
„Der Napoleon ist kein Aristokrat! Seine Abstammung ist keine Legitimation, an der Macht zu sein. Also muss er sie immer wieder beweisen. Und das kann er nur, indem er einen Krieg nach dem anderen führt! Nur Erfolge erhalten ihn! Also wird er nicht Ruhe geben!“
Inzwischen waren sie vor der Tür von Rosenbaums Haus angekommen. Er wohnte mit Therese und der Magd Sepherl in einer geräumigen Mietwohnung im dritten Stock. Vielleicht war Ninna, Thereses ältere Schwester, noch zu Besuch. Sie wollten für ihre Mama, die Witwe Gassmann, einen Schal und Handschuhe stricken. Sicher stand ein Topf Punsch auf dem Ofen. Genau das Richtige nach dem Heimweg durch die kalte Nachtluft. Werlen wollte nicht enden mit seinen Befürchtungen, obwohl Rosenbaum mittlerweile den Haustürschlüssel aus der Manteltasche geholt hatte.
Er fiel ihm schließlich ins Wort: „Also dann, lieber Werlen, noch einen guten Nachhauseweg! Wir sehen uns bestimmt bald im Theater. Im Burgtheater wird der Othello gegeben.“
„Ja, den muss ich mir noch anschauen“, sagte Werlen. Nun war er vom düsteren Thema Krieg und Napoleon abgebracht und ließ sich für heute abschütteln. „Gute Nacht, Herr Rosenbaum. Und schöne Grüße an die Gemahlin. Sie hat mir gestern in der Oper wieder sehr gut gefallen.“ Damit verabschiedete er sich.
Rosenbaum steckte den Schlüssel in das Schloss. Plötzlich erinnerte er sich an Haydns Kopf. In diesem Korpus war die Musik entstanden, die aus Therese und ihm Liebe gelockt hatte. Selten war er diesem Kopf so nahe gewesen. Und er wünschte, einmal in diesen Kopf blicken zu können. Welche Gestalt hatte der Ursprung seines Glücks?
2
Das Tor des Männertrakts wurde geöffnet, etwa zweihundert Strafgefangene strömten in den Hof. Kurze Zeit später öffnete sich auch das Tor auf der gegenüberliegenden Seite, und etwa hundert weibliche Gefangene kamen ins Freie; Insassen des k. und k. niederösterreichischen Provinzialstrafhauses in der Wiener Leopoldstadt. Sie wurden von Wärtern begleitet und beobachtet. Jeden Nachmittag, gleich im Anschluss an die Mittagsspeisung, verbrachten sie hier gewöhnlich eine halbe Stunde – geteilt in zwei Schichten mit männlichen und eine Schicht mit weiblichen Insassen.
Es war Sonntag. An Sonn- und Feiertagen durften sie zweimal, vormittags und nachmittags, in den Hof. Aber heute war einer jener Sonntagvormittage, an dem der Administrator der Anstalt, Johann Nepomuk Peter, alle zusammenkommen ließ. Meist wurden bei solchen Anlässen vorbildliche Insassen verabschiedet, um den Zurückbleibenden zu zeigen, dass es sich lohnte, während der Haft eine Besserung der eigenen Persönlichkeit anzustreben.
Für diesen Vormittag war den Insassen ein ungewöhnliches Programm angekündigt worden: Der Strafhausverwalter Peter wollte Musik spielen lassen, und zwar von einigen Gefangenen selbst.
Die Sonne hing an diesem März-Vormittag tief und schaffte es nur um die Mittagszeit über das Dach des Gebäudetraktes mit den Werkstätten. Die Wärter dirigierten die Gefangenen in einem Dreiviertelkreis um vier Stühle mit Notenständern. Der Platz der Musiker. Das restliche Kreisviertel war Verwalter Peter und dem obersten Gefängnisseelsorger Pater Hieronymus vorbehalten. Das demonstrierten zwei bequeme, leere Sessel aus Leder. Wer auf dem Stuhl sitzen sollte, der zwei Meter neben diesen Sesseln aufgestellt war, wusste niemand. Außer Peter. Er hatte einem der Wärter den entsprechenden Auftrag erteilt.
Die Gefangenen mussten einige Minuten warten, begannen zu frieren, denn die Hauskleidung aus eisengrauem Tuch schützte nur wenig gegen die Kälte. Endlich kamen aus dem Verwaltungsbau die Musiker: Sträflinge, ebenfalls im Hausgewand. Die drei Männer, die eine Violine, eine Viola und ein Violoncello trugen, sowie eine junge Frau mit einer zweiten Violine hatten sich in einer Stube im Verwaltungsgebäude eingespielt. Sie stellten sich vor die Musikerstühle, verharrten hier, bis schließlich auch der Strafhausverwalter Peter sowie der Geistliche Pater Hieronymus durch dieselbe Tür in den Hof kamen.
Applaus, wie er gewöhnlich beim Eintritt von Musikern losbricht, blieb aus. Die Musiker erwarteten ihn auch nicht. Niemand sah sie hier als Künstler. Man wusste vielmehr, sie waren lediglich Teil einer Inszenierung des Verwalters und nur an diesem Platz, weil sie in ihren früheren Jahren in Freiheit die Instrumente erlernt hatten. Dass sie ihre Instrumente ins Strafhaus mitnehmen und ihre Fertigkeiten weiter pflegen durften, war unüblich und ausschließlich der Leitungsphilosophie Peters geschuldet.
Wer nach einem Verbrechen nicht zum Tod oder lebenslänglicher Haft verurteilt worden war, trat eines Tages zurück in die Gesellschaft. Darauf musste der Verbrecher in seinem eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft vorbereitet sein. An dieser Überlegung orientierte sich Peter. Also durfte ein Gefangener das Gute in seinem Wesen während der Haftdauer nicht verlieren; andererseits musste er das Böse tilgen, zumindest aber unterdrücken.
Peters äußere Erscheinung und sein Verhalten standen im Widerspruch zu dieser humanistischen Denkweise. Der Sechsunddreißigjährige verstörte seine Umgebung mit seinem kargen und rauen Umgangston, brüskierte gelegentlich seine Gesprächspartner. Nie steckte sein langer, dünner Körper in farbiger oder heller Kleidung. Alles war schwarz an ihm; so konsequent, als erwarte er augenblicklich seinen Tod. Schwarz waren die Beinkleider, die Weste, der Rock, der Mantel. Sogar das Haar, das weit in den Nacken reichte und wie eine dichte Matte seinen Kopf verhüllte. Stets verkniff er den Mund zu einem harten Gesicht, wie aus Marmor geschlagen. Nur wenn man ihn lange kannte, bemerkte man in seinen Augen ein sonderbares Blitzen, das Angst vermuten ließ.
Peter und der oberste Seelsorger der Anstalt standen nun vor den Sesseln. Der zusätzliche Stuhl, etwas abseits, war weiter leer geblieben.
„Guten Morgen!“, rief Peter in die Menge.
Ein strammer Chor antwortete: „Guten Morgen, Euer Ehren!“
„In diesem Strafhaus fehlt ein Verbrecher: Napoleon!“, fuhr Peter fort. „Er hat sich als Erster unter Gleichen an die Spitze Frankreichs gehoben, dann aber selbst zum Kaiser gekrönt und damit unser ehrwürdiges Haus Habsburg schmählich beleidigt. Kaiser Franz, Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches, ist einzig befugt, diesen Titel zu tragen. Napoleon überzieht die Völker mit Krieg, zwingt unser geliebtes Österreich und seine Soldaten in blutige Schlachten. Napoleon hat Wien vor einigen Wochen verlassen. An seinen Stiefeln klebt noch das Blut unserer Brüder und Schwestern. Nach schlimmen Wochen des Krieges und der Unsicherheit ist unser geliebter Kaiser Franz nach Wien zurückgekehrt. Wir bitten Gott, dass er ihm ein langes Leben schenke. Um die Rückkehr des Friedens und die Rückkehr des Kaisers angemessen zu feiern, hören wir nun ein Adagio aus einem Streichquartett des hochgeachteten Haydn. Die Melodie ist das Lied ,Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!ʻ, das Haydn zu Ehren unseres Kaisers geschrieben hat.“
Die Musiker wollten sich bereits setzen, aber Peter sprach weiter: „Dieser Stuhl ist aufgestellt für eine Insassin, die nach vorne treten möge: Karoline Weber.“
Ein Raunen verbreitete sich durch die Reihen der Gefangenen. Sie waren es gewöhnt, dass einzelne Insassen bei solchen Versammlungen vor allen anderen gemaßregelt oder belobigt wurden, aber diese Herausstellung war seltsam.
Karoline Weber, eine junge, feiste Frau mit kurzen, rotblonden Locken, erstarrte vor Schreck. Nichts hatte im Vorfeld darauf hingedeutet, dass der Stuhl für sie bestimmt sein sollte.
„Los! Hervortreten!“, befahl Peter nachdrücklich.
Ein Wärter, der in ihrer Nähe stand, schob sie an. „Mach schon!“
Karoline fasste sich nervös an den Knoten ihres Kopftuches und ging mit zitternden Beinen zum Stuhl.
„Sie möge sich setzen“, sagte Peter, „und höre Sie aufmerksam zu!“
Die Frau gehorchte, wagte nicht, weiter zu Peter zu sehen. Stattdessen starrte sie auf die Musiker.
Peter gab ein Zeichen, und sie nahmen ihre Plätze ein. Gleichfalls Peter und Pater Hieronymus.
Nach kurzem Stimmen der Instrumente begann die Musik.
Die Melodie des Kaiserliedes erklang, schlicht und klar gesungen von der ersten Violine. Die zweite Violine, Viola und Violoncello begleiteten sanft mit wiegenden Figuren.
Peter hatte die Augen geschlossen und lauschte andächtig. Pater Hieronymus, ein gewichtiger Geistlicher mit Tonsur auf seinem kugeligen Kopf, fehlte ein tiefgreifendes Verständnis für die Musik, weshalb er die Aufführung mehr erstaunt als ergriffen mitverfolgte. So reagierten auch die meisten Gefangenen. Nur wenige freuten sich, nach langer Zeit etwas anderes als die geplärrten Kirchenlieder und die klägliche Orgel in der Kapelle zu hören. Die Musiker boten keinen vollendeten Kunstgenuss, aber sie mühten sich wacker und erfolgreich, die Musik weitgehend fehlerfrei und klangschön in diesem kalten Hof aufzuführen.
Karoline Weber saß so steif, als habe Peter ihren Körper mit Mörtel ausgegossen. Sie versuchte, das Gehörte aufzunehmen und festzuhalten, doch die Angst vor dem, was an Fragen und Herausstellung gewiss noch kommen würde, machte Konzentration oder gar Genuss unmöglich.
Die Melodie wanderte mit Variationen durch die Stimmen des Streichquartetts. Das Trio der Begleitinstrumente nahm den veränderten Tonfall jeweils auf. Süßlich umspielte die erste Violine nun die Linie der tiefer notierten zweiten. Ruhig und sonor sang das Violoncello. Schließlich strömte die Melodie im breiten Fluss dahin. Eine knapp zehnminütige Huldigung des Monarchen, ohne pompöse Effekte. Aus der Musik sprach der ergebene Wunsch, Kaiser Franz möge noch lange regieren.
Die vier Gefangenen, ungeübt für einen Auftritt vor größerem Publikum, setzten nach dem Schlussakkord ihre Bögen ab und warteten gespannt, was passieren würde. Auch die Zuhörerschaft wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Peter erhob sich und begann zu klatschen, und im Nu schloss sich die Schar der Insassen an. Gehemmt, als seien sie beim Naschen in einer Speisekammer entdeckt worden, verneigten sich die Musiker. Ihre Augen waren auf Peter gerichtet, der ihnen endlich das Zeichen zum Verlassen der improvisierten Konzertbühne gab. Erleichtert verschwanden sie in der Menge.
„Und nun singen wir gemeinsam das Kaiserlied“, befahl Peter. Sogleich begann er mit lauter Bassstimme: „Gott erhalte Franz, den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz!“
Unterschiedlich in Gesangesübung und Textsicherheit stimmten die Insassen, auch Pater Hieronymus und das Wachpersonal, in den Hymnus ein.
„Ich möchte euch noch einen Gedanken mit auf den Weg geben.“ Peter setzte anschließend zu einer Rede an. „Damit sollt ihr in den Sonntag, ja, in euer weiteres Leben gehen. Es ist wichtig, dass wir das Kaiserlied singen. Es soll uns verdeutlichen, dass außerhalb dieser Mauern eine Gemeinschaft von ehrenwerten Menschen lebt, geführt von Seiner Majestät, dem Kaiser. Eine Gemeinschaft, von der ihr euch durch eure Verbrechen abgesondert habt. Aber eines Tages wird jeder, der nicht zu lebenslänglicher Haft verurteilt ist, zurückkehren in diese Gemeinschaft, als verantwortungsbewusstes Mitglied, das sich würdig für die Gnade zeigt, die ihm durch den Wiedereintritt zuteilwird. Die Zeit hier im Provinzialstrafhaus ist daher keine Zeit des gedankenlosen Ausharrens, es ist vielmehr eine Zeit der Läuterung. Ihr sollt euch dessen bewusst werden, dass ihr keine Tiere, sondern Menschen seid. Ihr müsst also auch fähig sein, die höheren Eigenschaften des Menschseins zu leben. Darum haben wir heute das Kaiserlied gesungen und sogar Musik gehört, und zwar von Joseph Haydn. Der Tonsinn ist eine jener Eigenschaften, die nur dem Menschen zur Verfügung steht. Warum?“
Die Insassen hörten unbewegt zu. Der Sinn der Worte des Strafhausverwalters leuchtete ihnen ein. Doch dieser hatte schon so oft über die notwendige Besserung und Läuterung gesprochen, dass sie keinen Erkenntnisgewinn in dem Gesagten finden konnten – und daher letztlich nur geduldig und folgsam das Ende der Versammlung abwarteten. Pater Hieronymus hatte ja in der Morgenmesse nichts anderes gepredigt, wenn auch vorwiegend als Mahnung zur Hinwendung zu Gott. Dann aber erweiterte Peter seine Ansprache um eine Demonstration, die aufmerken ließ.
„Bringe Er den Hund“, befahl er dem Wachposten, der einen Schäferhund an der Leine hielt.
Der Wachposten führte das Tier vor Peter und blieb so weit abseits stehen, wie es die Leine erlaubte.
Peter streichelte den Kopf des Hundes. Dieser genoss die Zuwendung und sah hechelnd hinauf zu Peters Gesicht.
„Seht den Kopf eines Tieres“, rief Peter den Gefangenen zu. „Geschaffen am fünften Schöpfungstag.“ Dann blickte er zu Karoline. „Komme Sie her!“
Karoline ging zögernd zu Peter. Dieser dirigierte sie neben den Schäferhund.
„Nehme Sie das Kopftuch ab!“
Karoline riss es herab.
Peter fuhr mit dem Zeigefinger über ihre Stirn, vom Scheitel bis zur Nasenwurzel. „Und hier seht ihr den Kopf eines Menschen. Erschaffen am sechsten Schöpfungstag. Was unterscheidet die Lebewesen? Was schuf Gott am sechsten Tag hinzu?“
Pater Hieronymus war nervös geworden. Er wusste nicht, ob er das Erklären der Schöpfung des Menschen anhand der Physiognomie der Lebewesen gutheißen sollte. Doch er schwieg.
Einer der Gefangenen hatte den Arm gehoben.
„Ja, sprich!“
„Die Stirn!“, antwortete der Gefangene.
„Richtig! Die Stirn macht uns zu dem, was Gott einem Lebewesen schenken wollte, das ein Tier überragt. Die Stirn ist Sitz der Eigenschaften, die den Menschen zum Menschen erhebt: seine Fähigkeiten zur Sprache, Philosophie und Musikausübung, sich mit Farben und Zahlen zu beschäftigen.“ Er legte die Hand auf Karolines Scheitel. „Und hier ist der Thron, er ist Sitz des Bundes, den der Schöpfer mit den Menschen geschlossen hat. Das Organ der Theologie. Von hier aus regiert er über die Organe der Stirn, der Organe der Menschlichkeit. – Betastet nun euren Scheitel und eure Stirn.“
Die Insassen folgten verstört der Anordnung. Auch die Wachen griffen unwillkürlich an ihre Köpfe. Selbst Pater Hieronymus konnte dem plötzlichen Drang nicht widerstehen.
„Ihr seid Menschen und keine Tiere! Ihr habt eine Stirn, und ihr besitzt den Willen, der euch die Möglichkeit verleiht, eure Affekte zu beherrschen! Ihr seid hier, um das überreizte Tierische in euch zu befrieden und das Menschliche in euch zu stärken. – Das ist mein heutiger Gedankenanstoß für euch. Ich bitte Pater Hieronymus, noch ein abschließendes Wort zu sprechen.“
Der Geistliche erhob sich. „Ich möchte noch einmal an die Botschaft des Evangelisten Lukas erinnern: ,Ich sage euch, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über neunundneunzig Gerechte, welcher der Buße nicht bedürfen.ʻ – In diesem Sinne: Verlebt einen Sonntag, an dem ihr auf eurem Weg, bessere Menschen zu werden, ein gehöriges Stück vorankommt.“
Peter bedankte sich mit einem freundlichen Blick beim Pater und fügte an: „Wir kehren nun zurück zum üblichen sonntäglichen Tagesablauf.“
Das bedeutete, dass ein Teil der Gefangenen noch für eine halbe Stunde im Hof bleiben durfte, für die restlichen war ein späterer Zeitraum vorgesehen. Diese brachte man zurück in die Häuser. Pater Hieronymus verabschiedete sich von Peter mit kurzem Kopfnicken. Er schloss sich den männlichen Gefangenen an, die den Hof verließen.
Noch immer stand Karoline Weber mit dem Wachmann und dem Schäferhund bei Peter. Sie hatte sich nicht getraut, zu den anderen Gefangenen zu gehen.
Peter befahl dem Wärter: „Bringe Er die Gefangene Weber in meine Kanzleistube. Ich habe mit ihr zu sprechen.“
Der Wärter nickte und gab Karoline mit einem auffordernden Blick zu verstehen, dass sie ihm folgen solle. Sie gehorchte.
Der Wärter, an der Leine den Schäferhund, und Karoline Weber warteten unmittelbar neben der Tür der Kanzleistube. Es gebot der Respekt vor dem Amt, dass die Ankunft des Verwalters abzuwarten war, bis sich die Gefangene auf den Stuhl vor dem Schreibtisch setzen konnte.
Noch nie war Karoline in diesem Zimmer gewesen. Sie fror. Der hohe, weiß getünchte Raum verfügte über einen Holzofen, aber er war nicht in Betrieb. Durch die beiden kleinen Fenster fielen zwar Sonnenstrahlen, die zwei schräge Lichtquadrate auf den Bodenplanken bildeten, doch die Wärme, die sie mit sich brachten, besaß kaum Wirkung. Auf dem Schreibtisch aus dunklem Holz, auf den Karoline unwillkürlich starrte, lag eine Akte. Ein fingerdicker Stoß Papier, eingefasst von einer schwarzen Mappe. Womöglich ihre Akte mit allen Einzelheiten ihrer Verbrechen und Strafverbüßung. Ansonsten war die Tischplatte leer. Als sollte sie das mechanische Funktionieren eines Verwaltungsapparates versinnbildlichen. Die Nüchternheit verstärkte Karolines Angst. Nichts deutete darauf hin, dass ihr hier etwas Wohlwollendes begegnen würde. Im letzten Moment, bevor der Verwalter Peter die Amtsstube betrat, entdeckte sie auf einem Seitentisch eine Violine samt Bogen.
„Warte Er im Vorzimmer“, sagte Peter knapp zur Wache.
„Jawohl!“, antwortete der Mann und ging mit dem Hund nach draußen. Er schloss die Tür.
Und zu Karoline: „Sie möge sich setzen.“
Karoline nahm gefügig Platz.
Peter blieb stehen. Er schwieg und betrachtete ihren Kopf, dann trat er an ihre Rückseite und griff mit beiden Händen in die Locken. Seine Hände waren kalt. Karoline erschrak. Zunächst betastete Peter ihren Hinterkopf. Die Hände wanderten in den Nacken. Er wollte ihn nun betrachten. Da die Locken ihn bedeckten, schob er sie wie einen Vorhang beiseite. Karoline konnte ihr Haar nur in weiten Zeiträumen waschen, es war daher fettig und verfilzt. Peter ließ sich davon nicht abschrecken.
„Sie hat einen schlanken Hals, und der Hinterhauptbügel ist normal entwickelt. Keine Auffälligkeit. Das ist gut.“ Seine Hände glitten beidseits an die Schläfen. Er orientierte sich an der Oberkante der Ohren und forschte nach vorne, Richtung Stirn. „Hier muss man achtgeben, die Ausprägungen liegen eng beisammen“, sagte er mehr zu sich selbst als zu Karoline. „Hier ...“ Peter fand die Stellen, nach denen er gesucht hatte. Karoline schwitzte vor Angst. Ihre Schläfen waren nun feucht. Auch daran störte sich Peter nicht. Viel zu intensiv konzentrierte er sich auf die Begutachtung der Schädelform. „Der Diebessinn. Bei Räubern werden hier von der Wissenschaft Beulen beschrieben. Solche hat man auch bei Elstern und Raben gefunden. Unauffällig. Bei Ihr ist diese Hirnregion unauffällig. Das ist gut.“
Dass der Verwalter Erfreuliches an ihr feststellte, beruhigte Karoline ein wenig, auch wenn sie das Gesagte weder verstand noch beurteilen konnte.
„Sie ist mir neulich bei der Inspektion der Näherei aufgefallen“, erklärte Peter, während er weiter ihre Schläfen betastete und mit den Fingern behutsam nach vorne fuhr. „Diese Hügel treten so deutlich hervor, wie ich sie noch selten bei einem Schädel, noch weniger bei einem weiblichen Schädel, konstatiert habe. Mein erster Blick hat nicht getäuscht.“
Endlich ließ Peter ab von ihrem Kopf und ging zu einer Waschschüssel im hinteren Teil der Stube. Er goss aus einem Krug Wasser über seine Hände und trocknete sie an einem weißen Tuch. Lang sprach er kein Wort, bis er sich an seinen Schreibtisch gesetzt hatte. Dort lehnte er sich zurück und legte die Hände auf den Bauch.
„Nun, Fräulein Weber, wie ist es Ihr beim Anhören der Musik ergangen?“
Mit einer solchen Frage hatte sie nicht gerechnet. Sie stammelte: „Ja, also, sie hat mir schon sehr gut gefallen.“
Die Antwort enttäuschte Peter. „Wann hat Sie zuletzt solche Musik gehört?“
„In der Kapelle singen wir regelmäßig.“
„Und davor?“
„Wirtshauslieder und Tanzmusik an Kirchweih und im Fasching.“
Peter zügelte seine Ungeduld. „Und hat Sie bei dieser Musik irgendetwas bei sich bemerkt?“
„Ja, sie ist schon zu Herzen gegangen.“
„Und hat Sie irgendetwas im Kopf bemerkt? An den Seiten der Stirn?“
Karoline überlegte, kam aber zu keiner Erkenntnis und brachte daher keine Antwort hervor.
„Alles unterentwickelt und überlagert“, sprach Peter bitter, wieder mehr zu sich selbst.
Karoline fühlte sich schuldig. „Das tut mir leid, gnädiger Herr.“
Peter lehnte sich nach vorne. „Das muss Ihr nicht leidtun, Sie kann ja nichts dafür! Aber es ist erschütternd, wie weit es kommen kann, wenn eine Eignung durch fatale Lebensumstände verschüttet wird.“
„Meinen der gnädige Herr meine Verfehlungen?“
„Rekapitulieren wir kurz.“ Peter öffnete die Mappe mit den Prozess- und Strafdokumenten.
„Was meinen der gnädige Herr?“
„Also, ich lese, Sie stammt aus einer Gastwirtschaft. Der Vater war ein ganz üblicher Wirt.“
„Ja, draußen in Nussdorf.“
„Dann hat Sie als Gehilfin bei einem Gärtner gearbeitet. Beim Grafen von Krowitz.“
„Ich habe schon immer Blumen sehr gemocht. Darum hat es mir dort eigentlich gefallen.“
Peter merkte unvermittelt auf. „Sie liebt Blumen!“
Diese Heraushebung wusste Karoline nicht zu deuten. „Ja“, bestätigte sie kurz.
Sofort versenkte sich Peter wieder in die Akten. „Ich lese, dass Sie das Dienstverhältnis abgebrochen hat, ohne Angabe von Gründen.“
Karoline sah beschämt auf ihre Hände. „Ja, das stimmt.“
„Und warum?“
„Muss ich das sagen?“
Peter fixierte sie. Unerwartet erhielt sein Gesicht einen milden Ausdruck. „Dass wir uns recht verstehen, Fräulein Weber, es geht mir hier nicht um die justiziable Verfolgung der Verbrechen, wegen denen Sie hier sitzt. Das war Sache des Kriminalgerichts. Es geht mir hier um die Erziehung, dass Sie als besserer Mensch eines Tages von hier entlassen wird.“
Das beruhigte Karoline und sie überwand sich: „Der Gärtner, der Kreuzberger Heinrich, das war ganz ein grober Kerl, und er hat immer meinen Rock ...“
„Na ja“, unterbrach Peter, „so sind die Gärtner, das weiß man! Doch noch lange kein Grund, eine gute Stelle aufzugeben und hinterher Mannspersonen in kompromittierende Affären zu locken und dann Geldbörsen zu stehlen.“
„Ich habe Geld gebraucht, sonst wäre ich doch verhungert! Und es ist Winter geworden“, verteidigte sich Karoline kleinlaut.
„Wie gesagt, dies zu ahnden, war Aufgabe des Kriminalgerichts. Fünf Jahre sind Ihr auferlegt, lese ich. Drei Monate ist Sie hier.“
Karoline nickte traurig.
„Nach fünf Jahren ist Sie noch jung, und Sie hat, wenn Gott es will, ein langes Leben vor sich, mit dem Sie etwas Besseres anfangen kann als im bisherigen.“ Peter klappte die Mappe zu und lehnte sich wieder zurück. „Ich habe große Hoffnung für Sie.“
Karoline sah erstaunt auf. „Hoffnung? Für mich?“
„Der erste Schritt ist die Erkenntnis. Ich sage Ihr jetzt, dass Sie einen herausragenden Tonsinn besitzt. Der gehört zu Ihr wie Ihre Nase und Ihre Ohren. Es steckt ein edler Mensch in Ihr, dem Sie ein anderes Leben schuldig ist. Der zweite Schritt ist der Wille.“
„Der Wille zum Tonsinn?“
„Ganz recht. Der Wille, sich um den Tonsinn zu kümmern, ihm den Rang in den Verrichtungen des Gehirns zu geben, der ihm zusteht. Ihr Geschlechtssinn und Ihr Diebessinn sind ja nicht übermäßig ausgeprägt, also muss es für Sie ein Leichtes sein, diese Schädlinge zurückzudrängen und den vernachlässigten Tonsinn zu seinem Recht zu verhelfen.“
Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Ihr Mund stand offen, als habe ihr Peter soeben die Kaiserkrone angetragen. Endlich stotterte sie: „Und wie soll das gehen?“
„Die Geigerin, die gerade im Streichquartett mitgespielt hat, wird Ihr fortan Unterricht geben. Die Cäcilie Kern hat Wechsel gefälscht und bleibt ebenfalls noch etwa fünf Jahre im Strafhaus.“ Er hob die Violine vom Seitentisch. „Diese Geige hat ein aufgehängter Mörder hinterlassen, ein Landstreicher ohne Erben. Ich kann sie Ihr als Übungsinstrument leihweise zur Verfügung stellen.“
Karoline nahm die Geige und den Bogen entgegen. Ungeschickt, denn sie hatte noch nie ein solches Instrument in Händen gehalten.
„Sie weiß, jeder Insasse kann ein Gnadengesuch bei der Strafhauskommission einreichen. Ich bin Mitglied dieser Kommission. Mit der Insassin Kern habe ich bereits gesprochen. Wenn sich der Unterricht vorteilhaft entwickelt, dann werde ich in entsprechender Zeit eine Strafmilderung unterstützen. Eine Verkürzung auf vier Jahre wäre nach meinem Dafürhalten durchsetzbar.“ Peter freute sich mit einem selbstgefälligen Lächeln, dass er Karoline damit beeindrucken konnte.
Karoline betrachtete wortlos die Geige und strich mit ihren Fingern, die bislang in der Blumenerde gegraben hatten, über das edle Holz.
3
Im Kärtnertortheater ging die Oper Das unterbrochene Opferfest von Peter von Winter zu Ende. Eine der unzähligen Vorstellungen, denn die Oper hatte sich zum Kassenschlager entwickelt. Therese Rosenbaum sang darin die Rolle der Elvira, die weibliche Hauptrolle. Joseph Carl Rosenbaum wollte von Anfang an zuhören, aber im letzten Moment hatte ihn zuhause ein Botenjunge seines Dienstherrn, des Grafen Károly Esterházy, erreicht, und er musste sich, wie so oft, um eine dringende Angelegenheit kümmern. Der Anstreicher hatte bei der Instandsetzung einer Wohnung eine falsche Farbe verwendet! Voller Ärger, verschwitzt und nass, weil er den Weg zum Theater durch den Regen gerannt war, hatte er sich schließlich in den dritten Rang gesetzt, auf einen der wenigen freien Plätze, denn die Vorstellung war nahezu ausverkauft. Er hörte noch den Schluss der Aufführung, dann brach jubelnder Beifall los. Auch Rosenbaum applaudierte; besonders heftig und freudig, als Therese hervorgerufen wurde. Die einunddreißigjährige, korpulente Dame verneigte sich dankbar und gerührt. Rosenbaum lächelte.
Ja, Therese, seine Therese, wurde vom Publikum geliebt und gefeiert! Der Stolz auf seine Gattin, der Stolz, eine solche Gattin zu besitzen, schob seine üble Laune in den Hintergrund. Anna Gassmann, genannt Ninna, ihre ältere Schwester, hatte ebenfalls mitgesungen. Auch sie wurde vom Publikum mit viel Applaus bedacht. Rosenbaum mochte sie. Wegen ihres offenen, heiteren Wesens fand man rasch Zugang zu ihr. Zuverlässig stand sie in allen Lebenslagen auf Thereses und seiner Seite. Nur die „Mama“, die Mutter der beiden, Witwe des ehemaligen Hofkapellmeisters Leopold Gassmann, ging vor. Stets.
Wenig später wartete Rosenbaum am Bühnenausgang. Es dauerte eine Weile, bis sich Therese umgezogen und abgeschminkt hatte. Der Regen hatte aufgehört, überall waren Lachen entstanden, in denen sich die Straßenlaternen spiegelten, und ein leichter Frühlingswind zog um den Theaterbau. Rosenbaum studierte die Vorstellungsplakate für die folgenden Tage, während die übrigen Besucher aus dem Theater spazierten und bestens gelaunt in den umliegenden Straßen und Gassen verschwanden. In kurzen Abständen öffnete sich die Bühneneingangstür, und Kolleginnen und Kollegen von Therese kamen heraus. Rosenbaum kannte die meisten. Man grüßte sich, wünschte sich einen guten Abend, mit einigen tauschte er Belanglosigkeiten aus.
Schließlich verließ Ninna das Theater. „Grüß dich, Joseph. Therese ist gleich fertig. Sie muss nur noch wegen der Probe morgen mit dem Salieri reden.“
„Es eilt nicht“, antwortete Rosenbaum gelassen. „Zauberhaft habt ihr heute wieder gesungen.“
„Ja, die Oper gefällt immer noch und liegt gesanglich sehr angenehm“, gab Ninna zurück.
„Wie geht es der Mama?“ Rosenbaum und die Schwiegermutter mochten sich nicht, trotzdem fühlte er sich verpflichtet, nach ihr zu fragen.
„Ihr Husten ist besser geworden. Aber der Katarrh quält sie arg. – Ich mach mich auf den Heimweg, die Mama wartet gewiss schon auf mich. Ich wünsch euch noch einen schönen Abend!“ Sie lief davon.
Endlich kam Therese, zusammen mit Salieri. Sie sprachen noch immer über die morgige Probe.
„Schau dir besonders den Mittelteil der Arie im dritten Akt an. Der ist heikel, wirklich heikel. Da hast du kaum Zeit zum Schnaufen. Ungeschickt komponiert eben.“ Salieri bemerkte Rosenbaum. „Ah, Rosenbaum, freut mich! Lasst den Abend noch schön ausklingen.“
„Danke ebenfalls, Maestro Salieri.“
Salieri hob grüßend die Hand und wollte davon, doch er wurde von einem unbekannten Herrn angesprochen. Rosenbaum fasste Therese bei der Hand, und die beiden gingen los.
„Hast du gehört, der Schulz hat heute im ersten Akt ein paar Mal den Ton nicht getroffen. Das passiert ihm sonst nie!“
„Ich bin leider erst im zweiten Akt gekommen.“
Joseph besuchte so häufig ihre Vorstellungen, dass sie das nicht verärgerte. Sie war vielmehr besorgt. „Warum denn? Ist was geschehen?“
„Ah, der Graf hat mich im letzten Moment rufen lassen. Der Bschaidner malt doch gerade die Wohnung von der Urbanek aus, weil die in einer Woche einziehen will. Aber er ist schwer im Verzug, weil er gleichzeitig eine andere Baustelle hat. Und was macht der Trottel obendrein? Er nimmt die falsche Farbe! Der Graf schaut nachmittags, ob alles in Ordnung ist, und natürlich ist nichts in Ordnung! Also lässt er mich rufen, und ich versäum mehr als die halbe Oper. Tut mir leid, Schatzl!“
„Ach, das ist doch nicht schlimm! Kommende Woche spielen wir das Opferfest schon wieder!“
Rosenbaum wollte an der nächsten Kreuzung in Richtung ihrer Wohnung in der Oberen Bräuerstraße abbiegen, aber Therese zog dagegen.
„Du, was meinst, gehen wir noch eine Kleinigkeit soupieren? Ich hab einen solchen Hunger!“
Rosenbaum war einverstanden. „Ein Bier würde mir guttun, nach dem Verdruss.“
„Auf der Mehlgrube gibt es einen frischen Tiroler Strudel, hab ich gehört. Der würde mir jetzt schmecken.“
„Also dann.“
Im Gasthaus Zur Mehlgrube trafen sich die Künstler und ihr Publikum, auch Konzerte und Bälle wurden hier abgehalten. Um diese Zeit drängten sich daher die Besucher um die Tische. Die Kellnerinnen schleppten Bier und Wein, Würstl, Braten und Süßes herbei.
Therese und Rosenbaum schlug Tabakqualm entgegen. Sie überblickten die Gaststube, konnten aber keinen freien Tisch entdecken.
„Da drüben sitzen die Rooses“, rief Therese erleichtert. „Am Tisch ist noch Platz. Ganz bestimmt dürfen wir uns dazusetzen.“
Rosenbaum verzog den Mund. „Für die zwei bin ich heute nicht in Laune.“
„Komm, die sind doch zum Aushalten! Und schau, sie haben uns schon gesehen.“
Therese zog Rosenbaum durch die Wirtsstube, bis sie vor Betty und Friedrich Roose standen.
Das Ehepaar Roose gehörte zum Schauspielensemble der Hoftheater. Betty stammte aus Hamburg, hatte bereits in ihrer Heimatstadt sowie in Mannheim, Hannover und Bremen gespielt. Friedrich hingegen war in Limburg an der Lahn geboren worden. Engagements hatten ihn am Anfang seiner Karriere nach Heidelberg, Bayreuth, Leipzig und Regensburg geführt. Der damalige Schauspieldirektor der Hoftheater August von Kotzebue verpflichtete beide 1798 nach Wien. Hier lernten sie sich kennen und heirateten. Betty Roose brillierte in klassischen Rollen, wie 1802 als Ophelia in Hamlet. Friedrich, ein akkurater und intellektueller Mensch, verfügte über eine geschliffene Rhetorik, die ihn zum pointierten Komiker befähigte. Seine stattliche Erscheinung und Verwandlungsgabe führten dazu, dass er auch als jugendlicher Liebhaber und aristokratischer Salonlöwe die Herzen seines Publikums gewinnen konnte.
Rosenbaum hatte mit Friedrich Roose, meist in Gesellschaft mit anderen, schon manches Bier getrunken. Er war mit ihm also gut bekannt, hielt ihn aber für besserwisserisch und eitel. Betty Roose kannte er nur flüchtig.
Friedrich Roose erhob sich sofort: „Ah, das ist eine angenehme Überraschung! Setzen Sie sich! Auch noch Hunger?“
Betty Roose ergänzte: „Kommt doch her!“
Rosenbaum lächelte frostig.
„Ja, eine Kleinigkeit brauche ich jetzt.“ Therese zog den Mantel aus und gab ihn Rosenbaum. „Ich krieg immer einen kalten Magen von den vielen Koloraturen.“
Sie setzte sich zu Betty Roose auf die Bank. Vor Betty und Friedrich standen Weingläser mit Weißem sowie zwei Teller mit Soßenresten.
Auch Rosenbaum legte ab und brachte die Mäntel zur Garderobe.
„Heute war schon wieder das Opferfest, nicht wahr?“, fragte Herr Roose.
„Ja, die Oper zieht die Leute an wie eine Kerze die Staunzen.“
„Denen gefällt halt, dass sie unter Indianern spielt.“ Rosenbaum war zurück. Der Stuhl neben Therese war für ihn bestimmt. „Die Dekorationen sind ja großartig, aber die Musik ist manchmal ein bisserl fad – so ehrlich muss man sein.“
Betty Roose wandte sich zu Rosenbaum: „Waren Sie heute auch in der Oper?“
„Leider nur zum Finale. Ich hätte mein Schatzl liebend gerne länger singen gehört, aber ich hab überraschend eine größere Katastrophe verhindern müssen.“
Madame Roose freute sich auf eine wilde Geschichte. „Ei, das klingt ja spannend.“
„Es war leider weniger spannend, vielmehr dumm und ärgerlich.“
Die kleine Gesellschaft wurde von der Kellnerin unterbrochen, eine resolute, ältere Frau, die ihren Zuständigkeitsbereich im Griff hatte. „Guten Abend, wissen Sie schon, was Sie wollen?“
„Habts ihr einen Tiroler Studel da?“
„Ja, ganz frisch.“
„Mit ... Haben Sie eine Mandelmilch?“
„Ja, haben wir.“
Rosenbaum wies auf die leeren Teller. „Was war denn das? Kann man das empfehlen?“
„Hasenbraten“, erklärte Friedrich Roose. „Zart und fein!“
„Dann bitte einen Hasenbraten und dazu ein Bier.“
„Machen wir“, sagte die Kellnerin, räumte die Teller zusammen und ging davon.
Therese wunderte sich. „Hast du noch einen solchen Hunger?“
„Na, ich hab seit Mittag nichts mehr gegessen. Und mit Ärger und Hunger kann ich nicht schlafen.“ Er nahm den Faden wieder auf und erzählte den beiden Roose: „Ich muss nämlich eine Wohnung herrichten lassen, die mein Dienstherr vermieten will. Der Maler hätte um ein Haar eine Wand im Flur gelb gestrichen, obwohl grün ausgemacht war. Der Bschaidner, der ist eigentlich ein zuverlässiger Kerl, aber manchmal steckt er seinen Kopf in einen Trog, und dann hört er nur noch die Hälfte.“
Betty Roose fragte nach: „Sie sind beim Fürsten Esterházy in Stellung, wenn ich mich recht erinnere.“
„Oh, das ist lang her!“
Therese antwortete: „Mein Joseph war früher beim Fürsten Stallrechnungsführer. Hat sich um alle Abrechnungen der Stallungen kümmern müssen. In Wien, Eisenstadt und weiß Gott wo.“
„Aber es hat da ein paar leichte ... sagen wir: Wir haben es beide für besser gefunden, wenn ich mir einen anderen Dienstherrn such.“
Herr Roose schmunzelte verständnisvoll: „Bleibt alles unter uns!“
„Die Esterházys haben ja Gott sei Dank auch eine gräfliche Linie, und so bin ich jetzt der Sekretär vom Grafen Károly Esterházy de Galántha.“
„Der Graf hat uns sehr geholfen“, fügte Therese hinzu. „Und er ist ein fürsorglicher, umsichtiger Mann.“
Die Kellnerin brachte das Bier und die Mandelmilch.
„Meistens!“, brummte Rosenbaum, als die Kellnerin den Tisch verlassen hatte.
„Joseph, wir dürfen nicht über ihn klagen!“
„Nein! Natürlich nicht!“
Friedrich Roose schmunzelte erneut und hob das Weinglas. „Das bleibt alles unter uns, Rosenbaum, das bleibt alles unter uns! Wir alle haben unsere Nöte mit der Obrigkeit!“
Betty Roose, Therese und Rosenbaum hoben ebenfalls ihre Getränke.
„Auf den schönen Abend!“, bestimmte Friedrich Roose, und alle tranken.
„Und was ist Ihre Aufgabe beim Grafen Esterházy?“, wollte Betty Roose wissen.
„Ich kümmere mich um seine wirtschaftlichen Angelegenheiten, also seine Anwesen, seine Finanzen, seine Stallungen und Ländereien. Schafe hat er viele.“
„Dem gehört das Palais in der Kärntnerstraße?“, fragte Betty Roose weiter.
„Ja, das ist das gräfliche. Das Palais vom Fürsten ist das in der Wallnerstraße.“
Therese wandte sich an die beiden Roose: „Und was hat es heute im Burgtheater gegeben? Die Organe des Gehirns, oder?“
„Ja, sehr amüsant“, antwortete Betty Roose. „Ich spiele es gerne. Der Kotzebue weiß, wie man lächerliche Modeerscheinungen parodiert und treffende Pointen setzt.“
Friedrich Roose fragte: „Haben Sie das schon gesehen?“
„Ich leider noch nicht, ständig Proben oder Aufführungen“, klagte Therese.
Rosenbaum steckte sich eine Zigarre an. „Ich war in der Premiere. Viel Witz, aber manches ist ein bisserl arg vorhersehbar.“
Die Bemerkung ärgerte Friedrich Roose. Er schätzte seinen Förderer Kotzebue so sehr, dass er Kritik an seinen Stücken als persönliche Beleidigung empfand. Doch er zügelte sich und sagte erklärend: „Ja, natürlich, es hat eben den Aufbau einer Gesellschaftskomödie. Als Hauptrolle einen Vater mit einer Eigentümlichkeit, die man zur Genüge kennt: Er hat für seine Kinder andere Ehepartner ausersehen, als diese selbst. Es folgen Konfusion und eine Hinterlist, die dann zu einem glücklichen Ende für die Liebesleute führen. Aber Kotzebue weiß, wie er die Sache angeht! Was diese Komödie heraushebt, das ist das Thema! Sie ist, wie Betty schon anmerkte, eine grandios kluge Parodie! Sie trifft eine gegenwärtige Mode auf den Kopf.“
„Im wahrsten Sinne des Wortes!“, warf Betty Roose süffisant ein. „Eine Komödie mit sehr vielen Köpfen!“
„Mit abgemagerten Köpfen!“, lachte Rosenbaum schwarzhumorig.
Friedrich Roose nahm das Bonmot auf und lachte ebenfalls überraschend albern: „Mit sehr durchsichtigen Köpfen!“
Die beiden Herren kicherten einträchtig, erhoben schließlich sogar Weinglas und Bierkrug und stießen an.
„Ja, die Geschichte hat schon was“, gab Rosenbaum zu.
Therese fühlte sich ausgeschlossen: „Geh! Jetzt lassts mich halt mitlachen! Es geht um jede Menge Schädel, gell? Um die Schädel von diesem Gall.“
Friedrich Roose ergriff wieder erklärend das Wort: „Doktor Franz Joseph Gall. Ein viel beachteter Naturforscher!“
„Meinem Fritz gefällt alles, was mit Naturforschung zu tun hat“, bemerkte Betty Roose mit Überdruss.
Ihr Gatte verteidigte sich: „Die Wissenschaft ist eben doch eher Männersache.“
Damit war Therese nicht einverstanden: „He! Ich geh regelmäßig auf den Prater, um die Luftballonfahrten anzuschauen! Und im Naturalien-Cabinet war ich auch schon! Ich hab schon das Gerippe des Elefanten gesehen! Und die Wilden aus Afrika auch!“ Sie nahm Friedrich Roose ins Visier. „Aber was jetzt? Sie finden es gut, dass der Kotzebue die Schädellehre parodiert, und gleichzeitig finden Sie die Schädellehre gut, oder?“
„Es wird nur das parodiert, was auch Bedeutung hat“, stellte Friedrich Roose klar. „Aber, dass wir uns nicht falsch verstehen: Diese Leute, die Schädel sammeln, finde ich grauenvoll.“
Therese kicherte: „Geht es in dem Stück um einen Schädelsammler? Geschmackssache!“
Rosenbaum nickte: „Ja, die Hauptfigur ist ein Schädelsammler.“
„Einmal Hasenbraten, einmal Tiroler Strudel.“ Die Kellnerin stand am Tisch und servierte die Speisen.
„Danke“, sagte Therese.
Die Kellnerin ging davon.
Rosenbaum drückte seine Zigarre aus und nahm Messer und Gabel zur Hand. „Da freu ich mich jetzt drauf!“
Friedrich Roose wartete ab, bis die Gute-Appetit-Wünsche ausgesprochen waren, dann setzte er zu einer weiteren Erläuterung an: „Der Herr von Rückenmark, der schrullige Vater im Stück, lehnt die Liebschaften seiner Kinder ab, weil sie nicht die richtigen Schädelformen aufweisen.“
Das amüsierte Therese. „Der spinnt ja wirklich!“
„Die Hinterlist der Kinder besteht darin, dass sie ihm die Schädel von berühmten Persönlichkeiten besorgen, und im Gegenzug erteilt er sein Einverständnis.“
Betty Roose warf ein: „Ja, die Schädel von der Jungfrau von Orléans, Cagliostro, Robespierre ...“
„Und Voltaire war doch auch dabei“, erinnerte sich Rosenbaum.
Betty Roose fuhr fort: „Alles ist natürlich Lüge. In Wirklichkeit sind es völlig unbedeutende Schädel. Aber der Rückenmark glaubt es. Er ist eben ganz vernarrt in die Craniologie.“
„Das ist die Schädellehre?“, fragte Therese.
„Ja, die Lehre, dass sich die Eigenarten und Neigungen eines Lebewesens an der Schädelform ablesen lassen.“
Es war für Friedrich Roose wieder an der Zeit, das Erklären fortzusetzen: „Das halten viele für Unsinn. Aber andere sind so besessen von der Erkenntnis, dass Kotzebue das unbedingt parodieren wollte. Köstlich, gleich am Anfang, wie sich beim Herrn von Rückenmark zwei Männer um die Stelle als Kammerdiener bewerben, Walther und Katzrabe. Rückenmark betastet die Schädel der beiden, und so hält er den Walther für einen Spitzbuben und wirft ihn sofort aus der Wohnung. Den Katzrabe stellt er ein. Später hilft ihm dann der Walther, also der vermeintliche Spitzbube, aus einer misslichen Lage, in die ihn Katzrabe betrügerisch gebracht hat. Wie sagt der Rückenmark, gleich am Anfang, wenn er den Walther untersucht: ,Er hat ein Diebsorgan, so dick wie eine Rolle Knaster. Betrachte nur den breitgedrückten Schädel, und wie das zu beiden Seiten herausläuft.ʻ – Da hat unser Meister Kotzebue seine scharfsinnige Ironie gezeigt. – Aber wie gesagt: Man kann nur Dinge parodieren, die auch einen Kern Wahrheit haben!“
Therese hatte, während sie genüsslich ihren Strudel aß, interessiert zugehört. „Dann kann ich also am Schädel sehen, ob mein Joseph eine diebische Eigenschaft hat.“
Rosenbaum erschrak. „Therese! Bitte!“
„Komm, Joseph, hab doch ein bisserl Humor!“
Friedrich Roose griff sich an den Kopf. „Je ausgeprägter eine Neigung, desto größer das Organ. Das Diebsorgan sitzt beidseitig an den Schläfen, also vor den Ohren. Etwas höher als die Ohren, sonst ertasten Sie den Kunstsinn.“
Therese befühlte Rosenbaums Schläfe. Dieser ließ es grimmig geschehen. „Und wenn er da einen extra dicken Schädelknochen hat?“
„Doktor Gall hat erforscht, dass der Schädel das darunterliegende Organ formgetreu abbildet.“
Therese reizte Rosenbaum verspielt. „Na, da hast du einen gewaltigen Buckel!“
Rosenbaum bemühte sich, mitzuspielen. „Du betastest bestimmt meinen Kunstsinn.“
„Es gibt etwa dreißig Organe“, warf Friedrich Roose ein. „Vom Organ der Theologie, über Tonkunst und Diebessinn bis zum Organ des Geschlechtstriebes.“
„Ah, jetzt wird es pikant!“, kicherte Therese. „Wo ist denn der?“
Rosenbaum drohte zu explodieren. „Therese, hör jetzt auf!“
Endlich ließ sie von ihm ab. Sie strich liebevoll über seine dunklen Locken. „Das Organ des Geschlechtstriebes suchen wir nachher daheim. – Und noch eins, Herr Roose: Wie ist der Doktor Gall da draufgekommen?“
„Erforschung durch Beobachtung und Vergleich. Als erstes hat er den Wortsinn entdeckt.“
Betty Roose hatte bei den Ausführungen ihres Gatten verblüfft zugehört. Jetzt bemerkte sie spitz: „Ich bin überrascht, dass du so viel über diesen Doktor Gall weißt.“
Das Gesicht von Friedrich Roose rötete sich: „Na, der Ortner, der Dekorationsarchitekt Ortner, der kennt den Herrn Streicher, Andreas Streicher, einen Freund von Doktor Gall, und über den weiß er Hintergründe, die man nicht in der Zeitung liest. Und mit Ortner bin ich kürzlich ins Gespräch gekommen.“
„Meinen Sie den Klavierbauer Andreas Streicher?“, fragte Rosenbaum.
„Ja. Er komponiert auch ganz apart.“
Therese hakte ungeduldig ein: „Und was ist mit dem Wortsinn?“
„Der sitzt genau hinter den Augen. Doktor Gall hat schon als Kind bei der Beobachtung seiner Mitschüler festgestellt, dass alle, die sich Texte besonders gut merken können, sogenannte Glotzaugen haben.“
Therese kombinierte. „Weil das Organ des Wortsinns so groß ist, dass es die Augen heraustreibt. Ist das so?“
„Richtig, so argumentiert Doktor Gall. Die Folge sind Glotzaugen. Und dahinter liegt die Ursache: ein stark ausgebildetes Wortsinn-Organ. Mir fällt zum Beispiel das Textlernen schwer, und tatsächlich habe ich auch keine Glotzaugen.“
Betty Roose glühte auf: „Letzte Woche hast du gesagt, du bewunderst mich, weil ich mir meine Texte so gut merken kann.“
„Betty!“ Nun begann Friedrich Roose zu schwitzen.
„Hast du damit sagen wollen, dass ich Glotzaugen habe?“
„Du hast ein so ausgeprägtes Organ des Sprachsinns, das ist gleich daneben, sodass sich das ausgleicht.“
„Wie? Das versteh ich nicht. Der Sprachsinn müsste ja dann den Wortsinn zusätzlich drücken, und ich hätte noch ärgere Glotzaugen!“
Therese ging dazwischen, um den aufkeimenden Streit zu ersticken: „Wir könnten mit dem Doktor Gall doch mal soupieren, und er könnte uns das erklären.“
„Er ist leider nicht mehr in Wien.“
„Was? Alle berühmten Ärzte sind doch in Wien!“
„Der Doktor Gall ist vom Kaiser mehr oder weniger vertrieben worden. Er hat hier ja studiert, seinen Doktortitel erworben, dann in der Ungargasse, drüben auf der Landstraße, ein Haus mit Garten gekauft und einige Jahre eine bestens frequentierte Praxis betrieben. Dort hat er auch geforscht und Privatvorlesungen gehalten. Die hat aber der Kaiser vor etwa vier Jahren per Dekret verboten. ,Moralisch verwerflichʻ, hat er gemeint. Er hat erfahren, dass zu viele Weiber und junge Mädchen zuhören, und die wollte er vor ,moralischen Verwerfungenʻ schützen.“ Plötzlich stockte er. „Sind wir unter uns? Ich meine: Kann ich frei reden?“ Er beugte sich verschwörerisch in die Mitte des Tisches.
Rosenbaum und Therese beugten sich ebenfalls nach vorne, möglichst nahe zu Friedrich Roose. „Bleibt alles unter uns!“, versicherte Rosenbaum. Betty Roose blieb aus Protest aufrecht sitzen, aber auch sie spitzte die Ohren.
„In Wirklichkeit ist es unserem geliebten Kaiser natürlich um was ganz anderes gegangen. Die Vorlesungen sind ihm suspekt geworden, weil er Angst hatte, dass sich Zirkel, ja Geheimbünde bilden, die allzu freiheitlich denken könnten. Nicht umsonst sind ja auch die Freimaurer verboten. Keiner redet zwar darüber, aber die Angst vor einer Französischen Revolution hier in Österreich ist allgegenwärtig. Und die Kirche hat mit der Lehre von Doktor Gall ebenfalls ihre Not. Immerhin behauptet er: Der Mensch hat etwa dreißig Hirnorgane und das Tier ungefähr zwanzig, und mit diesen zwanzig stimmt der Mensch mit dem Tier überein. Sowas hört die Kirche nicht gern!“
Friedrich Roose löste die vertrauliche Nähe auf. Das Folgende durfte wieder von jedermann gehört werden. „Der Doktor Gall hat nach dem Verbot seiner Vorlesungen die Praxis aufgegeben und befindet sich jetzt auf Vortragsreise. Bis nach Deutschland, Dänemark und Holland soll er kommen. Seine Frau lebt weiterhin in Wien, auf dem Anwesen in der Ungarstraße. Der Herr Streicher kümmert sich um sie.“
Die Geschichte von Doktor Gall hatte Rosenbaums Laune verbessert. „Sowas tun Freunde gern!“, bemerkte er schelmisch.
Friedrich Roose lachte auf: „Nicht, was Sie denken, Rosenbaum! Der Streicher ist ja gut und ehrlich mit seiner Frau Nannette verheiratet.“
Betty Roose griff wieder ein: „Über die Lehre von diesem Doktor Gall mag man denken was man will, entsetzlich finde ich aber, dass der Doktor Gall und seine Anhänger Schädel von Tieren und Menschen sammeln! Zum Untersuchen! Der Herr von Rückenmark in der Komödie ist auch so ein unappetitlicher Sammler.“
Therese amüsierte sich darüber: „Was den Leuten alles einfällt!“
„Das Heranschaffen von Schädeln ist jetzt durch das Dekret ebenfalls strengstens untersagt!“
Rosenbaum pflichtete bei: „Da hat der Kaiser recht getan!“
„Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich die Craniologen, also die Schädelkundler, daran halten“, meinte Friedrich Roose. „Viele in Wien sind ja immer noch begeisterte Anhänger und sammeln und untersuchen selber – habe ich gehört.“
„Das ist doch pietätlos!“, rief Betty Roose. „Gott sei Dank habe ich gerade kein Ochsenhirn gegessen. Ich müsste mich jetzt übergeben!“
Therese ließ sich ihren Appetit nicht nehmen. Sie genoss soeben die letzten Bissen des Tiroler Strudels. „Aber andererseits muss ein Wissenschaftler auch an einem leibhaftigen Schädel forschen können.“
Rosenbaum stimmte Therese zu: „Das müssen die Justiziare doch ermöglichen können.“
„Unser Kaiser, Gott schütze ihn!, wollte das eben gerade nicht!“ Und halblaut fügte Roose hinzu: „Weil der diese Gall-Zirkel ja ausrotten will! Da gibt es bestimmt einige davon!“
„Aufpassen!“, bemerkte Betty Roose. „Jetzt hält der Fritz gleich wieder einen Vortrag!“
„Betty, bitte, lass mich kurz reden. Das Juristische hat mich immer interessiert. Bevor ich mich für die Karriere als Schauspieler entschied, habe ich in Mainz einige Semester Jurisprudenz und Philosophie studiert!“
„Bravo“, sagte Rosenbaum, „das kann man immer brauchen. Also, was ist mit dem Heranschaffen von Schädeln?“
„Ursprünglich argumentierte man, ein Leichnam sei eine Sache, die niemandem gehört, also herrenlos ist. Darum konnte man früher mit den Leichen machen, was man wollte. Nur die Kirche war dagegen, dass man sie seziert, damit man dem Herrgott nicht allzu genau auf die Finger schaut.“
„Fritz, bitte, es könnte uns jemand hören!“, mahnte Betty Roose.
Friedrich Roose sprach wieder leiser, und Rosenbaum und Therese neigten sich zur Tischmitte.
„Unsere Kaiserin Maria Theresia, Gott hab sie selig!, bestimmte dann aber in ihrem Strafgesetzbuch, dass das Ausgraben von Leichen und Leichenteilen, auch das Mitnehmen von Aufgehängten, verwerflich sei und daher als Diebstahl angesehen werden müsse. Unser Kaiser erließ ja vor ein paar Jahren ein neues Strafgesetz, und darin hat er dieses Verbot vergessen! Sehr zur Freude der Craniologen! Inzwischen hat der Kaiser den Makel korrigiert. Ein Hofdekret sagt nun, dass man einen schweren Diebstahl begeht, wenn man ein Grab ausraubt.“
„Und die Schädel von dem Doktor Gall?“, fragte Betty Roose kritisch.
„Welche Schädel?“
„Die er für seine Vorlesungen und Untersuchungen gesammelt hat? Die waren dann laut Maria Theresia ja gestohlen!“
Friedrich Roose wusste keine Erklärung. „Das wird man wohl nicht so genau genommen haben.“
Therese lachte hintergründig. „Wahrscheinlich hat der Doktor Gall auch Anhänger bei der Polizei. Die haben dann ein Auge zugedrückt – im Dienst der Wissenschaft.“
Rosenbaum war nachdenklich geworden. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“
„Ich finde, die Lebenden sollten die Toten in Ruhe lassen!“, sagte Betty Roose forsch.
„Jaja, das natürlich schon“, meinte Friedrich Roose. „Aber andererseits: Die Wissenschaft ist nicht aufzuhalten! Nichtsdestotrotz muss man denen das Handwerk legen, die Schädel nur zum Jux und aus Wichtigtuerei sammeln. Wie das der Herr von Rückenmark tut. Das hat der Kotzebue richtig erkannt und angeprangert!“
Roose verzog angewidert den Mund: „Jetzt könnten wir mal wieder von was anderem reden!“
Rosenbaum schob seinen leeren Teller beiseite: „Also, dann stoßen wir an!“
Alle hoben ihre Getränke.
Betty Roose mahnte: „Aber auf keinen Fall auf den Doktor Gall!“
„Nein, nehmen wir den Kotzebue!“, schlug Rosenbaum vor.
Friedrich Roose griff den Vorschlag begeistert auf und rief: „Auf dass er uns aus dem fernen Berlin noch viele schöne Komödien schickt!“