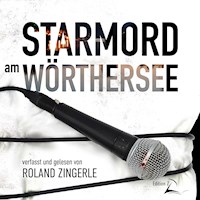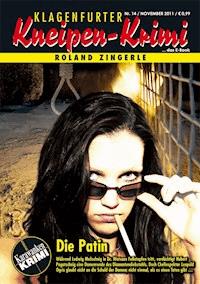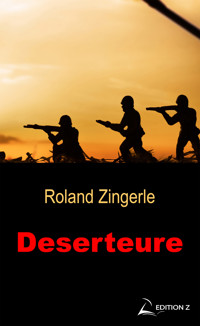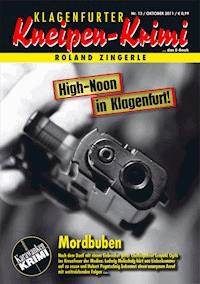9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Z
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wörthersee Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
SCHLAFENDE UNGEHEUER UND AUFGEWECKTE KRIMINELLE Nach einem Einbruch in Klagenfurt, bei dem eine Polizistin erschossen wird, sucht Detektiv Heinz Sablatnig einen Vermissten, der möglicherweise der Täter ist. Doch jede Spur fehlt, auch von der Beute und der Tatwaffe. MANCHE TÜREN BLEIBEN BESSER VERSCHLOSSEN An einem völlig anderen Ort, im Kärntner Hochgebirge, findet der Bergsteiger Lukas eine Pistole. Von einem Schneesturm überrascht stürzt er ab und erwacht in einer abgeschiedenen Kapelle. Diese wird von einer Nonne bewacht, denn im Felsen hinter der Kapelle lauert angeblich ein Scheusal. Durch die gefundene Waffe beflügelt, will Lukas beweisen, dass das angebliche Ungeheuer nur eine Legende ist – doch was er in der Höhle erlebt, ist für einen gesunden Verstand nicht fassbar. DIE SAGE WIRD WIRKLICHKEIT Nach Lukas' Rückkehr in die Zivilisation wird Sablatnig auf ihn aufmerksam, denn Lukas scheint irgendwie mit dem Einbruch in Verbindung zu stehen. Außerdem deutet alles darauf hin, dass die Pistole – die Lukas in der Höhle des Ungeheuers verloren hat – die Tatwaffe ist. Um das Verbrechen aufklären zu können, braucht Sablatnig diese Pistole, weshalb er Lukas dazu überredet, ihn zu der Kapelle zu führen, in die Höhle des Scheusals. WÖRTHERSEE-KRIMI TRIFFT ALPENSAGA Mit großem erzählerischem Geschick kombiniert Roland Zingerle die Sagenwelt der Kärntner Berge mit einem hintergründigen Kriminalfall an den Gestaden des Wörthersees. Ein ungewöhnlicher Mix voller starker, interessanter Charaktere, der immer wieder für Überraschungen sorgt und knisternde Spannung bis zur letzten Seite garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
Für Astrid.
Die beste Tochter,
die ein Papa sich wünschen kann.
Kapitel 1
Sonntag, 14 Uhr
Ein scharfer Windstoß fuhr Lukas ins Gesicht, die Eiskristalle nesselten wie tausend winzige Nadelstiche auf der Haut. Er wischte mit seiner dick behandschuhten rechten Hand über die Skibrille – was sinnlos war, denn anstelle der Eiskristalle behinderte nun der Nebel seine Sicht. Nebel – eigentlich waren es Wolkenfetzen, die der Sturmwind über den Grat jagte, gemeinsam mit Schneefahnen, die sich über dem Gletscherfeld ringelten, wie verrückt gewordene Hexen, die Salti schlugen.
Lukas stapfte weiter, hob einen Ski, zog ihn nach vorne und setzte ihn ab, dann den nächsten und immer so weiter. Er hörte sein eigenes Schnaufen, zwang sich, den Mund geschlossen zu halten, um die eisige Luft durch die Nase zu filtern. Doch es war aussichtslos, die Kälte und der Wind hatten seine Schleimhäute längst anschwellen lassen; die Nase ließ weniger Luft durch, als er benötigte. Als Bergsportler mit mehr als zehn Jahren Hochgebirgserfahrung wusste er, welche Gefahr es mit sich brachte, Mitte November auf einen Dreitausender zu steigen, wenn ein Sturmtief im Anmarsch war. Es war ein Würfelspiel, mit dem eigenen Leben als Einsatz. Doch Lukas hatte einen guten Grund, um hier zu sein, vielleicht den besten Grund, den ein Mann haben konnte.
Er blieb stehen und rammte mit einem kräftigen Ruck die Skistöcke in den Schnee, dann nahm er das GPS-Gerät, das um seinen Hals hing, und aktivierte es. Lukas war froh, dass er das teurere Gerät gekauft hatte. Einerseits wegen des größeren Displays, auf dem er auch bei Witterungsbedingungen wie diesen etwas erkennen konnte, andererseits wegen der größeren Sensorempfindlichkeit, so dass es auch mit angezogenen Handschuhen bedienbar war. Er war am Ziel. Die GPS-Messung hatte eine Genauigkeit von fünf Metern, und er befand sich in dem infrage kommenden Umkreis.
Er wischte einmal mehr über die Skibrille und blickte um sich. Hier war weit und breit keine Menschenseele zu sehen, und auch kein menschlicher Körper. Es war auch noch zu wenig Schnee gefallen, der einen solchen hätte zudecken können, und der Wind nahm erst seit einer halben Stunde an Stärke zu, das war zu kurz, um einen liegenden Menschen so zuzuwehen, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte. Noch einmal überprüfte Lukas das Display, doch es gab keinen Zweifel, er war am richtigen Ort.
Er fluchte. Lukas wusste, dass der Koordinatensatz, den er bekommen hatte, die letzten Daten waren, die Brunos GPS-Gerät gesendet hatte. Das bedeutete nicht zwangsläufig, dass Bruno hier war, es konnte auch bedeuten, dass an dieser Stelle einfach die Batterien ausgegangen waren, Bruno konnte inzwischen sonst wo sein. Aber Lukas hatte die bloße Chance ergreifen müssen, was hätte er sonst tun sollen, wenn ein Menschenleben auf dem Spiel stand?
* * *
Eine halbe Stunde später war er auf wilder Flucht vor den entfesselten Elementen. Das Heulen des Sturms überdeckte alle anderen Geräusche, der wirbelnde Schnee machte ihn fast blind. Alles, was er sah, waren die Spitzen seiner Ski, die den Firn des Gletschers beiseite pflügten. Lukas war froh, dass er die Felle nicht abgenommen hatte. Die vorherrschenden Witterungsbedingungen nahmen ihm jedes Gefühl für die Geschwindigkeit, mit der er ins Tal fuhr, da war es gut, dass die Felle seine Abfahrt bremsten. Beim Auftauchen eines Hindernisses hätte er so mehr Zeit zum Reagieren, und ein Sturz oder ein Anprallen an einen plötzlich auftauchenden Felsen würde nicht so stark ausfallen, so dass er sich ernsthaft verletzen konnte. Zumindest hoffte er das.
Zum ersten Mal seit seinem Aufstieg vor etwa sieben Stunden fühlte Lukas Hoffnungslosigkeit. Er hatte Bruno nicht gefunden, und er rechnete sich keine guten Chancen aus, heil vom Berg runterzukommen. Im dichten Wolken- und Schneegestöber hatte er mehrmals die Richtung geändert, ohne es zu bemerken, erst ein Blick auf sein GPS-Gerät hatte ihm gezeigt, dass er auf dem falschen Weg war. Doch zu dem Zeitpunkt war er schon zu weit abgefahren, er hätte zurück hinaufgehen müssen, bis knapp unter den Grat, um auf seine eigentliche Route zurückzugelangen. Das wäre jedoch Selbstmord gewesen, denn der Sturm nahm weiterhin an Stärke zu. Lukas blieb also nichts anderes übrig, als bis zum Ende des Gletschers abzufahren und dort zwischen den Felsen Schutz zu suchen. Dann würde er überlegen, wie es weiterging, auch wenn er jetzt schon wusste, dass es nicht rosig aussah. Wenn er keine Sicht auf das Gelände um sich herum hatte, konnte er nicht sehen, welcher Weg ins Tal für ihn gangbar war, da konnte ihm auch sein GPS-Gerät nicht helfen. Und er bezweifelte, dass sich die Sichtbedingungen bald besserten; die Wettervorhersage hatte eine massive Schlechtwetterfront angekündigt, die tagelang anhalten sollte.
Lukas spürte, wie seine Ski ruckartig einsanken. Vorsichtig bremste er ab und hielt inne, vermied jede noch so kleine Bewegung. Viel gefährlicher als Felsen, die vor seinen Skispitzen auftauchten, waren in seiner Situation Gletscherspalten, die vom Schnee zugedeckt und damit quasi unsichtbar waren. Oder Schneewechten, die über einen Felsgrat hinausragten. Befand sich ein Bergsteiger auf einer solchen, konnte es passieren, dass sein Gewicht ausreichte, um die Wechte brechen zu lassen, so dass sie als Lawine abrutschte und den Alpinisten mitnahm.
Die Entscheidung, was Lukas nun tun sollte, wurde ihm vom Schicksal abgenommen. Der Boden unter seinen Ski brach weg, und einen Moment später befand er sich in freiem Fall. Er schlug hart gegen einen Felsen, dann ging der Sturz weiter, sein Körper wirbelte um alle Achsen. Sein Kopf prallte irgendwo hart an, doch der hässliche Schmerz löste sich schnell in einer finsteren Bewusstlosigkeit auf.
Zwei Tage vorher
Freitag, 2.30 Uhr
Inspektorin Anita Furian hielt ihre Dienstwaffe mit beiden Händen umklammert, die Mündung zu Boden gesenkt. Lautlos wie eine Katze schlich sie an der Rückwand des Gemüseladens entlang. Wie es aussah, landeten sie und ihr Partner hier einen Glückstreffer. Zwar wurde der Gemüseladen schon seit Monaten observiert, allerdings von Kollegen in zivil, die einer anderen Abteilung angehörten und die den Geschäftseingang beobachteten, auf der anderen Seite des Gebäudes. Inspektorin Furian und ihr Partner waren auf Streife und hatten beim Vorbeifahren gesehen, wie eine dunkle Gestalt hier, in der Gasse hinter dem Laden, durch ein Fenster einstieg. Nach Rücksprache mit der Zentrale hatten sie den Befehl bekommen, das fragliche Fenster im Auge zu behalten, auf Verstärkung zu warten und gemeinsam mit dieser den Einbrecher zu empfangen, wenn er den Gemüseladen wieder verließ. Die Kollegen in zivil am Haupteingang wurden informiert und zu erhöhter Wachsamkeit angehalten, sollten jedoch inkognito und auf ihrem Posten bleiben.
Anita Furians Herz pochte im Takt eines Speedmetal-Songs. Sie war einundzwanzig Jahre alt, hatte die Polizeischule vor nicht einmal vier Monaten abgeschlossen und war erst vor Kurzem zum Inspektor befördert worden. Den Streifendienst kannte sie natürlich, doch bislang hatte sie es hauptsächlich mit betrunkenen Randalierern und Raufbolden zu tun gehabt. Einmal hatte sie einen kleinen Drogendealer festgenommen, der selbst so bekifft war, dass er in ihrer Gegenwart einem Jugendlichen ein Säckchen Marihuana anbot, aber das war auch schon das Highlight ihrer bisherigen Karriere bei der Exekutive gewesen. Das hier fühlte sich anders an – wie ein echtes Verbrechen. Ihre Sinne waren bis aufs Äußerste geschärft, sie fühlte sich wie ein Raubtier auf der Jagd, lebendig!
Das Fenster befand sich auf Kopfhöhe. Sie lugte vorsichtig hinein, sah aber nur Schwärze, weshalb sie sich darunter durch duckte und auf der anderen Seite in Stellung ging. Hier standen mehrere Müllcontainer, deren Schatten ihre Kontur verschleierten, somit würde der Einbrecher erst auf sie aufmerksam werden, wenn sie ihn stellte. Wobei sie ohnehin nicht damit rechnete, dass er schneller auftauchen würde als die Verstärkung, es würde immerhin einige Zeit dauern, bis der Eindringling alle Räume nach möglicher Beute durchsucht hatte. Inspektorin Furians Streifenpartner hatte gemeint, sie sollten im Wagen warten, doch sie wollte sich auf der anderen Seite des Fensters positionieren, um dem Einbrecher den Fluchtweg in die Gasse hinein zu versperren, sollte er früher als erwartet den Gemüseladen verlassen. Ihr Partner hatte nachsichtig gelächelt, wie jemand, der den Reiz der Jagd nur zu gut kannte. Er selbst war im Wagen geblieben, um die Kollegen von der Verstärkung einzuweisen, wenn diese kamen.
Die Inspektorin blickte durch die Gasse hinaus auf die Hauptstraße, an deren Rand ihr Streifenwagen parkte, als es plötzlich über ihr rappelte. Kam der Einbrecher etwa jetzt schon zurück? Hatte er Lunte gerochen und wollte sich aus dem Staub machen? Es dauerte ein paar Augenblicke, bis sie sich von ihrer Überraschung erholt hatte. Der Einbrecher war ein schwarz gekleideter Mann, ein ziemlicher Brocken. Er bewegte sich unbeholfen, als er aus dem Fenster kletterte, doch das lag augenscheinlich nicht an mangelnder Kraft. Und nein, er hatte seinen Einbruchsdiebstahl nicht abgebrochen, denn die schwarze Sporttasche, die an seiner Schulter hing, war sichtlich gefüllt.
„Stehen bleiben, Polizei!“, schrie Inspektorin Furian, so laut, dass sich ihre Stimme überschlug.
Der Einbrecher, der gerade am Boden angekommen war, fuhr erschrocken herum, und die Sporttasche traf die Inspektorin mit großer Wucht an den Schultern und am Kopf. Sie verlor das Gleichgewicht, stürzte aus ihrer Hocke benommen zur Seite und ließ dabei die Dienstwaffe fallen. Ehe sie sich aufrappeln konnte, traf sie die Tasche erneut, und dann wieder und wieder. Wie ein Berserker schlug der Einbrecher auf sie ein, dabei machte er Geräusche, die wie ein Schluchzen klangen.
„Aufhören“, hallte es in die Gasse. Inspektorin Furians Streifenpartner kam heran, mit schnellen, sicheren Schritten, den Oberkörper seitlich, die Waffe im Anschlag.
Da endlich ließ der Einbrecher von ihr ab. Im Angesicht des herannahenden Polizisten hielt er kurz inne, dann bückte er sich – und plötzlich hielt er die Dienstwaffe der Inspektorin in der Hand.
„Lassen Sie die Waffe fallen!“, schrie ihr Kollege.
Der Einbrecher wirkte unschlüssig. Er zielte auf ihn, ließ die Waffe aber gleich wieder sinken, sah sich hektisch um.
Inspektorin Furian musste handeln. Mit einem Satz war sie in der Hocke und einen Augenblick später sprang sie den Kerl an. Doch dieser sah sie kommen und wich aus. Die Inspektorin ging zu Boden, war aber gleich wieder auf den Beinen und wandte sich zu ihm. Die Mündung ihrer Dienstwaffe war das Letzte, was sie in ihrem Leben sah, der Knall des Schusses das Letzte, was sie hörte.
Freitag, 3 Uhr
Fünfzehn Minuten, nachdem Chefinspektorin Sabine Oleschko alarmiert worden war, kam sie in ihrem Büro im Sicherheitszentrum Klagenfurt an und wurde von einem Kollegen, der dort schon auf sie wartete, über die Ereignisse informiert. Dem Einbrecher, der Inspektorin Anita Furian erschossen hatte, war die Flucht gelungen, die Streifenbeamten vor Ort waren gerade dabei, den Tatort zu sichern. Sabine, die die Einsatzleitung innehatte, forderte die Kollegen von der Spurensicherung an und schrieb den Flüchtigen zur Fahndung aus, gleich darauf waren alle verfügbaren Einsatzkräfte unterwegs.
Was dann kam, war ein Ordnen der Kompetenzen. Der Gemüseladen im Klagenfurter Gemeindebezirk Sankt Ruprecht stand schon seit Monaten als Drogen-Umschlagplatz im Verdacht und wurde von den dafür zuständigen Kollegen überwacht. Bislang hatte man dem Inhaber Jemil Naim, einem Österreicher marokkanischer Abstammung, nichts nachweisen können, was vor allem daran lag, dass der Staatsanwalt bisher kein grünes Licht für eine Durchsuchung des Ladens gegeben hatte, mit der Begründung, die Suppe sei zu dünn. Das war nun anders, zwar nicht wegen des Verdachts eines Drogendelikts, sondern weil wegen des Einbruchs Gefahr in Verzug bestand. Der Einbrecher war nur wenige Minuten in dem Laden gewesen, das bedeutete entweder, dass er ein Insider war, der wusste, wo was zu holen war, oder dass er einen Komplizen hatte, der dies wusste. Und dieser Komplize konnte sich noch in dem Gemüseladen befinden. Darüber hinaus war der Weg durch das Fenster hinter dem Gebäude vielleicht genau die Art des Drogentransfers, nach der Sabines Kollegen von der Suchtmittelfahndung gesucht hatten. Das Fenster war nämlich unbeschädigt, es war also nicht aufgebrochen worden. Vielleicht war der vermeintliche Einbrecher in Wahrheit ja ein Drogenkurier.
Wie zu den meisten Kollegen hatte Sabine auch zum Leiter der Drogenfahndung einen guten Draht, weshalb sie diesen ans Telefon bekommen wollte. Das erwies sich als etwas kompliziert, da dieser keinen Bereitschaftsdienst hatte und somit zu so früher Stunde telefonisch nicht erreichbar war. Doch Sabine konnte seine Beamten im Nachtdienst von der Dringlichkeit der Sache überzeugen, so dass diese jemanden zu ihm nachhause schickten, ihn aus dem Bett läuteten und ihn baten, Sabine anzurufen. Sabine unterrichtete ihn von dem Vorfall und vereinbarte eine enge Zusammenarbeit bei den Ermittlungen. Die Drogenfahndung hatte immerhin jede Menge Informationen rund um den Gemüseladen gesammelt, die Sabines Ermittlungen erleichtern konnten, sie wiederum hatte bei einer Mordermittlung Kompetenzen, die viel weiter reichten als bei Ermittlungen wegen des Verdachts eines Suchtmitteldelikts.
Der Kollege war nicht nur einverstanden, er war geradezu begeistert, die Mordermittler würden den Laden immerhin auseinandernehmen – und so würde er endlich zu den notwendigen Beweisen kommen, sofern es welche gab.
Danach fuhr Sabine zum Tatort, wo reger Betrieb herrschte. Die uniformierten Kollegen hatten den Bereich rund um den Gemüseladen abgesperrt und den Inhaber herbeigeholt, der den Laden aufgesperrt hatte, dieser wurde nun durchsucht. Sabine musterte die Fassade des Gemüseladens, der wegen seiner Größe und der Vielfalt seines Angebots stadtbekannt war. Jeder nannte ihn „Gemüseladen“, was daran lag, dass dies das einzige Wort in deutscher Sprache war, das auf dem großen Schild über dem Eingang stand. Der eigentliche Name war darüber angeführt, in arabischer Schrift.
Obwohl sie Jemil Naim noch nie gesehen hatte, erkannte Sabine ihn sofort. Er war ein mittelgroßer, stark beleibter Mann mit orientalischem Aussehen, unrasiert, und er trug nur einen Bademantel und Filzpantoffeln. Seine Wohnung lag über dem Laden, offenbar hatte er keine Zeit mit Anziehen verschwendet. Der Mann fuchtelte mit weit ausholenden Bewegungen herum, während er auf einen Uniformierten einschimpfte. Die Augen über seinem dichten, schwarzen Schnauzbart funkelten, und trotz der Kälte standen Schweißperlen auf seiner Stirn.
Der Polizist versuchte, ihn zu beschwichtigen, und als er Sabine sah, entspannte sich sein Gesichtsausdruck. Er salutierte und meinte: „Frau Chefinspektorin, Gott sei Dank, dass Sie kommen. Ich kann Herrn Naim nicht begreiflich machen, warum wir sein Geschäft untersuchen.“
„Was?“ Jemil Naims Augen schnellten zu Sabine. „Wer ist das?“ Er sprach gebrochen deutsch.
„Herr Naim“, begann Sabine mit fester Stimme, „ich bin Chefinspektorin Oleschko, die Ermittlungsleiterin.“ Sie wollte weiterreden, doch der Besitzer des Gemüseladens schnitt ihr das Wort ab.
„Was sind Sie, Ermittlungsleiterin? Warum bricht die Polizei in mein Geschäft ein, äh?“
„Wir sind nicht eingebrochen, wir haben Sie geholt, damit Sie uns aufsperren. Und warum, das dürfte klar sein: Wir suchen denjenigen, der tatsächlich bei Ihnen eingebrochen ist.“
„Und was räumen Sie dann hier herum?“ Er deutete mit beiden Händen in sein Geschäftslokal.
„Der Einbrecher hat Sie bestohlen“, versuchte es Sabine erneut, „und danach hat er eine Polizistin erschossen.“
„Was geht das mich an?“, fuhr er heftig dazwischen. „Ich habe niemanden erschossen.“
„Aber Sie wurden bestohlen. Und wir müssen wissen, was gestohlen wurde.“
Jemil Naim starrte sie wütend an. „Warum?“
Sabine spürte, wie ihre Zähne aufeinander zu mahlen begannen. „Im Zweifelsfall wegen Ihrer Versicherung, oder?“
Zum ersten Mal blieb der Mann stumm.
Sabine nutzte die Pause, um fortzufahren. „Bitte gehen Sie hinein und sehen Sie nach, was fehlt.“
„Was fehlt? Was? Kichererbsen?“ Er kicherte.
„Herr Naim“, sagte Sabine betont langsam, „ich nehme doch an, dass auch Sie wissen wollen, was Ihnen gestohlen wurde, oder etwa nicht?“
Die Augen des Orientalen funkelten sie an.
„Haben Sie Wertsachen in Ihrem Laden? Die Tageseinnahmen von gestern zum Beispiel, einen Computer, ein Handy – irgendwas?“
„Keine Wertsachen.“ Er schüttelte den Kopf, dann ging er in den Laden und murmelte: „Werde nachsehen.“
Sabine stieß eine lange, lange Atemwolke aus. Das konnte ja noch was werden!
„Frau Chefinspektorin?“
Sie fuhr herum und sah sich zwei Männern in zivil gegenüber. Als diese vor ihr salutierten, wusste sie, wen sie vor sich hatte.
Die beiden zeigten ihre Dienstausweise und stellten sich mit Dienstgrad und Namen vor, womit sie Sabines Annahme bestätigten: Sie gehörten zu den Drogenfahndern, die den Gemüseladen verdeckt observierten. Einer der beiden, der Größere und auch Attraktivere, deutete mit dem Kopf in Richtung Laden. „Dürfen wir hinein?“ Er lächelte verschwörerisch, zweifellos hatte sein Vorgesetzter ihn bereits über die Zusammenarbeit mit den Mordermittlern informiert.
Sabine nickte, dann ging auch sie in den Gemüseladen. Während die Kolleginnen und Kollegen von der Spurensicherung in der Gasse hinter dem Gebäude tätig waren, wo sich der Mord ereignet hatte, durchsuchten hier Uniformierte mit Einweghandschuhen Gemüsekisten, schauten hinter Regale und klopften die Wände ab. Sabine schritt durch die Verkaufsräumlichkeiten, dann durch die Lager- und Büroräume. Gerade als sie sich damit abfand, dass die Arbeit hier wohl noch eine ganze Weile dauern würde, kam ein Ruf aus dem hinteren Bereich eines Lagerraums. Schnellen Schrittes ging sie zu einer Tür, die in einen kleinen Raum führte. Darin stand ein zufrieden grinsender Uniformierter, der bedeutungsvoll einen mit einem weißen Pulver gefüllten Plastikbeutel hochhielt. Der Beutel stammte aus einer Gemüsekiste, die zwischen anderen gestapelt gewesen war, welche Salat enthielten. Auch in der fraglichen Kiste befanden sich Salatköpfe, allerdings nur zur Tarnung, ihr Boden war mit Drogenbeuteln ausgelegt.
„Also doch“, brummte Sabine, dann schnellte sie herum und rief: „Holt mir den Ladeninhaber her!“
Kapitel 2
Dienstag, 9.15 Uhr
Ulrike Schuster schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf, trat ein und warf ihren Schlüsselbund in die dafür vorgesehene Schale, so dass es schepperte. Sie gähnte. Während sie den Schal von ihrem Hals wand und sich aus dem Mantel schälte, starrte sie geistesabwesend in den Garderobenspiegel. Die Arbeit als Krankenschwester im Unfallkrankenhaus Klagenfurt war an sich schon kein Spaziergang, aber die Nachtschichten zehrten besonders an ihren Kräften. In letzter Zeit noch mehr als sonst. Lag es daran, dass sie nicht jünger wurde?
Sie hängte den Mantel an den Kleiderhaken, trat nahe an den Spiegel heran und kontrollierte ihre Gesichtszüge. Natürlich hatte sie Fältchen, und das beileibe nicht vom Lachen, aber wer hatte die nicht? Mit dem Zeigefinger zog sie den Ansatz eines Tränensäckchens am linken Auge herunter, danach den am rechten Auge. Fünfundvierzig Jahre seien kein Alter, sagte sie immer, aber stimmte das auch? Müde ließ sie die Hand sinken und presste die Lippen aufeinander. Irgendwie waren die Jahre viel zu schnell vergangen, der Alltagstrott hatte sie regelrecht aufgefressen. Sie hatte viel zu wenig gelebt.
Ihr Handy summte, und sie kramte es aus der Tasche, die Nummer des Anrufers kannte sie nicht. „Hallo?“, sagte sie, nachdem sie das Gespräch angenommen hatte.
„Sind Sie Ulrike Schuster, die Tante von Bruno Bauer?“ Die Stimme des Mannes am anderen Ende der Leitung klang nervös, seine Unruhe übertrug sich sofort auf Ulrike.
„Ja?“
Der Mann stellte sich als Schichtführer der Maschinenfabrik vor, in der Bruno arbeitete. „Bruno hat Sie als seine nächste Angehörige genannt und Ihre Telefonnummer bei uns hinterlegt“, erklärte er dann. „Ich rufe an, weil Ihr Neffe heute schon den dritten Tag hintereinander nicht zur Arbeit gekommen ist.“
Ulrike sah im Garderobenspiegel, wie ihr Kiefer nach unten sank. Bruno hatte seine Schwächen, aber Unzuverlässigkeit gehörte nicht dazu. Im Gegenteil, auf ihn konnte man sich mehr verlassen als auf die meisten ... normalen Menschen.
Der Schichtführer redete indessen weiter. „Er geht nicht ans Telefon, er beantwortet keine SMS, keine WhatsApp ... ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen.“
„Seit drei Tagen?“ Ulrikes Stimme klang in ihren eigenen Ohren schwach.
„Seit vergangenem Freitag. Am Donnerstag war er ganz normal da, aber seither ... Funkstille.“
Ulrike schluckte und begann zu sprechen, doch ihre Stimme versagte. Sie räusperte sich, dann begann sie erneut: „Ich werde mich darum kümmern. Ich rufe zurück.“ Sie ließ die Hand mit dem Handy sinken und starrte sich wieder im Spiegel an. Bruno war verschwunden? Sie dachte nach. Auch sie hatte seit etwa einer Woche nicht mehr mit ihm gesprochen, was aber nicht ungewöhnlich war. Ungewöhnlich war jedoch, dass er nicht zur Arbeit ging und sich nicht meldete. Als sich Ulrikes Verwirrung etwas gelegt hatte, wurde ihr klar, dass es dafür nur einen einzigen logischen Grund gab: Bruno war etwas zugestoßen. Ihre Augen weiteten sich.
Dienstag, 10 Uhr
Ulrike hatte als Erstes versucht, Bruno anzurufen. Als er auch bei ihr nicht drangegangen war, hatte sie ihm eine Sprachnachricht mit der dringenden Bitte um Rückruf hinterlassen. Danach hatte sie ihm über alle Kanäle, die Bruno nutzte, Nachrichten mit demselben Inhalt geschickt und war dann zu seiner Wohnung aufgebrochen.
Bruno lebte in Fischl, einem Stadtteil von Sankt Ruprecht, in einem heruntergekommenen Wohnsilo aus den Neunzehnhundertsiebzigerjahren. Da Ulrike dem Aufzug des Hauses, dessen Kabine während der Fahrt wackelte und knirschte, misstraute, nahm sie die Treppe in den dritten Stock. Als einzige Verwandte, die mit Bruno regelmäßig Kontakt pflegte, hatte sie einen Schlüssel zu seiner Sechzig-Quadratmeter-Wohnung, mit diesem verschaffte sie sich nun Zutritt. Auf den ersten Blick bot sich Ulrike kein ungewohntes Bild. Die vorherrschende Unordnung entsprach Brunos Lebensstil, die Luft war abgestanden und stank nach ungewaschener Kleidung, alles wie immer.
Dieser Eindruck änderte sich jedoch, als sie die Räume der Wohnung nacheinander abschritt. Im Schlafzimmer standen die Türen des Kleiderschranks offen, ein Teil seines Inhalts lag auf dem Bett verstreut, der Rest im Kasten war durcheinander. Zwar wusste Ulrike nicht im Detail, welche Kleidungsstücke Bruno besaß, doch sie erkannte schnell, dass – mit Ausnahme der Arbeitsjeans – alle Hosen fehlten. Das galt ebenso für den T-Shirt-Bestand, und auch die Unterwäsche war verschwunden, bis auf ein paar löchrige Socken. Wäre es nicht so absurd gewesen, hätte Ulrike angenommen, dass Bruno zu einer Reise aufgebrochen war.
Sie überprüfte weitere Schränke, in denen Bruno Jacken, Taschen und dergleichen aufbewahrte, und überall zeigte sich dasselbe Bild. Als würde sie noch eine weitere Bestätigung brauchen, ging Ulrike in das kleine Badezimmer und wunderte sich nicht, als sie den Spiegelschrank ebenfalls mit offenen Türen vorfand. Auch er war ausgeräumt, bis auf eine fast gänzlich ausgedrückte Zahnpastatube, eine leere Schutzhülle für einen Rasierapparat und ein paar verstreute Wattestäbchen.
Wie in Trance blickte Ulrike aus dem Fenster, zu der trostlosen Fassade des Wohnblocks gegenüber. Alles deutete daraufhin, dass Bruno verreist war, ohne ihr oder seinem Arbeitgeber ein Sterbenswort zu sagen. Doch wenn man Bruno kannte, war das undenkbar! Sie ging ins Wohnzimmer und kniete sich zu einer großen Schublade am Fuß des Wohnzimmerschranks. Hier bewahrte Bruno seinen Reisepass auf, sein Geld, seine Sparbücher – alles von Wert, das er besaß. Sie hatte ihm hundertmal gesagt, er solle die Dinge besser verwahren, am besten irgendwo wegsperren, doch bis auf sein typisches „Ja, ja“ als Antwort war nichts geschehen. Sie zog die Lade auf und sah ihren Verdacht bestätigt: Sie war leer.
Ulrike wurde schwindlig. Sie kippte zur Seite, stützte sich mit den Händen am Boden ab und atmete mehrmals tief durch. War Bruno entführt worden? Aber wieso, wegen der paar hundert, vielleicht tausend Euro, die er besaß? Doch wer sonst hatte seine Sachen gepackt, in großer Eile, wie es aussah? Was war hier geschehen?
Dienstag, 11 Uhr
Ulrike hatte noch nie mit der Polizei zu tun gehabt, deshalb fühlte sie sich auch über die Maßen unsicher, als sie auf der Polizeiinspektion im Sicherheitszentrum vorsprechen wollte. Um überhaupt in das Gebäude eingelassen zu werden, musste sie einen Klingelknopf drücken, über dem eine Kamera installiert war. Dann fand sie sich in einem kalten Wartezimmer wieder, in dem eine Frau und zwei Männer saßen, die ihr alle drei aus unterschiedlichen Gründen suspekt vorkamen. Die Frau war gekleidet und geschminkt wie eine Prostituierte nach Ulrikes Vorstellung. Der zaundürre, junge Mann mit dem hoffnungslosen Blick, der zusammengesunken auf einer der Bänke saß, mochte ein Drogensüchtiger sein, wohingegen der muskulöse Kerl, der breitbeinig und mit verschränkten Armen in Raumesmitte stand und seinen Adlerblick regungslos aus dem Fenster gerichtet hielt, wie jemand wirkte, der es gewohnt war, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Ulrike schluckte und wandte sich zu der Tür, die in die Wachstube führte, doch diese war verschlossen, ein an ihr klebendes, groß beschriebenes Schild befahl: Bitte warten! Sie werden aufgerufen.
Es dauerte nicht lange und die Tür wurde geöffnet, allerdings nur einen Spalt weit. Ein junger Uniformierter steckte seinen Kopf herein, sah Ulrike und den großen Kerl an und meinte: „Bitte?“
Ulrike hob an zu sprechen, doch der Muskelprotz war schon an ihr vorbei, baute sich vor dem Polizisten auf und erklärte, er wolle einen Geschäftskonkurrenten wegen übler Nachrede anzeigen.
Der Polizist wollte Einzelheiten wissen, die der Kerl auch sofort lieferte, wobei er sich mit Kraftausdrücken nicht zurückhielt. Der Polizeibeamte nickte und meinte, er werde ihn gleich zu sich hineinholen, dann wandte er sich Ulrike zu.
Auch sie schilderte in knappen Worten ihr Anliegen, woraufhin der Beamte die Tür öffnete und sie aufforderte, einzutreten. Der Polizist ging mit ihr durch einen Raum, in dem Schreibtische an den Wänden standen, an denen Uniformierte telefonierten oder an PCs arbeiteten. Einer der Tische, der erste am Eingang, war mit einer Plexiglasscheibe versehen, davor stand ein Stuhl. Ulrike wollte sich schon auf diesen setzen, doch der Polizist ging weiter zu einer Tür, die in einen Gang führte und dann in ein Einzelbüro, das an diesem Gang lag. Das Büro war von einer älteren, gemütlich wirkenden Polizeibeamtin besetzt, deren Augen über zwei halbmondförmige Brillengläser hinweg zu den Eintretenden rollten. Ihr Blick war fragend und wirkte mäßig interessiert.
Der Polizist, der Ulrike eskortierte, klopfte anstandshalber an die offenstehende Tür und erklärte seiner Kollegin Ulrikes Anliegen. Die Frau blickte kurz zur Seite, dann nickte sie stumm. Ulrike trat ein, und die Beamtin deutete auf einen Besucherstuhl, während sie selbst aufstand, um die Bürotür zu schließen. Dann ging sie an ihren Platz zurück, zog sich die Brille von der Nase, so dass diese an einem Halteband vor ihrer großen Brust baumelte, und schenkte Ulrike einen freundlichen, unerwartet warmen Blick. „Erzählen Sie einmal von vorne weg.“
Ulrike war erleichtert – ein gutes Gefühl, von dem sie erst jetzt merkte, wie sehr es ihr gefehlt hatte. Sie schilderte die Vorkommnisse und erzählte Brunos persönlichen Hintergrund und dass er niemals verreisen würde, ohne es ihr zu sagen. Ihre Befürchtung, er könnte entführt worden sein, verschwieg sie, sie wollte nicht, dass die Polizeibeamtin sie für hysterisch hielt.
Diese hörte sich alles in Ruhe an und machte sich ab und zu Notizen. Als Ulrike fertig war, sagte sie: „Sie möchten eine Vermisstenanzeige aufgeben, nehme ich an?“
Ulrike hob unbeholfen die Schultern. „Ich weiß nicht, was man in so einem Fall tut.“
„Sie möchten, dass wir ihr suchen, nicht wahr?“ Wieder dieser warme Blick.
„Lieber wäre mir, wenn Sie ihn finden.“ Ulrike lachte unsicher.
Die Polizeibeamtin lächelte und wandte sich ihrem Computer zu. „Sagen Sie mir einmal Ihren Namen. Haben Sie einen Ausweis dabei?“
Was nun folgte, war ein langatmiger bürokratischer Prozess, der alle Daten von Bruno und alle Einzelheiten um sein Verschwinden berücksichtigte. Als die Polizistin mit ihren Fragen fertig war, druckte sie das Aufnahmeprotokoll in zweifacher Ausfertigung aus und gab alles Ulrike.
„Eine Kopie ist für Sie“, erklärte sie, „die andere lesen Sie bitte durch und achten darauf, ob alles so stimmt, wie es da steht. Am Schluss bitte unterschreiben und mir zurückgeben.“
Das Durchlesen dauerte einige Zeit, die sechs oder acht Seiten waren in polizeilichem Protokollstil verfasst, den Ulrike nicht gewöhnt war. Da sie mit allem einverstanden war, unterschrieb sie und gab die Blätter der Polizistin zurück.
Diese nahm sie entgegen und meinte: „Ich melde mich bei Ihnen, sobald wir etwas wissen.“
„Wie lange kann das dauern?“, fragte Ulrike hastig.
Die Beamtin setzte ihre Brille wieder auf und bedachte Ulrike mit einem langen Blick über die Halbmonde ihrer Sehhilfe hinweg. Dann zuckte sie mit einer Schulter. „Später Nachmittag?“
Ulrike lachte erleichtert, sie hatte befürchtet, es würde mehrere Tage dauern. Sie bedankte sich, schüttelte der freundlichen Beamtin heftig die Hand und verließ die Polizeiinspektion.
Dienstag, 15.30 Uhr
Als ihr Handy summte, schrak Ulrike aus einer Tiefschlafphase hoch. Normalerweise schaltete sie es stumm, wenn sie den durch die Nachtschicht versäumten Schlaf nachholte, doch sie wollte keinesfalls einen Anruf von der Polizei oder gar von Bruno verpassen. Noch völlig verwirrt schaltete sie das Nachttischlämpchen ein – wenn sie am Tag schlief, verdunkelte sie ihr Schlafzimmer stets völlig. Sie fingerte nach dem bereitliegenden Mobiltelefon und hob ab.
Eine weibliche Stimme meldete sich, sie nannte ihren Namen, doch Ulrike verstand ihn nicht richtig. Erst als die Anruferin die Polizeiinspektion Klagenfurt – Sankt Ruprechter Straße als Arbeitsplatz bekanntgab, fiel der Groschen.
Schlagartig saß Ulrike aufrecht im Bett, sie war nun hellwach. „Haben Sie Bruno gefunden?“
„Nun“, die Frau am anderen Ende der Leitung zögerte, „ja und nein, fürchte ich.“ Es war die Stimme der freundlichen Polizistin vom Vormittag.
„Wie soll ich das verstehen?“
„Wir haben ihn gefunden, aber ich darf Ihnen nicht viel dazu sagen.“
„Was? Wie ...“
„Lassen Sie mich bitte ausreden. Wir haben das Girokonto Ihres Neffen überprüft, die Zahlungsflüsse geben oft die beste Auskunft darüber, wohin sich eine Person bewegt. Das war auch hier der Fall. Herr Bauer, Ihr Neffe, hat am vergangenen Freitag ein Bahnticket gekauft, am Ticketschalter des Klagenfurter Hauptbahnhofs. Wir haben dort nachgefragt und erfahren, dass er nach Genua wollte.“
„Genua?“ Ulrike war fassungslos.
„Ja, Genua in Italien. Herr Bauer hat das Ticket noch am selben Tag eingelöst.“
„Was ... was soll das heißen? Dass er am Freitag mit dem Zug nach Genua gefahren ist?“
„Ganz genau.“
„Und dann?“
„Was meinen Sie?“
Ulrike massierte mit der linken Hand ihr Gesicht. „Sie haben doch gesagt, Sie hätten die Zahlungsflüsse auf Brunos Konto überprüft. Dann müssen Sie doch wissen, in welchem Hotel in Genua er abgestiegen ist. Ich nehme nicht an, dass er es bar bezahlt, und eine Kreditkarte hat er nicht.“
Die Polizistin schwieg kurz, dann meinte sie: „Das darf ich Ihnen nicht verraten.“
Ulrike war baff. „Wieso nicht?“
„Ihr Neffe ist fünfundzwanzig Jahre alt, mündig, und es besteht kein Hinweis darauf, dass er einer Straftat zum Opfer gefallen wäre. Wenn er beschließt, nach Genua zu fahren und von dort in alle Welt, ist das seine freie Entscheidung.“
„Ja, okay, aber warum dürfen Sie mir nicht sagen, wo er sich jetzt aufhält?“
„Weil er ein freier, mündiger Mensch ist.“ Die Polizeibeamtin sprach betont langsam. „Wenn er beschlossen hat, wegzufahren, ohne Ihnen zu sagen, wohin, dann ist das seine freie Entscheidung. Würde ich Ihnen seinen Aufenthaltsort verraten, würde ich möglicherweise gegen seine Absichten handeln.“
„Aber ...“, Ulrike rang nach Worten, „wenn Sie ihn kennen würden ...“
„Ich kenne ihn aber nicht. Und, Frau Schuster, ich kenne auch Sie nicht. Deshalb kann ich die Art Ihrer Beziehung zu Ihrem Neffen nicht beurteilen, verstehen Sie? Ich muss nach dem handeln, was ich weiß, und das deutet in keiner Weise darauf hin, dass Herr Bauer unter Zwang gehandelt hätte.“ Sie machte eine kurze Pause. „Vielleicht will er nur einmal Urlaub machen?“
„Ohne dass er seinem Arbeitgeber Bescheid gibt?“, Ulrike schluchzte, „oder mir?“
„Vielleicht will er alle Zelte abbrechen und ein neues Leben beginnen? Sowas kommt öfter vor, als Sie glauben.“
Ulrike erwiderte nichts, ihre ganze Verzweiflung brach in einem Sturzbach aus Tränen aus ihr heraus.
„Frau Schuster“, begann die Polizistin nach einer Weile und räusperte sich, „wenn es Sie beruhigt: Ich kann Ihnen zumindest so viel sagen, dass es ihrem Neffen offenbar gutgeht. Wenn es nach seinen Kontobewegungen geht, verhält er sich wie ein typischer Urlauber.“
Ulrike konnte nicht mehr. Ohne ein weiteres Wort trennte sie die Verbindung, sank auf ihr Bett und wurde von einem Weinkrampf geschüttelt, der nicht mehr enden wollte.
Kapitel 3
Zeit und Ort unbekannt
Wann immer Lukas geweckt wurde, fühlte es sich wie eine Störung an. Jemand packte ihn kräftig um die Schultern und hob seinen Oberkörper an, dann hielt man ihm einen Tassenrand an die Lippen und goss ihm ein paar Tropfen einer Flüssigkeit in den Mund. Wasser, ein anderes Mal lauwarmen Kräutertee, dann wieder Suppe. Alles schmeckte schal oder hatte einen eigenartigen Beigeschmack. Er ließ es über sich ergehen und war erleichtert, wenn sein Oberkörper wieder zurückgelegt wurde, so dass er weiterschlafen konnte. Wie viel Zeit zwischen diesen Sinneseindrücken verging, wusste er nicht.
Irgendwann erwachte er von selbst, mit dem Gefühl, alle Sinne beisammen zu haben. Er folgte seinem Bedürfnis, die Augen zu öffnen, schloss sie aber sogleich wieder, weil sich die Welt außerhalb seines Körpers im Zustand eines Wirbelsturms zu befinden schien. Er hechelte, um die Übelkeit niederzukämpfen, sein Herz raste. Dann versuchte er es erneut, diesmal behutsamer. Der Schwindel verschwand nach wenigen Augenblicken, so dass Lukas seine Eindrücke begreifen konnte. Er lag auf dem Rücken, an der Zimmerdecke über ihm tanzte der gelbliche Widerschein einer Kerzenflamme. Ansonsten war es dunkel in diesem Raum – dunkel, ruhig und warm, er roch Holzfeuer und eine Ahnung von Kerosin. Das Gesicht einer Frau erschien über ihm, eingerahmt in einem schwarzen Schleier mit weißem Saum. Sie lächelte. Lukas konnte nicht viel erkennen, doch ihr Blick wirkte besorgt. Eine schmale Hand legte sich auf seine Stirn, angenehm kühl, die flachen Wülste der Handfläche fühlten sich hart an.
„Wo bin ich?“
Die Nonne lächelte still, erst geraume Zeit später erwiderte sie: „In Sicherheit.“ Ihre Stimme klang dunkel, die Worte unbeholfen.
Lukas wollte seine Frage wiederholen, als die Frau sich erhob und wegging. Er wollte ihr nachblicken, doch als er seinen Oberkörper drehte, fuhr ein so schlimmer Schmerz in seine Brustwirbelsäule, dass er zurückfiel und für bange Sekunden unfähig war zu atmen. Der Schmerz ebbte nur langsam ab, wie ein Echo, das lange nachhallt.
Die Nonne kam zurück und trug eine große Tasse, in der ein Löffel lehnte. Sie trat hinter Lukas, und gleich darauf spürte er den vertrauten Griff um seine Schultern, der seinen Oberkörper anhob. Erleichtert stellte er fest, dass der Schmerz ausblieb. Die Frau stützte seinen Oberkörper mit ihrer Brust, mit den somit frei gewordenen Händen hob sie die Tasse vor Lukas’ Gesicht. Es war ein altes Häferl aus abgeschlagener Emaille, verziert mit einem Blumenmuster. In ihm schwammen Fleisch- und Karottenstücke sowie Zwiebelfasern in einer Brühe. Seine Helferin flößte ihm die Suppe nun Löffel für Löffel ein. Es war Hühnersuppe, lauwarm, angenehm. Doch obwohl er großen Hunger hatte, reichten ihm wenige Schlucke, er gab der Nonne ein Handzeichen. Sofort stellt sie die Tasse ab und ließ ihn behutsam nach hinten sinken. Ihr Gesicht erschien wieder vor ihm, sie lächelte, diesmal hoffnungsvoll. Ihre Hand strich über seine Haare, dann spürte Lukas, wie seine Lider schwer wurden, und er ließ sich fallen.
* * *
Irgendwann erwachte er wieder, öffnete die Augen, tastete mit seinem Blick die Zimmerdecke ab und lauschte in sich hinein. Er fühlte sich gut, klar, gereinigt. Vorsichtig bewegte er die Schultern, und als er spürte, dass sich der Schmerz in seiner Brustwirbelsäule in Grenzen hielt, wollte er den Versuch wagen, sich aufzurichten. Dazu senkte er den Kopf auf die Brust und hob langsam den Oberkörper. Er stellte sich vor, er würde sein Rückgrat Wirbel für Wirbel aufrollen. Es ging, kein Schmerz behinderte die Bewegung. Als er hoch genug war, um seine Ellbogen abzustützen, atmete er tief durch. Sein Kopf war wie Blei. Er wollte sich einen Überblick verschaffen, doch was er sah, ließ ihn glauben, er sei durch ein Loch in der Zeit gefallen.
Er lag auf einem niedrigen Bett am Boden einer kleinen, uralten Bauernstube. Die Längswand vor ihm war durch zwei Fenster unterbrochen, von denen jedes nicht mehr als einen halben Meter im Quadrat maß. Durch sie sickerte fahlweißes Tageslicht herein. Die Wände waren weiß getüncht, sie besaßen eine unregelmäßige Struktur, vermutlich waren die Mauern aus Backsteinen gefertigt. Der Boden bestand aus speckig glänzenden Holzbohlen. Er drehte den Kopf behutsam nach links, wo er durch einen Wald von schmucklosen, aber robust wirkenden Tisch- und Hockerbeinen blickte, zwölf insgesamt. Dahinter, im linken Eck, stand ein massiver, alter Sparherd aus grauem Eisen, mit emaillierten Seitenflächen und Türen, ein Ofenrohr führte hinter ihm nach oben und verschwand in der Decke. In der Wand rechts vom Herd befand sich eine schmale Holztür, in ihr stand eine Nonne, eine zierliche Frau in einem grauen Kleid, die einen leeren Weidenkorb unter dem Arm hielt und ihn ansah.
Lukas erschrak fast, als er auf sie aufmerksam wurde. Dann fragte er sich, ob das dieselbe Frau war, deren Gesicht er gesehen hatte, als er das letzte Mal bei Bewusstsein gewesen war. „Hallo“, zwang er sich zu sagen, seine Stimme war schwach und verursachte ein schmerzhaftes Echo in seinem Kopf.
Die Nonne kam auf ihn zu, mit kleinen, eiligen, kaum hörbaren Schritten. Ihr Schleier gab einige Zentimeter ihres Haaransatzes frei, sie hatte schwarzbraune Haare, in die sich silberne Strähnen mischten. An dem Lächeln, das nun ihr Gesicht verzauberte, erkannte Lukas sie wieder.
„Wo ... wo bin ich hier?“
Die Nonne hockte sich zu ihm und legte ihre schmalen Hände an seine Wangen, sie waren kalt. „Schone dich“, sagte sie gebrochen.
Lukas fragte sich, wie alt sie sein mochte. Ihre Haut war faltig doch ihr Gesichtsausdruck offen, geradezu kindlich. In ihren freundlichen Augen fand er denselben Widerspruch, ihr Blick verriet die tiefe Weisheit einer alten Seele und gleichzeitig eine unverbrauchte, unschuldige Neugier ohne Vorbehalte.
„Wer bist du?“, fragte er.
„Du stellst viele Fragen.“
Lukas sah verwirrt zu, wie sie sich erhob, scheinbar leicht wie eine Feder, und zum Herd hinüberlief. Er hörte verhaltenes Geklapper, und gleich darauf kam sie mit der Tasse zurück, die er schon kannte. Sie rührte mit einem Löffel darin und blies dichten Dampf weg.
„Warum antwortest du nicht?“
Doch sie lächelte nur, hockte sich wieder zu ihm und kühlte weiter den Tasseninhalt.
„Ich bin Lukas, Lukas Katolnig“, begann er, „ich habe mich im Schneesturm verirrt und bin abgestürzt.“ Das Sprechen strengte ihn sehr an und führte zu grässlichen Kopfschmerzen.
Die Nonne rührte weiterhin in dem Häferl und blies hinein. Zwischendurch warf sie ihm Blicke zu, die fast scheu wirkten. Schließlich hob sie den Löffel aus der Tasse und hielt ihn vorsichtig prüfend an ihre Lippen, dann führte sie ihn an seinen Mund.
Er sah sie an, ohne ihr Angebot anzunehmen. „Wie heißt du?“
Sie lächelte bescheiden und sagte endlich: „Schwester Anna.“
Lukas schürzte die Lippen und ließ sie den Löffel in seinen Mund leeren. Gemüsesuppe, leicht wässrig, ohne Salz. „Und wo bin ich hier?“
Diesmal war sie es, die sich nicht erweichen ließ, sie hielt den Löffel so lange an seinen Mund, bis Lukas die Gabe annahm.
„Die Georgskapelle“, sagte sie und ergänzte: „ist das hier.“
Er trank den nächsten Löffel. „Ich habe noch nie von einer Georgskapelle gehört.“ Wieder dieser Kopfschmerz!
„Sie ist nicht sehr bekannt.“
„Und wo steht sie?“
Schwester Anna schöpfte einen weiteren Löffel Suppe aus dem Häferl. „Du stellst viele Fragen.“
* * *
Als er das nächste Mal erwachte, fand Lukas sich in völliger Dunkelheit wieder. Er fragte sich, was ihn aufgeweckt hatte. Seine Kehle war trocken, aber das konnte der Grund nicht sein. Er hörte den Wind draußen an- und abschwellen, und hin und wieder spürte er eine zarte, kalte Brise auf sich herabrieseln. Offenbar waren die Fenster schlecht abgedichtet. Dann spürte er, was ihn geweckt hatte, er musste austreten. Lukas hatte keine Ahnung, wo sich die Toilette befinden konnte, er hatte von seinem Krankenlager noch nicht mehr gesehen als das, was ihm ein Blick nach rechts und links offenbart hatte. Auch seine letzte Wachphase hatte nicht lange angedauert, immerhin schien aber der viele Schlaf, den sein Körper von ihm forderte, seine Genesung zu beschleunigen, denn er fühlte sich insgesamt besser.
Er dachte nach. Sollte er die Nachtruhe von Schwester Anna, oder wer auch immer gerade seine Pflege innehatte, stören oder sich auf eigene Faust auf die Suche machen? Zweiteres schied aus, immerhin müsste er dazu alle Zimmer absuchen, und das würde ihn nur in die peinliche Lage bringen, eventuell private Räumlichkeiten zu betreten. Außerdem würde er damit seine Wohltäter ohnehin aufwecken. Die dritte Möglichkeit war, auf den Morgen zu warten, doch Lukas wusste nicht, wie spät es war, und sein Harndrang war schon jetzt sehr groß.
Er räusperte sich. „Hallo?“, fragte er halblaut in die Dunkelheit. Als er keine Antwort erhielt, versuchte er es etwas lauter: „Schwester Anna?“ Jetzt hörte er ein Rappeln und Stöhnen, dann das Rascheln von Bettwäsche. Plötzlich dimmte links von ihm ein leichter Lichtschimmer auf. Lukas sah hin, zu der Tür neben dem Herd, und nahm eine Gestalt wahr, die genauso gut ein Gespenst hätte sein können. Schwester Anna war in ein schmutzig-weißes Leinen-Nachthemd gekleidet, ihr dunkles Haar hing fast bis zu ihren Hüften herab, die Füße waren nackt. Sie trug eine Petroleumlampe vor sich her, eine Sturmlaterne.
„Was gibt es?“, wisperte sie, gerade so, als wollte sie niemanden wecken.
„Es tut mir leid, dich zu stören“, Lukas hatte unbewusst ihre Sprech-Lautstärke übernommen, „aber ich muss dringend aufs Klo.“
Schwester Anna nickte. Sie hockte sich zu ihm, zog einen der Hocker vom Tisch heran und stellte die Petroleumlampe darauf. Dann begann sie, Lukas abzudecken.
Ihr Verhalten irritierte ihn. „Warum schaltest du nicht das Licht ein?“
„Das ist das Licht.“ Mit einer weichen Kopfbewegung deutete sie auf die Petroleumlampe, ohne ihr Tun zu unterbrechen.
Lukas stutzte. Verstand er das richtig, hier gab es kein elektrisches Licht? Keine Elektrizität? Er blickte an sich herab und erschrak. Schwester Anna hatte ihn mittlerweile vollends abgedeckt, so dass er sehen konnte, dass er nackt unter den Decken gelegen war, abgesehen von einem Lendenschurz aus grobem Tuch, der wie eine Windel aussah. Sein Oberkörper war übersät von großen, geschwollenen, dunklen Hämatomen. „Was ... was ist mit mir los?“, wisperte er.
„Du bist verletzt“, erklärte Schwester Anna und schien es dabei belassen zu wollen.
„Das weiß ich, aber ... warum bin ich nackt? Und wo ist meine Unterhose?“
Die Nonne sah ihn müde an. Ihr Gesicht wirkte weich im Widerschein der Flamme. „Du bist seit drei Tagen hier.“
Lukas stockte. Drei Tage? Die Zahl schockierte ihn, und noch schockierter war er, als er erkannte, was Schwester Anna damit zum Ausdruck bringen wollte, immerhin hatte er seine Ausscheidungen all die Zeit über wohl kaum bei sich behalten. Er schluckte peinlich berührt.
Sie machte sich an seinem Lendenschurz zu schaffen.
„Was tust du da?“, fragte er entsetzt.
Anstelle einer Antwort zog die Nonne eine uralte Bettpfanne unter Lukas’ Bett hervor und hielt sie ihm bedeutungsvoll hin.
„Du willst, dass ich da reinmache? Ja, aber ... gibt es hier kein Klo?“
„Du solltest noch nicht aufstehen.“ Sie stellte die Bettpfanne ab und wandte sich wieder dem Lendenschurz zu.