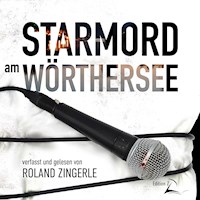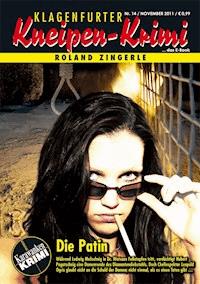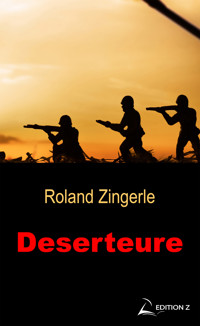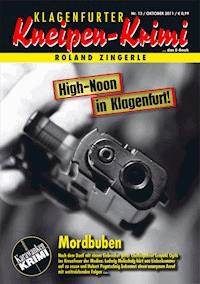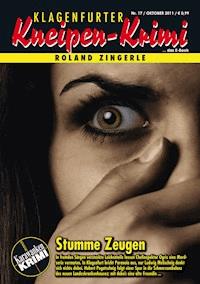Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Z
- Kategorie: Krimi
- Serie: Klagenfurter Kneipen-Krimi
- Sprache: Deutsch
In Klagenfurt wird ein junger Scheidungsanwalt bestialisch ermordet. Eine mögliche Mordzeugin steht unter Schock und kann nicht einvernommen werden. Und noch etwas befindet sich am Tatort: Ein schwarzes Plakat mit der weißen Aufschrift "Bald in Klagenfurt: Die Nacht der Zerper". Plakate wie dieses hängen seit Wochen in der Stadt aus und sorgen für ausgiebige Diskussionen, da niemand weiß, was sie ankündigen. Als Hubert Pogatschnig herausfindet, was ein "Zerper" ist, glaubt er, eine Spur zu haben. Gemeinsam mit Ludwig Melischnig und dessen Freundin, der Tochter von Chefinspektor Leopold Ogris, recherchiert er unter den Mitgliedern der mittelalterlichen Schaukampftruppe "Tafelrunde", von denen keiner wirklich unverdächtig ist. Zur Serie: Über die Einhaltung von Gesetzen wacht die Polizei – aber nicht nur! In Klagenfurt am Wörthersee haben sich Hubert Pogatschnig (zunächst Großhandelsvertreter, später Bierführer) und Ludwig Melischnig (Bierführer-Assistent) die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als "Zwei für die Gerechtigkeit" gefeiert und von der Kripo unter dem Kommando von Leopold Ogris als "Deppen-Duo" verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in Gaststätten oder Gewerbebetrieben, Vereinen oder Nachbarschaften, beim täglichen Herumkommen oder auf gelegentlichen Extratouren an Originalschauplätzen in und um Klagenfurt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Zingerle
Die Nacht der Zerper
Klagenfurter Kneipen-Krimi Nr. 12
Prolog
Gesetz und Verbrechen unterliegen dem Henne-Ei-Prinzip. Zwar scheint das Verbrechen älter zu sein, da Gesetze ansonsten nicht nötig geworden wären, doch hätte man schwerlich je ein Verbrechen erkannt, wäre damit nicht irgendein Gesetz gebrochen worden.
Gesetze regeln das menschliche Zusammenleben und über ihre Einhaltung wacht die Polizei. Aber nicht nur: In Klagenfurt haben sich der Bierführer Hubert Pogatschnig und sein Assistent Ludwig Melischnig die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als „Zwei für die Gerechtigkeit“ gefeiert und von der Polizei unter dem Kommando von Chefinspektor Leopold Ogris als „Deppen-Duo“ verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in den Gaststätten in und um Klagenfurt …
Sonntag, 1.30 Uhr, Mondgasse, Klagenfurt.
Erwin Anderle war Ende zwanzig und nicht mehr ganz nüchtern, als er vom St. Veiter Ring in die Gerichtsgasse einbog. Der Abend war lustig verlaufen und er hatte wohl etwas die Zeit übersehen, aber was sollte es? Heute konnte er ausschlafen. Die Gasse war spärlich beleuchtet und mutete ihm irgendwie mittelalterlich an, wie jedes Mal, wenn er durch sie hindurchging. Dort, wo die Gerichtsgasse in die Mondgasse einmündete, hatte ein humoriger Anwohner ein Holzschild an eine der Hausmauern angebracht, die er mit „Jaga-Vicke-Platz“ (mundartlich für: Jäger-Viktor-Platz; Anm.) beschriftet hatte. Hier hielt Erwin Anderle inne, sah sich das Schild an und lächelte. Das konnte er sich hier um diese Zeit erlauben; niemand würde ihn beobachten und für nicht ganz richtig im Kopf halten.
Plötzlich drang ein leises Wimmern an Anderles Ohr. Sein Blick schnellte nach rechts in die Mondgasse. – Er war auf der Stelle nüchtern! Die gesamte Gasse schien in Blut getränkt zu sein; schwarzrote Blutspritzer befleckten die Fassaden der flankierenden Häuser und in Gassenmitte lag – inmitten einer großen, dunklen Pfütze – eine bizarr verrenkte menschliche Gestalt. Es sah aus, als wäre ein Schwein vom Himmel gefallen und hier zerplatzt.
Erwin Anderles Kreislauf fuhr hoch: Sein Herz schlug so laut und schnell, dass er befürchtete, es werde aus seiner Verankerung springen, und das Sirren in seinen Ohren schien jedes andere Geräusch zu überlagern.
Zögernd trat er näher, versuchte zu verstehen, was er da sah. Die Gestalt war ein Mann, der offensichtlich schon seit einer ganzen Weile tot war. Denn das Blut, in dem er lag, war schwarz und gestockt. Der längliche Gegenstand neben ihm entpuppte sich bei näherem Hinsehen als hässlich großer Dolch, der vom eingedickten Blut vollständig eingeschlossen war.
Und schließlich – unmittelbar neben dem Messer – kauerte eine junge Frau an der Häuserwand. Ihr Blick war starr auf den Leichnam gerichtet. Sie hielt ihre Knie an sich gezogen und umklammerte sie mit ihren Armen. Mit den Händen hatte sie sich wohl ins Gesicht gefasst, denn beides war blutverschmiert. Ihr Oberkörper wiegte vor und zurück und ab und zu, wenn ein Schütteln durch ihren Körper ging, schluchzte sie verhalten und ein paar Tränen rannen über ihre Wangen.
Neben der jungen Frau klebte ein Plakat an der Häuserwand, das ebenfalls ein paar Blutspritzer abbekommen hatte. Das Plakat war vollständig schwarz, bis auf eine weiße Aufschrift mit dem Wortlaut: „Bald in Klagenfurt: Die Nacht der Zerper“.
Montag, 10.30 Uhr, Nähe Autobahnauffahrt Klagenfurt-West.
„Was für ein seltsamer Laden“, wunderte sich Hubert Pogatschnig, als er den Bierwagen endlich auf dem Parkplatz abgestellt hatte. „Bist du sicher, dass die Adresse stimmt?“
Obwohl sie Ludwig Melischnig inzwischen wohl schon fünfmal überprüft hatte, verglich er gehorsam noch einmal die Lieferadresse mit dem Stadtplan. Dann nickte er.
Der Parkplatz war groß genug für zumindest achtzig Autos, wenn nicht mehr. Doch außer dem Bierwagen war momentan nur ein schwarzer BMW hier geparkt. Das Gebäude selbst war ein flacher Neubau; großflächig angelegt, aber ohne Stockwerke. Die Fenster waren schwarz verhängt, ebenso eine große Tafel über zwei großen Eingangstüren.
„Was das etwa ist?“, fragte nun auch Melischnig.
„Na, ein Altersheim wird es nicht sein“, erwiderte Pogatschnig und Melischnig fragte unverständig:
„Wieso nicht?“
„Weil wir ab heute jede Woche 300 Liter Bier hierher liefern“, meinte Pogatschnig. „Das würden die in einem Altersheim ja nie wegtrinken!“
Melischnig begehrte auf:
„Und was ist mit den Pflegern?“
Hubert Pogatschnig seufzte und hielt Melischnig die Hand hin:
„Ich wette mit dir, dass das da drinnen ein modernes Gasthaus ist. Wettest du dagegen?“
Ludwig Melischnig sah zunächst Pogatschnigs Hand und dann Pogatschnigs Gesicht misstrauisch an, schlug aber nicht ein.
In dem Moment parkte ein weiteres Auto auf den Parkplatz ein. Es war ein roter Opel, der seine besten Jahre schon hinter sich hatte. Eine Frau stieg aus und hob umständlich eine große Damenhandtasche vom Rücksitz, ehe sie in dem Gebäude verschwand.
„Komm, Ludwig“, forderte Pogatschnig seinen Freund und Kollegen auf. „Machen wir, dass wir unsere Lieferung loswerden, uns läuft die Zeit davon.“
Es war dunkel im Gebäudeinneren, nur ein paar Deckenlampen sorgten für Arbeitsbeleuchtung. Hier herinnen wirkte das Gebäude um vieles größer als von außen. In der Mitte eines Gastraums standen zwei längliche Theken-Inseln, die den Raum in zwei Hälften teilten. Große Tische standen hier in Reih und Glied, jeder von ihnen war an drei Seiten von einer Eckbank umrahmt. Die Stirnseite gegenüber dem Eingang war zur Gänze mit einer großen Bühne verbaut, über der ein bedrohlich aussehendes Stahlgestänge mit einer mächtigen Licht- und Tonanlage hing.
„Du hast recht gehabt“, flüsterte Ludwig Melischnig. „Es ist wirklich kein Altersheim!“
Die Frau, die unmittelbar vor ihnen das Gebäude betreten hatte, stand nun in der vorderen Theken-Insel. Sie holte Trinkgläser aus einem Karton, wischte sie ab und stellte sie in die gläsernen Regale, die von der Decke zu ihr herabhingen.
Pogatschnig ging zu ihr hin. Er grüßte von weitem, um die Frau nicht zu erschrecken, und als sie aufsah, erkannte er, dass sie vor kurzem geweint hatte. Je näher er ihr kam, desto mehr Mitleid bekam er mit ihr. Sie war Anfang dreißig, dunkelblond und trug ihre schulterlangen Haare, die sie wohl schon seit einigen Tagen nicht mehr gewaschen hatte, zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie hatte eine sportliche Figur und ihr Gesicht empfand Pogatschnig als durchaus attraktiv, wenn auch durch das Weinen momentan etwas entstellt.
Hubert Pogatschnig reichte ihr über den Tresen hinweg die Hand und stellte sich vor. Sie erwiderte seinen Gruß freundlich und sagte nur kurz:
„Anne.“ Der Druck ihrer Hand war fest. „Was kann ich für Sie tun?“
„Wir sollen einer gewissen ‚Friedrich Wutte OHG’ eine Ladung Bier liefern“, erklärte Pogatschnig. „Die Anschrift war nicht leicht zu finden.“
„Das glaube ich“, erwiderte Anne und zwang sich zu einem Lächeln. „Aber Sie sind hier richtig.“ Anne öffnete eine Falltür innerhalb der Theken-Insel und rief hinunter: „Chef? Das Bier ist da!“
Dann lauschte sie, bis sie eine Antwort bekam, die Pogatschnig jedoch nicht hörte. Sein Blick fiel auf Annes große Handtasche, die auf der gegenüber liegenden Schankfläche der Theken-Insel lag. Sie war zur Seite gekippt und ein dickes, labbriges Buch aus ihr hervorgerutscht. Dieses war mit einer stilisierten gotischen Schrift bedruckt, die Pogatschnig nur schwer entziffern konnte. Schließlich glaubte er das Wort „Zeughaus“ zu erkennen und darunter „Der Katalog für Freunde des Mittelalters“.
„Ist in Ordnung“, rief Anne soeben in den Keller, schloss die Falltüre und erklärte: „Der Herr Wutte ist eh gerade im Getränkekeller. Fahren Sie einfach um das Gebäude herum, auf der Rückseite befindet sich die Laderampe. Dort wartet der Chef auf Sie.“
Pogatschnig bedankte sich und ging wieder in Richtung Ausgang, während Anne fortfuhr, die Gläser aus den Kartons abzuwischen und in die Regale über sich zu stellen. Auf dem Weg nach draußen sammelte er Ludwig Melischnig ein, der am Eingang stehen geblieben war und sich mit offenstehendem Mund umgesehen hatte.
Sie fuhren nun um das Gebäude herum und kamen zu einer betonierten Schräge, die in den Getränkekeller hinabführte. Auf ihr kam gerade ein Mann herauf, der sich für seine Ende dreißig ein wenig zu jugendlich gab, wie Pogatschnig empfand. Für Frauen-Augen mochte er fesch wirken: Er trug einen Dreitagebart und eine modische Frisur, bestach trotz seiner Arbeitskluft mit sportlichem Auftreten und war – wie sich herausstellen sollte – mit einem lockeren und unüberwindbaren Humor gesegnet.
Er drückte den beiden Bierführern fest die Hände.
„Ich bin der Friedl Wutte“, stellte er sich vor. „Der Inhaber von diesem Laden hier.“
Dann ging er den beiden voraus und zeigte ihnen, wo sie die Fässer abladen sollten.
„Das dürfte euch nicht schwer fallen“, meinte er, „ich habe euch extra eine Schräge herunter bauen lassen, da fahren die Fässer von selbst herein.“
Nachdem Hubert Pogatschnig artig gelacht hatte, stellte er Wutte eine Frage, die ihm auf der Zunge brannte, seit er und Melischnig hier angekommen waren:
„Wie heißt denn Ihr Lokal und wann wird es eröffnet?“
„Das ist vorerst noch ‚top secret’“, erwiderte Friedrich Wutte augenzwinkernd. „Aber nur keine Angst, ihr werdet es rechtzeitig aus den Medien erfahren.“
Als die Fässer ausgeladen waren und Hubert Pogatschnig gerade die hydraulische Heckklappe des Bierwagens schloss, fragte ihn Ludwig Melischnig:
„Du, Hubert, was heißt denn ‚topsikrät’?“
Montag, 13 Uhr, Sicherheitszentrum Klagenfurt.
Chefinspektor Leopold Ogris lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück und atmete tief durch. Er verschränkte die Hände hinter seinem Nacken, schloss die Augen sagte zu Kontrollinspektorin Christiane Schulz:
„Lesen Sie mir noch einmal die bisherigen Fakten vor, Frau Kollegin.“
Die Kontrollinspektorin räusperte sich und begann von unterschiedlichen Papierblättern abzulesen, die in wildem Chaos auf ihrem Schreibtisch lagen:
„Also: Der Tote ist ein in Klagenfurt-Sankt-Peter wohnhafter Rechtsanwalt namens Ingo Rabensteiner. Er hatte den akademischen Titel eines Magisters, war 28 Jahre alt und in der Klagenfurter Kanzlei Doktor Gatternig beschäftigt, wo er auf Scheidungsrecht spezialisiert war. Identifiziert wurde er durch einen Ausweis, den er bei sich hatte, und durch seine Verwandten. Laut den Aussagen der bisher befragten Verwandten, Freunde und Arbeitskollegen des Mordopfers war Ingo Rabensteiner ein liebenswürdiger, zurückhaltender Mann, der – so behaupten sie – keine Feinde hatte.
Allerdings kann man das bei einem Scheidungsanwalt nie mit Sicherheit sagen. Glaubt man den Worten seines Chefs, war Rabensteiner fleißig und verfügte über hervorragende Instinkte, mit denen er es als Anwalt noch weit gebracht hätte. Als Todesursache konnten drei Dolchstiche festgestellt werden, die von jener Waffe stammen, die am Tatort sichergestellt wurde.
Der erste Stich wurde von unten geführt, durchdrang Bauchdecke und Magenwand, der zweite durchbohrte den Hals unmittelbar unter dem Kehlkopf und kam an der Halswirbelsäule zum Stillstand und der Dritte traf das Opfer in die untere Rückenpartie, wobei die Klinge die Rückenmuskulatur aber nicht durchdrang. Der Mord muss sehr dynamisch vonstatten gegangen sein, denn Blut fand sich quasi überall in der Mondgasse.
Das erschwert auch ein Täterprofil: Wenn sich das Opfer wehrt, sind die Einstiche in der Regel nicht ganz so tief, weil dann die Wucht der Angriffe bis zu einem gewissen Grad gebremst wird. Der Mörder könnte demnach ebenso ein Mann wie auch eine Frau gewesen sein.
Laut medizinischem Gutachten trat der Tod bereits gegen 22 Uhr ein, was bedeutet, dass in den darauffolgenden dreieinhalb Stunden niemand mehr am Tatort vorbeikam – oder zumindest niemand, der das Gesehene gemeldet hat. Die Anwohner sagten aus, sie hätten nichts von einem Mord mitbekommen, was jedoch kein Wunder ist, immerhin handelt es sich bei ihnen um betagte Herrschaften, die bereits um 21 Uhr im Bett waren.
Eine mögliche Zeugin der Tat, wenn nicht gar eine Tatverdächtige, ist die 21-jährige Alexandra Schmiederl aus St. Veit an der Glan. Sie wurde von den Kollegen von der Streife am Tatort aufgefunden, kann aber nicht befragt werden, weil sie sich in einem sogenannten paralytischen beziehungsweise katatonischen Zustand befindet. Das bedeutet, sie nimmt ihre Umwelt nicht bewusst wahr und wird von immer wiederkehrenden Muskelkrämpfen geschüttelt. Sie wurde in die psychiatrische Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt eingeliefert, wo die Mediziner sie in künstlichen Tiefschlaf versetzten. Ihr behandelnder Arzt sagte, der Auslöser für ihren Zustand sei ein traumatisches Erlebnis gewesen, wann sich ihre Lage bessern werde, könne er jedoch nicht vorhersagen.
Alexandra Schmiederls Fingerabdrücke sind die einzigen Spuren auf der Tatwaffe, die nicht von dem Toten stammen. Weiters befand sich das Blut des Ermordeten auf Frau Schmiederls Händen, Gesicht, Kleidung und auf ihrem Mobiltelefon, welches ebenfalls am Tatort am Boden liegend gefunden wurde.
Mit Hilfe dieses Mobiltelefons konnte die Identität der Studentin festgestellt werden: Unter der letzten gewählten Nummer meldete sich eine Freundin der jungen Frau, die mit ihr eine Wohnung in einem Wohnblock unweit der Mondgasse teilt. Diese Freundin identifizierte Frau Schmiederl als Studentin der Pädagogischen Akademie – PädAk – und sagte aus, Frau Schmiederl hätte ihr gegenüber nie einen Magister Ingo Rabensteiner erwähnt und auch nie von einem Mann gesprochen, der Ingo Rabensteiner hätte sein können. Frau Schmiederl – so die Freundin weiter – wäre jedoch keinesfalls zu einer Bluttat fähig, auch hätte sie die Mordwaffe nie bei ihr gesehen.
Der Mann, der das Mordopfer und Alexandra Schmiederl gefunden hat, heißt Erwin Anderle. Er arbeitet als Grafiker in einer Klagenfurter Druckerei und gab an, vorletzte Nacht von einem lustigen Abend mit Freunden nach Hause unterwegs gewesen zu sein. Seine Freunde bestätigen diese Aussage. Herr Anderle hätte ihre Runde etwa um 1.20 Uhr verlassen – also etwa zehn Minuten, bevor er die Leiche fand und die Polizei verständigte.
Die Mondgasse betrat er durch die Gerichtsgasse. Diese ist die direkte Verbindung zwischen der Innenstadt und der Dr.-Franz-Palla-Gasse, wo sich seine Wohnung befindet. Herr Anderle gab an, durch den Anblick des Tatorts schlagartig einen klaren Kopf bekommen zu haben, weshalb er nichts anrührte, sondern per Mobiltelefon sofort die Polizei alarmierte. Da sich weder Spuren von ihm am Tatort noch Spuren vom Tatort an ihm befinden, ist davon auszugehen, dass die Aussage von Erwin Anderle der Wahrheit entspricht.“
Chefinspektor Leopold Ogris war aufgestanden und hatte damit begonnen, im Büro auf und ab zu gehen. Er nahm eines der Papierblätter vom Schreibtisch seiner Stellvertreterin und fuhr an ihrer Stelle fort:
„Die Tatwaffe ist ein mittelalterlicher Dolch mit einer Klingenlänge von achtzehn Zentimetern. Die Waffe stammt aber nicht wirklich aus dem Mittelalter, sondern von einem deutschen Versandhandel namens ‚Zeughaus’. – Ein Anbieter von Ausrüstungsgegenständen für mittelalterliche Schaukampftruppen.“
Kontrollinspektorin Christiane Schulz hatte ein weiteres Blatt genommen, hielt es ihrem Vorgesetzten hin und erklärte dazu:
„Die Firmenprägung dieses Unternehmens wurde auf der Klinge nachgewiesen.“
Chefinspektor Ogris hielt inne und sah seine Kollegin fragend an:
„Mittelalterliche Schaukampftruppen? Gibt es von denen so viele, dass sich ein eigener Versandhandel lohnt?“
Kontrollinspektorin Schulz lachte unwillkürlich auf, dann rief sie:
„Aber Herr Chefinspektor, wo leben Sie? Inzwischen gibt es doch keinen Jahrmarkt mehr, der nicht seine eigene Mittelalter-Abteilung hätte. Im Sommer finden im ganzen Land einschlägige Lager statt und in Friesach wird sogar eine authentische Burg gebaut.“
„Das zumindest ist nicht an mir vorübergegangen“, brummte Ogris missmutig.
Die Kontrollinspektorin fuhr fort:
„Das Mittelalter erlebt derzeit eine neue Hochblüte – und selbstverständlich blüht damit auch der dazugehörende Handel.“
„Warum wissen Sie so viel darüber?“ Der Stimme des Chefinspektors war ein Anflug von Misstrauen zu entnehmen.
„Weil auch ich mich dem Reiz des Mittelalters nicht ganz entziehen kann“, gestand Kontrollinspektorin Schulz lächelnd.
Der Chefinspektor seufzte.
„Ja, ja, ich verstehe schon“, sagte er. „Das wirkliche Leben ist Ihnen nicht blutrünstig genug, da müssen noch ein paar mittelalterliche Schwertkämpfe her.“
„Es gibt ja nicht nur mittelalterliche Waffen“, konterte die Stellvertreterin. „Es gibt ja auch Kultur, Literatur … schon einmal etwas vom Minnesang gehört?“
„Ja – verschonen Sie mich!“ Ogris’ abwehrende Geste war nicht ernst gemeint. „Zumindest ist das Mittelalter noch nicht so weit in unseren Alltag vorgedrungen, dass jeder einen ellenlangen Dolch mit sich herumführt. Die Tatwaffe muss also zum Tatort mitgebracht worden sein, was bedeutet, dass eine Tötungsabsicht oder zumindest eine Tötungsbereitschaft bestanden hat.“
„Halten Sie Alexandra Schmiederl für die Mörderin?“, fragte Kontrollinspektorin Christiane Schulz geradeheraus.
Der Chefinspektor hob die Schultern, als er erwiderte: