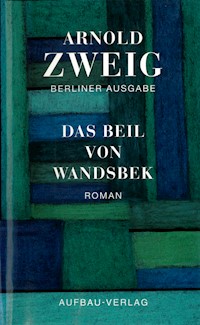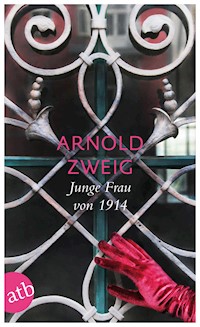16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der früheste Roman über den Nahostkonflikt: Weltliteratur mit Kriminalhandlung von global-politischer Brisanz.
An einem Spätsommerabend des Jahres 1929 wird der Schriftsteller und Jurist Jizchak Josef de Vriendt in Jerusalem erschossen. Ein Attentat aus dem Hinterhalt. Kommt der Mörder aus den zionistischen Kreisen, die in dem klugen, auf Ausgleich mit der arabischen Seite bedachten Politiker einen Verräter an der nationalen Sache sehen? Oder aus der Familie des jungen Arabers Saûd, der für de Vriendt mehr war als ein Schüler? Mr. Irmin, Chef des Geheimdienstes bei der britischen Verwaltung von Palästina, ein Freund de Vriendts und eingeweiht in dessen Freigeisterei, will den Täter stellen. Seine Fahndungen konfrontieren ihn mit der explosiven Situation im Land, den rivalisierenden Bevölkerungsgruppen der Araber, Juden und Christen, mit einer überwältigenden Landschaft und einer historischen Tradition von mehr als dreitausend Jahren.
Arnold Zweigs Roman von 1932 gilt als erster historischer Roman über den Nahostkonflikt und basiert auf einem wahren Mordfall. Mit seiner literarischen Bearbeitung der Ereignisse vermag er den Verstrickungen auf den Grund zu kommen, die die Welt noch immer in Atem halten.
»Ein politischer Mord ist Drehpunkt dieses ersten historischen Romans über das Land Palästina/Israel – vor einem explosiven politischen Hintergrund, der die Anfänge heutiger Konflikte im Nahen Osten aufzeigt.« Arnold Zweig, 1932.
»Man ist so erlebenssatt, nachdem man durch ist – der Stoff, sein Reichtum, die Schärfe der Zeichnung, die Unparteilichkeit der Schilderung, das nimmt Besitz von einem.« Sigmund Freud.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Der früheste Roman über den Nahostkonflikt: Weltliteratur mit Kriminalhandlung von global-politischer Brisanz
An einem Spätsommerabend des Jahres 1929 wird der Schriftsteller und Jurist Jizchak Josef de Vriendt in Jerusalem erschossen. Ein Attentat aus dem Hinterhalt. Kommt der Mörder aus den zionistischen Kreisen, die in dem klugen, auf Ausgleich mit der arabischen Seite bedachten Politiker einen Verräter an der nationalen Sache sehen? Oder aus der Familie des jungen Arabers Saûd, der für de Vriendt mehr war als ein Schüler? Mr. Irmin, Chef des Geheimdienstes bei der britischen Verwaltung von Palästina, ein Freund de Vriendts und eingeweiht in dessen Freigeisterei, will den Täter stellen. Seine Fahndungen konfrontieren ihn mit der explosiven Situation im Land, den rivalisierenden Bevölkerungsgruppen der Araber, Juden und Christen, mit einer überwältigenden Landschaft und einer historischen Tradition von mehr als dreitausend Jahren.
Arnold Zweigs Roman von 1932 gilt als erster historischer Roman über den Nahostkonflikt und basiert auf einem wahren Mordfall. Mit seiner literarischen Bearbeitung der Ereignisse vermag er den Verstrickungen auf den Grund zu kommen, die die Welt noch immer in Atem halten.
»Ein politischer Mord ist Drehpunkt dieses ersten historischen Romans über das Land Palästina/Israel – vor einem explosiven politischen Hintergrund, der die Anfänge heutiger Konflikte im Nahen Osten aufzeigt.« Arnold Zweig, 1932
»Man ist so erlebenssatt, nachdem man durch ist – der Stoff, sein Reichtum, die Schärfe der Zeichnung, die Unparteilichkeit der Schilderung, das nimmt Besitz von einem.« Sigmund Freud
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Arnold Zweig
De Vriendt kehrt heim
Roman
Mit einem Vorwort von Meron Mendel
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Vorwort — Von Meron Mendel
Erstes Buch — Ein Geistiger allein
1. Kapitel — Ein Freund seiner Freunde
2. Kapitel — Ein Fehlschlag
3. Kapitel — Ein Mann lässt sich warnen
4. Kapitel — Der Riss querdurch
5. Kapitel — Die Vorkämpfer Gottes
6. Kapitel — Nachts
7. Kapitel — Wärme der Menschen
8. Kapitel — Von Seiten des Landpflegers
9. Kapitel — Die Vernunft der Greise
Zweites Buch — Schüsse in Jerusalem
1. Kapitel — Umbruch
2. Kapitel — Ungelegenheiten
3. Kapitel — Widerruf
4. Kapitel — Ein länglicher Gegenstand
5. Kapitel — Heim nach Dameschek
6. Kapitel — Das Opfer des Arabers
7. Kapitel — Bundesgenossen
8. Kapitel — Palaver
9. Kapitel — Nachtspaziergang
Drittes Buch — Stoss und Gegenstoss regieren die Welt
1. Kapitel — Nelsons letztes Signal
2. Kapitel — Entladung
3. Kapitel — Die Spur
4. Kapitel — Ungewissheit
5. Kapitel — Sterben eines alten Mannes
6. Kapitel — Ein Brief
7. Kapitel — Taedium vitae
8. Kapitel — Am Toten Meer
9. Kapitel — In Jerusalem begraben sein
Anhang
Anmerkungen
Arnold Zweig — Nachwort zur holländischen Ausgabe des »De Vriendt«
Editorische Notiz
Die Autoren
Erläuterungen
Impressum
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
Für Lily Offenstadt
Die Araber sagen: »El Kuds« und führen die Hand an die Brauen: »Hierosolyma« sagen die Griechen und hoffen Christum zu schauen: »Jeruschalajim« rufen wir Dich, heimkehrende Söhne des Sem – Die jungen Völker aber, Ummauerte, grüßen Dich strahlend: Jerusalem!
(Aus den Vierzeilern des de Vriendt)
Vorwort
Von Meron Mendel
»Knapp zwanzig Jahre vor dem Weltkrieg hat sie [die Juden] ein österreichischer Schriftsteller namens Herzl … zur Rückkehr aufgerufen …: ›Jetzt ist die Stunde, Israel! Volk ohne Land, erlöse das Land ohne Volk.‹ Und dabei wohnten damals schon dreihunderttausend Araber darin, aber das wusste er glücklicherweise nicht.«
(Arnold Zweig, De Vriendt kehrt heim, S. 109)
Mit dem 7. Oktober 2023 rückte plötzlich und mit Wucht der Nahostkonflikt zurück ins Zentrum der Weltaufmerksamkeit. Die Bilder des Massakers an israelischen Zivilisten in den Kibbuzim und auf dem Supernova-Musikfestival sowie die darauffolgende Zerstörung des Gazastreifens führten die Grausamkeit des langjährigen Konflikts vor Augen. Das Massaker am 7. Oktober war das größte, aber nicht das erste in der Geschichte der beiden Bevölkerungsgruppen. Als Arnold Zweig vor etwa 90 Jahren das britische Mandatsgebiet Palästina besuchte, war die jüdische Bevölkerung gerade durch das Massaker vom August 1929 erschüttert worden. Ein Massaker, das mehreren hundert Jahren des weitgehend friedlichen Zusammenlebens von Juden und Arabern in Hebron, Safed und Gaza ein blutiges Ende bereitete. Einen Monat nach seiner Rückkehr aus Palästina veröffentlichte Zweig mit De Vriendt kehrt heim 1932 ein denkwürdiges Dokument seiner Zeit, das bis heute von brisanter Aktualität ist. Zweig selbst bezeichnete sein Buch später, im Nachwort zur Ausgabe von 1955, als »den ersten historischen Roman des Staates Israel«. Er ist zugleich eine fiktionalisierte Dokumentation des ersten politischen Mordes in der Geschichte des Zionismus.
Wie nun erneut im Oktober 2023, so hat auch das Massaker von 1929 existenzielle Fragen für Juden im Land Israel aufgeworfen: Hat die Idee von einer jüdischen Souveränität inmitten des Nahen Ostens eine Zukunft? Können die zwei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der Juden und Araber auf einem schmalen Streifen Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss nebeneinander und miteinander friedlich zusammenleben? Werden sich die zwei Nationalbewegungen jemals auf einen Kompromiss einlassen?
Arnold Zweig behandelt in seinem fiktionalen Werk den Mord an dem niederländischen Juristen und Schriftsteller Dr. Jacob Israël de Haan, der sich 1924 in Jerusalem ereignete. Es war der erste politische Mord in der Geschichte der Jischuv, der jüdischen Bevölkerung in Palästina vor der Staatsgründung Israels. Zweig datiert die Bluttat im Roman auf das Jahr 1929 um, sodass er direkt vor dem Hintergrund der Verschärfung des jüdisch-arabischen Konflikts stattfindet. In der israelischen Geschichtsschreibung wurde der reale Mord bis heute nicht aufgearbeitet – wie auch der Roman in Israel weithin unbekannt geblieben ist. Denn de Haan verkörperte wie kaum ein anderer das Gegenteil des zionistischen Ideals: Er war überzeugter Antizionist, der seine Positionen nicht nur öffentlich in Zeitungsartikeln, sondern auch in Gesprächen mit arabischen und britischen Politikern zum Ausdruck brachte. Unter anderem traf er sich mit dem Emir Abdallah ibn Husain, dem späteren König von Jordanien, und mit dem britischen Hochkommissar Herbert Samuel.
Seine ideologische Heimat fand de Haan stattdessen ausgerechnet bei der ultraorthodoxen Gemeinschaft in Jerusalem. Dort wurde er zum engen Vertrauten von Großrabbiner Joseph Sonnenfeld (im Roman heißt er Rabbiner Zadok Seligmann). Der dezidierte Antizionismus dieser Ultraorthodoxen begründet sich aus der jüdischen Theologie: Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer und das daraufhin erzwungene Exil des jüdischen Volkes werden als Strafe Gottes interpretiert. Eine jüdische nationale Souveränität kann und darf demnach erst dann wieder hergestellt werden, wenn der Messias gekommen ist. Das Projekt der Zionisten erscheint aus diesem Blickwinkel gotteslästerlich.
Von dieser ultraorthodoxen Theologie war der 1887 im damaligen Schlesien geborene Arnold Zweig weit entfernt. Dennoch faszinierte ihn de Haan. »Seit jenen Monaten, fast 8 Jahre lang, beschäftigte seine Gestalt meine Phantasie«, heißt es in seinem Nachwort zur niederländischen Ausgabe von 1933 (vgl. den Nachdruck im vorliegenden Band, S. 266). Diese Faszination kann biographisch erklärt werden. Wie seine niederländisch-jüdische Hauptfigur war auch der deutsch-jüdische Schriftsteller vom Zionismus zunächst begeistert, dann aber zutiefst enttäuscht. Bereits 1932 blickte Zweig nüchtern und kritisch auf das, was er später in der Ausgabe von 1955 als »selbstmörderischen Kurs« des Zionismus bezeichnete. Wenngleich er sich zu diesem Zeitpunkt selbst noch als Zionisten sah, betrachtete der entschiedene Pazifist doch mit Sorge die militaristischen und chauvinistischen Tendenzen in der zionistischen Bewegung. Mit dem literarischen Denkmal für Jacob Israël de Haan wollte Arnold Zweig eine politische Botschaft ausdrücken: »In der stummen und unerlösten Gegebenheit seines Schicksals, das sich vor acht Jahren in Jerusalem vollzog, lag für mich ein Auftrag – für mich, für niemanden sonst, denn sonst hätte sich wohl schon jemand gefunden, ihn zu hören und zu befolgen. Dieser Auftrag hieß offenbar: Kritik des modernen Nationalismus am jüdischen Nationalismus …« (Vgl. S. 266.)
Wie auch sein Freund, der Religionsphilosoph Martin Buber, vertrat Zweig die Auffassung, dass Juden und Araber gleichberechtigt in einem binationalen Staat leben sollten. Nach seiner erzwungenen Auswanderung 1934 nach Haifa (von Berlin über Prag und Sanary-sur-Mer) verließ Zweig der Glaube an die jüdische Nationalbestrebung endgültig. Er ging zunächst ins innere Exil, bevor er, in Palästina immer fremd geblieben, 1948 nach Ostberlin zurückkehrte; bis zu seinem Tod 1968 lebte er in der DDR. In de Haan erkennt Zweig den Schlüssel zum Verständnis der Dilemmata, die ihn den Rest seines Lebens begleiteten: »Ich wusste, er würde mich in die Tiefe jüdischer und menschlicher Problematik hineintragen; nur ahnte ich nicht, wie tief.« (Vgl. S. 266.) Zweig war von der Vielschichtigkeit, der schieren Widersprüchlichkeit seiner Hauptfigur angezogen: ein niederländischer Marxist, der zum ultraorthodoxen Juden wurde. Ein Dichter und Schriftsteller, der über sein gleichgeschlechtliches Begehren schrieb. Ein westeuropäischer Intellektueller inmitten der osteuropäischen ultraorthodoxen Gemeinde Jerusalems. Ein Jude, der für einen arabischen Jungen mehr als nur Lehrer war. Ein Pragmatiker und Ideologe zugleich. Das tragische Ende von de Haan steht für Zweig metaphorisch und konkret politisch für die Sackgasse, in der er selbst sich Anfang der 1930er Jahre befindet.
Auch in der zionistischen Bewegung gab es Stimmen, die den Mord an de Haan verurteilten. Einer der Anführer der Bewegung, Moshe Belinsohn, konstatierte am 28. Dezember 1926 in der hebräischen Tageszeitung Davar: »Wenn wir zu diesem Mittel greifen, wissen wir nicht, wo der Weg endet.« Diese Prophezeiung hat sich in den Jahrzehnten danach bewahrheitet: Vier Jahren später war es ausgerechnet der Hoffnungsträger der progressiven Kräfte in der Jishuv, der zionistische Politiker Chaim Arlosoroff, der beim Spaziergang am Strand von Unbekannten erschossen wurde. Im Verdacht stand der rechte Flügel der zionistischen Bewegung. Man könnte diesen Bogen bis zum 4. November 1995, zur Ermordung des israelischen Ministerpräsident Jitzchak Rabin durch einen jüdischen Fundamentalisten in Tel Aviv, spannen. Immer wieder griffen radikale nationalistische oder fundamentalistische religiöse Kräfte zum Mittel des politischen Mordes, um den Lauf der Geschichte zu ändern.
Jacob Israël de Haan vertrat die Position, die Juden in Palästina sollten in einem arabischen Staat als eine Minderheit mit religiösen, aber nicht mit nationalen Rechten anerkannt werden. Das ließ sich nicht realisieren. Aber auch die zionistische Vorstellung »Volk ohne Land, erlöse das Land ohne Volk« erwies sich als eine bequeme Illusion. Neunzig Jahre später leben im eng begrenzten Raum zwischen dem Mittelmeer und dem Jordanfluss sieben Millionen Juden und sieben Millionen Palästinenser, deren aller Leben aufs Tiefste vom ungelösten Konflikt geprägt ist.
Eine hebräische Übersetzung von De Vriendt kehrt heim ist erst 1991 erschienen. Arnold Zweig selbst hatte das anlässlich der deutschsprachigen Ausgabe von 1955 mit gewissem Sarkasmus kommentiert: »Daß ein so abgestempeltes Buch zwar in sechs Sprachen, aber nicht ins Hebräische übersetzt wurde, wird niemanden wundern.« Der Roman passt nicht ins zionistische Narrativ, das in Israel ab dem Kindergarten vermittelt wird.
Die nun vorliegende Neuausgabe macht De Vriendt kehrt heim für neue Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum zugänglich. 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist die Lektüre erstaunlich frisch und deprimierend zugleich. Der Roman ist das Dokument der longue durée des Nahostkonflikts. So viel ist seitdem passiert. Und doch haben sich die Grundkoordinaten des Konflikts so wenig geändert. Es bleiben zwei Völker, die miteinander oder nebeneinander zu leben verdammt sind.
Die oben aufgeworfenen Fragen bleiben vorerst ohne Antwort. Wie können Juden und Araber auf dem schmalen Streifen Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss zu einem Kompromiss finden, nebeneinander und miteinander friedlich zusammenleben?
Nach mehr als 100 Jahren des Konflikts scheinen die beiden Bevölkerungsgruppen zu tief in ihrem Schmerz und ihren Traumata zu verharren, als dass sie allein den Weg des Friedens beschreiten könnten. Angesichts der weltweiten Folgen dieses Konfliktes ist es nicht zuletzt im Interesse der Weltgemeinschaft, Israelis und Palästinenser mit Nachdruck an den Verhandlungstisch zu bringen. Es bedarf einiger Wunder, um den Konflikt endlich zu beenden. Aber wie schon David Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, konstatierte: »Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!«
Erstes Buch
Ein Geistiger allein
Dich beten sie in tausend Zungen an,Und manche nahen weich wie Schnecken Dir –Was willst, behagt Dir das, Du dann von mir?Dann lass Dich hassen, denn ich bin ein Mann.
(Aus den Vierzeilern des de Vriendt)
1. Kapitel
Ein Freund seiner Freunde
Lolard B. Irmin, der wichtigste Mann des Geheimdienstes bei der Verwaltung von Judäa (Südpalästina), hatte heute seinen europäischen Tag. So nannte er Zustände, die ihn von Zeit zu Zeit anfielen; dann schlug sein Herz schwer in der Brust, er neigte zu Schweißausbrüchen und trägem Hinbrüten und wunderte sich über alles, was ihm begegnete oder ihn betraf – über seine Tätigkeit, über die Stadt Jerusalem, über das Land und über sich selbst.
Ohne zu ahnen, dass der heutige Mittwoch besonders zählte, weil das gleichmütige Auge des Geschicks auf einen seiner Freunde gefallen war und Veränderung anhob für ihn und viele Tausende von Menschen, saß er am späten Vormittag im kühlsten Zimmer des Hauses in der Musrara, das er von Achmed Khouzy Effendi gemietet hatte – gegen gutes Geld, aber es war auch ein schönes Haus, mit großüberwölbtem Eingangsraum, den ein Springbrunnen erfrischte, eine Seltenheit in der wasserärmsten Bergstadt der Welt. Auf einem niedrigen Schemel hockte er, die Pfeife schmeckte ihm nicht, seine Hände hingen heiß zwischen den Oberschenkeln in den weißen Hosen, und aus dem geröteten Gesicht mit dem rotblond geschwungenen Schnurrbart blickten die blauen Augen gedankenvoll, fanatisiert vom Zweifel. War er verrückt? Ohne Frage. Nur ein Verrückter konnte fünf Jahre den S.S.-Mann (Secret Service) zwischen den Steinen dieser von allen guten Göttern verlassenen Stadt spielen; nur ein Verrückter in den Fäden hängen bleiben, die zwischen den Juden und den Arabern gespannt waren, zwischen den Briten und den Moslem, zwischen den Getauften aller Abschattungen – den Kopten, den Abessiniern, den Protestanten, den Griechen, den Römischen; zwischen den Konsulaten aller Völker, die der Turmbau zu Babel in jenem Zustand der Parteiung hinterlassen hatte, dessen sich die Rassen der Hunde oder Pferde geschämt hätten. Warum, zum Teufel, hatte er sich nicht längst aus diesem Spiel hier weggeschert, in das sich England als Bestallter des Völkerbundes eingeschaltet hatte, nur, um dafür von allen Seiten bekämpft zu werden? Hätte er nicht längst in einer gesunden, baumbewachsenen Kolonie oder in South Devon daheim Polo spielen, ein Weib nehmen und kleine Kinder zeugen können, wie es sich für einen Mann um die Mitte der dreißig nach den Regeln aller Weisen schickte? Was, ihr Götter des Fernen Ostens, hielt ihn davon ab, im Reiche des großen Buddha Beförderung zu suchen, unter den Deodars von Simla, wohin ihn seine Verdienste leicht gebracht hätten? Hier saß er, in Jerusalem, einer Stadt ohne Wasser, ohne Wald, ohne Frieden, in der zweiundfünfzig verschiedene Nationen und Sekten einander im Geheimen verachteten – nur weil er nicht loskonnte von diesem faszinierenden Stück nackten Felsens, das zwischen der Wüste und dem Mittelländischen Meer die Brücke von Asien nach Afrika bildete, einen der drei Gleichgewichtspunkte der Welt.
Es war Ende Juli 1929; der Himmel lag blau wie eine angelaufene Stahlglocke über der Stadt; erst gegen sechs, noch endlos hin also, würde der kühle Meerwind über die Berge Judäas ansausen und es auf den Dächern erträglich machen, im Schatten nasser Leinwände. Bis dahin lebte man so herum. Man konnte lesen, man konnte schlafen, vor allem den Gedanken zuhören. Zwar erwartete er seinen vertrauten Agenten, den besten seiner Untergebenen, den moslemischen Tscherkessen Machmud Iwanow, aber der mochte nur wiederkommen. Er brachte ja doch nur Kleinkram des Tages; an die eigentliche Sorge vermochte er nicht zu rühren – die Nervosität im Lande. Es hatte jetzt vier Monate kaum mehr geregnet; der Spätregen, Malkosch genannt, war früh gefallen in diesem Jahr; in die Gassen der Musrara und gar erst der Altstadt stieg man wie in ein heißes, trockenes Bad. Alle Nerven im Lande bebten, man musste sehr auf der Hut sein: das geringste Ereignis konnte zu Dummheiten führen. Dies war die Jahreszeit für politische Hitzköpfe – und Allah wusste, ob es daran mangelte! Gerade jetzt tobte der Streit um die Klagemauer, ein Kampf, bisher nur auf Papier geführt, auf journalistischem, auf juristischem und von Anfang an auf fromm bedrucktem, mit Gebeten und Predigten von beiden Seiten, den Juden und den Arabern – eine Angelegenheit, die für Fremde läppisch aussah, die von der Verwaltung auch so behandelt wurde, die aber aus Dynamit bestand, aus nichts Harmloserem, weil sie den religiösen Fanatismus beider Gruppen in Brand setzen konnte. Und er, Irmin, vermochte nicht, das »oben« begreiflich zu machen! »Dieses Spiel beschäftigt die Leute jetzt dreiviertel Jahr, und nichts ist passiert; lass es sie doch noch ebenso lange von schädlicherem Zank abhalten«, hatte ihm Robinson lachend entgegnet, als er das letzte Mal deswegen vorfühlte, obwohl das Geschmetter gewisser arabischer Zeitungen über die Bedrohung des Tempelplatzes die Posaunen von Jericho unter die harmloseren Musikinstrumente verwies. (Von den Posaunen von Jericho konnte sich L. B. Irmin einfach nicht trennen, obwohl Professor Garstand längst nachgewiesen hatte, dass sie eine schöne Erdichtung waren wie das Horn Rolands, die Flöte des Marsyas und die Leier Orpheus’.)
Lolard B. Irmin seufzte, klopfte die Pfeife aus, entnahm einem Schränkchen weiches Papier, verschiedene Nadeln und ein Fläschchen Spiritus und ging daran, sie umständlich zu reinigen. Er zerlegte sie in ihre Teile, den braungemaserten Kopf, das schwarze Rohr aus bestem Hartgummi, die silberne Kanüle im Innern, die listig mit Röhrchen und Stegen den unangenehmen Pfeifenabsud auffing und den Rauch kühlte; alsbald roch es im Zimmer nach verdunstetem Spiritus und dem scharfen, gelben Nikotin.
Die Zeiten waren vielleicht schlecht, bestimmt aber die spannendsten, die ein Mann erleben konnte. England focht um den Besitz Indiens, lautlos, ohne viel Gewalt, mit allen Mitteln einer erwachsenen Hand. Die Tage, in denen ein englischer General – zum Beispiel in Amritsar – sich demonstrierender Hindu-Versammlungen nur durch Maschinengewehrfeuer erwehren konnte – solch idiotische Tage waren hoffentlich für immer abgetan. Man musste auch nicht überall gleich Bolschewiken wittern und den Finger Moskaus. Wollte sich Mr. Ghandi mit seinen Hindu dem englischen Weltreich entziehen und zu den Tagen des kindlichen Spinnrockens zurückkehren, so musste man moslemische Politik treiben, und zwar auf der ganzen Linie. Und das taten sie nun, und ihre Sachkenner – L. B. Irmin lächelte sanft, während er einen umwickelten Draht durch das Pfeifenrohr sägte, wie ein Schornsteinfeger einen Fabrikschlot ausfegt – glaubten, sich der Moslem versichern zu können, wenn sie die Zionisten preisgaben. Es war viel Weisheit nötig, im Orient Politik zu machen, und sie war leider nicht immer denen gegeben, die sie am nötigsten brauchten. Ach nein! England hatte ein bisschen viel versprochen, als es in Kriegsnöten focht wie Roland bei Ronceval – den Arabern, den Juden, aller Welt, und es musste nun, nachdem der Krieg gewonnen und Europa mit Frankreichs Hilfe in ein Tollhaus verwandelt war, anständigerweise beiden Partnern einen Bruchteil Erfüllung und einen großen Haufen Enttäuschung bereiten. Die Juden, genauer: die Zionisten unter ihnen, hatten für sich freilich das Wort Großbritanniens, Palästina zum Heim des Judenvolkes ausbauen zu können – gegeben durch jenen berühmten Brief des greisen Lord Balfour, der seither die Balfour-Deklaration hieß. Die Araber wollten ein freies Arabien unter eigenen Herrschern haben. Es schien, dass den Arabern die Klugheit der westeuropäischen Juden mangelte, die das Land nach Kräften aufbauten und in der Person des Professors Weizmann die zionistische Sache geschickt und zäh vortrieben, unangefochten durch Rückschläge, Schikanen und selbst blutigen Aufstand. Höllisch schwer, sich hier durchzulavieren.
Lolard B. Irmin, während des Krieges Kapitän in der englischen Armee, betrachtete befriedigt seine saubere Pfeife, setzte sie zusammen und legte sie »zum Ausruhen« in den Schrank zurück. Dann stopfte er eine andere und trat mit ihr in den Hof des Hauses, um sie mit einem Brennglas an der Sonne zu entzünden. Zu etwas musste die sengende alte Dame da oben doch taugen, die so erbarmungslos auf die weißen Kalksteine Jerusalems, seine Häuser, sein Pflaster herunterknallte. Schweiß brach aus, so bald man sich ihr preisgab; die Kehle dörrte, es empfahl sich, schleunigst in die kühle Halle, das verdunkelte Zimmer zu flüchten und gleich einen heißen Tee mit Zitrone zu bestellen, noch das kühlendste Getränk in solchen Tagen. Diese Wissenschaft und einige andere verdankte Captain Irmin den langen Monaten, in denen er, nach beendetem Krieg, als Mitglied einer interalliierten Offizierskommission die Neutralität Wilnas, einer Stadt in Westrussland, behütet hatte, bis der polnische General Zeligorsky an der Spitze seiner Schwadronen einritt und Wilna für Polen beschlagnahmte. Seit damals verstand Irmin etwas von der Annehmlichkeit heißen Tees im Sommer und noch mehr von der Geistesart der östlichen Judenheit – und folglich also auch der Juden, die nach Palästina drängten, um es aufzubauen. Und dadurch unterschied er sich von fast allen seinen Kollegen in der englischen Verwaltung, in den Konsulaten und bei den paar Kompanien Gendarmerie, mit denen die Mandatarmacht das Land am Suez-Kanal hielt. Sie waren ein besonderer Schlag Menschen, diese russischen oder polnischen Juden, eine schwierige Sippschaft für Westeuropäer und gar für Briten, und wer sie begriff, besaß eine Vorhand im Spiel der Kräfte hier im Lande.
Als der Tee kam, kam auch Iwanow, der Tscherkesse, ein Mann mit grauem Spitzbart und lachenden Augen, hell im lederbraunen Gesicht. Irmin stellte ihm Zigaretten hin und die Zuckerdose, aus der er sich reichlich versah. Dann schlürfte er wie ein echter Russe, rauchte und betrachtete prüfend das Gesicht seines Herrn, mit dem er seit vier Jahren arbeitete. Er entstammte einer jener kaukasischen Familien, die von den Sultanen in ganzen Dörfern an den Grenzdistrikten des einstigen türkischen Reichs angesiedelt worden waren, treu, verlässlich und trotz gleichen Glaubens ohne Hinneigung zu den Einheimischen, die sie nicht ganz für voll nahmen.
Iwanow hatte für seinen Chef eine unangenehme Nachricht im Köcher. Nun fand er ihn in seinem »europäischen« Zustand, also ohne Schwungkraft und den Gleichmut des Herzens, den sich Männer im Orient schnell angewöhnen müssen, wenn sie nicht in die Flucht geschlagen und wieder übers Meer zurückgejagt werden wollen. Sollte er seine Mitteilung auf morgen verschieben? Vorläufig sprach er über den abnehmenden Wasserstand der Zisternen. Ferner vermochte man in der östlichen Altstadt heute wieder einmal kaum zu atmen, der Müllverbrennungsanstalt wegen, die Oberst P. W. Bathy seinerzeit im Kidrontal hatte anlegen lassen. Iwanow wusste, wie sehr diese, auf militärische Weise ohne Kenntnis der Voraussetzungen und der Folgen an den Stadtrand hingepflanzte Gestankfabrik seinen Effendi zum Lachen und zum Widerspruch reizte, weil sie, gleich einem Sinnbild unverständiger Zivilisierung, bei dem häufigen Ostwind aufdringlichen Anlass zu bösartigen Witzen bot.
Aber Irmin winkte leicht ab, seine Hand hing dabei zwischen seinen Knien. Das zog heute nicht. »Irgendetwas hast du doch herausbekommen, Iwanow«, gähnte er, »gib es von dir, und dann lass mich schlafen.«
Iwanow berichtete. Ein unerhört dreister Fall von Straßenraub machte seit einigen Tagen der Polizei und der Regierung zu schaffen. Nicht, dass Irmin sich etwa tugendhaft entrüstet hätte oder das Land dadurch besonders unsicher schien: dieselben bedauernswerten Kämpfer um ihr tägliches Brot, die es in den Großstädten des Westens mit Schneideapparaten und Sauerstoffgebläsen an fremden Geldschränken verdienten, waren in Palästina auf die Landstraßen angewiesen, und zwar in jahrhundertealter Tradition. Unglücklicherweise aber hatte es diesmal eine Karawane von dreizehn Autos mit Vergnügungsreisenden ausschließlich englischer Herkunft erwischt. An einer gutgewählten Stelle jener wundervollen Fahrstraße zwischen Jerusalem und dem Toten Meer, die in einer knappen Stunde ein Gefälle von zwölfhundert Metern hinabsteigt, waren die Wagen durch ein gespanntes Drahtseil und eine Anzahl weiß vermummter Herren mit Revolvern und Gewehren aufgehalten worden, die ohne jede Gewalttat und unter höflichsten Worten die Insassen dieser dreizehn Wagen – »wie konnten sie auch mit dreizehn Wagen losfahren, nicht wahr, Effendi?« – vollständig ausraubten. Es mussten Beduinen von einem recht armen Stamm gewesen sein, denn sie nahmen nicht nur Schmuck, Geld und Stiefel mit, sondern auch Taschenmesser, Feuerzeuge, selbst Streichholzschachteln – kurz, alles, was ein zeitgenössisches Lebewesen verwenden konnte, und verschwanden dann in der Dunkelheit, wie es hieß, nach Transjordanien. Dieses Land jenseits des Jordans, unter einem eigenen Fürsten, gab der Sache einen politischen Anstrich und erschwerte die Untersuchung aufs Äußerste. Ein Beamter der Politischen Abteilung hatte den Emir Abdallah bereits aufgesucht und bei ihm jede beliebige Zusicherung erlangt, außer der Überzeugung, die Räuber wirklich zu finden. Iwanow aber und sein Herr gingen einer anderen Version nach, die sich in den Bazaren herumsprach, und nach der die Ausführenden zwar Beduinen von jenseits des Jordans, die Veranstalter und Hauptnutznießer aber Einwohner Jerusalems waren, Unternehmer sozusagen. Als solche nannte man einen Kanadier, einen Griechen und einen Juden; es kam jetzt darauf an, irgendeinen Hinweis zu erwischen, ein Beutestück, das feilgeboten wurde, oder den Hauch eines Geredes darüber. Iwanow hatte sich in griechischen, arabischen und jüdischen Gegenden der Altstadt ausgiebig zu schaffen gemacht, indem er nach einem Taschendieb fahndete, welcher im Gedränge an der Klagemauer der Juden einem schwedischen Herrn den Kreditbrief gestohlen haben sollte, und er erzählte angeregt von all den kleinen Hinweisen auf missliebige Bekannte und Verwandte der jüngeren Generation, die man ihm zugeflüstert. Ja, Strolche, Taugenichtse, junge Geldverdiener ohne Arbeit gab es genug in Jerusalem. Die fleißigen Fellachen der Umgegend wussten ein Lied davon zu singen, wenn sie ihr Gemüse in die Stadt brachten, ihre Hämmel, die Webereien ihrer Frauen.
Irmin hörte zerstreut zu; er hatte sich von diesem Fall eine bestimmte Meinung gebildet, im Übrigen ließ er ihn ziemlich kalt. Die wohlhabenden Touristen hatten zum Aufbau des Landes unfreiwillig beigetragen und der Armut der Beduinen eine große Spende dargebracht. Selbstverständlich musste man die Täter einsperren, es würde sich schon ergeben.
Jetzt fand sich Iwanow im Schuss – derart, dass er seine Bedenken von vorhin einfach vergaß. »Ja, da schnappte ich gestern noch eine Kleinigkeit auf – wie, ist fast unanständig zu berichten. Sie betrifft deinen holländischen Freund, Effendi, den Doktor de Vriendt; es könnte unangenehm werden. Ich kam aus einem Café im Shouk, nahe der Churwah-Synagoge; ich wollte durchs Zionstor die Altstadt verlassen, ein bisschen frische Luft holen und mit einem Auto nach Hause fahren. Selbst meine Füße vertragen nicht mehr einen ganzen Tag auf Jerusalems Pflaster. In der Nähe des Tores überkam mich ein Bedürfnis; na, da muss man sich eben hinhocken. Die Gegend ist abgelegen, dunkel, nicht sehr begangen; was hinderte mich also, in einer Mauerecke zu verschwinden? Und während ich mich nun ganz still verhielt, hörte ich zwei Männer vorübergehen und erhorchte, was sie sprachen. Der eine nannte fragend den Namen deines Freundes, der andere sagte: »Derselbe. Das Blut dieses Hundes muss sehr bald vergossen werden.«
L. B. Irmin blickte auf. Plötzlich hingen weder seine Hände mehr noch seine Lider. »In welcher Sprache?«, fragte er, »hebräisch?«
»Arabisch«, entgegnete sein Agent.
In Jerusalem regieren drei Sprachen: das Englisch, von Touristen, Beamten und jenen Einheimischen gesprochen, die schnell eine richtige Auskunft von ihnen wünschen; das Hebräisch, im Verkehr der Juden untereinander, besonders der jüngeren, auf der Straße, überall im öffentlichen Leben; unter den Nichtjuden aber ganz allgemein das Arabisch.
Iwanow wunderte sich leicht darüber, dass Mr. Irmin zuerst nach dem Hebräischen gefragt hatte. »Nein, Effendi«, bekräftigte er schnell, »diese beiden Männer sprachen Arabisch, und der eine ein sehr gutes. Ich darf dich darauf aufmerksam machen, dass dein Freund Unvorsichtigkeiten begeht. Wir sind nicht in Ägypten, Herr, die Freundschaft eines erwachsenen Mannes mit einem arabischen Knaben ist nicht alltäglich hier, und manche Familien sehen ungern, was ihre Sprösslinge treiben.«
Irmin nickte. Das war es also. Eigentlich wunderte er sich, dass es so spät kam. Es blieb ziemlich gleichgültig, welcher Art die Freundschaft war, die den Dr. de Vriendt mit dem Knaben Saûd verband. Auch hätten andere als Mitglieder der Geheimpolizei diesen Knaben kaum zu Gesicht bekommen; denn Jerusalem ist eine Stadt der Städte, ineinandergeschachtelt wie ein Geduldspiel, nirgendwo anders kann man so leicht nach vier Jahren Dienstes noch immer neue und unbekannte Winkel, Eingänge zu großen Häusern, kleine Treppen finden, die in bislang übersehene Höfe führen. Wie in den großen Städten des Westens heranwachsende Kinder sich auf ihr Fahrrad schwingen und fünf Minuten später in Gegenden und Lebensformen auftauchen, von denen ihre Eltern nie etwas erfahren, vermochte in Jerusalem ein eilig durchtrabter Weg von fünf Minuten einen Menschen wie wegzuzaubern, und besonders einen Jungen. Gute Familien empören sich dann und wann, wenn etwas über dieses verborgene Leben ihrer Söhne oder Töchter an den Tag kommt. »Du weißt also nicht, wer gesprochen hat, Iwanow?« Irmin stand auf und ließ sich sogar zu Schritten hinreißen, mittelgroßen Schritten eines mittelgroßen Mannes mit schlanken Hüften und den Schultern eines Sportlers.
»Sie verschwanden, ehe ich imstande war, ihnen nachzuspüren«, sagte Iwanow beschämt. »Aber ich will meinen Dolch zu Mittag essen, wenn der eine nicht den gebildeteren Kreisen seines Volkes angehörte.«
»Man wird feststellen müssen, wer dieser Knabe Saûd eigentlich ist, und wie seine Verwandtschaft aussieht«, sagte Irmin stehenbleibend, »diese Worte könnten Folgen haben.« »Üble Folgen«, unterstrich Iwanow ernst, »sie klangen nicht obenhin. Nun ist ein erbittertes Wort nachts an der Mauer des Zionstores noch kein Schwur …«
Irmin nickte. Aufwallungen hielten nicht lange hierzulande; sie lösten entweder Taten aus oder verdunsteten ohne Rückstand.
»Dennoch, Effendi, wird man deinen Freund bewachen müssen wie die Schöne eines Harems, und wenn er Warnungen Gehör gibt, wird er weise sein.«
Wohin hatte sich der europäische Zustand Mr. Irmins verflüchtigt? Hier stand ein Mann vom Stuhle auf, der am Horizont eine Gefahr heraufdämmern sah, völlig bereit, ihr zu begegnen. Die Sonne stand im Zenit, es war um keinen Deut kühler in dieser gewölbten Eingangshalle, die Last des Sommers drückte unverändert – nur nicht auf ihn. Er sah über den sitzenden Iwanow weg durch die Mauern hinüber nach der Prophetenstraße, wo in einem hohen Haus der Doktor de Vriendt wohnte, mit dem er zu streiten liebte, zu sprechen, Schach zu spielen. Dieser holländische Israelit war beinahe ein verfemter Mann, ungeschickt in vielem, ein verbissener Widersacher allgemeiner Stimmungen und Überzeugungen: nämlich der zionistischen, die das Judentum politisch auffassten und gestalten wollten, das religiöse Leben der privaten Sphäre überlassend. Er aber, de Vriendt, gehörte zu den Führern derjenigen Juden, die vor allem Frömmigkeit ins Heilige Land geführt hatte, und zwar zu ihrem orthodoxesten Flügel. Der Hass seiner Hörer, junger Studenten, hatte ihn und seine Vorgesetzten gezwungen, die Vorlesungen einzustellen, die er, glänzender Jurist, über schwierige Probleme des türkischen (geltenden) Rechts hielt; seit gewissen Unterredungen mit König Hussein von Hedschas, König Fessal vom Irak und dem Emir Abdallah von Transjordanien, über die er selbst in zwei fremden Zeitungen berichtete, hatte er die Achtung durch die führenden Kreise der zionistischen Judenheit auf sich nehmen müssen, die ihn als Schädling im politischen Aufbau des jüdischen Heims brandmarkten; seine Eingaben und sein Benehmen anlässlich des Besuches, den der nicht sehr judenfreundliche Lord Northcliffe, Zeitungskönig der englischen Rechten, dem biblischen Lande abstattete, brachten ihm den Hass der Arbeiterschaft ein. Aber dieser Starrkopf, J. J. de Vriendt, ließ nicht ab. Zwei Aufsätze im Amsterdamer Telegraaf, voll kühler Darlegung des arabischen Rechtsstandpunktes im Klagemauerstreit, waren ihm nicht verziehen worden, auch als sich herausstellte, dass die Londoner Kronjuristen Satz für Satz bestätigten, was er vorgezeichnet. Und jetzt sollten ihm Araber auf den Hals kommen, gleichsam um das Rudel vollzumachen?
Iwanow schmunzelte vor sich hin. Er liebte diesen Ausdruck im Gesicht seines Chefs, wenn seine leicht gebogene Nase plötzlich vom kühnen Blick eines Falken verdeutlicht wurde. Den hatte er nicht schlecht unter Dampf gesetzt. Und er, Idiot, hatte ihm die Bedrohung des Doktor de Vriendt verschweigen wollen.
Irmin sagte nachdenklich: »Mach doch für mich ein Telefongespräch, Iwanow; der Apparat steht noch neben dem Bett. Frag mal den Doktor Gluskinos in seinem Spital in der Jaffastraße, wann er heute für mich zu sprechen ist. Bester Freund de Vriendts«, fügte er erläuternd hinzu.
Der Tscherkesse nickte und ging hinaus.
Irmin stand mit gerunzelter Stirn vor dem fadendünnen Springbrunnen, die Hände auf dem Rücken. Er gab sich Rechenschaft über zwei Punkte seines inneren Ablaufs: erstens, warum er grade zu Gluskinos ging, und zweitens, warum er zunächst gemeint hatte, die Mordworte seien in hebräischer Sprache gefallen. Zu Gluskinos ging er, weil es einem Gentleman nicht angenehm war, mit einem anderen über dessen delikateste Lebensbeziehungen zu reden; dafür hatte Gott Geistliche, Ärzte und möglicherweise auch Schriftsteller erfunden, nicht Polizisten und ehemalige Soldaten, denen dergleichen Einmischung zuwiderer war als Pferdestehlen. »Hebräisch?«, aber hatte er unwillkürlich gefragt, weil sich de Vriendt nicht entschließen konnte, auf die Gefühle seiner Volksgenossen Rücksicht zu nehmen. Die Lage der Juden in Palästina, besonders der Zionisten, war politisch bedrängt vom Widerstand der Araber, von der Lauheit der Verwaltung, von der Gleichgültigkeit, ja Angst breiter Judenmassen auf der Erde vor der zionistischen Idee, die ihnen ihre heimische Staatsbürgerschaft zu gefährden schien; wenig Geldmittel also, viel zu langsame Entwicklung, von der Regierung gedrosselte Einwanderung und dabei grenzenloser Opfermut der hitzköpfigen jungen Burschen, die ins Land strebten, um unter unsäglichen Schwierigkeiten aus Malariasümpfen Getreidefelder zu schaffen, aus Sandböden Orangengärten, aus kahlen Hängen Weinberge, aus stockerigen Feldwegen moderne Asphaltstraßen, bei glühender Sonne und frostigen Nächten, im Zelt jahrelang, unter den strömenden Regen des Winters und der dörrenden Sommerglut. Sie durften den schon hassen, der zu all diesen Schwierigkeiten in gespanntesten Zeitläuften nun noch den Feind in ihrer eigenen Mitte spielte und in jeder seiner Äußerungen genau das Gegenteil von dem aussprach, was sie selber dachten, wünschten, glühend für richtig hielten. Nun waren es also nicht diese, die ihn bedrohten, sondern die arabische Verwandtschaft eines kleinen Buben. Kurios liefen die Bahnen dieses Daseins.
»Es passt dem Doktor um vier Uhr pünktlich, vor Beginn der allgemeinen Sprechstunde«, meldete Iwanow, zurückkehrend. »Wird es dir nicht zu heiß sein, Effendi?«
Irmin lachte: »Es wird höllisch heiß sein, und du wirst meinen Wagen mit frischem Kühlerwasser versehen und dafür sorgen, dass er die ganze Zeit im Schatten steht.«
»Einverstanden«, salutierte Iwanow militärisch, die Hand an der Lammfellmütze. Selten noch war ein »europäischer Zustand« seines Chefs so glimpflich und so schnell verflogen.
2. Kapitel
Ein Fehlschlag
Das Wartezimmer schien leer – dämmerig-dunkel, geweißte Wände trugen eine gotische Gewölbedecke aus dem vierzehnten Jahrhundert, schönes Netzwerk dort, wo die Bogen einander schnitten. Eine tiefbraun gebeizte Bank um alle vier Wände unterhalb der schmalen Fensterscharten vervollständigte den Eindruck einer kleinen klösterlichen Sakristei oder des Sprechzimmers eines Abtes aus den Tagen König Balduins.
In einer Ecke lehnte etwas Dunkles, gleich einem Kleiderbündel, das ein früherer Wartender vergessen hatte.
»Guten Tag«, grüßte Irmin, »falls da jemand ist.«
Das Kleiderbündel antwortete mit einem kleinen Gelächter, dem fröhlichen Gekicher eines belustigten alten Mannes, dem ein kurzer, tiefer Husten folgte.
Dann sah Irmin das Kleiderbündel ein Taschentuch an den Mund führen, betrachten und wortlos wieder wegstecken. Das grüne Licht der Butzenscheiben enthüllte einen Greis mit kaffeefarbenem Schädel, weißem Bart bis über den Hals und heiteren Augen – einen Arbeiter in Leinenhosen und halbhohen Stiefeln. Irgendwoher kannte Irmin dieses reizvolle Profil, den frauenhaft feinen Mund unter der groben Nase, und er erinnerte sich: dieses Profil zierte seit Monaten den Schaukasten einer jungen österreichischen Photographin in der Jaffastraße, die gute Bilder machte und sich sehr durchzusetzen begann. Dieses Kleiderbündel war N. A. Nachman, das geistige Haupt der sozialistischen Arbeiterschaft, auf den zwanzig- bis dreißigtausend jüdische Arbeiter hörten und ein Teil der besten jüdischen Jugend in der ganzen Welt. Vornübergebeugt saß er da, ganz ausruhend, und musterte Irmin mit dem langen Blick des Menschen, der mit den beständigen Dingen der Natur Umgang hat – des Seemanns oder Bauern. Und da wusste Irmin mit einem Male, warum der Greis hier saß, und dass er, Irmin, gut daran tat, seine Pfeife wieder in die Tasche zu stecken. Der Arbeiter Nachman litt an der Schwindsucht; schwindsüchtig schon war er vor vierzig Jahren aus Ost-Galizien eingewandert. Nach den Berechnungen der Ärzte war er längst verstorben. Irmin ging freimütig auf ihn zu, nannte seinen Namen und freute sich der Gelegenheit. Er hoffe, Dr. Gluskinos tue sein Bestes, eine Gesundheit zu bewahren, die dem Lande so unschätzbare Dienste leiste.
Der alte Jude kicherte: nicht er leiste dem Lande Dienste, sondern das Land ihm; er sei nur hier, weil seine Genossen ihn aus der Ebene Jesreel (dem Emek) weghaben wollten, damit er sich schone. »Sie wollen die Ernte ohne mich einbringen, verstehen Sie? Als ob an mir noch etwas zu schonen wäre. Gluskinos soll es mir bestätigen.« Und ernster werdend: »Vorzeitig in die Grube fahren will ich nicht. Jeder Mensch mit ruhigem Herzen ist dem Lande heute so wichtig wie Wasser.«
Leider redeten die arabischen Zeitungen nicht so, meinte Irmin, während er seine Finger betrachtete, die so gern in die Tasche gefahren wären, um eine Pfeife zu stopfen. Die Furcht vor der stillen Angriffskraft der Zionisten stand deutlich überall zu lesen; und der Streit um die Klagemauer, die Besorgnis um den Tempelplatz ließ die Öffentlichkeit nicht zur Ruhe kommen und riss selbst so ausgezeichnete Köpfe wie den Dr. de Vriendt zu Unbesonnenheiten hin. Es war sehr nötig, da Klarheit zu schaffen, sehr nötig und sehr schwer.
N. A. Nachman runzelte die Brauen, zu Boden blickend, schwarzweiße Fliesen, die an ein Schachbrett erinnerten. Über den Herrn Dr. de Vriendt wollte er lieber schweigen; krankhafte Außenseiter verwirrten nur, was sie anrührten. Die Furcht der Araber vor den Juden aber war ein Problem. Sie war eine Wirklichkeit, diese Furcht, und deshalb ein schweres Kapitel. »Nicht, dass sie Grund hätten, uns zu fürchten, verstehen Sie. Aber wenn Leute voreinander Furcht haben, so ist das ein Faktum, nicht wahr? Angst, die jemand hat, ist ein höchst reales Ding, und ein scheuendes Pferd wirft Menschen über den Haufen, ganz gleich, ob es vor einer wirklichen Gefahr oder einem Schatten erschrickt. Die Araber fürchten die Juden und die Juden die Araber, und keiner von beiden fürchtet die Engländer.«
Irmin horchte auf. Nicht umsonst sprach er hier mit einem Mann, der denken gelernt hatte, noch bevor er Roggen von Weizen unterscheiden konnte. »Ist das so?«, fragte er.
»So ist es«, antwortete Nachman, »leider. Die Fellachen und Beduinen, wenn sie von unseren Landkäufen hören, fühlen einen Riemen um ihre Rippen geschnürt, der ihnen und ihren Kindern das Atmen kurz macht; sehen die Juden auf die Überzahl – die vierfache Überzahl – der Araber und die Gewehre der Beduinen und ihre Messer, so finden sie sich unbeschützt und fürchten, in diesem Lande niemals eine Masse zu werden, eine Mehrheit, die sich selber schützen kann. Und von Ihren Leuten, Mr. Irmin, fühlen wir uns nicht verteidigt. In der Gendarmerie dienen zu viele Araber und zu wenig Juden. Und wie viel britische Soldaten hält England hier im Lande? Sind es dreihundert Mann gegen sechshunderttausend Araber?«
Irmin errötete. Er wagte nicht, die wahre Ziffer zu nennen. Die weiße Garnison Palästinas bestand aus sechs Offizieren und neunundsiebzig Tommies – einer Wachkompanie für den High Commissioner. »England vertraut der Einsicht von beiden, Juden und Arabern.«
»Vertraut es der anderen Seite nicht zu sehr? Wir, die wir lange im Lande sind, haben viel erlebt. Und doch bauen wir nur mit unseren Händen und unseren Leben dieses Land auf, für uns und für sie. So ist es«, bekräftigte er.
Und Irmin wusste: so war es, soweit die Arbeiterschaft des Landes zu sprechen hatte. »Und die Klagemauergeschichte?«, fragte er. »Dieser Streit mit seinem Hin und Her, mit Religion und Jurisprudenz – was halten Sie davon?«
Der kleine gebeugte Mann richtete sich auf. Jetzt war alles an ihm hell, führerhaft, ohne Rücksicht: »Damit haben wir nichts zu schaffen, Mr. Irmin. Wir begreifen nicht, dass dies nun schon so lange dauern kann. Wir werden bald irgendwelche mächtigen Interessen an Unfrieden und Aufregung hinter dieser Sache argwöhnen. Religiöse Wildheit treibt dem friedlichsten Fellachen das Blut in die Augen. Sie verstehen? Dann bekommt seine Furcht einen Gegenstand, und sein Messer fährt von selbst aus der Scheide. Es ist gewiss unerträglich für unsere Frommen, beim Gottesdienst an dieser heiligen Stelle Jerusalems belästigt zu werden. Eine politische Hauptfrage aber ist das nur für aufgeregte Bürger und Studenten und die Jungen in den Jugendbünden. Prestigepolitik wissen Sie, und wir wollen damit nichts zu schaffen haben.«
Geräuschlos öffnete sich die Tür zum Sprechzimmer; im weißen Kittel und weißer Kappe stand die dickliche Gestalt des Dr. Gluskinos in ihrem Rahmen. »Sie müssen noch etwas warten, Mr. Irmin«, sagte er, »Herr Nachman war früher da.«
Aber N. A. Nachman erklärte, Irmin solle nur ja vor ihm dort hineingehen. Hier sitze es sich kühl und still, gut für Gedanken und Folgerungen. Und wenn er ein Blatt Papier und einen Bleistift haben könnte, wäre es möglich, sogar einen kleinen Aufsatz zu entwerfen, zu dem ihn das Gespräch mit Mr. Irmin angeregt.
Dr. Gluskinos, die Augen von Brillengläsern vergrößert, fragte Irmin, was ihm fehle. Irmin antwortete mit einem Lächeln und dem Einbeugen seines kräftigen Boxerarms. Er kam gar nicht als Patient. Er kam zu dem Freund des Dr. de Vriendt, der als Arzt das Recht hatte, dessen intimere Angelegenheiten zu berühren. Und er stellte ihm in vorsichtigen Worten den Sachverhalt dar, wie er sich aus Iwanows und seiner Kenntnis aufbaute.
Dr. Gluskinos erblasste, wie Irmin es schon lange nicht mehr gesehen. Er streckte abwehrend beide Hände aus: »Schweigen Sie! Was reden Sie da! Dr. de Vriendt ist ein strenggläubiger Mann!«
»Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe, Doktor«, antwortete Irmin. »Sie meinen, das gehe nicht zusammen? Ich versichere Ihnen das Gegenteil. Die Natur der Menschen gehorcht anderen Gesetzen als ihr Geist.«
Gluskinos wischte sich die Stirn, wich langsam von seinem Schreibtisch bis an die Wand zurück: »Ich kann es nicht glauben«, stöhnte er, »ich glaube es Ihnen einfach nicht.«
Irmin zuckte die Achseln. Er betrachtete den Arzt, in dem offenbar der bürgerliche Mensch für kurze Zeit den Sieg über den Beruf davongetragen hatte. »Bitte beurteilen Sie es medizinisch«, beharrte er. »Wäre dies eine Krankheit, an der Dr. de Vriendt leidet, so kann seine Religiosität nichts daran ändern. Und es ist eine Krankheit, mit tödlichem Ausgang, wenn wir nichts dagegen tun. Ich rufe Sie, weil er von Ihnen wahrscheinlich Ratschläge leichter annehmen wird – in solch einer Sache.«
Dr. Gluskinos, selbst ein sehr frommer Mann, stand wie abwesend immer noch an der Wand. »Wie er leiden muss«, flüsterte er, »was ihn der Kampf dagegen kosten mag! Deshalb ist sein Herz so schlecht«, sagte er lauter. Dann wanderte er, tief in Gedanken, zu seinem Waschtisch und begann, sich die Hände zu seifen, als habe er etwas Unreines angefasst. Den Kopf zu Irmin wendend, so dass sein dickes rundes Gesicht mit den kugeligen Augen und der krummen Nase beinahe beängstigend über der massigen Schulter schwebte: »Sie haben recht, Mr. Irmin, ich bin nicht angestellt, ihn zu richten. Aber einmischen kann ich mich noch weniger.«
»Doktor«, sagte Irmin gelassen, »würdigen Sie den Fall, wie er ist. Zwei Araber, die keiner von uns kennt – noch nicht wenigstens, aber von dem einen hoffe ich bald Witterung zu nehmen – verabreden Mord an einem Juden. Glauben Sie, dass sie sich lange bedenken werden? Diese Leute sind große Kinder, wilde Buben ohne Hemmungen, rasch mit dem Messer in eines Mannes Rücken. Nachher können sie schrankenlos bereuen, sich in die Tat nicht mehr hineinfinden, wunderbar großherzig um Vergebung bitten und sich hängen lassen. In ruhigen Zeiten ist das ein privater Mord, nichts anderes. Heute kann es zum Zündfunken werden und Araber und Juden auffliegen lassen wie eine Mine. Wir werden alles tun, die arabische Seite zu überwachen; Sie, als Freund und Arzt, müssen Dr. de Vriendt davon unterrichten, dass er in den nächsten Tagen sehr vorsichtig leben und keine arabische Maus in seine Wohnung lassen darf, am besten aber sofort verreist. Ist das zu viel verlangt? Können Sie ihn nicht gleich auf vierzehn Tage in die Berge schicken?«
Dr. Gluskinos näherte sich mit müden Schritten seinem Schreibtisch wieder, stand neben Irmins Stuhl; der kleine dicke Mann, nicht viel größer als der sitzende Irmin. »Sie missverstehen mich, Mr. Irmin. Nicht um meinetwillen weigere ich mich. Ich kann es de Vriendt nicht antun, davon zu wissen. Es würde ihn so beschämen, so tief treffen – wir müssen einen anderen Ausweg finden. Männer, die zusammen mehrmals in der Woche beten, können voneinander solche Kenntnis nicht vertragen; sehen Sie das ein? Sie müssen selbst zu ihm gehen, ihm den ersten Stoß versetzen. Sie sind Polizist, sie haben die Pflicht, geheime Dinge zu erfahren und zu verschweigen. Ich unterstütze Sie selbstverständlich – keine Frage! Sobald ich ihn sehe, morgen bei Tisch. Er soll in die Berge – alles, was ich vermag – selbstverständlich.« Er stammelte beinahe. »Fahren Sie gleich zu ihm, geben Sie es ihm dringlich. Er ist ein Hartschädel, ein träger Bursche, er wird sich keine Unbequemlichkeit machen wollen. Morddrohung, in diesen Wochen! Er wird auf Sie hören und von mir den Vorwand bekommen. Denn nach außen, um Himmelswillen, darf von alldem nichts dringen. Er richtet uns alle zugrunde, dieser unselige Mensch!«
Irmin stand langsam auf, streckte seine Knie, seine Schultern. Uns alle – darunter verstand Dr. Gluskinos im Besonderen die kleine Gemeinde des Rabbi Zadok Seligmann, den strengsten Flügel des thoratreuen Judentums, den de Vriendt politisch vertrat. Aber Irmin sah: die Sache fiel auf ihn zurück. Scheußlicher Beruf manchmal, Polizist zu sein, dachte er. »Schön oder nicht schön, Doktor, Sie haben recht. Man überlegt immer um eine Elle zu kurz; aber auf jeden Fall: wir sind Bundesgenossen.«