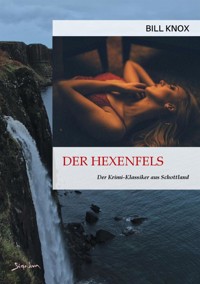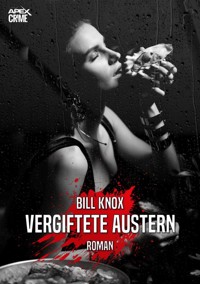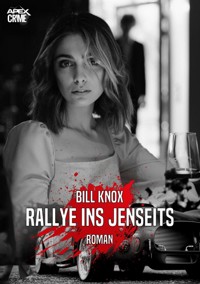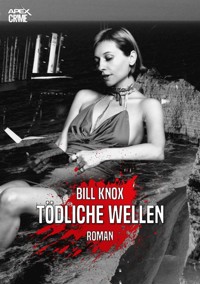5,99 €
Mehr erfahren.
Die Schlagzeile: Raubmord in Glasgow. Lohngelder in Höhe von 7.000 Pfund erbeutet. Junger Polizeibeamter erschossen.
Der Polizeireporter David Renfield nutzt seine Chance. Er hofft auf ein paar gute Tipps für seine Reportage, als er Inspektor Thane einen wichtigen Zeugen nennen kann.
Aber dieser Zeuge wird für David Renfield selbst zum Verhängnis...
Der Roman Deadline für einen Traum von Bill Knox (* 1928 in Glasgow; † März 1979) erschien erstmals im Jahr 1957; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962 (unter dem Titel Aus sicherer Quelle).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BILL KNOX
Deadline für einen Traum
Roman
Apex Crime, Band 257
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DEADLINE FÜR EINEN TRAUM
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Das Buch
Die Schlagzeile: Raubmord in Glasgow. Lohngelder in Höhe von 7.000 Pfund erbeutet. Junger Polizeibeamter erschossen.
Der Polizeireporter David Renfield nutzt seine Chance. Er hofft auf ein paar gute Tipps für seine Reportage, als er Inspektor Thane einen wichtigen Zeugen nennen kann.
Aber dieser Zeuge wird für David Renfield selbst zum Verhängnis...
Der Roman Deadline für einen Traum von Bill Knox (* 1928 in Glasgow; † März 1979) erschien erstmals im Jahr 1957; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962 (unter dem Titel Aus sicherer Quelle).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DEADLINE FÜR EINEN TRAUM
Erstes Kapitel
Der junge Polizeibeamte griff hastig nach seinem Schlagstock und öffnete die Wagentür. Im selben Moment schoss der Fremde.
Der scharfe, harte Knall zerriss den Ruf des Beamten. Der Mann brachte nur noch ein schmerzvolles Stöhnen hervor.
Während der Schuss noch in den Ohren der beiden anderen Männer nachhallte, sachte der Constable zusammen und fiel seltsam steif aus der offenen Tür des Rolls Royce. Die blaue Uniformmütze mit dem breiten blau-weiß karierten Band rollte in einem weiten Bogen über die Straße. Der hölzerne Schlagstock polierte gegen das Trittbrett.
Der Constable war dreiundzwanzig Jahre alt; er hatte ein frisches, intelligentes Gesicht. Jetzt war er tot.
Steifbeinig, wie benommen, kam der Fremde näher. Sein Gesicht hinter der Maske war schweißgebadet und zuckte nervös? Mit drei Schritten stand er neben dem Wagen und winkte mit der Pistole.
»Die Tür auf, aber schnell!«, befahl er dem Kassierer, der im Fond saß. »Der da war ein Narr.« Er machte mit dem Kopf eine Bewegung zu dem Toten hin. »Also los, sonst knallt’s nochmal!«
Der Kassierer hatte im Krieg dem Tod schon öfter in die Augen gesehen. Er war sich sofort darüber klar, dass auch jetzt der Tod neben ihm stand.
Er riss sich aus seiner Erstarrung und öffnete die Tür. Dann wich er unwillkürlich zurück.
Der Unbekannte, ein schlanker, mittelgroßer Mann in einem schmutzigen Regenmantel und mit Wollhandschuhen, trug vor dem Gesicht eine groteske Maske. Er griff mit der Linken in den Wagen, während er mit der Pistole in seiner Rechten den Kassierer und den uniformierten Chauffeur in Schach hielt.
Die beiden prallen Säckchen beachtete er nicht. Er langte nach der schwarzen Ledertasche, die neben den Füßen des Kassierers stand.
Noch einmal hob er drohend die Pistole. Hinter der Maske drang seine dumpfe Stimme hervor.
»Ich möchte nicht noch einmal schießen. Rührt euch nicht von der Stelle!«
Er rannte zu seinem Motorrad, das einige Meter entfernt auf der Straße lag, und schob die Pistole in die Manteltasche. Er hängte sich die Tasche an den linken Arm, hob das Motorrad auf und trat den Kickstarter durch. Beim dritten Mal, sprang der Motor an. Er schwang. sich auf den Sitz, gab Gas, und die Maschine schoss mit lautem Geknatter in das schmale Gässchen hinein, aus dem sie vor wenigen Minuten herausgekommen war.
Stöhnend schob sich der Kassierer durch die offene Wagentür. Der Fahrer stieg ebenfalls aus. Die beiden Männer beugten sich über die gekrümmte Gestalt neben dem Wagen. Vorsichtig drehten sie den jungen Constable um – und blickten sich entsetzt an.
»Er ist...« Dem Kassierer versagte die Stimme, und er starrte ungläubig auf seine blutverschmierten Hände.
Zwei Reifen des Rolls Royce waren platt, von Kugeln durchlöchert. Die Gasse war auch viel zu schmal, als dass man mit diesem Auto die Verfolgung des Motorrades hätte aufnehmen können.
Mit einem erbitterten Fluch rannte der Chauffeur in die Richtung, die der Räuber genommen hatte. Der Kassierer folgte ihm. Als sie den Eingang der Gasse erreichten, wussten sie, dass an eine Verfolgung nicht zu denken war.
Knatternd bog das Motorrad am Ausgang der Gasse in die Hauptstraße ein und schoss davon.
Jetzt ergriff der Chauffeur die Initiative. Achselzuckend wandte er sich an den Kassierer.
»Wir können jetzt nichts weiter tun, als die Polizei zu verständigen und nach einem Sanitätswagen zu telefonieren. Helfen kann man dem armen Keri allerdings nicht mehr. Aber ich habe mir die Nummer des Motorrades gemerkt, das wird uns nützen.« Plötzlich schien ihm ein neuer Gedanke zu kommen. »Wieviel hat der Lump eigentlich erwischt, Sir?«
»Siebentausend Pfund«, sagte der Kassierer leise mit leichenblassem Gesicht. Automatisch holte er ein Zigarettenpäckchen hervor. »Dieser Kerl mit seiner Clownsmaske! Das Geld ist zu verschmerzen, aber der junge Mann ist tot. Mein Gott, wie furchtbar!«
Sekundenlang starrten sie sich ratlos an, dann gingen sie zum Auto zurück.
In diesem Augenblick näherte sich aus der entgegengesetzten Richtung ein Lastwagen. Der Fahrer sah den Rolls Royce und die leblose Gestalt daneben. Er bremste scharf, sprang auf die Straße und kam eilig näher. Als er sich über den toten Polizeibeamten beugte, bekreuzigte er sich.
Zwei Minuten waren inzwischen verstrichen. Außer dem Lastwagen hatte kein Fahrzeug die Straße passiert.
Zweites Kapitel
Fast im gleichen Moment, als der Lastwagenfahrer in einem kleinen Milchladen die Telefonnummer 999 wählte, lenkte David Renfield anderthalb Kilometer entfernt das Motorrad auf ein unbebautes Grundstück.
Am Horizont, leicht verhüllt von Dunst und Rauch, konnte er die Kräne und Schornsteine der Schiffswerften sehen. Auf dem nahe gelegenen Bahndamm fuhr ratternd ein Güterzug vorüber. An der einen Seite wurde das Grundstück von der fensterlosen Giebelwand eines Wohnhauses begrenzt, an der anderen von einer Kirche mit hohem Turm.
Von der Straße aus war dieser Platz wegen einer Wand aus Reklametafeln nicht einzusehen. Ein Hund von unbestimmbarer Rasse, der an einem alten Karton herumschnüffelte, war das einzige Lebewesen weit und breit.
Als das Motorrad neben dem silbergrauen Ford-Kombiwagen zum Stehen kam, den Renfield dort geparkt hatte, schaltete er den Motor ab. Er stellte die Maschine zur Seite und legte die Ledertasche auf den Boden.
Dann schloss er die hintere Tür des Ford auf und öffnete sie weit. Er packte das Motorrad an der Lenkstange und hob mit einem gewaltigen Ruck das Vorderrad in den Wagen. Dann fasste er am Gepäckträger an und wuchtete die Maschine Unter Ächzen und Stöhnen nun vollends ins Auto.
Nachdem er eine Plane darüber gebreitet hatte, schloss er sorgfältig die Tür ab. Er nahm die Geldtasche, setzte sich ans Steuer und drückte auf den Anlasser.
Es war alles glatt gegangen. So glatt, wie er es geplant hatte. Jede kleinste Einzelheit hatte er vorausbedacht, nur nicht, dass es einen Toten geben würde.
Aber jetzt hatte er keine Zeit, darüber nachzudenken – jetzt nicht!
Mit unsicherer Hand schaltete er in den ersten Gang, und der Wagen fuhr sanft schaukelnd über das unkrautbewachsene Gelände. Dann führ er auf die Straße hinaus.
Renfield fuhr mit ungefähr fünfzig Stundenkilometer nach Süden. Mit blinkendem Dachlicht kam ihm ein schwarzer Funkstreifenwagen, ein Jaguar, entgegen. Der Beamte am Steuer trug weiße Handschuhe; sein Kollege neben ihm sprach eifrig ins Mikrophon. Die beiden schenkten dem silbergrauen Ford keinen Blick.
Ich hab’s geschafft!, sagte sich Renfield triumphierend. Und nun hübsch langsam – nur keinen Unfall bauen oder ein lumpiges Rotlicht überfahren! Solche Kleinigkeiten können alles verderben. Am liebsten möchte ich gleich mal in die Tasche schauen, aber das ist nicht vorgesehen. Erst muss ich in der Garage sein.
Er wusste genau, dass er jedes Detail seines Planes einhalten musste.
Die Idee zu diesem Coup war Renfield vor über einem Monat gekommen. An diesem Tag hatte er, der neunundzwanzigjährige Reporter des Evening View, in der Kantine des Glasgower Polizeipräsidiums eine Tasse Tee getrunken.
In dem großen Raum, zu dem die Presseleute inoffiziell Zutritt hatten, herrschte Stille. Sergeant Breaden, ein Hüne von eins-achtzig, setzte sich leutselig zu Renfield an den Tisch. Der Sergeant hatte Grund, guter Laune zu sein: Eines seiner Schäfchen war zu sechs Monaten Knast verdonnert worden.
»Na, wie geht’s, David?«, fragte er Renfield, den er schon lange kannte. Renfield war der Polizeireporter des View, und als solcher stets auf der Jagd nach Informationen.
»Ach, ziemlich mau«, erwiderte Renfield. »Im Fundbüro sind ein paar Schafe abgeliefert worden – vierbeinige. Ein Mann hat sie heute Morgen im Flur vor seiner Wohnungstür gefunden. Der Mann tat einen feierlichen Schwur, nie mehr einen Tropfen Alkohol zu trinken, aber schließlich merkte er doch, dass er diesmal nicht an Halluzinationen litt und dass die Viecher eher echt waren. Wahrscheinlich sind sie vom Schlachtviehmarkt davongelaufen.«
»Tja, Mitte der Woche ist selten was los«, meinte der Sergeant. »Vom Donnerstag bis zum Sonntagmorgen dagegen herrscht Hochbetrieb bei uns. Besonders donnerstags gibt es Überfälle und Einbrüche. Die meisten lassen am Donnerstag ihre Lohngelder für den Freitag holen, oder sie bringen ihre Einnahmen zur Bank. Am Freitagmorgen entdeckt man dann die geknackten Safes. Es ist unglaublich, welche Nase die Ganoven für leicht zu knackende Geldschränke haben. Und sie wissen natürlich ganz genau, dass die Lohngelder bereits am Donnerstag geholt werden. Am Samstag passiert dann alles, was man sich nur denken kann – besonders nach der Polizeistunde. Bis in den Sonntag hinein stromern die Betrunkenen umher.«
»Ja, und das Traurige ist, dass die Brüder nicht die geringste Rücksicht auf uns Zeitungsleute nehmen«, sagte Renfield mit einem Seufzer. »Ein Straßenraub passiert gewöhnlich genau zehn Minuten vor Redaktionsschluss. Wird ein Geldschrank geknackt, machen die Burschen solchen Lärm dabei, dass sie gleich erwischt werden und die Morgenzeitungen die Meldung groß herausbringen können. Wir als Abendzeitung haben immer das Nachsehen. Sergeant, Sie sollten diese Leute besser erziehen.«
»Was mich am meisten wurmt, ist, dass viele Firmen ihre Geldboten ohne jeden Schutz zur Bank schicken«, brummte der Sergeant.
Er rührte seinen Tee um und packte sein Frühstücksbrot aus.
»Jede Woche ist es das gleiche«, fuhr er kopfschüttelnd fort. »Diese harmlosen Gemüter schicken ein Kind von sechzehn mit einem Sack Geld zur Bank. Oder lassen die Lohngelder immer zur gleichen Zeit, immer auf demselben Weg und immer durch dasselbe kleine Mädchen abholen. Oder – aber das gehört schon zu den rühmlichen Ausnahmen – ein alter Knabe, der die Sechzig längst hinter sich hat, besorgt den Geldtransport. Und dann wundem sich die Leute, wenn ihre Bankboten eins über den Schädel bekommen und ihr schönes Geld, zum Teufel ist.«
Renfield nickte. »Gewiss. Aber oft genug stellt sich auch hinterher heraus, dass das nette kleine Mädchen oder der liebe gute Opa mit den Räubern unter einer Decke steckte. Der Schlag über den Schädel war lediglich, eine effektvolle Beigabe. Außer der dicken Beule gibt es dann anschließend einen ebenso dicken Anteil an der Beute.«
»Natürlich, das kommt schon mal vor«, gab der Sergeant zu.
Er blickte auf, als ein Polizeibeamter auf den Tisch zukam.
»Hallo, Lawson!«, rief er, als dieser, ebenfalls ein Sergeant, bei ihnen stehenblieb. »Ich erzähle dem jungen Mann gerade, wie leichtsinnig unsere Geschäftsleute bei ihren Geldtransporten sind.«
Jack Lawson schnaufte, stellte seine Tasse auf den Tisch und zog sich einen Stuhl heran.
»Ja, und man sollte es nicht glauben, aber auch die großen Firmen machen darin keine Ausnahme«, sagte er. »Zum Beispiel Swivney.«
Renfield bemühte sich, ein interessiertes Gesicht zu machen, aber er hatte genug mit sich selbst zu tun und deshalb keine Lust, sich auch noch mit den Sorgen der Polizei zu belasten. Nun, vielleicht ließ sich ein Artikel daraus machen.
»Also, nehmen wir einmal Swivney«, begann Sergeant Lawson erneut, nachdem er einen ordentlichen Schluck Tee genommen hatte. »Jeden Donnerstagnachmittag schicken sie ihren großen, schwarzen Rolls Royce mit dem Chauffeur und dem Kassierer zur Bank. Sie holen die Lohngelder – ungefähr siebentausend Pfund. Die Fabrik liegt draußen im Industriegelände. Sie fahren jede Woche durch dieselben einsamen Seitenstraßen, benutzen stets denselben Wagen und haben als Schutz nur einen jungen Constable dabei. Eines Tages werden noch ein paar Londoner Banditen hier aufkreuzen und den ganzen Zaster schnappen. Sie wissen doch, wie es dort draußen abseits der Hauptstraße aussieht: Dann und wann kommt mal ein Wagen, aber die meiste Zeit sind die Nebenstraßen wie ausgestorben. Der schwarze Rolls Royce ist geradezu eine Provokation.«
Gleich darauf wechselte man das Thema. Die beiden Sergeanten unterhielten sich angeregt über den Sturm der Glasgow Rangers. Aber Renfield hörte nicht mehr zu. Wie hätte er sich jetzt noch für Fußball interessieren können! Ihm war eine ganz wilde Idee gekommen.
Als er eine Stunde später in die Redaktion zurückkehrte, erwähnte er, entgegen seiner ursprünglichen Absicht, nichts von dem Gespräch mit den beiden Polizeibeamten. In seinem Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander. Er winkte den wenigen um diese Stunde anwesenden Reportern zu und setzte sich an seine Schreibmaschine. Er spannte einen Bogen ein und öffnete sein Notizbuch.
Nur rasch dieses Zeug schreiben, damit ich den Kopf freibekomme!, dachte er.
Abgesehen von den im Fundbüro abgelieferten Schafen hatte er von der Polizeipressestelle nur noch zwei kurze Notizen erhalten. In einem Fall suchte man den Zeugen eines Verkehrsunfalls, im anderen wurde die Öffentlichkeit aufgerufen, bei der Identifizierung eines Mannes mitzuhelfen, der mit Gedächtnisverlust ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Aber noch während er schrieb, gingen ihm ständig die Worte des Sergeanten durch den Kopf: Immer zur gleichen Zeit, immer denselben Weg, immer mit demselben Wagen...
Bis jetzt war alles nur eine vage Idee. Aber sie konnte Gestalt annehmen und ihn mit einem Schlag von allen Sorgen befreien.
Da war das Geld – siebentausend Pfund! Man brauchte sich nur zu bedienen. Der Sergeant hatte es selbst gesagt.
Und da war Jean Catta! Dunkeläugig, hübsch, temperamentvoll. Sie hatte eine leidenschaftliche Vorliebe für anregende Geselligkeit und elegante Kleidung, für Luxus und alle guten Dinge des Lebens. Jean war Mannequin und die Tochter eines Arztes. Erst kürzlich hatte sie ganz offen erklärt, sie würde nur einen Mann heiraten, der nicht nur gut aussah, sondern ihr auch ein luxuriöses Leben bieten, konnte.
Renfield hatte sie kennengelernt, als er in seiner Eigenschaft als Polizeireporter den Modesalon aufsuchte, in dem sie arbeitete. Es war dort eingebrochen worden, aber die Diebe hatten sich weniger für die traumhaften Modellkleider als vielmehr für die Ladenkasse interessiert. Jean hatte sich für ein paar Fotos zur Verfügung, gestellt, nachdem der Geschäftsführer erkannt hatte, dass hier auf billige Art Reklame für die Firma zu machen war.
»Möchten Sie Abzüge von den Bildern?«, hatte er sie gefragt, während der Fotograph sie so zurechtrückte, dass zwar alles von ihrer Figur, aber, so gut wie nichts von der aufgebrochenen Ladenkasse zu sehen war. Jean hatte sein Angebot erfreut angenommen.
Wieder in der Redaktion, hatte Renfield eine kleine Auseinandersetzung mit dem Fotographen, der ebenfalls jung, ledig und in höchstem Maße an dem dunkelhaarigen Mädchen interessiert war. Dass er Sieger blieb, verdankte.er lediglich dem Zufall: Das Geldstück, mit dem sie losten, entschied zu seinen Gunsten. Am Abend war er dann wieder zu dem Modesalon gegangen, einen Umschlag mit zwei großformatigen Hochglanzfotos unter dem Arm.
Er sprach Jean an, als sie das Geschäft verließ. Anfänglich tat sie sehr überrascht, aber als er sie an die Bilder erinnerte, willigte sie ein, sie bei einem Drink zu begutachten.
»Aber nur ein paar Minuten«, hatte sie gesagt. »Ich muss gleich nach Hause.«
Die paar Minuten endeten kurz vor Mitternacht mit dem Versprechen eines Wiedersehens.
Das lag nun einige Monate zurück. Im Augenblick konnte Renfield das Mädchen noch durch den Glorienschein seines Berufes als Polizeireporter halten und durch seinen Wagen, der allerdings noch lange nicht abbezahlt war. Nicht zuletzt aber fesselte er sie dadurch, dass er seine Ersparnisse rücksichtslos angriff, um ihre luxuriösen Wünsche zu erfüllen.
Vor wenigen Abenden allerdings hatte es wieder einmal eine heftige Auseinandersetzung gegeben, weil Renfield Überstunden gemacht hatte und müde und abgespannt eine Stunde zu spät zu der Verabredung gekommen war.
»Ich bin eine solche Behandlung nicht gewöhnt!«, hatte sie ihn gewarnt. »Und ich habe auch keine Lust, mich jemals daran zu gewöhnen.«
Mit einem kunstvoll ziselierten Silberarmreif und einem langen Brief bat er sie am nächsten Tag um Verzeihung. Damit war der Riss in ihrer Freundschaft wieder gekittet, aber sein rapide abnehmendes Bankkonto wies weitere neun Pfund weniger auf. Er brauchte Geld, viel Geld, um Jean Catta imponieren zu können.
Hatte er endlich die Lösung gefunden? Immer zur gleichen Zeit, immer denselben Weg, immer mit demselben Wagen...
An jenem Abend, als ihm die Idee zum ersten Mal im Kopf herumgeisterte, fand er glücklicherweise viel Zeit zum Nachdenken. Jean hatte abgesagt – sie wollte zu einem Hausball, den wohlhabende Freunde ihres Vaters gaben. Die Kollegen, mit denen er früher oft in seiner Freizeit zusammen gewesen war, hatten selbst Verabredungen. Er sah sich die Kinoanzeigen an. Nichts, was ihn interessiert hätte. Gelangweilt entschloss er sich, nach Hause zu gehen.
Sein Zuhause bestand aus einem Zimmer in einem kleinen Häuschen in Southwood am Rande von Glasgow. Mrs. Senior, seine Wirtin, bemutterte ihn mit Hingabe, besaß aber doch genügend Einsicht, ihn allein zu lassen, wenn er allein zu sein wünschte.
Gegen sechs Uhr kam er nach Hause. Er stocherte unlustig in dem Essen, das Mrs. Sentor ihm vorsetzte, und zog sich bald auf sein Zimmer zurück. Mit einem Seufzer warf er sich aufs Bett und blickte sich um. Diese vier Wände waren nun schon seit Jahren, sein Heim. Nach Beendigung des Wehrdienstes war er nach Glasgow gegangen, um beim Evening View zu arbeiten. Seine Eltern waren damals bestürzt gewesen; sie selbst, waren, außer auf ihren jährlichen Urlaubsreisen, nie aus Dundee herausgekommen. Ehe Renfield seinen Wehrdienst ableisten musste, hatte er in Dundee bei der lokalen Zeitung gearbeitet und bei seinen Eltern gewohnt. Sie hatten es niemals verstanden, dass ihr Sohn imstande gewesen war, von ihnen fortzugehen. Jede Woche schrieben sie ihm einen ausführlichen Brief, er antwortete alle vierzehn Tage.
Zum Teufel auch!, dachte er. Zu Hause bekam ich alles, was ich wollte – und hier...?
Er zündete sich eine Zigarette an und warf das Streichholz in hohem Bogen in den Kamin.
Ja, es war kein Vergleich mit dem angenehmen Leben in Dundee – zuerst in der Armee und nun hier beim View. Er musste wie jeder andere im Leben seinen Mann stehen. Und obwohl er innerlieh oft vor Wut gekocht hatte, war er doch niemals imstande gewesen, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, geschweige denn durchzusetzen. Es war eben leichter und bequemer, sich den Entschlüssen zu beugen, die energischere Männer gefasst hatten.
Und wohin war er damit gekommen? Er, David Renfield, neunundzwanzig Jahre alt, ein Meter achtundsechzig groß, dunkles Haar, braune Augen, verdiente zwanzig Pfund in der Woche, besaß einen zur Hälfte bezahlten Wagen und ungefähr hundert Pfund Ersparnisse. In seinem Schrank, hingen ein paar Sportanzüge und für besondere Anlässe ein guter dunkler Anzug. Abgesehen von den Raten für seinen Wagen schuldete er lediglich dem Buchmacher noch ein paar Pfund – die Strafe dafür, dass er den Renntipps des View Glauben geschenkt hatte.
Seit er Jean kannte, sah das Leben jedoch gänzlich anders aus. Jean hatte, die Entscheidung gebracht. Diesmal würde er die Initiative ergreifen, und alles würde so ausgehen, wie er es sich wünschte. Wenn er das Geld in die Hände bekam, bewies er gleichzeitig seine Intelligenz und seine Lebenstüchtigkeit. Damit bewies er, dass er Entschlüsse fassen und sie ausführen konnte. Und Jean würde er wie mit einer goldenen Kette an sich ziehen.
Er zupfte sich an der Oberlippe und begann, über das Problem nachzudenken.
Durch seine Tätigkeit als Polizeireporter wusste er nur zu gut, dass Polizeibeamte keine Trottel waren. Er hatte an zu vielen Gerichtsverhandlungen teilgenommen, als dass er nicht gewusst hätte, welche Strafe ihn erwartete, falls man ihn erwischte. In Schottland gab es zwar kein Zuchthaus Dartmoor, aber auch Barlinnie und Peterhead waren keine Ferienpensionen.
Es würde ein gewaltiges Spiel sein. Aber die Summe, um die es ging, lohnte den Einsatz. Und eine sorgfältige Planung versprach beträchtliche Erfolgschancen.
Bis spät in die Nacht hinein saß er in seinem kleinen Zimmer und machte sich Notizen. Einen Plan nach dem anderen verwarf er wieder. Als er zu müde war, noch logisch denken zu können, verbrannte er sämtliche Aufzeichnungen. Er ging zu Bett, immer noch ohne feste Vorstellung, wie er die Sache anpacken wollte.
Aber ich werde einen Weg finden!, sagte er sich entschlossen.
Am folgenden Abend war er wieder mit Jean verabredet, und diesmal sagte sie nicht ab. Er holte sie von daheim ab; sie wohnte bei ihren Eltern in einem Wohnblock in Pollokshields, einer einst vornehmen Wohngegend, die im Lauf der Jahre altersgrau geworden war. Er erschien Punkt sieben, bewaffnet mit zwei Karten für das neue Musical im King’s Theatre.
Für ihn war es der schönste Abend seit langem. Schließlich hatte er jetzt ein Ziel vor Augen. Wenn es erreicht war, würde die dunkelhaarige Nixe an seiner Seite ihm für immer gehören.
Nach der Vorstellung gingen sie essen. Renfield fühlte sich entspannt und in gelöster Stimmung. Jean war ausgelassen und schwatzte übermütig über das Musical – und nur ganz entfernt fiel ihm ein, dass ihre gute Laune niemals lange anhielt.
Ich weiß genau, dass sie berechnend ist, dass sie nimmt, was sie bekommen kann, aber ich bin ganz einfach verrückt nach ihr, sagte er sich. Insgeheim machte er sich heftige Vorwürfe wegen dieser Schwäche.
Es gibt mancherlei Wege, auf denen ein Reporter zu der Information kommen kann, die er benötigt. Manchmal ist es denkbar einfach: Er braucht nur ein Telefongespräch zu führen und einem guten Bekannten eine direkte Frage zu stellen. Diese Möglichkeit hatte Renfield nicht – jetzt, da es sich nicht um einen Bericht über, sondern die Vorbereitungen für ein Verbrechen handelte.
Er betrachtete es als einen glücklichen Umstand, dass er nach der augenblicklichen Arbeitseinteilung donnerstags dienstfrei hatte.
An diesem Tag fuhr er hinaus ins Industriegelände. Er schaute sich die Schaufenster einiger Geschäfte an und ließ dabei das Fabriktor der Firma Swivney nicht aus den Augen. Er brauchte nicht lange zu warten. Um Viertel nach zwei Uhr kam der schwarze Rolls Royce herausgefahren. Am Steuer saß der Chauffeur, neben ihm ein uniformierter Polizeibeamter. Auf dem Hintersitz sah Renfield den Kassierer, einen Mann in mittleren Jahren. Renfield kaufte in den Geschäften ein paar Kleinigkeiten. Er ließ sich Zeit dabei.
Etwa eine Stunde später kam der Rolls Royce zurück.
Das war der erste Teil. Erst nach sieben langen Tagen, in denen die Berufsarbeit für ihn zur sturen Routine wurde, kam nach Renfields Plan Teil zwei.
Am nächsten Donnerstagnachmittag parkte er seinen Wagen in einiger Entfernung von der Fabrik. Wieder passierte der Rolls Royce pünktlich um zwei Uhr fünfzehn das Fabriktor. Drei Männer saßen im Wagen – dieselben wie am Donnerstag zuvor. Mit seinem Ford folgte er der Limousine durch die wenig belebten Nebenstraßen des Industriegeländes. An einer Straßenkreuzung auf halbem Weg zur Stadtmitte bog der Rolls Royce ab. Renfield wendete und wartete vor einem großen Bürohaus.
Eine halbe Stunde später kam der Rolls Royce zurück.
Man benutzte also für die Hin- und Rückfahrt dieselbe Route.
Immer zur gleichen Zeit, immer denselben Weg...
Wieder wartete Renfield eine Woche. Dann kam Teil drei.
Diesmal wartete er auf den Rolls Royce vor dem Bürohaus und folgte ihm durch den dichten Verkehr der Innenstadt. An einer Verkehrsampel hätte er den schwarzen Wagen beinahe aus den Augen verloren. Dann hielt der Rolls Royce vor einer Bank in der Hope Street. Renfield fuhr langsam weiter.
Es gelang ihm, eine Parklücke zu finden, und Minuten später stand er gegenüber der Bank auf dem Gehsteig und beobachtete, wie der Kassierer durch die breiten Schwingtüren herauskam. Der Mann ging seelenruhig zu dem Rolls Royce. Er trug eine schwarze Ledertasche in der Hand und wurde von dem Polizeibeamten begleitet. Der Chauffeur war im Wagen geblieben.
Der Kassierer stellte die Ledertasche in den Wagen und ging noch einmal zurück. Gleich darauf kam er mit zwei Säckchen, die offenbar das Kleingeld enthielten, wieder heraus.
Für einen Mann, der es gewohnt war, Verbrechen zu rekonstruieren, war alles andere nicht schwer.
Der Rolls Royce passierte auf seinem Weg eine einsame Straße im Industriegelände. Nur selten kam hier ein Fahrzeug. Als Renfield sie probehalber noch einmal durchfuhr, bemerkte er ein schmales Gässchen, das zwischen hohen Fabrikmauern auf eine Hauptstraße mit regem Verkehr führte.
Diese Gasse war für sein Vorhaben bedeutungsvoll. Vielleicht konnte er seinen Wagen am anderen Ende parken und nach dem Raub hindurchrennen.
Sein Plan nahm immer festere Umrisse an. Ein Rädchen griff ins andere.
Renfield besaß eine Pistole, die er während seiner Wehrdienstzeit einem betrunkenen Soldaten abgekauft hatte. Damals war er Kradmelder bei der Nachrichtentruppe. Der Krieg war längst vorbei, und er fasste die Soldatenzeit mehr als Pfadfinderlagerleben, als Abenteuer auf. Er war stolz auf seine Auszeichnung als bester Schütze der Abteilung.
Eine eigene Pistole zu besitzen – der Gedanke erregte damals seine noch jungenhafte Phantasie ungemein. Ohne zu zögern, hatte er fünf Pfund bezahlt, um in den Besitz dieser aus dem Krieg stammenden Waffe zu gelangen.
Die Soldatenzeit war nun vorüber, aber die Pistole und die Munition lag ganz zuunterst in einem verschlossenen Koffer in seinem Zimmer.
Wie kann ich auf eine ganz simple Art den Wagen stoppen?, grübelte er immer wieder. Ich möchte nicht schießen. Es muss genügen, nur mit der Pistole zu drohen. Schließlich ist es ja nicht ihr eigenes Geld – warum sollten sie also ihr Leben riskieren? Aber selbst wenn ich die Waffe gebrauchen muss, falls der Polizist sich nicht einschüchtern lässt, wird ein harmloser Streifschuss vermutlich jeden Widerstand brechen.
Blieb nur noch das Problem, wie er den Wagen stoppen und anschließend ungeschoren davonkommen könnte.
Die Lösung fand er genau zehn Tage vor Ausführung der Tat.
Zu so früher Abendstunde war es ruhig in der Bar. Jean hatte wieder einmal üble Laune, sah aber trotzdem atemberaubend schön aus in ihrem grauen Seidenkleid. Mürrisch drehte sie ihr Glas in den Händen.
Und dann begann es: Er brauche endlich einen neuen Wagen; sie könne diesen grauen Ford bald nicht mehr sehen...
»Warum hast du nicht so einen flotten Sportwagen wie Ronnie Sett?«, fragte sie schnippisch, ohne allerdings zu erwähnen, dass Setts Vater zufällig ein Tabakwarengeschäft mit mehreren Filialen besaß und es ihm darum nicht besonders schwerfiel, die Wünsche seines Sohnes zu erfüllen. »Es ist einem direkt peinlich, in deinem alten Kombiwagen gesehen zu werden. Ich finde ihn genauso grässlich wie diese Motorräder, von denen du ewig schwärmst! Könntest du dir nicht auch so einen hübschen Triumph-Sportwagen kaufen?«
Renfield hörte plötzlich nicht mehr zu. In seinem Gehirn hatte es geklingelt.
Ein Motorrad – das war die Lösung! Damit konnte er den Rolls Royce zum Anhalten bringen. Er konnte das Motorrad in seinen Ford laden, diesen in einiger Entfernung vom Ort des Überfalls parken und den Rest des Weges mit dem Motorrad zurücklegen. Nach dem Raub konnte er durch das schmale Gässchen fliehen. Dem schweren Rolls Royce war dieser Weg versperrt – man würde ihn also nicht verfolgen können. Später würde er die Maschine wieder in den Ford laden und davonfahren. Der Fahrzeugwechsel würde die Polizei auf jeden Fall irreführen.
Er musste vor der Zeit in der Gasse sein und auf den Rolls Royce warten. Es war kaum anzunehmen, dass um diese Zeit andere Fahrzeuge die Straße entlangkommen würden. Im entscheidenden Moment würde er aus dem Gässchen geschossen kommen, einen Unfall vortäuschen und mit dem Motorrad vor den Rolls Royce kommen.
Für einen alten Kradmelder war das eine ganz schöne Sache. Er würde sich dabei nicht verletzen und auch das Motorrad sicherlich nicht beschädigen.
Der Rolls Royce würde anhalten. Die Insassen würden sich um den Verletzten kümmern wollen. Jetzt musste die Pistole in Tätigkeit treten. Er würde sofort zwei Reifen zerschießen, womit er bestimmt jede Absicht, sich zur Wehr zu setzen, im Keime erstickte.
Renfield triumphierte. Es traf sich großartig, dass er sich jederzeit eine Maschine entleihen konnte, ohne dass der Eigentümer es merkte. Er teilte seine Garage – eine alte Wellblechbaracke – mit einem jungen Mann, der sein etwas vernachlässigtes Motorrad nur zu Wochenendausflügen benutzte. Es war eine Zweihunderter Dot. Sie war schnell, fuhr sich leicht, und er konnte sie ohne Schwierigkeit in seinen Wagen laden. Eine ganze Reihe Kratzer zeugten von der Nachlässigkeit des Besitzers. Wenn also bei dem vorgetäuschten Sturz noch ein paar Schrammen hinzukamen, würde es kaum auffallen.
»Natürlich brauche ich andere Nummernschilder«, murmelte er geistesabwesend vor sich hin. »Sonst könnte ich schwer reinfallen.«
»David, wovon redest du?«, fragte Jean gereizt.
»Ich glaube, du hast mir gar nicht zugehört.«
»Oh doch, Liebes. Ich habe nur eben darüber nachgedacht, was ich für den Ford bekommen kann, wenn ich ihn verkaufe.«
»Du willst dir also einen neuen Wagen kaufen?« Sie strahlte ihn an.
»Vielleicht«, antwortete er ausweichend. »Ich werde es mir jedenfalls durch den Kopf gehen lassen.«
Am nächsten Abend fertigte er die Nummernschilder an. In der Garage hatte er sich eine genaue Skizze gemacht. Zwei Sperrholzplatten, etwas schwarze und weiße Farbe – das war alles, was er brauchte. Er kaufte die Sachen auf dem Heimweg.
Das Schwierigste waren die Nummern. Erst nach mehreren Versuchen sahen sie echt aus.
Als er endlich fertig war, roch es in seinem Zimmer so stark nach Farbe, dass er das Fenster über Nacht offenlassen musste. Er wusste, am Morgen, wenn Mrs. Sentor aufräumen kam, musste alles unbedingt verschwunden sein.
Am nächsten Tag zur Arbeit ging, packte er die Nummernschilder tatsächlich verblüffend echt aussahen, in den Koffer zu der Pistole. Den Koffer schloss er sorgfältig wieder ab. Mrs. Sentor war zwar vertrauenswürdig, aber er wollte nicht das kleinste Risiko eingehen.
Nun blieb noch ein letzter, aber ungemein wichtiger Punkt: Er durfte nicht erkannt werden. Auch hier ergab sich die Lösung wie von selbst.
Johnny Fellows, ein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, legte am Montagnachmittag eine groteske Maske auf den Schreibtisch.