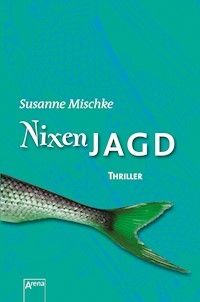12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein tödlicher Sinneswandel Hauptkommissar Bodo Völxen wird von Sirenen aus dem Schlaf gerissen. Auf dem benachbarten Grundstück brennt die Scheune lichterloh. Am Morgen steht fest: Es war Brandstiftung, eine Leiche wurde gefunden und vom Bewohner, dem CEO einer Frackingfirma, fehlt jede Spur. Dieser hatte sich Feinde gemacht, weil er nach dem Genuss psychoaktiver Pilze seinen Ölreichtum gegen Umweltschutz eintauschen wollte. Ein Plan, der in der Firma und Familie viele erzürnte. Das Team ermittelt und Völxen will den Fall schnellstmöglich lösen, denn das Verbrechen auf dem Nachbargrundstück steht ihm unerwartet nahe. Frackingfirma gegen Umweltschützer – Völxen und sein Team geraten zwischen die Fronten In diesem Kriminalroman schreibt Bestsellerautorin Susanne Mischke wieder einen hoch spannenden Fall rund um das Ermittlerteam aus Hannover und nimmt sich dabei dem aktuellen Thema Umweltschutz an. Regio-Krimi von Bestsellerautorin Susanne Mischke
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Deine Welt wird brennen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1 – Der Brand
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
Kapitel 2 – Und doch wieder eine Leiche
Donnerstag
Kapitel 3 – Das wäre dann Mord
Kapitel 4 – Schöner Wohnen
Kapitel 5 – Nichts als die Wahrheit
Kapitel 6 – Die eigenen Leute
Kapitel 7 – Die Lindians
Kapitel 8 – Renitente Damen
Freitag
Kapitel 9 – Töchter und andere Ärgernisse
Kapitel 10 – Seltsame Zustände
Kapitel 11 – Meerverrückt
Kapitel 12 – Nahtoderlebnis
Kapitel 13 – Die Welt ist schlecht
Kapitel 14 – Warten, nichts als Warten
Samstag
Kapitel 15 – im Wald
Kapitel 16 – Abkühlung
Sonntag
Kapitel 17 – Überraschung!
Zehn Tage später …
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Die Nacht umfängt ihn wie ein schützender Mantel. Sternklar wölbt sich der Himmel über den schwarzen Konturen des Waldes, die fadendünne Mondsichel spendet kaum Licht. Er riecht die Feuchtigkeit, das Moos, das Harz. Ein Fuchs stößt ein heiseres Bellen aus, ein Ast fällt vom Baum. Blätter flüstern im Wind, eine Maus huscht durch trockenes Laub. Sein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Mit der Zeit nimmt er immer mehr von seiner Umgebung wahr, es ist ein Spüren mit allen Sinnen, ein intensives Lebensgefühl, wie er es zuvor nicht kannte. Er nimmt Dinge wahr, die er noch nie wahrnahm. Das Ächzen der Bäume, deren Holz sich ausdehnt, ihre Wurzeln, die das lebenserhaltende Wasser aus dem Boden saugen. Ein Kauz ruft. Die feinen Härchen an seinen Unterarmen stellen sich auf.
Bald wird das alles verschwinden. Der Wald, die Tiere, die Pflanzen – todgeweiht. Die Vögel werden verstummen. Zum Glück wissen sie es nicht. Nur die Menschheit beginnt zu ahnen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Niemand weiß das besser als er. Er war zu lange auf der dunklen Seite. Er hat sein Wissen in den Dienst der Vernichtung gestellt, seine Läuterung kommt zu spät. Die einzige Gewissheit ist die, dass nichts mehr einen Sinn ergibt. Kinder nicht, Liebe nicht, Geld – lächerlich!
Er spürt, wie Tränen über seine Schläfen rinnen. Er lässt es geschehen. Es tut gut, zu weinen. Zu bereuen, was er tat. Zu trauern über ein falsches, vergeudetes Leben.
Stürbe er noch in dieser Nacht, er würde sofort und ohne Umwege Teil dieses ihn umgebenden Organismus. Käfer würden sich seiner bemächtigen, Krähen, Marder, Raubvögel, Füchse. Er wäre Nahrung, er wäre Erde, Materie, aus der Neues erwächst, sein Körper fände seinen Platz in diesem Kreislauf, ginge vollkommen darin auf. Sein Leben hätte einen Sinn. Und sein Geist wäre auf der anderen Seite.
Kapitel 1 – Der Brand
Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
Bodo Völxen sitzt in der ersten Bank und soll ein Gedicht aufsagen. Er hat es geübt, aber jetzt ist alles weg. Er beginnt zu schwitzen. Der alte Schafbock hinter dem Lehrerpult mustert ihn mit schrägen Pupillen und leckt sich hämisch grinsend über die gelben Zähne. Dann hebt er den Kopf mit dem schweren Gehörn und stößt ein schauerliches Geheul aus, denn er ist gar kein Schafbock, sondern ein Wolf, der heult und heult …
Völxen fährt aus den Kissen und reißt die Augen auf. Schwaches Mondlicht fällt durch die Ritzen der Jalousie. Langsam schälen sich die vertrauten Konturen des heimischen Schlafzimmers aus dem Dunkel. Er atmet tief durch. Was für ein Irrsinn, jetzt verfolgt ihn Amadeus, das alte Biest, sogar schon in seinen Träumen. Das darf er keinesfalls Sabine erzählen, die lacht ihn aus. Oder rät ihm zu einer Therapie.
Nicht alles war ein Traum, das Heulen ist echt. Es hält an und bohrt sich wie eine Schraube in seinen Kopf. Oscar, der Terriermischling, sitzt am Fußende des Bettes. Dem Fenster zugewandt jault er um die Wette mit den Sirenen, die von draußen zu hören sind.
»Still, Oscar. Verdammt noch mal!«
Zu spät, jetzt ist auch Sabine wach. Sie knipst die Nachttischlampe an, blinzelt und fragt: »Was ist denn los?«
»Feuerwehr«, konstatiert der Hauptkommissar, denn er muss es schließlich wissen.
Bei Westwind kann man ab und zu Polizei- oder Feuerwehrsirenen von der Bundesstraße hören, aber daran hat sich der Hund längst gewöhnt. Die Töne, die Oscar zum Jaulen animiert haben, waren lauter und näher. Soeben sind sie verstummt. Nicht so der Terrier.
»Oscar, Ruhe! Und runter vom Bett!«, schimpft Sabine.
Widerstrebend und in Zeitlupe wird der Befehl ausgeführt.
Die Leuchtziffern des Weckers zeigen 02:25. Schlaftrunken wankt Völxen durchs Zimmer, stolpert über den Hundekorb und flucht. Er zieht die Jalousie hoch und öffnet das zuvor gekippte Fenster ganz. Die Sommernacht ist angenehm kühl, frische Luft strömt ins Zimmer und streichelt seinen verschwitzten Nacken. Im Dorf scheint alles in Ordnung zu sein, nirgendwo ein Widerschein von Flammen oder Blaulichtern. Er hat das doch nicht geträumt, oder? Nein, Oscar ist sein Zeuge. Wo sind die Fahrzeuge denn dann hin? Sie waren doch ganz nah.
Sabine scheint sich ähnliche Gedanken zu machen. »Vielleicht ist was passiert, drüben, beim Hühnerbaron«, flüstert sie ängstlich, als könnte es sich bewahrheiten, wenn sie es nur laut genug ausspricht.
Die beiden schauen einander an. Eine Menge Unausgesprochenes liegt in diesem Blick, allem voran die Frage, wie gefährlich ein Feuer beim Nachbarn ihnen selbst werden kann. Ziemlich gefährlich, durchzuckt es Völxen. Je nachdem, wie stark und woher der Wind weht.
Er schlüpft in seinen gestreiften Bademantel, verlässt das Zimmer und überquert den Flur. Vom Badfenster aus hat man einen guten Blick auf das Wohnhaus und die Hühnerställe des Nachbarn.
Da ist etwas im Gange. Fast alle Fenster im Haus von Jens und Hanne Köpcke sind erleuchtet. Zwei Löschfahrzeuge bewegen sich hinter Köpckes Hof mit zuckenden Blaulichtern einen holprigen Feldweg entlang. Die Sirenen wurden abgeschaltet. Da draußen gibt es keine Verkehrsteilnehmer, die man warnen müsste, der Weg führt nur durch Rüben- und Kornfelder zu einer alten Feldscheune. Diese Scheune ist der Grund für den Einsatz. Sie steht in Flammen, Feuerzungen lodern hoch zum Dach hinaus in den Nachthimmel. Für einige Momente überlässt Völxen sich diesem Schauspiel, das ihn auf eine morbide Weise fasziniert.
»Es ist nicht Köpckes Hof«, sagt er zu Sabine, die nun ebenfalls ins Badezimmer kommt. »Da hat er Schwein gehabt, der Hühnerbaron.«
Jetzt schaut auch sie aus dem Fenster und spricht dann mit schriller Stimme aus, wovor ihr Ehemann seit Wochen die Augen verschließt: »Bodo! Wie kannst du das nur sagen? Da drin wohnt doch dieser Arnold!«
An Schlaf ist nicht mehr zu denken, also tauscht Völxen sein Lieblingskleidungsstück, den Bademantel, gegen seine Arbeitshose und ein T-Shirt. Vorsichtshalber steckt er auch noch seinen Dienstausweis ein. Zurück bleiben ein kläffender Terrier und Sabine, die hinuntergegangen ist in die Küche. Gähnend füllt sie den Wasserkocher, um sich einen Tee zuzubereiten, denn auch sie kann jetzt nicht einfach zurück ins Bett und weiterschlafen.
Der Hauptkommissar schnappt sich sein Rad und schiebt es durch den Garten in Richtung der Schafweide mit den Obstbäumen und dem Stall. Alles liegt friedlich im Dunkeln. Die vier Schafe und der Bock sind nachts im Stall eingeschlossen. Früher konnte man sie getrost draußen lassen, aber inzwischen gibt es in dieser Gegend immer wieder herumstreunende Wölfe. Völxen kann nur hoffen, dass der Lärm der Einsatzfahrzeuge die Schafe nicht in allzu große Panik versetzt hat. Er wird sich gleich morgen früh um seine Lieblinge kümmern, jetzt, mitten in der Nacht, würde sein Erscheinen sie nur noch mehr aufregen. Ächzend tritt er in die Pedale. Der Trampelpfad entlang der Schafweide ist Gift für seine Bandscheiben, aber der kürzeste und schnellste Weg zur Brandstelle führt über Köpckes Hof und den Feldweg dahinter. Man kann die Scheune zwar auch von der anderen Seite mit dem Auto erreichen, doch nur auf einem Riesenumweg über das Nachbardorf.
Da drin wohnt doch dieser Arnold. Der Satz von Sabine hallt als aufdringliches Echo in seinem Kopf nach. Natürlich hat er mitbekommen, dass der seltsame Kauz seit dem Frühjahr mit ziemlicher Regelmäßigkeit in der Scheune schläft. Jedenfalls brennt da drüben fast jeden Abend Licht. Strom gibt es dort nämlich, denn früher nutzte Jens Köpcke das Gebäude als Werkstatt für alte Traktoren, die er aufkaufte, herrichtete und teuer verkaufte. Irgendwann bekam das Finanzamt Wind von diesem lukrativen Hobby, und nach einer saftigen Steuernachzahlung verlor der Hühnerbaron die Lust daran. Von der Elektrizität abgesehen fehlt der Scheune jedoch jegliche Errungenschaft moderner Zivilisation. Vor allen Dingen eine Toilette. Aus diesem Grund mied Völxen die Umgebung der Scheune in letzter Zeit bei seinen Hundespaziergängen. Man weiß ja nicht, wie dieser Arnold das Problem handhabt, und Terrier Oscar hat eine ausgesprochen unappetitliche Angewohnheit …
Völxen verdrängt den Gedanken daran. Er hat Köpckes Hof erreicht, lässt Hühnerställe und Wohnhaus links liegen, biegt auf den Feldweg ein und nimmt Fahrt auf. Der Dynamo schnurrt, der Lichtkegel zittert über die Schlaglöcher. Jetzt kann er den Brand nicht nur sehen und riechen, sondern auch hören. Er hat fast vergessen, wie laut so ein Feuer sein kann. Vor langer Zeit, auf Streife und beim KDD, war Völxen häufiger unter den Ersten an einer Brandstelle. Während der letzten zwanzig Jahre, als Leiter des Kommissariats für Todesdelikte, kam er meistens nur noch zu bereits gelöschten oder leise vor sich hin schwelenden Brandorten. Doch dieses Feuer ist noch dabei, sich richtig auszutoben. Die Flammen führen einen wilden Tanz auf, fast wie ein lebendes Wesen, eine Bestie, die faucht und braust, dazwischen knackt es. Balken krachen in die Glut. Als würde das nicht genügen, gibt es hin und wieder eine kleine Explosion. Farbdosen vielleicht oder Terpentin, denn der Scheunenbewohner hat sich der Malerei verschrieben. Was vorhin, vom Fenster aus, noch eine gewisse archaische Faszination auf den Hauptkommissar ausübte, empfindet er nun als beängstigend und bedrohlich. Außerdem weckt es unangenehme Erinnerungen. Vor etlichen Jahren tauchte eine verbrannte Leiche im Osterfeuer auf dem Süllberg auf. Er hat den grässlichen Anblick bis heute nicht vergessen. Seither hat er es nicht mehr so sehr mit Feuer, abgesehen vom heimischen Kaminofen.
Von hinten nähern sich Scheinwerfer. Völxen muss absteigen und ins Rübenfeld ausweichen. Schon wird er überholt von einem LHF, was für Lösch-Hilfeleistungs-Fahrzeug steht, dem folgt ein größeres Tanklöschfahrzeug. Die Feuerwehren werden nicht allzu viel ausrichten können, befürchtet er. Ein paar Tausend Liter Wasser sind schnell versprüht. Einen Hydranten gibt es mitten in der Feldmark nicht, erst recht keinen Löschteich. Da ist nur ein Brunnen vor der Scheune, mit einer Handpumpe. Morgens duschte der Scheunenbewohner dort regelmäßig mithilfe dieser Pumpe und einer selbst gebastelten Duschkonstruktion, was Sabine Völxen zu manch anerkennender Bemerkung über den athletischen Körperbau des neuen Nachbarn veranlasste. Kürzlich erkundigte sie sich beiläufig, wo eigentlich der Feldstecher abgeblieben sei, den Völxen von seinem Großvater geerbt habe, und man kann getrost davon ausgehen, dass sie damit keine Vögel beobachten wollte.
Der Hauptkommissar hat sich wieder aus dem Rübenacker herausgearbeitet, doch er muss erneut zur Seite springen. Ein Passat rast mit aufgesetztem Blaulicht ohne Rücksicht auf Verluste den Feldweg entlang. Der Kriminaldauerdienst. Völxen hat als junger Polizist ebenfalls ein paar Jahre dort verbracht. Flott unterwegs, die Herrschaften, stellt er fest.
Zum Qualm des Feuers und der Anstrengung des Radelns kommt nun auch noch die Staubwolke, die die Fahrzeuge aufgewirbelt haben. Völxen muss husten. Er macht sich Sorgen. Wann hat es eigentlich zum letzten Mal geregnet? Ist schon etliche Tage her, zwei Wochen bestimmt. Die Böden in den Gärten und auf den Äckern haben Risse, das Korn ist reif und trocken. Einige Felder wurden schon abgeerntet, doch zwischen der Scheune und seinem und Köpckes Hof steht das Korn noch ordentlich hoch. Da reicht ein Funke, ein paar Windböen, und dann ist ein halber Kilometer plötzlich keine Entfernung mehr. Andererseits wissen die Feuerwehrleute vom Land nur allzu gut um diese Dinge, sie werden darauf achten und entsprechend handeln. Zumindest hofft Völxen das.
Warum brennt die Scheune denn überhaupt? Hat dieser Freak wieder einmal ein Lagerfeuer entfacht, die Glut nicht ordentlich gelöscht – und schon ist die Kacke am Dampfen, wie es der Kollege Raukel ausdrücken würde.
Völxen ist heiß vom Radeln oder vielleicht auch von den Flammen, die ihre Hitze abstrahlen. Rauchschwaden umfangen ihn wie Nebel, ehe der Wind sie fortweht. Ungeachtet seiner Befindlichkeit strampelt er, so schnell er kann. Sollte der worst case eintreten und dieser Arnold in den Flammen umgekommen sein, dann ist das ohnehin ein Fall für ihn und seine Leute. Da ist man dann besser gleich von Beginn an vor Ort. Diese praktische Erwägung ist jedoch nicht der wahre Grund für seine Eile.
Es ist ein vages Schuldgefühl, das ihn antreibt. Er hätte den Hühnerbaron längst darauf ansprechen sollen, dass das Wohnen in einer Feldscheune, die offiziell als Maleratelier vermietet wurde, nicht erlaubt ist. Nicht ohne eine Nutzungsänderungsgenehmigung. Doch er hat geschwiegen, bis heute, denn ihm ist klar, dass Köpcke, das alte Schlitzohr, die Vorschriften genau kennt – und ignoriert. Und was, fragte sich Völxen, kümmern mich derlei Lappalien? Sein Kommissariat ist schließlich für Straftaten gegen das Leben zuständig, nicht für Bau- und Mietrecht. Hauptsächlich aber wollte er das gutnachbarliche und freundschaftliche Verhältnis mit Jens Köpcke, das seit bald dreißig Jahren besteht, nicht belasten. Hier, in diesem Dorf, in diesem alten, umgebauten Bauernhof, ist Völxens Zuhause, sein Rückzugsort. Hier ist er Privatmann, Schafhalter, Hundebesitzer, Nachbar. Alles, nur nicht im Dienst. Obgleich Köpcke und Konsorten ihn mit Kommissar anzusprechen pflegen, möchte er in seiner privaten Umgebung keinesfalls den Dorfsheriff geben. Deshalb drückt er bisweilen ein Auge zu – oder auch mal zwei.
Was, wenn sein Wegsehen und Schweigen nun fatale Folgen hat? Jens und Hanne Köpcke werden auf alle Fälle Ärger bekommen, denn mit den Brandermittlern ist nicht zu spaßen. Für die ist jeder Besitzer einer abgebrannten Immobilie zuerst einmal ein potenzieller Versicherungsbetrüger. Es kommt also einiges auf den Hühnerbaron zu, selbst wenn die Sache glimpflich ausgeht. Glimpflich heißt in diesem Fall: ohne brennende Felder und ohne einen Toten in dem verbrannten Gebäude.
Die Leute vom Kriminaldauerdienst haben keine Zeit verloren. Das kann Völxen erkennen, als er am Einsatzort ankommt und sein Rad abstellt. Eine Beamtin in den Dreißigern hat den Hühnerbaron in der Mache, ihr Kollege unterhält sich mit Hanne Köpcke. Völxen kennt die beiden nicht, sie sind zu jung. Oder er zu alt. Vom Mieter der Scheune ist nichts zu sehen, auch sein Wagen parkt nicht vor dem Tor. Völxen nimmt dies erst einmal mit Erleichterung zur Kenntnis.
Außer den Kollegen vom KDD sind zwei Streifenwagen und vier Löschfahrzeuge vor Ort. Scheinwerfer werden aufgestellt, Schläuche ausgerollt, Kommandos gebrüllt. »Wasser marsch!« Das erste Löschfahrzeug ist schon im Einsatz, das zweite positioniert sich auf der anderen Seite der Scheune. Blaulichter zucken durch die Nacht.
»Achtung! Weg da! Der Dachstuhl kommt runter!«, schreit es aus mehreren Kehlen.
Schon kracht es. Balken stürzen herab, dazwischen Heuballen, sie sehen aus wie Kissen aus Feuer. Funken sprühen. Die Männer richten den Wasserstrahl auf die glühenden Heuballen. Es zischt und dampft. Völxen weicht zurück.
»Was wollen Sie hier?« Ein Jungspund von der Streife, der gerade das Absperrband ausrollt, betrachtet ihn mit grimmiger Miene. Offenbar hält er ihn für einen Schaulustigen, dem kein Weg zu weit war. Völxen zeigt dem Mann seinen Dienstausweis.
»Hauptkommissar Völxen vom 1. 1 K?« Der Junge nimmt Haltung an. »Aber wer hat Sie denn gerufen? Hier gibt es gar keinen Personenschaden.«
»Umso besser«, antwortet Völxen knapp, denn gerade hat ihn der Hühnerbaron bemerkt und wirft ihm über die Schulter der Kollegin vom KDD einen halb erfreuten, halb verzweifelten Blick zu.
Völxen mag sich nicht in die Befragung der Kollegen einmischen, das käme nicht gut an. Er hält Blickkontakt mit dem Hühnerbaron und streicht sich dabei mit der Hand über seine Lippen, als müsse er dort etwas abwischen. Der Nachbar nickt kaum merklich. Die Botschaft, Klappe halten!, ist angekommen. Nun, in der Krise, zahlt sich die wortkarge Kommunikation am Zaun der Schafweide aus, die Völxen und sein Nachbar seit Jahren praktizieren und perfektionieren. All die Sundowner in Form lauwarmer Herrenhäuser wurden nicht vergeblich schweigend getrunken, registriert Völxen mit Befriedigung.
Er macht sich auf und umrundet in gebührendem Abstand die Brandstelle, nur um sich zu vergewissern, dass Arnolds Wagen wirklich nicht da ist. Auf der Rückseite angelangt, bekommt er eine ordentliche Wolke Qualm ab. Der Rauch brennt in den Augen und lässt ihn erneut husten. Der Wind hat aufgefrischt. Das ist gar nicht gut. Jetzt muss die Feuerwehr wirklich aufpassen, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommt. Ein kräftiger Regenguss wäre Gold wert, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Wie schon die letzten Sommer ist auch dieser recht trocken, obwohl das Frühjahr verheißungsvoll regnerisch begann.
Immerhin kommt Verstärkung. Auf dem befestigten Weg aus Richtung Hemmingen nähern sich drei weitere Löschfahrzeuge. Eines muss man den freiwilligen Feuerwehren der Dörfer lassen, wenn es irgendwo brennt, sind sie sofort zur Stelle. Manchmal entbrennt – was für ein makabrer Ausdruck – sogar ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Ortschaften, wer die schnellsten sind.
Völxen sieht zu, dass er dem Rauch entkommt und den eintreffenden Einsatzfahrzeugen nicht im Weg ist.
Nein, der Volvo ist nicht da, zum Glück. Alles halb so schlimm, kein Personenschaden, wie es das junge Streifenhörnchen eben formuliert hat.
»Kommissar! Gut, dass du hier bist!« Hanne Köpcke taucht wie ein kompaktes Gespenst aus dem Qualm auf. Ihr rundes Gesicht glänzt feucht, ihr Doppelkinn bebt. Anders als ihr Gatte war die Nachbarin noch nie eine Anhängerin der nonverbalen Kommunikation. Schon schnattert sie drauflos. Sie sei es gewesen, die das Feuer entdeckt habe, erklärt sie. Sie könne in letzter Zeit oft nicht durchschlafen. »Die Wechseljahre! Ehe ich mich nur im Bett herumwälze, stehe ich lieber auf und mache mir eine Tasse Kräutertee. Wenn es eine schöne Nacht ist, so wie heute, dann gehe ich auch mal ein paar Schritte vor die Tür. Ich denk mir noch, was riecht denn hier so komisch, und als ich um die Ecke biege, da sehe ich das Feuer. Hab ich einen Schrecken bekommen! Ich habe sofort den Jens geweckt und die Feuerwehr gerufen.« Sie deutet auf die Flammen, die inzwischen nicht mehr ganz so hoch und hell lodern. Der alles verschlingenden Bestie scheint allmählich das Material auszugehen. »Mein Gott, wie kann denn das passieren?«
»Das wüsste ich auch gerne«, antwortet Völxen. »Noch mehr würde mich allerdings interessieren, wo unser Künstler abgeblieben ist.«
»Der Becker? In der Scheune war er jedenfalls nicht«, antwortet die Nachbarin. »Sein Auto ist auch weg.«
Bei den Einsatzkräften der Feuerwehr wird beratschlagt, wie man weiter verfährt. Völxen entnimmt den Gesprächsfetzen, dass man sich gegen die Anforderung weiterer Löschfahrzeuge entscheidet. Da die Scheune ohnehin nicht mehr zu retten ist, will man den Rest kontrolliert abbrennen lassen und lieber die Umgebung sichern. Später, wenn alles heruntergebrannt ist, kann man noch eventuell vorhandene Glutnester mit Schaum löschen. Diese Strategie ist ganz in Völxens Sinn. Es beruhigt ihn etwas, dass die Männer und die ein, zwei Frauen, die er bis jetzt unter den Helmen ausmachen konnte, die Lage im Griff haben.
Der Hühnerbaron ist den Fängen des KDD entronnen und nähert sich. »So ein verdammter Mist!«, schimpft er. »Da macht man einmal im Leben ein gutes Geschäft und dann das!«
»Sei lieber froh, dass der Kerl nicht da drin war«, versetzt Völxen missmutig.
»Hm, ja, ist auch wieder wahr«, grummelt Köpcke.
»Hast du ihn schon angerufen?«, fragt Völxen
»Nein. Ich hatte Besseres zu tun. Das erfährt er schon noch früh genug.«
»Weißt du, wo er ist?«
»Keine Ahnung, er hat sich bei uns nicht abgemeldet.«
Die zwei Beamte vom Kriminaldauerdienst steigen gerade wieder in ihren Wagen. Sie können hier nicht viel ausrichten. Die Scheune wird man erst morgen betreten können, und die Brandursache zu erforschen ist nicht mehr ihre Sache. Sollte dabei ein gewisser Verdacht aufkommen, dann bekommt der Hühnerbaron es mit den Kollegen vom 1. 2 K – Brandstiftung – zu tun.
»Was haben sie euch gefragt?«, will Völxen von seiner Nachbarin wissen.
»Wo wir waren, als wir das Feuer bemerkt haben.«
»Und ob sich in der Scheune gefährliche, explosive Substanzen befinden«, fügt ihr Mann hinzu.
»Was hast du gesagt?«
»Dass da drin ein paar alte Möbel, Gerätschaften und Bilder lagern. Und altes Heu, oben auf dem Boden. Ist ja auch die reine Wahrheit«, grinst Köpcke.
Zumindest Teile davon, ergänzt Völxen in Gedanken. Kann es sein, überlegt Völxen, dass den Köpckes nicht so recht klar ist, wie haarscharf sie an einer Katastrophe vorbeigeschlittert sind?
»Hast du erwähnt, Jens, dass der Kerl dort praktisch gewohnt hat?«
»Nein. Du etwa, Hanne?«
Die Gefragte plustert sich auf. »Mit keinem Wort! Ich bin ja nicht bescheuert. Ich habe genug Krimis gesehen, ich weiß, wie das läuft. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden …«
»Dann vergesst das mal nicht in nächster Zeit«, rät Völxen.
»Du meinst, wir werden noch richtig vernommen? Wegen der ollen Scheune?« Der Hühnerbaron runzelt zweifelnd die Stirn.
»Darauf kannst du dich verlassen«, antwortet Völxen. »Mit den Brandermittlern ist nicht zu spaßen.«
»Du verstehst es wirklich, einen aufzumuntern, Kommissar.«
Völxen verspürt plötzlich eine bleierne Müdigkeit und starke Sehnsucht nach seinem Bett. »Soll ich noch hierbleiben?«, fragt er anstandshalber das Ehepaar Köpcke.
»Nicht nötig, Kommissar. Wir kommen schon klar«, meint der Nachbar.
Völxen schwingt sich auf sein Gefährt und radelt zurück, deutlich langsamer als vorhin. Trotz Hanne Köpckes vorgeblicher Abgebrühtheit durch fleißigen Krimikonsum ist der Nachbarin nämlich doch etwas herausgerutscht, wenn auch vielleicht nur ihm gegenüber: Becker. Offenbar der Nachname ihres Mieters, welchen Jens Köpcke ihm die ganze Zeit über partout nicht verraten wollte. Völxen war deswegen sogar ziemlich angefressen in den letzten Wochen.
Arnold Becker also. Damit lässt sich schon mal etwas anfangen, und wenn er nicht so müde wäre, würde er ihn heute noch überprüfen und googeln.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Seit Anfang März wusste Völxen schon, dass Köpcke seine Scheune vermietet hatte, denn wo sich sonst nur Krähen und Füchse tummelten, herrschte auf einmal ein Kommen und Gehen. Natürlich kann Köpcke mit seiner Scheune anstellen, was er will, das hielt ihm auch Sabine vor Augen, wenn Völxen sich bei ihr beklagte. Aber es missfiel ihm trotzdem.
Ein paar Tage darauf kam der Scheunenmieter im Gefolge von Jens Köpcke an den Zaun der Schafweide. Unangemeldet. Was Völxen sofort gegen den Mann einnahm. Dieser Platz ist sein kleines Refugium, dort steht er frühmorgens oder nach Feierabend gerne lange und in sich gekehrt da und beobachtet die grasenden Schafe und den Sonnenuntergang hinterm Deister. Selbst Familienmitglieder sind dabei nicht immer willkommen, und der Hühnerbaron nur, weil er die Kunst des Schweigens beherrscht.
Der ungebetene Gast stellte sich mit Arnold vor.
»Völxen«, sagte Völxen und taxierte den Eindringling mit Polizistenscharfblick. Teure Sneakers, teurer Haarschnitt, das karierte Hemd weit aufgeknöpft. Eine Kette mit einem Anhänger verlor sich in seinem Brusthaar. Das und die militärisch anmutende Cargohose wirkten an ihm wie eine Verkleidung. Ohne dass ihn jemand gefragt hätte, erklärte Arnold, er habe aufgrund eines einschneidenden Erlebnisses eingesehen, dass sich in seinem Leben einiges ändern müsse. Er wolle die Scheune nutzen, um darin zu malen, zu meditieren und die ländliche Ruhe zu genießen. Völxen wünschte ihm dabei viel Vergnügen und dachte an die Traktoren mit den Spritzmitteln, die bald losziehen würden, und den Mähdrescher, welcher der ländlichen Ruhe zur Kornernte im Sommer gründlich den Garaus machen würde. Dasselbe noch einmal im Herbst, beim Rübenroden, nur mit weniger Staub.
Danach versandete die Unterhaltung, denn Köpcke und Völxen übten sich demonstrativ in ihrer Königsdisziplin.
Am nächsten Tag knöpfte Völxen sich den Hühnerbaron vor. Ob derlei ungebetene Besuche jetzt zur Gewohnheit würden?
Köpcke, sichtlich verlegen, entschuldigte sich und meinte, der Kerl sei ihm einfach nachgelaufen. Unter Völxens bohrenden Fragen wand er sich wie ein Wurm an der Angel. Der Mann habe ihn um Diskretion gebeten, war zunächst alles, was Völxen aus Köpcke herausquetschen konnte, und dass Arnold ihm die Miete für ein halbes Jahr in bar und im Voraus bezahlt habe, einen überaus großzügigen Betrag für eine alte Scheune ohne fließendes Wasser.
Bei diesen Worten zogen sich die Augenbrauen des Hauptkommissars zusammen, zwei buschige graue Raupen auf Kollisionskurs. Ob Köpcke denn schon davon gehört habe, dass in den Niederlanden und in Belgien die Drogenkartelle gerne abgelegene Scheunen anmieteten, um darin Ecstasy und dergleichen herzustellen? Zwar sei man nicht in den Niederlanden, sondern in Niedersachsen, aber könne man deshalb ausschließen, dass diese Unsitte nicht auch hierzulande bereits um sich griff? »Dir ist schon klar, Jens, dass du mit einem Bein im Knast stehst, wenn der Kerl in deiner Scheune ein Drogenlabor betreibt?«, setzte er noch einen drauf.
»Ein Drogenlabor? In meiner Scheune! Das ist doch …«
»Was? Abwegig?«
»Irgendwie schon«, meinte Köpcke. »Wenn du mich fragst, ist das ein reicher Spinner mit einer Midlife-Crisis, nichts weiter.« Um Völxen zu beruhigen, versicherte er, alle paar Tage nach dem Rechten zu sehen.
»Versprich es mir!«
»Großes Indianerehrenwort.«
Bald gab der Hühnerbaron Entwarnung. »Kein Drogenlabor, Kommissar. Er hat ein paar Möbel da reingestellt, die sehen aus wie vom Sperrmüll. Und Staffeleien und Leinwände. Er malt. Seltsames Zeug. Aber das ist ja nicht verboten.«
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Eines Nachmittags radelte Völxen höchstpersönlich zur Scheune und spähte durch das schmutzige Fenster. Er sah Köpckes Aussage bestätigt. Ein geradezu Spitzweg’sches Idyll breitete sich vor seinen misstrauischen Blicken aus. Der Tisch mit den Malsachen, Staffeleien mit und ohne Leinwand, ein rotes Samtsofa, das auch schon bessere Tage gesehen hatte, genau wie das Bett, der Tisch und das alte Küchenbuffet. Kann es sein, grübelte Völxen auf dem Rückweg beschämt vor sich hin, dass der Beruf zu sehr abfärbt und ich überall Verdächtiges wittere?
War der Künstler anwesend, dann parkte vor dem Scheunentor ein protziger, mit allen Schikanen ausgestatteter Volvo-Geländewagen, der zum Lebensstil des Scheunenbewohners nicht passen wollte. Eine Kennzeichenabfrage wäre für den Hauptkommissar ein Leichtes gewesen. Mit dem Namen könnte man die Daten des Einwohnermeldeamts einsehen, überprüfen, ob eine Kriminalakte existiert, und Google befragen. Die Versuchung war sehr groß, manchmal schier übermächtig. Andererseits geschah in der Scheune nichts, was eine solche Maßnahme gerechtfertigt hätte.
Je wärmer es wurde, desto öfter übernachtete dieser Arnold in seinem Atelier und erfreute die weibliche Nachbarschaft mit seinem morgendlichen Duschritual. Dieses Benehmen war unverfroren und exzentrisch, aber nicht kriminell. Das hielt Völxen sich in schwachen Momenten vor Augen. Datenabfragen für private Zwecke verstoßen seit jeher gegen die Dienstvorschrift. Früher sah man das nicht ganz so eng. Es gab Kollegen, die jemandem einen Gefallen taten oder aus eigenem Interesse die Adresse zum Kennzeichen einer attraktiven Verkehrsteilnehmerin abfragten. Heute ist das sowohl verpönt als auch riskant. Sämtliche Abfragen werden automatisch protokolliert. Wenn es dumm läuft, handelt man sich mit so einer Sache eine Menge Ärger ein. Es wäre überaus peinlich, wenn er als Dienststellenleiter bei einer derartigen Regelverletzung erwischt würde. Dieses Risiko war Völxen seine Neugierde dann doch nicht wert. Also übte sich der Hauptkommissar zähneknirschend in Selbstbeherrschung.
Aber er blieb wachsam. Sein Instinkt sagte ihm, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmte.
Kapitel 2 – Und doch wieder eine Leiche
Donnerstag
Schon zwanzig nach neun und keine Spur vom Hauptkommissar. Frau Cebulla wundert sich, denn normalerweise ist ihr Chef recht pünktlich in seinem Büro, mal mit, mal ohne seinen Hund. Um 10 Uhr findet üblicherweise die Morgenbesprechung statt, und vorher möchte er gerne seine Mails, so gut es geht, abarbeiten. Dazu serviert Frau Cebulla ihm seit Jahren unaufgefordert einen gesunden Kräutertee, den er entweder trinkt oder in den Topf des Gummibaums gießt, um sich danach einen Cappuccino und ein paar Kekse zu holen. Sie überlegt, ob sie ihn anrufen soll, aber da klingelt der Apparat auf ihrem Schreibtisch, und im Display erscheint die private Nummer ihres Vorgesetzten.
»Herr Hauptkommissar?«
»Guten Morgen, Frau Cebulla, Sabine Völxen am Apparat. Mein Mann wird heute wohl erst gegen Mittag auf der Dienststelle erscheinen.«
»Ist etwas passiert?«
»Es gab einen Brand in der Nachbarschaft. Nur eine Scheune, aber er war deswegen die halbe Nacht auf den Beinen, und er kann solche Strapazen nicht mehr so gut wegstecken. Also habe ich ihn schlafen lassen.«
»Das war eine kluge Entscheidung«, stößt Frau Cebulla aus tiefstem Herzen hervor. »Er soll sich ruhig Zeit lassen.«
»Sie meinen, wenn er unausgeschlafen und schlecht gelaunt ist, soll ich ihn so lange wie möglich dabehalten.«
»Das haben jetzt Sie gesagt«, schmunzelt Frau Cebulla und fragt: »Sind die Schafe wohlauf? Brände können Tiere nämlich sehr nervös machen, die riechen das kilometerweit.«
»Das werden wir gleich sehen. Die Biester sind garantiert das Erste, worum er sich kümmern wird, sobald er aufgestanden ist.«
Elena Rifkin trinkt ihren Kaffee schwarz und im Stehen und schaut dabei aus dem Küchenfenster auf die Straße hinunter. Es ist 8 Uhr, die Sonne vergoldet die gegenüberliegenden Backsteinfassaden. Menschen gehen oder radeln leicht bekleidet zur Arbeit, und gleich wird auch sie sich auf ihr Rad schwingen und zu ihrer Dienststelle, der Polizeidirektion Hannover, fahren.
»Ist was da unten?«
Sie fährt herum. Sie hat ihren Gast gar nicht kommen hören. Er ist zum Glück schon geduscht und angezogen, sein Haar fällt ihm in feuchten Strähnen ins Gesicht, und jetzt, da sie ihn zum ersten Mal bei Tageslicht sieht, bemerkt sie, dass es einen rötlichen Stich hat.
»Nein«, antwortet Rifkin.
Nein, es ist nichts Auffälliges zu sehen. Sie hat es auch nicht wirklich erwartet. Nicht nach über einem Jahr.
»Ich … äh … geh dann mal.«
»Gut.« Rifkin trinkt ihren Kaffee aus. Anstandshalber müsste sie ihm auch einen anbieten, aber er hat ja schon gesagt, dass er gehen will, und das ist ihr sehr recht. Für einen Moment sieht es so aus, als wollte er in die Küche kommen und sie zum Abschied küssen oder umarmen oder dergleichen. Rifkin dreht sich rasch weg, wäscht ihre Tasse mit viel Sorgfalt ab und stellt sie ins Abtropfgitter.
Mit einem schiefen Grinsen macht er kehrt. »Kann ich dich mal wieder anrufen?«
»Sicher doch, Martin.«
»Markus.«
»Sorry.«
»Was sind schon Namen, Helene?«
Erleichtert hört sie, wie er die drei Schlösser der Wohnungstür öffnet, und wartet darauf, dass er die Tür hinter sich schließt. Stattdessen ruft er: »Da liegt ein Paket auf dem Fußabtreter.«
Das wird die neue Fahrradlampe sein, wurde auch Zeit. Jemand aus der Nachbarschaft muss das Päckchen angenommen und es ihr frühmorgens vor die Tür gelegt haben, denn gestern, als sie und dieser … wie auch immer … gegen Mitternacht ankamen, war es noch nicht da.
»Leg es auf den Schuhschrank! Danke.«
Ein paar zähe Sekunden vergehen, dann fällt die Tür ins Schloss. Sie atmet auf, geht ins Bad und macht sich zurecht. Diese kleinen Falten um die Mundwinkel und zwischen den Augenbrauen hat sie neulich schon bemerkt. Nun ja, sie ist über dreißig, und die Nacht war kurz. Zeit für die erste Botox-Spritze? Sie muss kichern bei diesem Gedanken und zieht ihrem Spiegelbild eine Grimasse. Rifkin ist auf ihre eigene Weise eitel, zum Beispiel legt sie großen Wert auf einen durchtrainierten Körper, aber sie wäre die Letzte, die sich wegen ein paar Falten graue Haare wachsen ließe. Wobei … Sie fährt mit dem Kamm langsam durch ihr kurzes, espressobraunes Haar. Nein, noch keines zu entdecken.
Im Flur streift ihr Blick das Paket, das unter ihren Jacken auf dem Schuhschrank liegt. Es ist etwas zu groß geraten für eine Fahrradlampe und mit braunem Packpapier umwickelt. Als sie es anhebt, ist es unerwartet schwer, und es fehlen sowohl der Adressaufkleber als auch die Frankierung und der Absender. Da steht nur ihr Vorname, Elena, mit schwarzem Filzstift von Hand geschrieben, in kyrillischen Buchstaben. Ihr Herz beginnt zu rasen. Sie weiß sofort, von wem das Paket kommt. Jenem Mann, mit dem sie, gegen ihre sonstige Gewohnheit, gerne gefrühstückt hatte. Mit dem sie jedoch besser erst gar nichts angefangen hätte. Sie hastet in die Küche, öffnet das Fenster und schaut erneut auf die Straße.
Nichts. Natürlich nicht.
Igor Baranow. Nicht, dass sie ihn vergessen hätte. Nur verdrängt. Nachdem sie sich von ihm trennte, stand wochenlang sein Maserati in unregelmäßigen Abständen vor ihrem Wohnblock. Wegen des steilen Blickwinkels aus dem vierten Stock und der getönten Scheiben des Wagens konnte sie nicht feststellen, ob er selbst darin saß oder nur einer seiner Fahrer und Handlanger. Rifkin weigert sich bis heute, die Sache Stalking zu nennen. Dafür war die Frequenz zu niedrig, und es passierte ja sonst nichts. Spricht man erst von Stalking, ist der Begriff Opfer nicht mehr weit, und als Opfer will Rifkin sich nun wirklich nicht betrachten. Doch es reichte, um sie, die auf der Dienststelle im Ruf steht, cool zu sein, ziemlich nervös zu machen.
Einen Igor Baranow serviert man nicht ungestraft ab, das hätte ihr klar sein müssen, und sie verstand auch die Botschaft des Maserati vor dem Haus: nicht reden! Dabei verhält es sich umgekehrt: Ein Wort von ihm, und sie kann ihre Laufbahn bei der Polizei vergessen. Eine Liaison mit dem Boss der örtlichen Russenmafia macht sich nicht gut im Lebenslauf einer Staatsdienerin. Heute fragt sie sich, wo in dieser Zeit nur ihr Verstand und ihre Zurechnungsfähigkeit geblieben waren. Wie konnte sie an seine Geschichte glauben, er habe das kriminelle Milieu hinter sich gelassen und sei nun ein solider Geschäftsmann? Dass es einen Krieg brauchte, um ihr die Augen zu öffnen über die wahre Gesinnung ihres Geliebten, ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt.
Das alles ist Monate her. Gerüchten zufolge hat Baranow das Land verlassen und ist zurückgekehrt in den Schoß von Mütterchen Russland.
Was von dieser Episode bleiben, sind Rifkins Selbstzweifel und die Angewohnheit, vom Küchenfenster aus die Fahrzeuge am Straßenrand zu checken. Ach ja, und ein gelegentliches anzügliches Grinsen von Kollege Raukel, das sie zähneknirschend wegstecken muss. Ausgerechnet das Schmuddelkind der Polizeidirektion musste auf den letzten Drücker hinter ihre Affäre mit Baranow kommen. Kein beruhigender Gedanke, dass ihre Karriere seither nicht nur von Baranows Verschwiegenheit abhängt, sondern zusätzlich auch noch in Erwin Raukels kleinen fetten Händen liegt. Mit dieser dunklen Wolke über ihrem Haupt muss sie leben. Selbst schuld! Mitleid ist da nicht angebracht.
Nun also dieses Paket. Sie ahnt, was sich darin befindet: ein kostbarer Gegenstand von eigenwilliger Schönheit, aber auch ein weiteres Zeugnis ihrer mangelhaften moralischen Integrität. In erster Linie aber etwas, das sie vor neue Probleme stellen wird.
Was, schon fast 10 Uhr? Völxen schlüpft eilig in seinen Bademantel und die Gummistiefel und hastet durch den Garten, zur Schafweide. Höchste Zeit für die Tiere, ins Freie zu kommen. Schafe brauchen ihren gewohnten Rhythmus, sonst sind sie total durch den Wind. Erst recht nach einer bewegten Nacht wie der zurückliegenden. Hoffentlich haben sie von dem Krach und dem Gestank nicht allzu viel mitgekriegt. Er öffnet die Tür des Schafstalls, macht auf dem Absatz kehrt und rennt, so schnell ihn die Gummistiefel tragen, über die Wiese. Sollte Amadeus mit dem falschen Huf aufgestanden sein, was man im Voraus nie wissen kann, dann sieht man besser zu, dass man Land gewinnt.
Die gestörte Nachtruhe hat dem alten Schafbock offenbar gehörig die Laune vermiest. Wie der Blitz fegt er mit gesenktem Gehörn zum Stall hinaus. Völxen schiebt gerade den Riegel des Gatters zu, da knallt der mächtige Schädel schon gegen die Bretter. Puh, das war knapp! Aber wenigstens ist Völxen jetzt wach. Der kleine Sprint am Morgen ist sozusagen sein tägliches Fitnessprogramm.
Amadeus dreht ein paar Runden und keilt wütend aus. Leider fehlt ihm ein Gegner, denn heute wagt sich nicht einmal der Terrier heran, der den Bock sonst gerne ein wenig triezt. Doris, Mathilde, Salome und Angelina folgen Amadeus in gesitteter Manier nach draußen. Auch sie wirken etwas verstört. Ein paar Minuten lang starren die vier Damen desorientiert in die Gegend, doch schließlich fangen sie an zu grasen. Der Bock zieht noch eine Weile seine Show ab, dann zupft auch er an den Gräsern, die ihm munden, und das sind längst nicht alle.
Was immer nachts im Stall los war, es scheint keine schwerwiegenden Folgen nach sich zu ziehen. Völxen dagegen braucht jetzt dringend einen starken Kaffee, um den Anstrengungen des Tages gewachsen zu sein.
Nach seiner Rückkehr von der Brandstelle ist er wie ein gefällter Baum ins Bett geplumpst, aber einschlafen konnte er dann doch nicht. Zweimal stand er auf und schlich hinüber ins Bad, um sich zu vergewissern, dass der Brand wirklich gelöscht wurde und kein Kornfeld in Brand geraten ist. Erst als es draußen schon hell wurde und die Vögel anfingen zu lärmen, fielen ihm die Augen zu. Hätte Sabine ihn nicht geweckt, würde er wahrscheinlich jetzt noch schlafen.
Für einen ganz normalen Donnerstag hat Sabine ein ziemlich fürstliches Frühstück zubereitet. »Ist ja wie im Urlaub!«, bemerkt er, und tatsächlich ist seine Motivation, sich in nächster Zeit zur Dienststelle zu begeben, nicht besonders groß.
»Nimm dir doch heute frei. Du hättest bestimmt einen Berg Überstunden, wenn du sie aufschreiben würdest.«
»Mal sehen«, murmelt Völxen und lädt sich noch eine Portion Rührei, welche natürlich von Köpckes Hühnerschar stammt, auf den Teller. Wenig später steht er im Bad und rasiert sich, ganz vorsichtig, mit dem Rasiermesser seines Großvaters. Es klappt ausnahmsweise ohne Blutvergießen, und nachdem er mit seiner Morgentoilette fertig ist, schnappt er sich den alten Feldstecher, den seine voyeuristisch veranlagte Gattin doch tatsächlich oben auf dem Badezimmerschrank platziert hat. Von der Scheune stehen nur noch einzelne Balken und Fragmente der Wände, der Anblick erinnert an ein sehr lückenhaftes Gebiss.
Es ist schon einiges los da drüben. Das kleine LHF der örtlichen Feuerwehr ist präsent, ein Streifenwagen, ein ziviles Dienstfahrzeug und der Kombi der Brandermittler. Darin befinden sich eine Art fahrbares Labor und ein tragbares Massenspektrometer. Sollte jemand das Feuer gelegt haben, werden die Kollegen es rasch rauskriegen, und zwar nicht nur, dass gezündelt wurde, sondern auch, womit. Völxen erkennt die gedrungene Gestalt von Jens Köpcke, wie immer im Blaumann mit Latzhose und einem gelben Käppi mit der Aufschrift New Holland auf dem fast kahlen Kopf. Die Aufschrift kann man von hier natürlich nicht lesen, aber Köpcke trägt diese Kappe mindestens so lange wie Völxen seinen gestreiften Bademantel. Der Nachbar steht etwas verloren an der Seite, im Moment scheint niemand etwas von ihm zu wollen.
Männer mit Schutzkleidung räumen die Balken und Bretter, die den Flammen halbwegs widerstanden haben, beiseite und stochern dazwischen herum.
Völxen ist im Zwiespalt. Ob es wohl arg aufdringlich wirken würde, wenn er mal kurz am Ort des Geschehens vorbeischaut? Kriegen die Kollegen das womöglich in den falschen Hals? Andererseits – er wohnt schließlich hier, der Besitzer der Scheune ist sein Nachbar und Freund, es wäre, im Gegenteil, schon fast eigenartig, wenn er sich gar nicht blicken lassen würde. Der Hühnerbaron würde es ihm sicher übel nehmen. Er schnappt sich sein Handy und ruft den Nachbarn an. »Moin, Jens. Wie sieht’s aus?«
»Ich steh hier an der Brandstelle«, sagt der Hühnerbaron. »Schöne Schweinerei!«
»Hast du deinen Mieter erreicht«?
»Der geht nichts ans Handy.«
»Nicht mal die Mailbox?«
»Teilnehmer nicht erreichbar.«
»Hm«, meint Völxen. Das gefällt ihm nicht, ganz und gar nicht.
»Ich fahr mal rüber und sehe, wie weit sie sind«, sagt er zu Sabine, die gerade die Reste des opulenten Frühstücks wegräumt. »Ach, übrigens … Kann ich das Fernglas wieder aus dem Bad entfernen, oder brauchst du es noch?«
»Es hat seinen Zweck erfüllt.«
»Tut mir sehr leid, dass sich das Objekt deiner Begierde nun woanders duschen muss.«
»Komm schon, das war doch nur ein Witz.«
»Dann würdest du also herzlich lachen, sollte ich eines Tages nackte Frauen durchs Fernglas beobachten?«
»Oh, gleich im Plural«, bemerkt Sabine süffisant. »Aber ja. Gleiches Recht für alle.«
Völxen verdreht die Augen und macht, dass er rauskommt. Er trägt bei ihren ehelichen Wortgefechten so gut wie nie den Sieg davon, bestenfalls endet es unentschieden, und heute ist er solchen Scharmützeln erst recht noch nicht gewachsen.
Über den Trümmern der Scheune liegt noch immer ein starker Geruch nach Verbranntem. Nur der Qualm ist weg. Die drei Brandermittler in ihren Anzügen und der Hühnerbaron stehen inmitten des Infernos zusammen und starren auf das Mikado aus verkohlten Balken und Brettern. Völxen erkennt Fetzen von Leinwänden, das Gestell einer Stehlampe, ein metallenes Spülbecken und ein Stück der Tischplatte. Alles rußgeschwärzt. Die zwei Männer von der freiwilligen Feuerwehr, die vorhin noch dabei waren, die Trümmer abzutragen, haben damit aufgehört und stehen abwartend da. Einer hat sich eine Zigarette angezündet. Der andere fummelt an seinem Handy herum.
Wieso tun die alle mehr oder weniger nichts, wieso stehen die nur da? Worauf warten die? Völxens inneres Alarmsystem schlägt an. Er wird von einer bösen Vorahnung erfasst und atmet gegen eine aufkommende Übelkeit an. Von allen mehr oder weniger schlimm zugerichteten Leichen, die er im Lauf seines Berufslebens zu sehen bekam, waren ihm Brandopfer immer am unheimlichsten. Ihre Körper haben so wenig Menschliches an sich, sie sind geschlechts- und alterslose Aliens, gebratenes, verkohltes Fleisch, kaum zu unterscheiden von einem Spanferkel. Nach einem solchen Erlebnis kann er wochenlang keinen Braten sehen und riechen, ohne dass ihn ungewollte Assoziationen heimsuchen. Am liebsten würde er gleich wieder verschwinden, aber natürlich geht das jetzt nicht mehr, er wurde längst entdeckt. Die zwei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr sind aus dem Dorf. Jakob Schmidt, der Ältere, hat Völxens Dachfenster eingebaut, der Jüngere wird Rüben-Sven genannt, er steuert für die Genossenschaft den Rübenroder und den Mähdrescher über die Felder der Umgebung.
»Moin, Kommissar!«, grüßen die beiden zackig.
Auch einer der Männer in Zivilkleidung dreht sich um, ein Endfünfziger mit weißem Stoppelhaarschnitt und kantigen Zügen.
»Völxen? Donnerwetter! Schneller vor Ort als die Schmeißfliege beim Aas.«
»Dir auch einen schönen Tag, Gerloff.«
Hauptkommissar Rudi Gerloff, bekannt dafür, dass er sich gerne durch forsches Auftreten Respekt verschafft oder es jedenfalls versucht. Völxen lässt das kalt.
Widerstrebend reiht er sich in den Kreis derer ein, die um das herumstehen, was von einer Schicht aus Asche teilweise verdeckt wird. Man kann ohne Zweifel die Umrisse eines Menschen erkennen. Der Körper hat die für Brandopfer typische Haltung angenommen. Fechterstellung, wie Völxen einst von Dr. Bächle lernen musste. Verkrümmter Körper, abstehende Arme. Diese Fetzen, ist das Haut oder Kleidung? Vermutlich beides. Auf jeden Fall ein schockierender Anblick.
»Kommissar! Da bist du ja.« Der Hühnerbaron hat seine Schildmütze abgenommen und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Seine Gesichtsfarbe, die normalerweise zwischen Dunkelrosa und Violett changiert, zeigt eine fahle Blässe. »Ich versteh das nicht. Wieso war der da drin? Wie kann denn das sein? Sein Auto ist doch gar nicht da.«
»Wen meinen Sie denn damit?«, unterbricht ihn Gerloff, der sofort hellhörig geworden ist. »Wissen Sie, um wen es sich bei dem Leichnam handelt?«
Ehe der Hühnerbaron sich um Kopf und Kragen reden kann, antwortet Völxen an dessen Stelle: »Herr Köpcke ist mein Nachbar. Er wird seine Zeugenaussage zu diesem Leichenfund später bei meinen Leuten zu Protokoll geben.«
Der Brandermittler runzelt missgelaunt die Stirn, aber er kann nicht viel dagegen einwenden. Leichen gehören nun einmal in Völxens Zuständigkeitsbereich.
»Gibt es schon etwas zur Brandursache?«, erkundigt sich Völxen.
»Nein, noch nicht. Der hier«, er deutet auf den Körper, »ist uns dazwischengekommen.«
»Genau. Es rührt hier keiner mehr etwas an, bis die Spurensicherung und die Rechtsmedizin hier waren.« Völxen wendet sich an die zwei Herren von der freiwilligen Feuerwehr. »Kein Wort zu niemandem über den Leichenfund! Ich will nicht in den nächsten fünf Minuten das ganze Dorf hier haben.«
»Geht in Ordnung, Kommissar«, sagt Jakob Schmidt, der Fensterbauer.
Rüben-Sven murmelt etwas Unverständliches.
»Wie bitte?«, fragt Völxen den jungen Mann mit dem kurz geschorenen Quadratschädel und den abstehenden Ohren.
»Ich hab es nur meiner Freundin geschickt.«
Der Hauptkommissar kann seinen Zorn nur mühsam bändigen. »Sollten Fotos von diesem Leichnam im Netz auftauchen, ist das ein Straftatbestand«, zischt er. »Aber zum Glück wissen wir dann ja, woher sie stammen.«
Rüben-Sven wird flammend rot und tippt hektisch auf seinem Handy herum, bemüht, den Schaden zu begrenzen.
»Wie lange wird das dauern?«, fragt Jakob Schmidt.
»Eine ganze Weile.«
»Holt euch euer Mittagessen lieber bei McDoof«, rät der Kollege Gerloff, der genau weiß, was Völxen denkt, und es nur nicht laut ausspricht: dass ein Brand bisweilen gelegt wird, um einen Mord oder Totschlag zu vertuschen.
Völxen gibt dem Hühnerbaron einen Wink und dirigiert ihn weg vom Zentrum des Geschehens.
»Er ist es, Kommissar«, flüstert Köpcke.
»Aber wo ist sein Wagen?«
»Komm mit!« Köpcke marschiert zielstrebig dorthin, wo einmal die Rückseite der Scheune war. In einigen Metern von den Resten der Wand entfernt liegt ein Fahrrad auf dem Boden. Es ist schwarz vom Ruß, und die Reifen, der Sattel und die Kunststoffummantelungen der Seilzüge sind teilweise geschmolzen. Vielleicht lehnte es an der Wand und wurde bei den Löscharbeiten zur Seite geworfen. Die Form der Lampe und des Gepäckträgers lassen auf ein älteres Modell schließen. Völxen wischt über den Lenker. Unter dem Ruß befinden sich Spuren von Rost. »Das scheint mir ein etwas angejahrtes Schätzchen zu sein. Kennst du es, Jens?«
»Nein. Das war vorher noch nie da«, erklärt Köpcke. »Er hat immer rumgefaselt, dass er sein Auto am liebsten abschaffen will, weil Autofahren nicht mehr zu verantworten sei.«
»Ja, das klingt nach ihm«, bestätigt Völxen mit einem leicht abfälligen Unterton.
»Da wäre noch etwas, Kommissar«, druckst Köpcke herum.
»Ja?«
»Der hatte doch immer dieses Amulett mit dem komischen Symbol um den Hals, irgendwas mit drei Armen oder Flügeln oder so.«
»Ich kann mich schwach erinnern«, nickt Völxen.
»Das Ding hat aus der Asche rausgeschaut, ich habe es erkannt.« Er ringt nach Atem. »Mir ist ganz übel geworden, als ich das sah. Hätte ich ihn doch bloß damals weggeschickt …«
»Es ist, wie es ist«, meint Völxen kurz angebunden. »Du gehst jetzt am besten zu dir nach Hause und hältst dich bereit. Ich rufe meine Leute an, die werden dich und Hanne befragen.«
»Wieso machst du das nicht?«
»Erstens habe ich hier noch zu tun, zweitens könnte man mir Befangenheit vorwerfen, weil wir uns ja gut kennen.«
»Ich bin doch nicht verdächtig, oder?« Das eben noch bleiche Gesicht rötet sich in Windeseile.
»Ehe wir die Brandursache nicht kennen, ist erst mal niemand verdächtig«, sagt Völxen, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entspricht. »Aber ihr seid Zeugen, du und Hanne, und als Zeugen müsst ihr die Wahrheit sagen, sonst macht ihr euch strafbar. Und zwar die ganze, klar?«
Der Hühnerbaron gibt ein Grunzen von sich und trottet mit hängenden Schultern davon.
Völxen schaut ihm nach. Dann greift er zum Telefon, um die Maschinerie in Gang zu setzen.
Erwin Raukel hat den Ausfall des Morgenmeetings ausgesprochen sinnvoll genutzt. Er hat sich in die Markthalle begeben, ein Fischbrötchen gegessen und das späte Frühstück mit einem Pils hinuntergespült. Nun ist er zurück in seinem Büro. Seinem eigenen Büro. Herrlich!
Gegen Ende von Oda Kristensens Sabbatjahr sind unter Völxens Leuten Wetten gelaufen, ob sie zurückkommen oder in Frankreich bleiben wird. Sie blieb bei den Froschfressern, wie Raukel zu sagen pflegt, und was er ehrlich bedauert, denn für ein Frauenzimmer war die Kristensen wirklich keine schlechte Ermittlerin. Sie war auch sonst ziemlich in Ordnung, doch, ja.
Nach seiner dreimonatigen Abwesenheit vom Dienst, aus Gründen, an die er nicht mehr gerne zurückdenkt, hatte Raukel gar nicht mehr damit gerechnet, das Büro leer vorzufinden. Aber weder Rifkin noch Tadden erhoben Ansprüche darauf. Wäre ja auch noch schöner, wenn man Alter und Dienstjahre bedenkt. Blieb Fernando Rodriguez, der zwar jünger ist als Raukel, aber er hat die meisten Jahre unter dem Schafstrottel auf dem Buckel. Doch das spanische Weichei störte sich angeblich an dem Geruch, den Odas Selbstgedrehte, die sie hier jahrelang qualmte, hinterlassen haben. In Wahrheit würde der geschwätzige Rodriguez in einem Einzelbüro eingehen wie eine Primel ohne Wasser. Also haben es sich die Russin, der Ostfriese und der Spanier nebenan gemütlich gemacht, und Hauptkommissar Erwin Raukel hat jetzt nicht nur das Büro, sondern obendrein noch einen großen Serranoschinken. Um den hat er nämlich mit Fernando gewettet, der überzeugt war, dass Oda wiederkommen würde.
Zugegeben, Odas olfaktorische Hinterlassenschaften stören auch ihn ein bisschen. Denn dass Raukel einen guten Riecher hat, gilt nicht nur im übertragenen Sinn, er ist ein Genussmensch, ein Feinschmecker, er besitzt empfindliche Sinnesorgane. Etwas frische Farbe würde vielleicht Abhilfe schaffen, aber zu dieser körperlichen Anstrengung konnte er sich dann doch noch nicht aufraffen. Er ist schließlich ein Mann von brillantem Geist, ein begnadeter Ermittler, kein Anstreicher. Geruch hin oder her, hier, in seinem kleinen Reich, steht er wenigstens nicht mehr unter Beobachtung. Deshalb öffnet er jetzt ungeniert die Schublade seines Schreibtisches, nimmt den Flachmann heraus und krönt das zurückliegende Mahl mit einem kleinen Verdauer, denn die Zwiebeln lassen ihn immer wieder aufstoßen. Der Kognak rinnt warm die Speiseröhre hinab und hat noch nicht ganz den Magen erreicht, als sein Telefon klingelt. Der Schafstrottel, höchstpersönlich und unpassend wie meistens.
Ende der Leseprobe