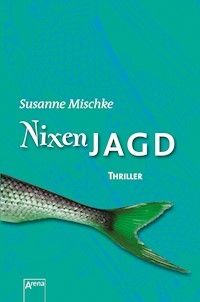9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein falsches Urteil, ein ungesühnter Mord und jede Menge Turbulenzen Endlich ist es so weit. Die Hochzeitsglocken läuten für Kommissarin Jule Wedekin und Fernando Rodriguez. Einzig Pfarrer Hector Santiago fehlt. Er liegt tot in seinem Wohnzimmer, erschlagen von einer Voodoo-Figur. Hauptkommissar Völxen schwant Böses: Hat der Mord an dem Priester mit dem dreizehn Jahre alten Mordfall an der fünzehnjährigen Kristina zu tun? Denn Pfarrer Santiago hat dem vermeintlichen Täter noch vor wenigen Tagen im Gefängnis die letzte Beichte abgenommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97794-4
August 2017
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Dragan Todorovic / Trevillion Images und Ollie Taylor / Trevillion Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Prolog
I. Samstag, 27. August
II. Drei Wochen zuvor ...
III.
IV.
V.
VI. Donnerstag, 18. August
VII.
VIII.
IX.
X. Montag, 22. August
XI. Dienstag, 23. August
XII. 27. August, Jules und Fernandos Hochzeitstag
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
IX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI. Freitag, 23. September
Prolog
Aus der Ackerkrume steigt Bodennebel, der um ihre Beine streicht. Ein erster kühler Hauch nach einem brütend heißen Tag, doch sie nimmt es kaum wahr. Sie hastet weiter, immer entlang der Reifenspur, die ein Trecker schnurgerade durch das Maisfeld gezogen hat. Jetzt nur nicht stolpern! Erdklumpen und Steine bohren sich in die Sohlen ihrer Sneakers. Die Reitstiefel wären jetzt besser, aber die klemmen im Gepäckträger ihres Fahrrads, und das liegt irgendwo im Graben.
Als sie ihn plötzlich vor sich sah, er immer näher kam und sogar ihren Namen rief, ist sie in Panik geraten, hat das Rad hingeworfen und ist in das Maisfeld gerannt. Es schien ihr eine gute Idee zu sein. Inzwischen ist sie sich da nicht mehr so sicher.
Sie wird langsamer, bleibt schließlich stehen. Sie kann nicht mehr, es geht einfach nicht. Ihre Lungen brennen, ihr Herz hämmert gegen ihren Brustkorb, und in ihrem Kopf sirrt es wie von einem elektrischen Draht. Sie lauscht, darauf gefasst, jeden Moment seine Schritte zu hören oder seine Stimme, die nach ihr ruft. Aber da sind nur ihr keuchender Atem, das Wispern der Maisblätter und das Rauschen des fernen Verkehrs auf der Autobahn. Jetzt erst nimmt sie den Geruch wahr: nach Erde und einem scharfen Düngemittel. Sie sieht auf. Auf beiden Seiten der Schneise stehen die Stauden Spalier, wie Speere ragen sie in den blassrosa Abendhimmel, höher als sie selbst.
Sie sollte, so schnell es geht, von hier verschwinden. Wenn er ihr nachläuft, wird auch er diesen Reifenspuren folgen. Oder aber er wartet am anderen Ende des Feldes. Dennoch zögert sie, sich seitwärts zwischen die eng stehenden Stauden zu schlagen. Dort, im Dunkel der hohen Pflanzen, kann alles Mögliche sein. Wildschweine vor allen Dingen. Aber ihr ist klar, dass sie die Schneise verlassen muss. Sie versucht, ihre Panik zu verdrängen, und schlüpft innerlich widerstrebend zwischen zwei Stauden hindurch.
Immer weiter arbeitet sie sich voran, tiefer hinein in den Maisdschungel, wo jetzt kaum noch Licht hinfällt. Es hat lange nicht geregnet, die Erde ist rissig und trocken, doch so sinkt sie wenigstens nicht ein, während sie planlos durch die Reihen taumelt. Längst hat sie die Orientierung verloren. Blätter peitschen gegen ihre vorgestreckten Unterarme. Etwas raschelt vor ihr. Dann, plötzlich, erhebt sich ein Schatten. Sie schreit erschrocken auf und presst sofort ihre Hand vor den Mund, als könnte sie dadurch den Schrei wieder einfangen. Ein Vogel, es ist nur ein Vogel, der mit klatschendem Flügelschlag wegfliegt und sich wahrscheinlich genauso erschreckt hat wie sie. Hoffentlich hat sie sich jetzt nicht verraten. Was, wenn er am Rand des Feldes steht und wartet? Vielleicht kann er die Bewegung der Stauden sehen, wenn sie hindurchkriecht. Der Gedanke lässt sie abrupt innehalten. Ein tiefes Schluchzen bricht sich Bahn, sie schluckt es im letzten Moment hinunter. Sie muss sich langsamer und vorsichtiger vorwärtsbewegen. Oder am besten gar nicht mehr.
Bald, spätestens in einer halben Stunde, wird die Sonne untergegangen sein. Dann kann er nichts mehr sehen, keine Bewegung im Feld. Ja, sie muss die Dunkelheit einfach nur abwarten, um sich aus der Deckung zu wagen. Und dann: weglaufen. Nach Hause, oder besser zurück zum Hof. Dorthin, wo Menschen sind. So lange muss sie hier ausharren, einfach nur still sein und warten. Kräfte sammeln. Ihr Atem verlangsamt sich, die Stiche in der Lunge lassen nach. Sie zittert. Eben schwitzte sie noch, jetzt ist ihr kalt. Sie geht in die Hocke, kauert sich wie ein Embryo zusammen und sagt sich immer wieder:Die Dunkelheit ist mein Freund. Die Dunkelheit ist mein Freund.
Und wenn er genauso denkt? Wenn er wie sie durch dieses Feld schleicht, ungesehen und leise wie ein Tier? Was, wenn er eine Taschenlampe dabeihat? Sie unterdrückt ein verängstigtes Wimmern, indem sie sich in die Hand beißt. Nein, sie darf nicht zu lange hierbleiben, sonst wird der Schutz zur Falle.
Ein dumpfes Grollen lässt sie zusammenzucken. Ein Gewitter? Nicht möglich, der Himmel war eben noch vollkommen klar. Ein Mähdrescher? Die arbeiten ja Tag und Nacht.
Jetzt sieht sie über sich Lichter blinken. Es ist ein Flugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Hannover-Langenhagen. Wie gerne säße sie jetzt da drin. An jedem Ort der Welt wäre sie lieber als hier, in diesem Maisfeld. Sie wartet, bis der Motorenlärm verklungen ist.
Inzwischen ist der Drang, dieser Lage zu entkommen, übermächtig. Langsam steht sie auf, ermahnt sich, vorsichtig und lautlos zu gehen, aber ohne es zu wollen, wird sie immer schneller. Sie erreicht wieder eine Treckerschneise und folgt den Furchen mit dem groben Reifenprofil. Wenn sie erst einmal aus diesem Feld raus ist, dann wird sie sich schon zurechtfinden.
Da! Da vorn ist der Mais zu Ende, endlich! Kann es sein, dass das die Landstraße ist? Dann könnte sie ja vielleicht sogar ihr Rad wiederfinden, das sie neben dem Feldweg hingeworfen hat, der von der Straße abzweigt. Sie könnte direkt nach Hause fahren und so tun, als hätte es diesen Zwischenfall nie gegeben. Sie zwingt sich, anzuhalten, ehe sie die letzte Staudenreihe hinter sich lässt. Ein Blick zum Himmel. Ein dunkles Blaugrau, das in ein dunstiges Rosa übergeht, mit einem orangefarben glimmenden Streifen im Westen. Sie horcht. Alles ist still. Noch ein Schritt. Ganz vorsichtig lugt sie zwischen den Pflanzen hervor. Nichts zu sehen, also wagt sie sich aus dem Maisfeld heraus. Sie überwindet den flachen Straßengraben. Auf der Straße stehend sieht sie sich erneut um. Zwei Lichter tauchen auf. Das Auto ist noch ein ganzes Stück weit weg. Sollte sie es anhalten oder sich lieber verstecken? Hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Panik steht sie einfach nur regungslos da, wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Die Lichtstrahlen erfassen ihre Gestalt. Bremsen quietschen.Die Tür des Wagens wird geöffnet, und jemand ruft ihren Namen. Diese Stimme ... Die kennt sie doch! Wie kann das sein? Ihr Herz beginnt schon wieder wie wild zu klopfen, und endlich kommt Bewegung in ihre Gestalt. Sie streicht sich das wirre Haar aus dem Gesicht und geht auf den Wagen zu.
I.
Samstag, 27. August
Das Wetter meint es gut mit ihnen, und für Ende August besitzt die Sonne noch viel Kraft. Die weißen Anemonen auf der Kühlerhaube lassen jedenfalls schon die Köpfe hängen. Bis wir aus der Kirche kommen, befürchtet Jule, wird das Blumenbukett aussehen wie welker Salat.
»Was haben wir für ein Glück mit dem Wetter!«, freut sich Brigitta, während sie den Mercedes vor der Kirche anhält.
Jule nickt und lächelt. Sie ist ihrer Stiefmutter dankbar dafür, dass sie Mäxchen heute woanders untergebracht hat. In ihren Albträumen hat der Kleine die gesamte Trauungszeremonie zerquäkt.
»Da wären wir«, stellt der Professor fest.
Höchste Zeit. Es ist zehn vor drei, Fernando wird schon nervös sein, ganz zu schweigen von Pedra. Die ist seit Wochen ein einziges Nervenbündel, gerade so, als befürchte sie, dass Jule, das Schicksal, Gott oder der Teufel ihr doch noch einen Strich durch die Rechnung machen und die lang herbeigesehnte Heirat ihres Sohnes verhindern wird. Dabei könnte sie ganz beruhigt sein, denn Fernando Rodriguez und Alexa Julia Wedekin sind schließlich bereits seit gestern vor dem Gesetz ein Ehepaar. Aber die Eheschließung vor der Standesbeamtin im Alten Rathaus zählt für Pedra Rodriguez nicht wirklich – Gesetz hin oder her. Richtig verheiratet ist man ihrer Meinung nach erst, nachdem man sich das Jawort vor dem Altar gegeben hat, in Gegenwart eines Priesters.
Die Hochzeitsgesellschaft hat sich vor St. Benno in Linden versammelt, alles scheint nur noch auf die Braut zu warten. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen, denkt Jule. Es sei denn, sie erleidet vor dem Altar einen Ohnmachtsanfall, was durchaus möglich wäre in diesem eng auf Taille geschnittenen Kleid.
Aber zunächst müssen erst einmal die Stoffmassen irgendwie heil aus dem Auto raus. Mit der linken Hand versucht sie, das Kleid zusammenzuraffen, die Rechte reicht sie ihrem Vater, der sie am Ellbogen aus dem Wageninneren heraushebt, wobei ihm ein unterdrückter Schmerzenslaut entfährt. Vorgestern hat sich der Professor beim Abschlag mit dem Driver einen Hexenschuss zugezogen, seither hält er sich mit Schmerzmitteln über Wasser.
Jule hingegen, ganz auf ihr Kleid fixiert, hat nicht an ihr hochgestecktes Haar gedacht. Der Turm streift beim Aussteigen den Türholm, und eine Haarnadel bohrt sich in ihre Kopfhaut.
»Au, verdammt!«
»Du sagst es«, ächzt ihr Vater.
Das hätte man üben sollen, erkennt Jule: elegantes Verlassen einer Limousine mit voluminösem Brautkleid und Marge-Simpson-Frisur.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie ihr Haar offen getragen wie sonst auch, aber ihr Friseur meinte, zum Brautkleid müsse sie eine Hochsteckfrisur tragen, da gebe es gar keine Diskussion. Jules Einwand, sie würde damit ihren Bräutigam überragen, wischte der selbst nicht gerade hünenhaft geratene neapolitanische Figaro einfach weg, mit dem Hinweis, auf solche Feinheiten könne man keine Rücksicht nehmen, basta.
Da muss Fernando jetzt eben durch. Schließlich ist es seine Mutter, der zuliebe man dieses Tamtam veranstaltet: katholische kirchliche Trauung mit allem Drumherum. Hätte man Jule so etwas vor einem Jahr erzählt ... Auch Jules Vater, Professor Jost Wedekin, musste erst einmal schlucken, als er davon erfahren hat. Inzwischen hat Jule jedoch Geschmack an der Sache gefunden, und jetzt, da sie die Kirchenglocken läuten hört, wird sie von einer freudigen Erregung ergriffen. Es ist ihre Hochzeit, ihr großer Tag. Ob es der sprichwörtlich schönste Tag ihres Lebens werden wird, bleibt abzuwarten, aber auf jeden Fall wird sie den Gang zum Altar und die feierliche Zeremonie in vollen Zügen genießen. Das Leben ist im vergangenen Jahr hart genug mit ihr umgesprungen. Es wird ihr kein Zacken aus der Krone brechen, wenn sie sich ausnahmsweise mal eine gehörige Portion Romantik gönnt. Außerdem ist sie schon gespannt auf die Predigt von Hochwürden Hector Santiago. Hoffentlich wird seine Ansprache nicht zu vertraulich und persönlich. Sie hat dem Pfarrer nämlich viel zu viel von sich erzählt. Santiago ist der Typ, der Menschen zum Reden bringt, und Jule ist ihm nur allzu bereitwillig auf den Leim gegangen. Man sollte ihn vielleicht in Zukunft zum Verhören von Zeugen und Verdächtigen anheuern.
»Warte, dein Haar ...«
Jule bleibt stehen, während Brigitta an ihrer Frisur herumnestelt.
»So, jetzt kannst du heiraten«, lächelt ihre Stiefmutter.
Der Schmerz kommt wie so oft ohne Vorwarnung. Sie muss daran denken, dass eigentlich ihre Mutter neben ihr stehen und ihr die Haare richten sollte.
Tief durchatmen. Jetzt bloß keine Tränen, sonst ist das Make-up schon vor der Trauung ruiniert!
»Alles in Ordnung, Liebes?« Professor Jost Wedekin ruckelt an seiner Fliege, während er seine Tochter prüfend mustert. Er sieht prächtig aus in seinem Smoking. Ein wenig overdressed vielleicht, aber der alte Silberlöwe macht noch immer etwas her.
»Alles bestens.«
»Du siehst wunderschön aus.« Er lächelt ihr strahlend zu. »Nervös?«, fragt er.
»Ein bisschen.«
»Das wird schon. Ich bin ja da.«
Brigitta reicht ihr den Brautstrauß, den Jule glatt im Auto vergessen hätte.
»Danke!« Sie hakt sich bei ihrem Vater unter, und dann gehen sie gemessenen Schrittes auf die Hochzeitsgäste zu. Die Kollegen sind alle gekommen. Und wie verkleidet sie alle aussehen! Völxen muss sich ihr zu Ehren doch noch einen neuen Anzug gekauft haben, denn es ist nicht das gute Stück, das er zu Beerdigungen von Mordopfern zu tragen pflegt. Das Jackett sitzt locker um die kompakte Körpermitte, und die Hose hat keine einzige Sitzfalte, gerade so, als hätte man ihren Chef stehend hierher transportiert. Neben ihm steht Sabine Völxen im himmelblauen Leinenkostüm und mit einem farbenfrohen Halstuch. Jule fragt sich, ob Fernando und sie auch einmal ein so harmonisches Paar abgeben werden wie diese beiden. Frau Cebulla, die Sekretärin des Dezernats, hat ihre Birkenstocks gegen elegante Pumps getauscht und sich in ein marineblaues Kostüm geworfen, das sie gleich zwei Kleidergrößen schlanker aussehen lässt. Du lieber Himmel, ist das da drüben Oda? Oda Kristensen, die man im Dienst nur in Schwarz kennt, trägt ein tief dekolletiertes champagnerfarbenes Seidenkleid und dazu rote, hochhackige Schuhe. Ihr hellblondes Haar, normalerweise streng geknotet, wallt in großen, lockeren Wellen um ihre Schultern. Und als wäre das noch nicht genug, ist ihr Begleiter, Tian Tang, in seinem taubengrauen Seidenanzug geradezu ein Paradebeispiel schlichter Eleganz. Aber auch Dr. Bächle, Odas heimlicher Verehrer, sieht ausgesprochen schick aus im Nadelgestreiften. Vermutlich ein Maßanzug, denn Jule bezweifelt, ob es Anzüge von der Stange für Männer seiner Größe gibt. Wobei Größe hier auch wieder das falsche Wort ist. Ach, und dahinten ist ja auch Erwin Raukel. Ein Friseur, dem man gar nicht dankbar genug sein kann, scheint Raukel überredet zu haben, sein Resthaar kurz abzurasieren, anstatt wie sonst die pomadigen Strähnen über die Glatze zu kämmen. Der dunkle Anzug kleidet auch ihn halbwegs vorteilhaft, nur die Hose dürfte einen Tick länger sein. Was hat er da an den Füßen, sind das etwa Lackschuhe? Bleibt nur zu hoffen, dass Raukel sich nachher auf dem Schiff nicht zu schnell betrinken und vor allen Dingen nicht allzu sehr danebenbenehmen wird. Gerade starrt er auf die Beine einer Dunkelhaarigen ... aber das, das ist doch ... Rifkin! Rifkin trägt ein Kleid! Und was für eines! Es ist flatterig und reichlich kurz und – rosa. Du lieber Himmel, wo hat sie das nur her? Immerhin können sich Rifkins schlanke, durchtrainierte Beine wirklich sehen lassen. Ob Fernando das auch schon bemerkt hat?
Etwas abseits, im Schatten der Kirchenmauer, glucken die spanischen Verwandten zusammen wie Vampire, die die Sonne fürchten. Warum nur müssen sie alle Schwarz tragen? Es ist doch keine Beerdigung. Einzig Pedra Rodriguez trägt den weiten, roten Rock, den Jule mit ihr zusammen ausgesucht hat und der jetzt um ihre kleine Gestalt flattert, als sie mit energischen Schritten auf die Braut zueilt. Fernando, der seiner Mutter gefolgt ist, hebt Arme und Schultern, was vermutlich heißen soll: Wo bleibt ihr denn so lange? Bestimmt hat Pedra ihm während der vergangenen Minuten die Hölle heißgemacht.
»Ja, ich weiß, wir sind spät dran. Tut uns leid, der Verkehr ...«, schwindelt Jule.
In Wirklichkeit haben ihr Vater und Brigitta Jule schon zu spät vom Friseur abgeholt. Woran dies wiederum lag, war nicht herauszufinden. Während der Fahrt hierher schob einer die Schuld auf den anderen, wobei Jule den Verdacht hat, dass ihr Vater sich vertrödelt hat, denn so war es schon immer mit ihm gewesen.
»Wenigstens ist die Braut jetzt da«, bemerkt Fernando und lächelt. »Du siehst ... umwerfend aus!«
»Du auch«, entgegnet Jule strahlend.
Ja, es stimmt. Eine vierstellige Summe in den Anzug zu investieren hat sich gelohnt, der edle Stoff fließt elegant an Fernando herab und unterstreicht seine geschmeidigen Bewegungen, die Jule schon immer an ihm gemocht hat. Mit dem Duftwässerchen hat er es wieder einmal übertrieben, das bemerkt Jule, als er sie vorsichtig auf die Wange küsst, aber zum Glück ist es die Edelmarke, die sie ihm geschenkt hat.
»Was heißt hier wenigstens die Braut?«, spielt Jule die Eingeschnappte. »Ich dachte, ich wäre heute die Hauptperson.«
»Das ist schon wahr«, knurrt Fernando. »Aber dieser verdammte ...«
»Fernando! Wie kannst du hier vor der Kirche fluchen?«, fährt Pedra ihren Sohn an und bekreuzigt sich voller Hast.
»Ich würde auch lieber in der Kirche fluchen«, entgegnet Fernando, und für einen, der gleich mit der Frau seiner Träume vor den Altar treten wird, sieht er ziemlich miesepetrig aus.
Ein ungutes Gefühl beschleicht Jule. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wieso stehen sie alle vor der Kirche und starren sie so seltsam an? Okay, sie ist die Braut, die Hauptperson, aber trotzdem ... Für ein paar Sekunden befindet sich Jule plötzlich wieder im Garten ihres Elternhauses, am Morgen jenes heißen Julitages. Sie rennt über den taufeuchten Rasen, vorbei an Männern in Schutzanzügen, an Flatterband, Stativen, Nummernschildchen, und alle, die auf der Terrasse um den Transportsarg der Rechtsmedizin herumstehen, sehen sie genauso erschrocken an wie jetzt ...
»Da ist ja die Braut!«, ruft irgendwer, und Jule wird zurück ins Hier und Jetzt katapultiert. Sie ringt nach Luft, lächelt automatisch und rollt mit den Schultern, um die Erinnerung abzuschütteln. Nein, die Gespenster haben heute Pause, heute ist ihre Hochzeit, ein glücklicher Tag. Als Nächstes hört sie Pedra rufen: »Es ist zum Verrücktwerden, Pfarrer Santiago ist immer noch nicht da!«
Jule schaut Fernando erschrocken an. »Wie, nicht da? Ist er unterwegs, steht er im Stau?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, gesteht Fernando und flüstert: »Er geht nicht ans Telefon, Völxen hat schon eine Streife hingeschickt.«
»Das darf doch nicht wahr sein«, stöhnt Professor Wedekin gequält und sieht die Umstehenden einschließlich Jule so vorwurfsvoll an, als hätten sie diesen Schlamassel angezettelt, einzig und allein, um ihm den Tag zu verderben.
Jule sieht das Unheil auf sich zurollen wie eine Welle am Horizont. Auf der Suche nach einem Rettungsanker begegnet ihr Blick dem von Völxen. Aber auch der hat nur eine hilflose Geste für sie parat.
Das Gedankenkarussell in Jules Kopf beginnt sich zu drehen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Hat er womöglich das Datum verwechselt oder den Termin vergessen? Pfarrer Hector Santiago ist zwar schon im Pensionsalter, aber er machte auf Jule überhaupt keinen vergesslichen oder zerstreuten Eindruck, ganz im Gegenteil.
Nein, Santiago würde ihre Trauung nicht vergessen und erst recht nicht unentschuldigt fernbleiben, auf gar keinen Fall.
II.
Drei Wochen zuvor ...
Der Totenkopf grinst mit riesigen Zähnen, deren grünliches Weiß das Dämmerlicht reflektiert. Jule weicht erschrocken zurück und wendet den Blick ab, aber er fällt nur auf weitere Gesichter mit dämonischen Grimassen. Das ganze Zimmer ist bevölkert von exotischen Kultwesen aus Stein, Holz und – ja, Knochen, eindeutig. Da ist eine Statue mit sieben Köpfen, ein Gehörnter mit drei Augen und ein Krieger mit einem Speer, auf dessen Schultern ein Totenkopf sitzt, der verdammt echt aussieht. Neben ihm steht eine rosa bemalte Frauenfigur, und obwohl nur aufgemalt, wirken die Augen der Statue im Dämmerlicht, das durch die geschlossenen Jalousien fällt, irgendwie ... lebendig.
Jule läuft ein Schauder den Rücken hinunter.
»Erzulie, la déesse de l’amour et la fertilité«, hört sie dicht an ihrem Ohr eine Stimme in einem verwaschenen Französisch sagen. Jule fährt erschrocken herum. Pfarrer Hector Santiago ist lautlos neben sie getreten. Der Geistliche hat sie in Leinenhose, einem Hawaiihemd und barfüßig empfangen.
»Darf ich vorstellen: Erzulie, Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und der Romantik.«
»Dafür schaut sie aber ziemlich böse.«
»Ich nenne es maliziös. Aber es stimmt schon. Sie kann auch Schaden anrichten, wenn sie schlechte Laune hat.« Er lacht über Jules verblüffte Miene. »Sie müssen wissen, es gibt im Voodoo kein reines Gut oder Böse. Jedes dieser Wesen hier hat mehrere Seiten und Launen, so wie wir Menschen auch.«
»Verstehe«, sagt Jule. »Ist sie wertvoll?« Lieber Himmel, ich bin in die Fänge eines Irren geraten!
»Ja, möglich. Sie ist ein Original, vor mehr als zweihundert Jahren kam sie mit einem Sklavenschiff von Guinea nach Haiti. Aber ihr spiritueller Wert ist unschätzbar.«
»Sie sehen alle ziemlich furchterregend aus.«
»Kein Wunder. All diese Kultfiguren und Masken stehen für die kollektive Erinnerung an die Gräuel der Sklaverei.« Er geht zurück in die Küche. Jule hört einen Korken ploppen und kurz darauf Santiagos Stimme: »Möchten Sie auch ein Glas Wein?«
Am liebsten gleich zwei, aber sie besinnt sich auf ihre guten Vorsätze und außerdem ist sie mit dem Auto hier, also bittet sie um Wasser.
Er kommt zurück und deutet mit der Weinflasche nach draußen. »Wollen wir uns auf die Terrasse setzen? Es ist so ein schöner Sommerabend.«
Jule hätte sich auch bei strömendem Regen lieber rausgesetzt. Nur nicht hier drin bleiben, zwischen diesen furchterregenden Fratzen. Die Wohnungseinrichtung eines katholischen Priesters hat sie sich wirklich ein bisschen anders vorgestellt.
»Es tut mir leid, dass Fernando nicht pünktlich hier sein kann.« Jule hat an dem runden Tisch Platz genommen, dessen Platte aus kleinen Mosaikfliesen zusammengesetzt ist. Es fällt ihr nicht leicht, ihren Ärger zu verbergen. Vor ein paar Minuten hatte Fernando sie angerufen. Er sei zu einem Einsatz gerufen worden. Unfall mit Verdacht auf Fremdeinwirkung an einer Baustelle. Und nein, natürlich könne er nicht sagen, wie lange das dauert.
»So etwas passiert gerne kurz vor Dienstschluss, und immer dann, wenn man etwas Wichtiges vorhat.«
»Wir sollten den Tod eines Menschen dennoch nicht als lästiges Übel betrachten«, mahnt Hector Santiago.
Fernando hat nichts über den Zustand des Unfallopfers gesagt, aber wenn man für die Mordkommission arbeitet, wie ihr Dezernat für Tötungsdelikte im Volksmund genannt wird, gehen die Leute automatisch immer gleich vom Schlimmsten aus.
»Auch wenn solche Ereignisse für Sie natürlich zum Alltag gehören«, fügt der Pfarrer hinzu.
»Ja ... nein, natürlich, Sie haben recht.« Schon der erste Fauxpas, das läuft ja großartig.
»Wir sollten im Angesicht des Todes innehalten und uns über das Geschenk des Lebens freuen und über die vielen guten Dinge, die es für uns bereithält.« Santiago hebt das Weinglas mit dem purpurn funkelnden Rioja und nimmt einen ordentlichen Schluck.
Jule sieht ihm neidisch dabei zu. Fast glaubt sie, selbst den herben Geschmack des Rioja am Gaumen zu schmecken.
»Ein kleines Bestechungsgeschenk von meiner zukünftigen Schwiegermutter«, hat sie gestanden, als sie dem Pfarrer die Flasche bei der Begrüßung überreicht hat. Der zeigte sich hocherfreut und machte sie auch gleich auf.
»Sollen wir den Termin lieber verschieben?«, fragt Jule.
Hector Santiago schüttelt den Kopf. Don Camillo, eindeutig. Dieses Pferdegesicht mit den langen Zähnen, die Jule an leicht vergilbte Klaviertasten erinnern, ähnelt auf frappierende Weise dem Antlitz von Fernandel, dem Darsteller des Don Camillo in der Uralt-Serie Don Camillo und Peppone. Besonders jetzt, als Hochwürden Santiago schelmisch lächelt. »Im Grunde ist es mir ganz recht, dass wir beide uns erst einmal alleine unterhalten.«
Jule wird mulmig. Klar, Fernando ist fein raus, er kennt den Pfarrer von früher und er hat den Katholikenbonus. Wie will Santiago wohl herausfinden, ob Alexa Julia Wedekin, die Feiertags-Protestantin mit Neigung zum Atheismus, für eine katholische Trauung infrage kommt? Sollte sie zugeben, dass sie schon jahrelang keine Kirche mehr von innen gesehen hat?
Wie es die Vorschrift will, hat Santiago die Brautleute zum Traugespräch zu sich nach Hause gebeten, nach Dedensen, einem dörflich geprägten Ortsteil der kleinen Stadt Seelze, die vor den Toren Hannovers liegt. »Es gibt hier eine wunderschöne gotische Kirche, die sollten Sie sich unbedingt ansehen«, hat er Jule am Telefon empfohlen. »Sie heißt Hase-Kirche nach ihrem Erbauer.«
»Wenn sie so schön ist, könnten wir ja auch dort heiraten.«
»Leider gehört sie der Konkurrenz wie die meisten schönen Sakralbauten hierzulande«, hat Santiago bedauert.
Der Pfarrer bewohnt seit ein paar Monaten das Haus, das sich seine Eltern als Altersruhesitz gekauft hatten: ein gut hundert Jahre altes Backsteinhaus mit Fachwerk und hohen Decken. Das Highlight aber ist der Garten. Er ist im Stil eines traditionellen Bauerngartens angelegt, die Beete, in denen es kunterbunt blüht, sind eingerahmt von kleinen Buchsbäumchen oder niedrigen Natursteinmauern. Aus einem alten Mühlstein plätschert Wasser in einen steinernen Trog. Ein Idyll wie aus einem dieser Landmagazine.
Sie hat gehofft, dass Fernando den größten Teil dieses Gesprächs bestreiten würde, aber jetzt sitzt sie allein hier, auf der weinumrankten Terrasse, und hat keine Ahnung, was der Mann von ihr hören will.
Santiago scheint zu ahnen, was in Jule vorgeht. »Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das hier wird keine Prüfung.«
»Gut«, sagt Jule, kein bisschen beruhigt.
»Fernando Rodriguez ...« Santiago atmet schwer. »Er war ein fürchterlicher Schlingel.«
»Das höre ich öfter.«
»Mein größter Fehler war, ihn Ministrant werden zu lassen.«
Jule traut ihren Ohren nicht. »Fernando war Ministrant?!«
»Ja, und zwar der schlimmste, den ich je hatte!« Santiagos Faust donnert auf den Steintisch. »Und das will etwas heißen, Linden war schon damals keine einfache Gemeinde.«
Jule versucht, sich Fernando als Jungen in der langen Kutte eines Ministranten vorzustellen. Stand er mit artig gesenktem Blick neben dem Altar und schwenkte den Weihrauchkessel? »Bitte erzählen Sie!« Sie beugt sich über den Tisch, um sich kein Wort entgehen zu lassen.
»Natürlich war Fernando nicht der erste Ministrant, der sich am Messwein vergriffen hat. Wenn er ihn nur wenigstens durch Traubensaft oder meinetwegen durch irgendeinen billigen Fusel ersetzt hätte ... Doch dieser vermaledeite Rotzlöffel ... verzeihen Sie mir, aber Sie können es sich vielleicht vorstellen, wie man reagiert, wenn man bei der Eucharistiefeier vor seiner Gemeinde steht, den Kelch an die Lippen setzt und plötzlich den Mund voller Balsamico hat.« Santiago seufzt und schüttelt den Kopf. »Zur Rede gestellt, meinte er, er habe sich gedacht, dass der Essig mich an unseren Herrn Jesus erinnern soll, der ja auch von seinen Peinigern Essig zu trinken bekam, als er am Kreuz von Golgatha hing. Ich muss zugeben, als ich das hörte, war ich einen Moment lang sprachlos.«
Jule kann das Lachen nicht mehr zurückhalten. Die Sache mit dem Messwein wundert sie kein bisschen. Garantiert hat er sich auch am Klingelbeutel vergriffen.
Santiago lächelt mild. »Lässliche Jugendsünden, längst verziehen und vergessen. Er hat einen guten Charakter, das habe ich immer gewusst. Wann haben Sie beide sich kennengelernt?«
»Vor ungefähr acht Jahren, als ich meinen Dienst im Dezernat für Tötungsdelikte antrat«, antwortet Jule, die inzwischen ein wenig aufgetaut ist. »Gleich am ersten Tag hat er mich in den Laden seiner Mutter geschleppt. Ich mochte Pedra von Anfang an. Sie war so laut und so resolut und dabei so liebevoll – ganz anders als meine Mutter. Bei Fernando hat es länger gedauert. Ich hielt ihn anfangs für ein Macho-Muttersöhnchen. Was er auch war. Aber inzwischen ...« Sie gerät ins Stocken. »Fernando und Pedra sind jetzt meine Familie. Natürlich habe ich auch noch meinen Vater, aber er ist immer sehr beschäftigt, und außerdem hat er seine junge Frau und den gemeinsamen Sohn ...«
»Ihren Halbbruder.«
»Meinen Halbbruder, ja.« Jule verscheucht eine Wespe.
»Jule, ich darf Sie doch so nennen? Sie haben ein sehr schweres Jahr hinter sich.«
Sie nickt.
Santiago schwenkt sein halbvolles Weinglas in der Hand und scheint darauf zu warten, dass Jule redet. Schweigen, ein alter Verhörtrick. Die meisten Leute halten die Stille nicht aus. Jule schon, und schließlich ist es Santiago, der fragt: »Wann haben Sie beschlossen, die Frau von Fernando Rodriguez zu werden?«
»Nach dem Tod meiner Mutter. Mir ist dadurch klar geworden, wie rasch alles vorbei sein kann, und ich fühlte mich so ... entwurzelt. Obwohl ich schon lang nicht mehr bei meiner Mutter gewohnt habe und wir auch nie ein besonders herzliches Verhältnis hatten. Aber als sie dann tot war und aus meinem Elternhaus ein Tatort wurde, habe ich begonnen, über manche Dinge nachzudenken. Ich wollte wissen, wo ich hingehöre. Also sind Fernando und ich nach Sevilla gereist, zu seinen Verwandten. Dort haben wir uns verlobt, so richtig schön altmodisch.« Sie lächelt und hält die Hand über den Tisch. Die Abendsonne lässt den kleinen Diamanten an ihrem Ringfinger aufblitzen. »Ich bin sonst nicht der romantische Typ«, gesteht Jule. »Aber ich wollte all dem Schrecklichen etwas Schönes entgegensetzen.«
»Das verstehe ich sehr gut«, wirft Santiago ein.
»Inzwischen habe ich mich wieder gefangen. Und ich will Fernando heiraten. Ich habe es mir gründlich überlegt und extra so lange gewartet.«
Santiago sieht sie eine Weile an, dann nickt er. »Ich kann gut nachfühlen, wie furchtbar das mit Ihrer Mutter für Sie gewesen sein muss.«
»Es hat mir den Boden weggezogen«, gesteht Jule. »Als ich angegriffen wurde und danach verletzt im Krankenhaus lag, wollte ich sogar den Dienst quittieren. Aber mein Chef, Hauptkommissar Völxen, hatte mir das Versprechen abgerungen, mich erst einmal ein halbes Jahr lang beurlauben zu lassen. Ich sollte nichts überstürzen. Er kennt mich wohl besser als ich mich selbst.«
»Hauptkommissar Völxen ist Ihr Chef?«, fragt Santiago verwundert.
»Ja. Kennen Sie ihn?«
»Nach der Jahrtausendwende war ich einige Jahre als Gefängnisseelsorger tätig. Damals haben sich unsere Wege gekreuzt.« Er nimmt einen gehörigen Schluck Wein und fragt: »Stört es Sie, wenn ich rauche?«
»Nein, nur zu.«
Der Pfarrer verschwindet im Haus.
Jule lässt den Blick schweifen. Im hinteren Teil des Gartens rankt sich eine Rose mit purpurrosa Blüten über einen eisernen Pavillon. Schilf wächst um einen kleinen Teich und raschelt im Wind.
So ein Haus mit so einem Garten müsste es sein – nur ein bisschen näher an der Stadt.
Santiago kommt mit einer Zigarre wieder. »Das ist eine Flor de Selva«, erklärt er. »Auf Deutsch Waldblüte, und so schmeckt sie auch: fruchtig und holzig. Kommt aus Honduras und ist milder als die kubanischen. So, nun kennen Sie also schon meine Laster. Rotwein und Zigarren. Allerdings habe ich zwischenzeitlich gelernt, Maß zu halten. Das war nicht immer so.«
Jule wird flammend rot. Weiß er etwa Bescheid? – Quatsch, nein, woher denn? Fernando und Pedra würden doch nie über solche ... Vorkommnisse mit dem Pfarrer reden. Ich bilde mir was ein. Wahrscheinlich will Santiago lediglich andeuten, dass auch so mancher Pfarrer weltlichen Genüssen nicht abgeneigt ist. Doch zum Glück scheint ihr Gastgeber kein Interesse an der Vertiefung des Themas zu haben. Mit einer kleinen Guillotine schneidet er das Mundstück der Zigarre ab, zündet sie an, und als die ersten duftenden Rauchwolken über den Rasen hinwegziehen, sagt er: »Sie sind aber noch immer bei der Polizei. Was hat Sie dazu gebracht, Ihre Meinung zu ändern?«
»Ganz simpel: Ich wurde wieder gesund.«
Santiago nickt mit einem wissenden Gesichtsausdruck.
»Ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich immer gerne Polizistin war«, erzählt Jule. »Es war mein Kindheitstraum. Andere wollten Tierärztin werden oder Model, ich wollte Mörder fangen. Und außerdem ...«
»Ja?«
»Im letzten Herbst sind so viele Dinge passiert. In der Welt und sogar bei uns. Da wird in Hannover das Fußball-Länderspiel wegen Terrorgefahr abgesagt, eine Fünfzehnjährige mit Kontakten zum IS sticht einen Polizisten am Bahnhof nieder ... Da habe ich begriffen, dass die Welt eine andere geworden ist, als sie es noch vor ein oder zwei Jahren war, und ich sagte mir: Du kannst dich doch nicht jetzt aus dem Staub machen, wo man gute Polizisten dringend braucht. Und ich war ... ich bin eine gute Polizistin. Also bin ich geblieben.«
»Ist es anders als vor dem Mord an Ihrer Mutter und dem Überfall auf Sie?«, will Santiago wissen.
»Ich weiß jetzt, dass ich verletzlich bin. Eigentlich wusste ich das vorher auch schon, aber es ist etwas anderes, wenn man selbst einen solchen Schicksalsschlag erlebt hat. Momentan mache ich Innendienst, Völxen besteht darauf.« Sie lacht kurz auf. »Er will nicht, dass ich Leichen zu sehen bekomme. Klingt langweilig, ich weiß. Aber es macht mir nichts aus. Ich bin gut im Aktenwälzen, ich mag es, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Bei nächster Gelegenheit werde ich das Dezernat wechseln, damit Fernando und ich uns nicht im Dienst ins Gehege kommen.«
Der Pfarrer quittiert Jules Rede mit einem Lächeln. »Wenn man durch Gewalt verletzt wird, ist das ein gewaltiger Schock für Körper und Geist«, bestätigt er. »Auch ich habe das erfahren, als ich nach dem schweren Erdbeben von 2010 auf Haiti verletzt wurde. Nicht durch das Beben, sondern weil ich den Helden spielen und mich einem Plünderer entgegenstellen wollte, der ein Messer dabeihatte. Danach fragte ich mich: Was mache ich eigentlich hier? Was kann ich schon ausrichten in einem Land, das immer wieder von Katastrophen aller Art heimgesucht wird, das zu den ärmsten der Welt gehört und in dem Hilfsgelder im Sumpf der Korruption versickern? Was nützt es da, wenn man ein paar Brunnen bohrt und ein paar Kinder unterrichtet?«
»Aber Sie haben es auch nicht hingeschmissen.«
»Weil ich gebraucht wurde, genau wie Sie. Unsere Missionsschule und das Kinderheim wurden nach der Katastrophe wichtiger denn je, denn wo sollten die Kinder denn hin? Etliche hatten ihre Eltern verloren, viele Familien waren obdachlos geworden. Die Schule war ein Rettungsanker und gab ihnen ein Stück Normalität zurück. Und ganz ähnlich wie Sie erhielt auch ich noch einen äußeren Ansporn, etwas, das mich in einen heiligen Zorn versetzte, wenn Sie so wollen.«
»Was war das?«, fragt Jule neugierig.
»Nach dem Erdbeben führten Evangelikale aus Nordamerika aggressive Missionskampagnen durch, sie schreckten nicht einmal vor nackter Gewalt zurück. Sie griffen Voodoo-Priester an, attackierten Versammlungen, es gab Brandstiftungen und Fälle von Lynchjustiz. Sie behaupteten, dass der Voodoo-Glaube die Schuld an der Katastrophe trage ...«
»So ein Blödsinn!«, wirft Jule ein.
»Diesen Eiferern wollte ich nicht kampflos das Feld überlassen.« Unbewusst streicht sich der Priester mit der linken Hand über seine rechte Faust.
Also doch ein Don Camillo!
Santiago leert sein Glas und schenkt sich noch einmal ein.
»Dabei haben sich der Katholizismus und die Voodoo-Religion hervorragend ergänzt und arrangiert. Die Haitianer verehrten die alten afrikanischen Voodoo-Götter in Gestalt der katholischen Heiligenfiguren. Der Kriegsgott Ogoun entspricht dem heiligen Jakob, Maria ist eigentlich die Liebesgöttin Erzulie und so fort. Dadurch konnte Voodoo die Kolonialzeit überleben, und heute ist er Staatsreligion neben dem Katholizismus. Offiziell sind drei Viertel der Leute katholisch, aber fast alle praktizieren Voodoo. Er ist überall, im Tanz, in der Musik, in der Kunst, im täglichen Leben und in der Sprache, dem Kreol. Aber jetzt suchen immer mehr junge Haitianer den Anschluss an Amerika. Sie lassen sich nicht mehr initiieren und gehen ins Ausland, dadurch verliert sich die Tradition. Die Kultobjekte, die ich besitze, habe ich Voodoo-Priestern abgekauft, die aufgegeben haben. Schon damit sie nicht diesen Fanatikern in die Hände fallen, die sie womöglich verbrennen würden. Die Skulpturen wurden den Göttern geweiht, das verlangt einen gewissen Respekt, finde ich. Aber eigentlich gehören sie ins Land, nicht hierher. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich sie zurückbringen kann.«
Jule blickt den Priester prüfend an und vergewissert sich: »Sie sind aber schon noch katholisch, oder? Ich meine, ich würde mich auch nach einer Voodoo-Zeremonie trauen lassen, aber ich fürchte, meine zukünftige Schwiegermutter würde ausflippen.«
Santiago legt den Kopf in den Nacken und gibt ein dröhnendes Lachen von sich. »Keine Sorge. Es wird ein durch und durch katholischer Traugottesdienst werden.«
Drinnen schrillt ein Telefon. Santiago, noch immer lachend, entschuldigt sich und eilt ins Haus.
Jule blinzelt in die tief stehende Sonne und horcht auf die gedämpfte Stimme des Pfarrers aus dem Wohnzimmer und die ländlichen Geräusche ihrer Umgebung. Hühner gackern, ein Rasenmäher schnurrt, vorn auf der Landstraße donnert ein Trecker vorbei. Er zieht ein Güllefass hinter sich her, was die Landluft gleich noch eine Prise würziger macht. Aus dem Nachbargarten tönen laute Stimmen. Du bist doch zu blöde zum Geradeausschauen!, hört sie einen Mann brüllen, eine Frau kreischt irgendetwas, dann hört man eine Tür zuschlagen. Offenbar wird der Disput im Haus fortgesetzt. Es wäre ja auch naiv, anzunehmen, die Leute wären hier friedlicher als in der Stadt.
Bisher, resümiert Jule, lief dieses Traugespräch ja ganz gut. Aber er wird sie bestimmt noch fragen, ob sie an Gott glaubt, wie oft sie in die Kirche geht, ob sie Kinder haben wollen und ob sie diese im christlichen Glauben erziehen werden.
Notfalls muss sie eben lügen, dass sich die Balken biegen, schon Pedra zuliebe.
Vor ein paar Wochen war Hector Santiago so leichtsinnig gewesen, beim Besuch in seiner ehemaligen Pfarrgemeinde auch Pedras spanischen Lebensmittelladen zu betreten, um dort Wein und Serranoschinken zu kaufen. Entzückt über das Wiedersehen nach über dreißig Jahren bestürmte sie den Pfarrer, ihren Sohn und seine Zukünftige zu trauen. Santiago ließ sich nicht lange bitten. Nein, dass die Braut nicht katholisch ist, sei kein Hindernis, versicherte er. Auch nicht, dass er seit Kurzem Pensionist sei und keine eigene Gemeinde mehr betreue. Man müsse nur ein paar Formalitäten klären und die Sache mit dem jetzt amtierenden Pfarrer regeln.
Auch Jule fand die Idee charmant: eine kirchliche Trauung, durchgeführt von dem Pfarrer, durch den Fernando die Heilige Kommunion und die Firmung erfuhr. Es erschien ihr, als schließe sich damit ein Kreis.
Ihr Blick wird von dem halbvollen Weinglas magisch angezogen, und sie spürt, wie ihr das Wasser im Mund zusammenläuft. Denk nicht mal daran! Von der Zigarre im Aschenbecher steigt ein dünner Rauchfaden in die Luft. Plötzlich hat Jule die Zigarre in der Hand und nimmt einen ordentlichen Zug, und gleichzeitig fragt sie sich, was sie da überhaupt macht. Außerdem ist sie nichts mehr gewohnt, denn sie muss prompt husten.
»Zigarren muss man paffen!« Santiago, der wie ein Geist plötzlich wieder da ist, lässt sich ihr gegenüber auf den Stuhl sinken.
Jule läuft knallrot an und legt die Zigarre hastig weg. »Entschuldigung, ich ... das war ein Reflex. Mein Vater hat mich früher immer gebeten, seine Zigarre nicht ausgehen zu lassen. Dabei hat meine Mutter ihm immer vorgehalten, er sei schuld, wenn ich mit zwölf Kette rauchen würde. Aber das Gegenteil war der Fall, ich habe nie geraucht.«
Nur getrunken.
»Schon gut, alles in Ordnung. Sie schmecken wirklich nicht mehr, wenn sie mal ausgegangen sind, und das wäre doch schade gewesen.« Er nimmt einen Zug und hält Jule die Zigarre hin. »Teilen wir sie uns?«
»Nein danke«, wehrt Jule ab.
»Konnten Sie dieser verirrten Seele, die Ihre Mutter auf dem Gewissen hat, verzeihen?«
Jule presst die Lippen aufeinander. Erwartet er allen Ernstes, dass ich Ja sage? Sie denkt an ihren Vorsatz, sich Santiagos Wohlwollen zu erschwindeln, aber eine solche Lüge brächte sie nicht über die Lippen, und Santiago würde es ihr bestimmt nicht abnehmen, er ist schließlich kein Dummkopf. Also antwortet sie: »Nein. Das werde ich auch nie können.«
Wenn es nach ihr ginge, könnte diese verirrte Seele für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren.
Der Priester schaut sie ernst an und sagt: »Ich kann Sie verstehen. Nur sollten Sie nicht zulassen, dass die Bitterkeit Ihr Leben beherrscht.«
»Ich bin nicht verbittert«, entgegnet Jule. »Ich denke nicht an Rache oder dergleichen. Es gab ein Gerichtsurteil, mit dem ich gut leben kann. Aber für Vergebung sind andere zuständig, nicht ich. Wenn das die Bedingung ist, damit Sie uns trauen, dann tut es mir leid.«
Santiago schüttelt den Kopf und hebt abwehrend die Hände. »Jule ... darf ich Sie so nennen? Es gibt keine Bedingungen. Ich freue mich, dass Sie und Fernando sich den göttlichen Segen für Ihre Verbindung wünschen, und ich wäre der Letzte, der Ihnen diesen aus irgendeinem Grund verweigern würde.«
*
»He, Kommissar! Dein Gesicht ist ja länger als das von deinem Schafbock. Ist einer gestorben?«
»Du wirst lachen, so ist es«, antwortet Völxen seinem Nachbarn, der in seinem Blaumann gerade um die Schafweide herum auf ihn zukommt, zwei Bierflaschen in der Hand.
»Dienstlich?«, fragt Köpcke verunsichert.
»Ja, keine Sorge.«
Der Hühnerbaron öffnet die Bierflaschen an der Zaunlatte durch zwei beherzte Handkantenschläge und hält Völxen eine davon hin. Schaum quillt aus dem Flaschenhals, und wie immer ist das Herrenhäuser lauwarm. Wegen meinem Magen, hat Köpcke erklärt, als Völxen sich eines Tages erkundigt hat, ob bei ihnen drüben der Kühlschrank kaputt sei.
»Was Schlimmes?«, forscht der Nachbar nach.
»Vergiss es«, knurrt Völxen. Er hat keine Lust, über die Sache zu reden. Eigentlich will er nicht einmal daran denken. Wie jeden Abend wollte er den Tag am Rand seiner Schafweide ausklingen lassen: nach Doris, Salomé, Matilda, Angelina und dem Bock Amadeus sehen und Oscar ein bisschen Gelegenheit zum Herumschnüffeln geben. Und seinetwegen diese lauwarme Plempe trinken. Völxen greift nach der Flasche und lässt das Bier seine Kehle hinabrinnen, ebenso sein Nachbar.
Nachdem Völxen das Bier zur Hälfte geleert hat, rückt er dann doch mit dem heraus, das ihn beschäftigt: »Ein Typ, gegen den ich mal ermittelt habe, den hat’s jetzt erwischt.«
»Wurde er umgebracht?«
»Vom Krebs. Im Knast.«
»Hatte er einen umgebracht?«
Völxen nickt. »Eine Fünfzehnjährige.«
»Es gibt also doch einen Herrgott.« Köpcke setzt erneut die Flasche an. »Prost.«
»Prost, Jens.«
An die rauen Zaunbretter gelehnt, starren die beiden in die Landschaft. Ein Bussard zieht Kreise über einem frisch abgeernteten Kornfeld, der Himmel färbt sich langsam orangerot. Die Schafe stehen unterm Apfelbaum und sind mit Wiederkäuen beschäftigt. Oscar hat sich hingelegt, nachdem er eifrig nach Mäusen gebuddelt und eine davon erlegt hat.
»Warum dann das lange Gesicht?«, fragt Köpcke nach einer angemessenen Schweigezeit.
Völxen antwortet lediglich mit einem Seufzen und starrt abwesend in das Buddelloch des Terriers. Wenn er eines nicht leiden kann, dann sind es Löcher. Löcher im Rasen, Löcher in seinen Ermittlungen. Lücken, die nicht geschlossen werden konnten, und offene Fragen, die keiner beantworten kann.
*
»Wieder nichts dabei!« Fernando klappt den Laptop zu, nachdem er wie jeden Abend die Immobilienportale abgeklappert hat. Langsam wird es eng. Heute in zwei Wochen findet die standesamtliche Trauung statt, und am nächsten Tag die Hochzeit in der Kirche. Und sie haben noch immer keine passende Immobilie gefunden. Wenn das so weitergeht, wird er bei Jule einziehen müssen. Er verbringt ja eh schon die meiste Zeit in ihrer Wohnung, und wenn es nach Jule ginge, könnte es auch fürs Erste so bleiben, wie es ist. Wegen des Hochzeitstermins müsse man nicht in Panik und Aktionismus verfallen, hat sie dieser Tage gemeint.
»Ein Ehepaar, das nicht richtig zusammenwohnt – was soll das? Wozu heiratet man denn dann?«
»Dann zieh eben ganz hier ein.«
»Das ist deine Wohnung. Ich wäre ein Eindringling.«
Dem hat Jule, wenn er es recht bedenkt, nicht so vehement widersprochen, wie er es sich gewünscht hätte.
Vielleicht sollten sie ein paar Abstriche machen, was die Größe angeht, die Ausstattung oder – die Lage? Fernando würde am liebsten in Linden bleiben, wo er sein Leben lang gewohnt hat. Jule wiederum hätte gern ein Haus, was in Linden schwierig werden dürfte. Linden bietet schöne, große Altbauwohnungen, die sie beide toll finden, für die inzwischen jedoch aberwitzige Preise aufgerufen werden, die zu zahlen Fernando einfach nicht bereit ist. Er möchte nicht vom Geld seiner Frau profitieren, auch wenn er weiß, dass Jule das nicht so eng sieht. Sie konnte ihr Elternhaus für eine knappe Million verkaufen, trotz des Mordgeschehens, das dort ein Jahr zuvor stattgefunden hat. Das, findet Fernando, sagt schon alles über den Immobilienmarkt aus.
»Fernando?«
Er klappt den Laptop zu. »Ja?«
»Warum hast du mir verschwiegen, dass du Ministrant warst?«
»Ich hab’s dir nicht verschwiegen. Ich hab einfach nicht daran gedacht.«
»Ist es dir peinlich?«
»Nein. Ja, doch, ein bisschen. Es war die Idee von Mama. Sie dachte, dass ich dadurch geläutert werde.«
»Hat ja voll hingehauen«, bemerkt Jule.
»Ich finde schon«, versetzt Fernando. »Mit ein bisschen Verspätung ...«
»Wie lange warst du denn Ministrant?«, will Jule wissen.
»So etwa ein halbes Jahr, glaub ich.«
»Das ist nicht lang.«
»Mir hat’s gereicht.«
»Warum hast du so schnell wieder aufgehört?«
Ihr Tonfall ist so harmlos, dass er sein Misstrauen weckt. »Komm, spuck’s aus. Was hat er dir erzählt?«
»Dass du eine Weile lang Ministrant warst.«
»Ich ... ich hatte eben keine Lust mehr. Ich wollte am Sonntag nicht so früh aufstehen, sondern lieber Fußball spielen oder mit den Kumpels abhängen.«
Jule holt tief Atem und sieht ihn streng an. »Fernando! Wie soll ich mit dir vor den Altar treten, wenn du mich anlügst?«
»Weißt du eigentlich, dass du dich manchmal genauso anhörst wie meine Mutter?«
III.
Eigentlich hat Völxen sich heldenhaft vorgenommen, ab sofort nur noch die Treppe zu nehmen, aber der Aufzug sieht ihn gerade so einladend an, also springt er hinein. Für Oscar mit seinen kurzen Beinen ist das viele Treppenlaufen ohnehin nicht gesund, rechtfertigt er seinen Entschluss. Gerade schließen sich die Türen, als sich ein Fuß, der in blauen Ballerinas steckt, durch den Spalt schiebt. Die Türen gehen wieder auf, und Jule Wedekin steigt zu ihm in den Lift.
»Könnt ihr jungen Leute nicht die Treppe nehmen?«
»Dir auch einen wunderschönen guten Morgen! Hi, Oscar.«
Oscar wedelt.
»Moin!«, brummt Völxen. Allzu gut gelaunte Menschen gehen ihm auf die Nerven, ganz besonders am Morgen.
»Ich soll dich von Hochwürden Hector Santiago grüßen«, zwitschert Jule drauflos.
»Arroganter Pfaffenpinsel!«
Jule schaut ihn prüfend an. »Wohl mit dem falschen Bein aufgestanden?«
»Ja, aber es geht mir besser, seit ich den Hund verprügelt habe.«
Der Aufzug setzt sich in Bewegung.
»Was hast du mit Santiago zu schaffen?«, fragt Völxen.
»Ich war am Freitag zum Traugespräch bei ihm.«
»Ihr lasst euch von Santiago trauen?«