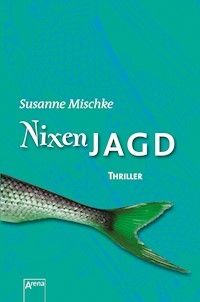Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vom Großvater, der sein Gemüt kühlen muss, über verrückte Käse- und Steinpilzjunkies, die für ihr Objekt der Begierde über Leichen gehen, bis hin zu unterlassener Hilfeleistung, Mord aus Genervtheit, Gleichgültigkeit, Versehen oder Langeweile – oder nur in Gedanken ... Die Herren in Susanne Mischkes Kurzgeschichten haben es faustdick hinter den Ohren. In fünfzehn Kurzkrimis erzählt sie abstruse, kuriose oder auch nur allzu menschliche Begebenheiten, die nicht immer für alle Beteiligten gut ausgehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Mischke
MORDSKERLE
Kleine böse Geschichten
© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
Umschlaggestaltung: © Hildendesign · München · www.hildendesign.de
Bildmotiv: © HildenDesign unter Verwendung mehrerer Motive von shutterstock.com
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-86674-649-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Tod einer Weinkönigin
Gnadenlos
Sheepnapping
Weißlacker-Junkie
Hölle, Hölle, Hölle
Amadeus’ Unschuld
Down Under Arosa
Vier Barleichen und ein Stromausfall
Schall und Rauch
Die geheime Pilzstelle
Ein böser Ort
Seitenlinien
Karlo muss sterben
Bestien
Autorenplage
Die Autorin
Nachweise
Weitere Bücher
Tod einer Weinkönigin
»Für das Protokoll: Sie sind Herr Heiner Kiebitz, geboren am 11. Mai 1967 in Wiesbaden, wohnhaft in Wiesbaden, von Beruf Weingroßhändler.«
»Jawohl, Herr Richter. Spezialisiert bin ich auf Rheingauer Rieslinge und toskanische Rote, aber Sie können bei mir auch …«
»Schon gut, das gehört jetzt nicht hierher. Herr Kiebitz, geben Sie zu, Ihre Frau Petra Kiebitz, geborene Werner, am Abend des 10. September 2006 im Wohnzimmer Ihres Hauses mit einer Weinflasche erschlagen zu haben?«
»Einer Weinflasche! Also wirklich!«
»War es denn keine Weinflasche, Herr Kiebitz?«
»Nichts für ungut, Herr Richter, aber es war ein 88er Tignanello. Außerdem war die Flasche leer. Einen solchen Tropfen dekantiert man selbstverständlich schon Stunden vorher.«
»Sie geben aber zu, dass Sie mit dieser leeren Flasche Ihrer Gattin viermal auf den Kopf geschlagen haben.«
»Viermal?«
»Das geht aus dem forensischen Gutachten hervor.«
»Mag sein. Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich war zu dem Zeitpunkt völlig weggetreten.«
»Es wurde Ihnen eine Blutprobe abgenommen, Herr Kiebitz. Zur Tatzeit hatten Sie lediglich einen Alkoholgehalt von 0,8 Promille im Blut. Nicht gerade die Menge, bei der ein kräftiger Kerl wie Sie nicht mehr weiß, was er tut, oder?«
»Ich meine damit nicht, dass ich betrunken war. Ich bin ja gar nicht zum Trinken gekommen! Ich war außer mir vor Wut – über dieses Weibsbild!«
»Warum waren Sie so wütend auf Ihre Frau, Herr Kiebitz?«
»Herr Richter, sind Sie Weintrinker?«
»Meine Trinkgewohnheiten tun hier nichts zur Sache.«
»Oh, doch, Herr Richter. Denn sonst können Sie mich ja gar nicht verstehen.«
»Na, schön. Ich trinke abends gern einmal ein Glas Rotwein«
»Das habe ich Ihnen gleich angesehen, dass Sie ein Kenner sind!«
»Herr Angeklagter, beantworten Sie bitte meine Frage. Warum waren Sie an dem besagten Abend so wütend auf Ihre Frau?«
»Es war ja nicht nur der Abend. Ich war schon ziemlich lange stinksauer auf sie.«
»Können Sie uns die Gründe dafür vielleicht näher erläutern?«
»Das kann ich, Herr Richter, das war nämlich so: Als ich die Petra kennengelernt habe, das war im Sommer 1998, da war sie die Weinkönigin von Trier gewesen. Sie hätten sie sehen müssen, Herr Richter, mit ihren blonden Haaren und dem Krönchen! Und so knackig wie eine reife Rieslingtraube … Ich habe mich gleich in sie verliebt. Wir haben ja auch gut zusammengepasst. Mein Vater, müssen Sie wissen, ist Winzer. Wenn Sie mal einen ehrlichen, anständigen Rheingauer Riesling haben möchten …«
»Bitte, Herr Kiebitz. Bleiben Sie beim Thema.«
»Das ist das Thema, Herr Richter. Eine Weinkönigin! Also, ich möchte wirklich mal wissen, nach welchen Kriterien die in Trier ihre Weinköniginnen aussuchen. Wahrscheinlich nur nach der Schönheit. Ich meine, mal unter uns, Herr Richter: Von einer Weinkönigin kann man doch wohl erwarten, dass sie sich ein klein wenig für Wein begeistert, oder?«
»Herr Kiebitz, hat das mangelnde önologische Interesse Ihrer Gattin denn irgendetwas mit der Tat zu tun, die man Ihnen zur Last legt?«
»Doch, das hat es. Also … zuerst hat sich die Petra schon für die Sache begeistert, zumindest, solange sie Weinkönigin war. Erst später hab ich gemerkt, dass sie eigentlich gar kein Verständnis für die Materie hat. Aber da war es schon zu spät. Da waren wir schon verheiratet.«
»Es war für Sie als Weingroßhändler also ein Problem, dass Ihre Frau Ihre Leidenschaft des Weintrinkens nicht teilte.«
»Was heißt, Problem? Sie hätte ja nicht unbedingt mittrinken müssen, so ein Fläschchen am Abend schaff ich auch allein. Aber ein wenig Verständnis kann man doch erwarten.«
»Inwiefern?«
»Schauen Sie, Herr Richter, das war so: Wir haben das Haus auf dem Neroberg gekauft und renoviert, und ich habe mir im Keller einen schönen großen Weinkeller eingerichtet – nur so für mich, privat, sozusagen. Dafür musste natürlich der Betonboden raus und Lehmziegel mussten verlegt werden. So was ist nicht billig. Allein, bis ich die Ziegel aus Rumänien importiert hatte … Und natürlich braucht es ein bisschen Kapital, bis so ein Grundstock an Wein vorhanden ist, das muss doch jeder Frau klar sein, besonders, wenn sie mal Weinkönigin war und einen Winzersohn heiratet, nicht wahr Herr Richter?«
»Aber Ihrer Frau war das nicht so klar, oder, Herr Kiebitz?«
»Nein. Sie wollte einen Swimming-Pool. Meinetwegen, habe ich gesagt, aber erst kommt der Keller, dann der Pool. Danach hat mir dieses Frauenzimmer sozusagen den Krieg erklärt. Mir und vor allen Dingen meinem Weinkeller. Wann immer eine Weinlieferung eintraf, hat sie wegen der Rechnung gezetert, und dass sie noch immer keinen Swimming-Pool hat. Danach ist sie aus purem Trotz losgezogen und hat halb Wiesbaden leergekauft. Designerfetzen und so Tinnef, die meisten Sachen davon hat sie gar nie angezogen! Ich trinke meinen Wein wenigstens! Bis auf den, den man lange lagern muss. Ich bin da vor Jahren schon relativ günstig an eine Kiste Chateau Margaux aus dem Jahr 1973 gekommen, ein grandioser Jahrgang …«
»Herr Kiebitz!«
»Schon gut, Herr Richter. Ich komm gleich zum Punkt. Nur Geduld.«
»Strapazieren Sie sie nicht allzu sehr, Herr Kiebitz.«
»Wissen Sie, Herr Richter, ich koche auch gerne. Deshalb habe ich öfter Kunden zu einem schönen Essen mit Wein eingeladen. Als Weingroßhändler muss man seine Kundschaft sorgfältig hegen und pflegen. Das grenzt manchmal schon an Bestechung, Sie wissen, was ich meine …«
»Herr Kiebitz …«
»Naja, auf Sie trifft das vielleicht weniger zu, Herr Richter, Sie müssen sich um Ihre Kundschaft nicht sorgen. Schon gut, Sie brauchen nicht so bös zu gucken. Ich bin ganz bei der Sache. Wo war ich stehen geblieben?
»Beim Essen.«
»Ah, ja. Einmal waren vier Ehepaare eingeladen, und es gab einen unübertrefflichen 96er Riesling vom Schloss Johannisberg zum Zander. Ein ganz schmissiger Tropfen, sag ich Ihnen, der duftete nur so nach Holunderblüten, nach Minze, Zitrone und frisch gemähtem Gras. Dann kam sie. Hat am Glas gerochen wie ein Hund an seiner Schüssel und sagte: ›Der riecht wie Heiners Socken nach drei Tagen.‹ Sie können sich vorstellen, was danach für eine Stimmung herrschte. Ein Andermal hat sie vor versammelter Runde meinen Lieblings-Sangiovese als Katzenpisse bezeichnet. Ich habe es bald nicht mehr gewagt, Kunden zu uns nach Hause einzuladen. Freunde kamen auch immer seltener.«
»Warum haben Sie sich nicht von Ihrer Frau scheiden lassen?«
»Gute Frage, Herr Richter. Natürlich habe ich ihr das vorgeschlagen. Sie war auch einverstanden damit. Sie wollte mein halbes Vermögen, auch das aus der Firma und – und jetzt halten Sie sich gut fest an Ihrem Stuhl, Herr Richter – sie wollte die Hälfte des Inhalts meines Weinkellers. Von jeder Kiste die Hälfte. Und mein Anwalt hat mir bestätigt, dass sie damit womöglich sogar vor Gericht durchkommt. Da habe ich zu ihr gesagt, ich würde sie eher umbringen, als mich unter diesen Bedingungen von ihr scheiden zu lassen.«
»Eine Morddrohung also.«
»So was sagt man halt mal, wenn man eine Mordswut hat. Jedenfalls hätte ich nie zugelassen, dass sie die Hälfte meines Weinkellers kriegt. Unter diesen Umständen kam also eine Scheidung nicht in Frage. Daraufhin habe ich versucht, unsere Beziehung so gut es geht wieder zu kitten.«
»Wie denn, Herr Kiebitz?«
»Ich habe schweren Herzens die Kiste 73er Margaux versteigert und ihr im Garten diesen verdammten Swimming-Pool bauen lassen. Sie bräuchte das Schwimmen für ihre Figur, hat sie gesagt. Sie schwamm dann tatsächlich von Frühjahr bis Herbst jeden Tag ihre Bahnen. Unser Verhältnis schien sich zu bessern. Zumindest glaubte ich Idiot das. Sie trank ab und zu wieder ein Glas Wein mit mir und wollte sogar manchmal was über diesen und jenen Wein wissen. Mit der Zeit aber merkte ich, dass aus dem Weinkeller Flaschen fehlten. Ich führe nämlich ganz genau Buch darüber, was reinkommt und was rausgeht, und es fehlten jeden Monat so zehn, zwölf Flaschen, lauter teure. Ich installierte also heimlich eine Überwachungskamera – und schon am nächsten Tag war Petra zweifelsfrei überführt.«
»Was tat sie mit dem Wein?«
»Tja, genau das habe ich mich auch gefragt, Herr Richter!«
»Und?«
»Ich habe einen Detektiv engagiert, der hat es rausgefunden. Sie hatte einen Liebhaber. So ein Jüngelchen aus der Staatskanzlei. Wissen Sie, Herr Richter, das wäre mir egal gewesen, sie kann rumficken, mit wem sie will …«
»Angeklagter, achten Sie bitte auf Ihre Wortwahl.«
»Verzeihung, Herr Richter. Ist mir so rausgerutscht. Also, der Liebhaber wär mir wurscht gewesen, aber dass sie Wein aus meinem Weinkeller klaut und ihn mit zu ihren Schäferstündchen nimmt, das geht doch zu weit, oder, Herr Richter?«
»Nun, wie gesagt, von Rechts wegen gehörte ihr der Weinkeller zur Hälfte.«
»Genau das hat sie auch gesagt. Also wirklich, Herr Richter, das mag ja gesetzlich so sein, aber das war eine kolossale Sauerei! Ich muss zugeben, als sie mir das kalt lächelnd ins Gesicht sagte, da reiften in mir tatsächlich Mordgedanken.«
»Welche Sie am Abend des zehnten September in die Tat umgesetzt haben.«
»Aber nein, Herr Richter, es war ganz anders …«
»Herr Kiebitz! Hatten Sie am Abend des zehnten September Streit wegen des vermeintlich gestohlenen Weins? Oder wegen des Liebhabers? Erklären Sie mir jetzt um Himmels willen endlich, was geschehen ist!«
»Beruhigen Sie sich, Herr Richter, nur keine Aufregung. Ich bin doch die ganze Zeit schon dabei, Ihnen alles zu erklären. An dem Abend, als das mit Petra passiert ist, hatten wir keinen Streit. Ich hatte an dem Tag seit langem mal wieder einen neuen Großkunden gewonnen und wollte dieses Ereignis feiern. Deshalb hatte ich schon am Mittag ein ganz besonderes Fläschchen aus dem Keller geholt, nämlich den 88er Tignanello. Ich hatte ihn geöffnet und in eine Karaffe gefüllt. Die Flasche stand noch auf der Anrichte. Petra ging am Abend oft noch mal in ihren Swimming-Pool. Auch an diesem Abend schwamm sie, obwohl es draußen schon recht kühl und herbstlich war. Kurz nach acht, es war schon dunkel, kam sie herein. Sie trug ihren Bademantel und schlotterte vor Kälte. Ich bot ihr ein Glas Tignanello an, das sie auch annahm. Dann sagte sie, sie müsse sich erst aufwärmen.«
»Ja, und weiter? Was geschah dann?«
»Was sie dann tat, kann ich kaum beschreiben, Herr Richter, es treibt mir – wie Sie sehen – noch heute die Tränen in die Augen.«
»Versuchen Sie es trotzdem.«
»Petra ging mit dem Glas in die Küche. Ich ahnte nichts Böses, noch nicht. Ich hörte die Tür der Mikrowelle auf- und zugehen, und zwei Minuten später piepste es. Petra kam zurück ins Wohnzimmer. Sie hielt eine Tasse in der Hand aus der es dampfte und nach Wein roch. Mir schwante Furchtbares, und ich sagte: ›Du hast doch nicht etwa den Tignanello …?‹
Sie grinste nur. Herr Richter, dieses teuflische Grinsen, das hätten Sie sehen sollen.«
»Und da haben Sie die Beherrschung verloren und sie erschlagen.«
»Nein, Herr Richter.«
»Nein?«
»Erst, als sie vor meinen Augen einen Beutel Glühfix in die Tasse hängte – da habe ich sie erschlagen!«
Gnadenlos
Ewald Bärle schielte schon den ganzen Vormittag auf die blassgelbe Tür seines Büros. Bei jedem Geräusch schreckte er auf. Jetzt! Jetzt ist es so weit. Am liebsten hätte er diesen Tag frei genommen, aber das würde nichts nützen. Sie würden am nächsten Tag kommen, oder gar am Abend in sein Haus eindringen und dort tun, was sie anscheinend tun mussten. Nur das nicht!
Halb eins. Bis jetzt war alles ruhig gewesen. Zu ruhig. Man konnte liegengebliebene Dinge in Ordnung bringen, reinen Tisch machen. Einen besseren Zeitpunkt dafür würde es nie mehr geben.
Schon ein Uhr. Vielleicht ließen sie Gnade walten? Aber nein, Gnade kannten die nicht, nicht in solchen Fällen, und auch auf Vergessen brauchte er nicht zu hoffen. Nicht bei der Sorte von Leuten. Außerdem – die Gebhard trug ihren blauen Faltenrock, das gute Stück für den Ernstfall. Nein, er würde nicht davonkommen. Sie ließen sich einfach nur Zeit, wollten ihn so lange wie möglich schmoren lassen. Vielleicht waren noch gewisse Vorbereitungen zu treffen. Ruhig, Bärle, ganz ruhig. Du wirst das durchstehen. Ihm wurde heiß, Minuten später fröstelte er, und seine Hände fühlten sich fischig an, als er sie an die pochenden Schläfen legte.
Schritte auf dem Flur. Dumpfe, schwere Männerschritte. Stimmen wie Donnergrollen. Die Tür platzte auf wie eine zu lange gekochte Weißwurst, und in einer finsteren Prozession schoben sie sich herein, undurchdringlich die Gesichter. Der Anführer war Monz, der Ranghöchste, im schwarzen Anzug, wie zu seiner Beerdigung. Ekelhaft, wie die Gebhard nun so furchtbar überrascht tat. Dabei war garantiert sie es, die ihn verraten hatte.
Unauffällig griff Bärle in die Schublade seines Schreibtisches. Zärtlich tasteten seine Finger über den rauen, geriffelten Griff, den verspielten Schnörkel des Abzugs, den blanken, glatten Lauf. Er stellte sich vor, wie er die Waffe zücken, blitzschnell entsichern und abdrücken würde. Monz zuerst, mitten in die Brust. Sein Blut würde die schneeweiße, frisch gestärkte Bluse der Gebhard beschmutzen, aber das wäre egal, denn sie wäre die nächste. Niemals mehr wäre er dem Anblick ihres Faltenrocks zu Birkenstock-Sandalen ausgesetzt. Schiere Panik wäre die Folge seines Tuns, und in diesem infernalischen Durcheinander könnte man es getrost dem Zufall überlassen, wen die anderen vier Kugeln niederstreckten. Ein kleines Massaker zur Mittagszeit. Nie mehr würden sie »Mahlzeit« durch die Gänge blöken.
Bärle zog die Hand mit dem schwarzen Etwas darin aus der Schublade. Schicksalsergeben seufzend hängte er sich die Krawatte um. Vielleicht, so hoffte Hauptkommissar Ewald Bärle dabei tapfer, wird dieses zwanzigjährige Dienstjubiläum doch nicht gar so schlimm werden.
Sheepnapping
Die Morgensonne blinzelt durch die Gardinen und scheint Hauptkommissar Bodo Völxen ins Gesicht. Es ist Samstag, er könnte ausschlafen, aber er hat einen fürchterlichen Brand. Gestern war das Sommerfest der freiwilligen Feuerwehr, ein Pflichttermin für alle Dorfbewohner, auch für ihn und seine Frau Sabine. Brummschädelig und etwas kreuzlahm quält er sich die Treppen hinunter und begrüßt den Terrier Oscar, ehe er sich an den Wasserhahn hängt. Schon besser.
Wie jeden Morgen führt ihn sein erster Gang durch den Garten, der dieses Jahr besonders schön ist, hinüber zur Schafweide. Die Taschen seines Bademantels sind mit Zwieback gefüllt. Unterwegs erleichtert er sich hinter dem Holzschuppen, während Oscar sein Bein an der Regentonne hebt. Auch das gehört zum Morgenritual, doch danach ist plötzlich nichts mehr so wie sonst. Denn als Völxen an der Weide ankommt, steht das Gatter weit offen. Die Schafe haben sich nicht, wie üblich, unter dem Apfelbaum zusammengerottet und sie sind auch nicht im Schafstall. Sie sind weg! Völxen fühlt sich wie vom Blitz getroffen. Hat jemand nachts das Gatter geöffnet? Irren die vier Schafe und Amadeus, der Bock, jetzt im Dorf herum oder, Gott bewahre, auf der Bundesstraße? Panik ergreift ihn, als er plötzlich ein Stück Papier bemerkt, das jemand mit einer Wäscheklammer an den Zaun geheftet hat. Darauf steht eine Handynummer. Sonst nichts.
So schnell ihn seine Gummistiefel tragen, rennt Völxen zurück ins Haus, sucht sein Telefon, wählt die Nummer.
»Ja?« Eine Frauenstimme.
»Wer sind Sie, wo sind meine Schafe?«
»Wer ich bin, tut nichts zur Sache«, sagt die fremde Stimme. Es scheint eine jüngere Frau zu sein. »Ihren Schafen geht es gut, und Sie bekommen sie zurück, wenn Sie etwas für mich tun.«
»Wie bitte?«
»Es geht um den Überfall auf die Postagentur letzte Woche. Der, den die Polizei festgenommen hat, ist unschuldig! Ich möchte, dass Sie das beweisen und den wahren Täter finden.«
»Hören Sie mal, junge Frau!«, bellt Völxen in den Hörer. »Ich bin Leiter der Mordkommission und nicht für solche Lappalien …« Aufgelegt. Völxen flucht, der Terrier verdrückt sich mit angelegten Ohren unter den Küchentisch.
»Was ist denn los?«, fragt Sabine, die leicht verkatert im Türrahmen steht.
»Was los ist? Jemand hat unsere Schafe entführt!«
Etwa fünfzehn Kilometer weiter nördlich, in einer großen Altbauwohnung in Hannover-Linden, klingelt das Handy von Fernando Rodriguez und reißt ihn aus einem frivolen Traum, in dem seine Kollegin Jule Wedekin eine tragende Rolle spielte. Noch halb im Schlaf nimmt er das Gespräch an. Völxen? Am Samstagmorgen um … halb acht! Sein Chef klingt aufgelöst, faselt etwas von entführten Schafen und einer Handynummer, die er, Fernando, sofort überprüfen soll.
»Moment!« Fernando steigt aus dem Bett, taumelt zur Tür und ruft: »Mama! Bring mir sofort einen Stift und Papier!«
»Bin ich dein Dienstmädchen?«, tönt es widerspenstig aus der Küche.
»Es ist der comisario, es ist wichtig!«
»El comisario?« Schon ist Pedra Rodriguez zur Stelle und reicht ihrem Sohn Block und Kuli. »Was ist denn passiert, wieder ein grässlicher Mord?«
»Sei doch mal still, ich hör ja sonst nichts«, zischt Fernando, während er die Nummer notiert. »Ja, ich kümmere mich darum. – Ja, sofort! – Ehrlich! Ich ruf dich an.« Er legt auf. »Herrgott noch mal, der und seine verdammten Schafe!«
»Nando! Fluch nicht!« Pedra Rodriguez bekreuzigt sich und funkelt ihren Sohn böse an. »Denk daran, du hast es dem comisario zu verdanken, dass du als Junge nicht auf die schiefe Bahn …« Aber Fernando, der diese Leier schon tausendmal gehört hat, knallt ihr die Tür vor der Nase zu.
»Wenn ich nur wüsste, wie ich heute noch an die Fallakte rankomme«, jammert Völxen, während er ruhelos in der Küche auf und ab tigert.
»Wozu brauchst du denn eine Fallakte? Frag doch einfach deine Ehefrau!« Sabine Völxen reicht ihm einen Becher Kaffee und befiehlt ihm, sich hinzusetzen und sich zu beruhigen.
Da ihm im Augenblick auch nichts anderes übrig bleibt, leistet Völxen Gehorsam.
»Vergangenen Dienstag wurde die Postagentur im Nachbarort überfallen. Du weißt schon, der Schreibwarenladen, der den ganzen Krimskrams führt, den kein Mensch braucht. Diese Agenturen haben meist keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, und doch müssen sie Bargeld …«
»Ja, ja, und weiter«, knurrt Völxen gereizt.
»Die Beute betrug ungefähr neuntausend Euro. Am Donnerstag wurde ein junger Mann verhaftet. Es gab zwei Zeugen. Einer ist ein älterer Mann, der gegenüber wohnt und ihn aus dem Laden rennen sah. Er hat ihn wohl zweifelsfrei anhand der Verbrecherkartei identifiziert. Der Zeuge heißt Buchholz, er war früher der Sargtischler im Dorf.«
Völxen nimmt sich vor, seine Kollegin Jule anzurufen und sie zu bitten, dem Herrn einen Besuch abzustatten.
»Die andere Zeugin ist Frau Lambert, unsere Gärtnerin«, fährt Sabine fort. »Die war dort einkaufen, als es passierte. Sie konnte allerdings nicht viel sehen, weil der Mann eine Maske trug.«
»Was ist mit der Inhaberin des Ladens?«, will Völxen wissen.
»Die hat einen Schock und erinnert sich an gar nichts.«
»Weißt du auch, wer verhaftet wurde?«
»Ja, der Autoschrauber-Alex. Alexander Kreipe. Er hat als Jugendlicher Tankstellen und Kioske überfallen und später eine Filiale der Volksbank. Dafür hat er drei Jahre gesessen. Vor zwei Jahren hat er geheiratet. Er hat einen festen Job in einer Autowerkstatt und eine einjährige Tochter. Es wäre tragisch, wenn er rückfällig geworden wäre.« Sabine Völxen ist fertig und schaut ihren Mann triumphierend an. »Na, wie war ich?«
»Ich wusste gar nicht, dass du so eine Dorftratsche bist!«
Ehe Sabine ihm sagen kann, was er sie mal könne, klingelt Völxens Handy.
Es ist Fernando. »Die Nummer gehört zu einer Julia Kreipe, zweiunddreißig, sie wohnt in eurem Kaff, Hinter der Kirche 2. Kann ich jetzt wieder ins Bett?«
»Nein. Finde heraus, ob es in ihrer Verwandtschaft jemanden gibt, der was mit Landwirtschaft zu tun hat.« Er legt auf und sagt zu Sabine: »Es muss jemand getan haben, der vom Fach ist. Um fünf Schafe zu entführen, braucht man einen Transporter, eine Rampe … und außerdem ist mit Amadeus nicht zu spaßen.«
»Wem sagst du das?«, seufzt Sabine.
»Wissen Sie, ich stand zufällig am Wohnzimmerfenster, weil ich die Blumen gegossen habe. Da sehe ich den Typen aus dem Laden rennen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Schnäpschen gefällig, junge Frau?« Schon pirscht sich der Zeuge Helmut Buchholz, achtundsiebzig Jahre alt und verwitwet, heran, in der einen Hand eine Flasche Doppelkorn, in der anderen zwei Gläser.
»Aber gern doch«, sagt Kommissarin Jule Wedekin. »Es ist ja schon … zehn Uhr.«
Seine Hände zittern beim Eingießen, sodass die Hälfte auf dem klebrigen Linoleum landet. »Prösterchen!« Der Alte hebt sein Glas. Seiner Ausdünstung nach ist es nicht der erste Kurze dieses jungen Tages »Nicht lang schnacken, Kopp in’ Nacken!«
Was sein muss, muss sein, denkt Jule und kippt den Schnaps hinunter. »Herr Buchholz, es hieß, der Täter habe eine Maske getragen. Wo war die denn, als er den Laden verließ?«
»Jedenfalls nicht mehr auf seinem Kopf. Wie hätte ich den Alex, diesen Tunichtgut, denn sonst erkennen können?«
»Stimmt auch wieder«, räumt Jule ein. »Wo lief der noch mal lang?«
»Genau hier, vor der Bushaltestelle, rannte er über die Straße.«
»Sie meinen dort, wo gerade der Mann mit der Aktentasche steht?«
Der Alte späht mit zusammengekniffenen Augen durch die staubige Fensterscheibe. »Ja. Dort, wo der Mann steht.«
Jule betrachtet die junge Frau mit dem Schäferhund, die als einzige Person an der Bushaltestelle wartet.
»Noch ’nen Kurzen, Frau Kommissarin? Auf einem Bein steht es sich so schlecht.«
Julia Kreipe ist in Tränen aufgelöst. Das mit den Schafen tue ihr leid, es sei eine Verzweiflungstat gewesen. »Der Alex, mein Mann, hat nichts mit dem Überfall zu tun! Aber er hat halt früher viel Scheiß gebaut, und wenn die dem das anhängen, sieht der unsere Sophie erst wieder, wenn sie eingeschult wird.«
Die Kleine sitzt auf einer Decke und nagt sabbernd an einem Stofftier.
»Und wieso ich? Wieso meine Schafe?«
»Weil Sie der Beste sind. Das erzählt man sich zumindest im Dorf.«
Völxen fühlt sich wider Willen ein wenig gebauchpinselt. »Nun ja … Ich nehme an, meine Schafe sind auf dem Biobauernhof Ihres Onkels in der Wedemark?«
Die zarte Blondine zuckt zusammen. »Woher wissen Sie das?«
»Ich bin der Beste, bekanntlich«, versetzt Völxen. »Gnade Ihnen Gott, wenn sie traumatisiert sind!« Anschließend rät Völxen der Frau, den Anwalt ihres Mannes zu bitten, die Sehkraft des Zeugen Buchholz amtsärztlich untersuchen zu lassen. »Danach ist der Staatsanwalt diesen Zeugen los«, prophezeit er.
»Was ist mit der anderen Zeugin?«
»Die übernehme ich«, antwortet Völxen und steht auf. Als sie ihn zur Tür bringt, bemerkt er, dass sie ein wenig hinkt. »War das …«
»Ihr Schafbock. Ein hinterlistiges Biest! Wollen Sie den wirklich zurückhaben?«
Seit Ulla Lampert den Garten der Völxens unter ihren Fittichen hat, grünt und blüht es schöner denn je. Sie und der Hauptkommissar sind etwa gleich alt und haben sich immer gut verstanden. Aber nun, da Völxen die Frau in deren eigenem Garten antrifft, schaltet sie auf stur. Nein, sie habe den Täter in der Postagentur nicht erkannt. Dass Alex Kreipe entlastet sei, freue sie, aber sie könne Völxen nicht mehr sagen, als dass der Täter mittelgroß, von mittlerer Statur und mittelblond gewesen sei.
»Und seine Stimme?«, fragt Völxen.
»Die war … normal.«
»Ich glaube Ihnen nicht«, bekennt Völxen rundheraus. »Ich glaube vielmehr, Sie haben aus irgendeinem Grund Angst, mir die Wahrheit zu sagen.«
Da irre er sich, behauptet die Gärtnerin.
Völxen schüttelt enttäuscht den Kopf. »Schade«, verabschiedet er sich. »Dass Sie einen Straftäter decken, hätte ich nicht von Ihnen gedacht.«
In den folgenden Wochen kommt es Völxen so vor, als ginge ihm die Gärtnerin aus dem Weg. Schließlich lässt der Hauptkommissar die Sache auf sich beruhen. Was soll er auch tun? Es ist nicht sein Fall, die Schafe sind heil zurück, die Anklage gegen Alex Kreipe wurde fallen gelassen und vom Biohof in der Wedemark kommt ein intensiv duftendes Paket mit einem großen Laib Ziegenkäse darin.
An Weihnachten erreicht Sabine und Bodo Völxen eine Ansichtskarte aus Schottland: eine grüne Wiese mit einer Schafherde, dahinter erstreckt sich der Ozean. Grüße von Ulla Lampert.
»Ist sie ausgewandert?«, erkundigt sich Völxen.
»Ja. Ullas Tochter hat als Hostess auf der Messe Eurotier gejobbt und dort einen Schaffarmer von den Orkney Islands kennengelernt. Jetzt sind Mutter und Tochter dort hingezogen.«
»War die Tochter nicht mit einem Kerl aus Bothfeld verheiratet?«
»Ja, war. Ihr Ex scheint ein übler Typ zu sein. Auch gewalttätig, Ulla hat nie gern darüber gesprochen.«
An einem sonnigen Morgen im März, steht Völxen auf dem Balkon vor dem Schlafzimmer und inspiziert den Garten. Die ersten Tulpen spitzeln hervor. Plötzlich brüllt er: »Sabine!«
Erschrocken kommt seine Frau die Treppe heraufgerannt. »Was ist?«
»Hast du einen Liebhaber?«
»Wie bitte?«
»Wer hat die Tulpen hinterm Haus gesetzt?«
»Ulla Lampert, im vergangenen Herbst. Was stellst du für idiotische Fragen?«
Völxen weist stumm nach unten. Beide starren ins Beet, wo die knospenden Tulpen ein Muster bilden. Nein, es sind Buchstaben: Paul.
»Das ist Ullas Ex-Schwiegersohn«, fällt Sabine ein. »Aber wieso …?«
Völxen grinst und sagt: »Mein Schatz, wie wär’s, wenn wir Ostern auf die Orkneys fahren würden? Meer, Wind und Schafe … Und ich könnte dort eine Zeugenaussage aufnehmen.«
Weißlacker-Junkie
Schon zum dritten Mal schlich der Lochbihler Franz am Käsestand vorbei. Es ging auf ein Uhr zu, und die Händler waren dabei, ihre Waren zusammenzupacken. In Kürze würde der Kemptener Wochenmarkt an der Lorenzkirche schließen.
Dem Lochbihler lief das Wasser im Mund zusammen. Der Geruch seines Lieblingskäses verfolgte ihn bis zum Wurststand am anderen Ende des Platzes, wo immer noch dichtes Gedränge herrschte. Weißwürste sollten das Zwölf-Uhr-Läuten eigentlich nicht hören, aber hier kümmerte man sich nicht darum und ließ sie sich schmecken, genauso wie die Wiener und die Polnischen mit Brezen und Semmeln.
Den Lochbihler ließen die heißen Würste kalt. Er kehrte um, pirschte sich wieder an den Käsestand heran und beobachtete verstohlen, wie nacheinander der Camembert, der Bergkäse, der Emmentaler und der Romadur weggeräumt wurden. Aber der Weißlacker lag noch da! Fünf Exemplare, sauber verpackt in Silberfolie. Eine knappe Wochenration. Vielleicht würde er sie so kurz vor Schluss etwas günstiger bekommen? Nein! Diesmal musste er der Versuchung widerstehen! So konnte es einfach nicht weitergehen. Und wenn ich nur einen einzigen …?
Die junge Frau hinter der Käsetheke lächelte ihm aufmunternd zu. Erschrocken wandte sich der Lochbihler ab. Hatte die Lisa ihn womöglich erkannt? Obwohl er seit dem Vorfall