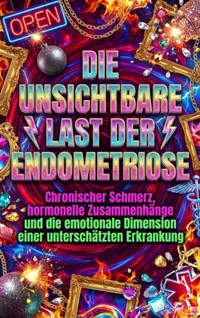12,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Essaysammlung "Denken und Sein" stellt den Versuch einer philosophischen Selbstbesinnung und Selbstbestimmung dar. Sie zentriert sich um Probleme der Selbst- und Welterkenntnis und lotet deren moralische und politische Implikationen aus. Vor allem wendet sich der Autor gegen Formen der Identitätsphilosophie, die Ungleiches gleichmachen wollen. Ungelöste Fragen gehören ebenso zum Leben wie Widersprüche und Unvereinbarkeiten. Die essayistische Form entspricht der Offenheit eines Denkens, das sich seiner Subjektivität bewusst ist. Die Essays stehen in der Tradition der Aufklärung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Kühn
Denken und Sein
Neue Essays
© 2020 Thomas Kühn
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-01497-8
Hardcover:
978-3-347-01498-5
e-Book:
978-3-347-01499-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Fragen über Fragen
Das Bedürfnis, Denken und Sein als Einheit zu begreifen, ist ein starker Antrieb in unserem Leben. Gelingt es uns, das Widerstreitende zu versöhnen, so erleben wir das als „Sinn“. Im entgegengesetzten Fall öffnet sich in uns ein Abgrund der Sinnlosigkeit. Dieser Abgrund kann schöpferisch sein, er kann ein Anfang von Neuem sein. Aber als ständige Bleibe ist er nicht empfehlenswert. Steht am Anfang ein namenloses Erleben, so sucht man in Philosophie, Literatur, Kunst Formen der Gestaltung des Namenlosen. Was noch keine Sprache hat, artikuliert sich anfänglich als Frage. So steht die Fraglichkeit des „Sinns“ am Anfang jeder Sprache. Im Alltag öffnet sich der Abgrund im Nichtverstehen oder im Missverständnis. Nicht immer stehen dahinter Dummheit, Faulheit oder Bosheit, wie mancher vermutet. Der Sinn der Welt selbst ist fraglich. Da Vernunft nach dem Sinn fragt, ist Nichtverstehen eine natürliche Haltung. Das ist die Geburtsstunde der Philosophie oder der Beginn eines Lebens, das sich hinter vermeintlichen Sicherheiten verschanzt. Das heimliche Wissen um die mögliche Sinnlosigkeit treibt uns mehr an, als uns lieb ist. Daher lieben wir die großen Metaphern, die uns Sinn versprechen, den Glauben, der uns beruhigt. Wer philosophiert, hat in der Regel diesen beruhigenden Glauben nicht. Wer philosophiert, hat einen eher beunruhigenden Glauben. Er glaubt daran, dass die Rede von Welt und Wahrheit, Bewusstsein und Sein, Wirklichkeit und Sinn nur provisorisch sinnvoll ist – als vorläufiges Ergebnis der Versuche, dem Namenlosen zur Sprache zu verhelfen. Er versucht, die Spannung auszuhalten, er lernt, damit umzugehen. Die vorliegenden Essays sind den Menschen gewidmet, die „metaphysisch obdachlos“ sind und die dennoch nicht aufgehört haben, jenseits der modischen Etiketten nach „Sinn“ zu suchen, ohne die Suche voreilig für beendet zu erklären. Die Offenheit des Denkens, sein explorativer Charakter, fügt sich am besten in die Form des Essays.
Berlin-Lankwitz, den 26.2.2020
I
Selbstbesinnung und Selbstbestimmung
Mutter des Wissens, Vater des Zweifels
Philosophie hat seit ihrer Entstehung aus Mythos und Alltagsdenken in Griechenland, China und Indien immer das Weltganze und die Stellung des Menschen in der Welt als Erkenntnisziel. Jede Detailuntersuchung zu einzelnen Begriffen hat stets diesen übergeordneten Bezug zum „Ganzen”. Es geht ihr selten nur um Theorie, sondern meist auch um praktisches Wissen zur Naturbeherrschung, Politik und Lebensführung des Einzelnen. Dabei spielt die Auseinandersetzung mit Mythen, Ideologien und Religionen, die ebenfalls einen solchen Anspruch hegen, eine zentrale Rolle. Insofern beginnt Philosophie als Kritik an dominierenden Erklärungsund Begründungspraktiken nicht nur von Wissen, sondern auch von Macht. Diese Kritik kommt nicht ohne eigene Vorschläge aus, sie muss Alternativen der Welt- und Naturerklärung, der Staatsorganisation oder der Seelenkunde vorlegen. Je größer die Erklärungskraft eines dieser Prinzipien für alle großen Phänomenbereiche ist, desto folgenreicher wird es. Platon war der erste, der die Einheit von Natur, Gesellschaft und Individuum unter leitenden Prinzipien nicht nur dachte, sondern auch systematisch entfaltete. Dabei konnte er schon auf viele, widersprüchliche Versuche zurückschauen, von denen uns heute nur Fragmente überliefert sind. Hier zeigt sich ein weiterer Zug des philosophischen Zugangs zur Welt: es gibt nicht nur einen, mehrere sind möglich. Widerspruch und Interpretationskonkurrenz beleben die Philosophie. Ein einheitliches, widerspruchsfreies Bild von Welt und Mensch gibt es nicht. Kam eine Religion oder Ideologie zur Vorherrschaft, wurde Kritik daran brutal unterdrückt. Sekten- und Schulbildung dagegen gehören von Anfang an zum Schicksal der Philosophie. Das sollte sich erst ab dem 17. Jahrhundert in gewisser Weise ändern, da die großen empirischen Wissenschaften allmählich ihre heutige Gestalt annahmen und aufgrund ihrer theoretischen und praktischen Erfolge die Philosophie ablösten. Diese degenerierte zur beinahe bedeutungslosen „Geisteswissenschaft”1. Die Binnendifferenzierung der „Einen Philosophie“ in die vielen Wissenschaften wurde teilweise nach dem Grundriss von Aristoteles vorgenommen. Viele modernen Wissensdisziplinen verdanken Aristoteles ihren Namen, ihre Grundprobleme, ihre Methoden. So blieben die Grundprinzipien der platonischen und aristotelischen Philosophie lange bestimmend für die Wissenschaften, aber auch für die Fragestellung politischer und ökonomischer Probleme, ja für die Organisation der Gesellschaft. Dies gilt nicht nur für das ganze Mittelalter und die frühe Neuzeit, sondern selbst bis heute. Man muss allerdings auch sagen, dass dieser schöpferische Prozess der Organisation der menschlichen Gesellschaft, Wissenskultur und unseres Selbstverständnisses durch die antithetische Skepsis bedroht wurde. Die radikale Infragestellung aller Wissens- und Herrschaftsansprüche begleitet die Philosophie seit ihren Anfängen. Das betrifft auch zur Herrschaft gekommene philosophische Paradigmen. So kann man sagen, dass es immer zwei Philosophien gegeben hat: eine aufbauende, systembildende und eine niederreißende, problematisierende. Schaut man auf die Jahrtausende zurück, dann scheint eins klar zu sein: eins geht ohne das andere nicht. Denn der kritischen Seite verdankt die Philosophie ihren Aufstieg, der konstruktiven ihre Ausweitung. Im 21. Jahrhundert sehen wir die Wissenschaften auf einem Gipfelpunkt. Die Gesellschaften und Individuen sind auf dem Weg zur wissensbasierten Selbstorganisation. Zugleich stehen wir am Abgrund einer alles Wissen negierenden Selbstzerstörung. Was bleibt also dem Philosophierenden? Was ihm durch alle Krisen hinweg immer blieb: Versuche der Selbstbesinnung, Versuche der Selbstbestimmung.
Ist Selbsterkenntnis möglich?
Wenn wir beginnen, uns selbst zu erforschen, haben wir meist schon alle möglichen Erfahrungen, Gedanken, Bilder und Lektüren im Kopf. Diese sind nicht spontan in uns selbst entstanden, sondern wir haben sie von Kindesbeinen an in uns aufgesogen. Die Sprache spielt dabei die entscheidende Rolle. Wie sich unser kindlich spontanes Selbstbewusstsein ausgebildet hat, wie wir gelernt haben, uns selbst mentale Eigenschaften wie Denken, Fühlen und Wollen zuzuschreiben, wie wir auch andere Zuschreibungen übernommen haben2 – …all das fällt in die Phase unseres Spracherwerbs. Wir haben das Urteilen über uns und unsere Umwelt mit der Sprache gelernt – denn wir haben sie unserer urteilsfreudigen Mitwelt abgelauscht. Dieses tief in unserem Sprachbewusstsein verankerte Selbst- und Weltbild prägt auch unsere Fähigkeit, über uns nachzudenken. Deshalb ist die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis bei jedem äußerst begrenzt und es scheint ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein, das eigene „Selbst“ jemals erkennen zu können. Aber ist dann nicht die ganze Philosophie zum Scheitern verurteilt? Vielleicht. Nicht nur in der Philosophie ist die Selbsterkenntnis Ursprung und Ziel des Denkens, sondern ebenso in den Wissenschaften vom Menschen und in unserem alltäglichen Handeln und Reden. Auch in der Literatur, im Mythos, in Religion, in der Kunst, im Film geht es meist um das Bild vom Menschen, das er von sich selbst entwirft. Aber vielleicht haben wir nur unfertige Bilder von uns, Skizzen, die nichts darstellen, sondern durch die wir uns erst schaffen? Gehen wir an den Ausgangspunkt der Überlegungen zurück: Das Streben nach Selbsterkenntnis setzt schon Selbsterkenntnis voraus – jedenfalls rudimentär: Bekanntschaft mit sich selbst. Denn ich kann nicht nach mir selbst fragen, ohne zu wissen, dass ich nach mir selbst frage. Außerdem frage ich sowohl als Individuum – als dies konkrete Ich – als auch als Mensch – als Exemplar einer biologischen Gattung oder einer kulturellen Epoche. Als Mensch bin ich aber ab ovo mit Welt- und Menschenbildern konfrontiert. Um nach mir zu fragen, muss ich zunächst alle Antworten auf die Frage nach mir selbst einklammern, die mich unter einen Allgemeinbegriff subsumieren. Wenn ich nach mir frage, kann ich nicht schon die Bilder voraussetzen, die vom Menschen im Allgemeinen entworfen wurden. Aber genau das ist die Situation, wenn ich damit beginne, mich zu befragen: Ich habe schon die Bekanntschaft mit den Entwürfen vom Menschen und auch von mir gemacht, die von anderen stammen. Ich kann aber nicht schon voraussetzen, ein konkretes Exemplar einer biologisch, religiös, sozial und kulturell definierten Gattung zu sein. Denn ich bin nicht als ich selbst ein Exemplar einer Gattung. Ich kann mich zwar selbst als ein solches denken – und werde von anderen Menschen als ein solches gedacht -, aber das Verhältnis zwischen mir als Fragendem und dem allgemeinen Gattungsbegriff „Mensch“ kann nicht schon als geklärt vorausgesetzt werden. Außerdem: Die Aufgabe der Selbsterkenntnis verstehe ich als meine Aufgabe, mich selbst zu erkennen. Auch ist durch die Frage nicht vorentschieden, wie die Antwort ausfallen soll, ob ich also eine theoretische Antwort erwarte oder eine eher praktische. Je weiter ich mein Wissen um die Welt und den Menschen vermehre, umso schmerzlicher wird die Lücke spürbar, die ich in diesem Wissensnetz bilde. Als nach mir selbst fragendes Wesen stehe ich den Bildern gegenüber, die ich von mir selbst und meinesgleichen entworfen und übernommen habe. Diese Bilder bleiben aber so lange unverständlich, solang der Mensch sich nicht selbst als Konstrukteur dieser Bilder erkennt. Denn keiner fällt von sich aus unter eine bestimmte Beschreibung. So entwirft ein jeder von uns verschiedene Bilder von sich selbst und von den anderen Menschen, ebenso wie jeder in den Köpfen der anderen als Bild existiert. Selbst in den objektiven Wissenschaften vom Menschen, wie beispielsweise in der Neurobiologie, der Psychologie oder in den Sozialwissenschaften, entwerfen Menschen Bilder vom Menschen. Diese Bilder werden zwar an der Erfahrung überprüft und unterscheiden sich so von nur gedachten Bildern, aber sie müssen ja zunächst begrifflich konzipiert und die Erfahrungen müssen anschließend interpretiert werden. Wenn der Mensch Schöpfer der Menschenbilder ist, dann können die Menschenbilder nicht stimmen, die den Menschen nur als gegenständliches Wesen vorstellen. Der philosophische Auftrag der Selbsterkenntnis kann also bedeuten, die Bilder, die wir von uns selbst entwerfen, immer wieder zu hinterfragen, ja, sie zu zerstören, und uns immer wieder als die Suchenden und Fragenden zu erkennen. In der Regel werden wir durch Zu- und Unfälle zu „Fragenden“: Ein Selbstbild bekommt Risse; eine Erfahrung mit dem eignen Fühlen, Urteilen und Handeln gerät in Widerspruch zu einer Selbstzuschreibung, aus der eine andere Sichtweise, auch eine andere Handlung folgen sollte, als tatsächlich geschehen. Die Selbstzuschreibungen sind mit Handlungen verknüpft, aber auch mit dem Urteil anderer Personen. Selbstbilder sind wie Hypothesen, die an der Wirklichkeit scheitern können, weil sie durch Handlungen, Gedanken, Gefühle bestätigt oder widerlegt werden können. So streiten wir uns um die richtige Interpretation unseres Tuns oder Motivs oder meiden Situationen, die uns in Konflikt mit unserem Selbstbild bringen können. Es meidet mancher Situationen, in denen sein privat gepflegtes Selbstbild Kratzer bekäme, es lebt mancher in unwirklichen Beziehungen, in denen keiner sagt, was er sieht, bis er es nicht mehr sieht. Das sind wohlbekannte Immunisierungsstrategien. Um zu wissen, wer und wie man ist, reicht es also nicht, sich selbst via Introspektion zu erkunden; denn hierbei stößt man nur auf sprachlich induzierte Selbstbilder. Sondern man muss auch das eigene Handeln einbeziehen, das mit diesen Selbstbildern in einem argumentativen Zusammenhang steht. Ein Selbstbild bekommt Risse, weil es an der Erfahrung scheitern kann. Selbstbilder sind in diesem Sinn Erwartungen an uns selbst, die wir auch anderen durch Gestus, Mimik, Logos (Rede) und Habitus einimpfen. So erzeugen wir einen Schein, an den wir selbst glauben und andere glauben machen, bis unsere eignen Taten uns widerlegen. Daher die Bemühung so mancher, sich ihrem Bild gleich zu machen. In der medial vermittelten Welt nennt man das Imagepflege. Daher auch der Sog der Bilderwelt, weil es viel einfacher ist, ein Wunschbild von sich selbst zu entwerfen, als ihm zu entsprechen. Im alltäglichen Sinn bedeutet Selbsterkenntnis die bewusste, schonungslose Überprüfung der Selbstbilder, den kritischen Vergleich zwischen dem, was ich über mich denke, wie ich mir und anderen erscheine und dem, was ich tue. Diese Selbstkritik setzt die Fähigkeit voraus, zu sich selbst auf Distanz zu gehen, um überhaupt Anspruch und Wirklichkeit aneinander zu messen. Messen kann ich sie, weil sie in einem argumentativen Zusammenhang stehen. Ich bin nicht großzügig (Zuschreibung), wenn ich mich nicht generös verhalte (Handeln). Die Selbstdistanz setzt ihrerseits voraus, dass ich in der Lage bin, mich zu mir selbst zu verhalten, also mich reflexiv auf mich zu beziehen. Der „Ort“ der Selbstkritik ist also die argumentative Vernetzung unterschiedlicher Bereiche meiner selbst, die nicht automatisch harmonieren, sondern die ich aktiv knüpfen und überprüfen muss. Dieser Prozess verläuft in der Zeit. Dabei muss ich mich auf mein biografisches Gedächtnis verlassen. Das Selbstbild kann in unterschiedlicher Weise als kohärent erlebt und beurteilt werden, je nachdem, welche Strategien zur „Kohärenzbildung“ erworben werden, einschließlich der Immunisierungsoder Repressionsstrategien, die die Selbstreflexion eher unterdrücken. Dieser Prozess führt nicht zwangsläufig zu einer immer vertiefteren Selbstreflexion, er kann im Gegenteil auch in stereotypen Interpretationsmustern verharren, in einem fixierten Selbstbild, das sich dank interpretatorischer Kniffe immer selbst bestätigt. Grund dafür ist, dass dieser Prozess im Laufe der Ontogenese zunehmend versprachlicht wird und wir Sprache immer interpretieren müssen. So kann man alltägliche Selbsterkenntnis auch als Selbstinterpretation bezeichnen, die unter dem Schlüssigkeitsgebot steht und an der (internen und externen) Realität scheitern kann. Ob wir unser Selbstbild als hypothetisch formulieren und offen für Selbstrevisionen sind oder nicht, entscheidet darüber, ob wir damit an der Realität scheitern können. In der Regel scheitern wir gerade dann, wenn das Selbstbild sich zunehmend verselbstständigt und von dem nährenden Prozess der Selbstüberprüfung ablöst. Wir werden umso schwächer auf eigene Inkohärenzen reagieren, je stärker unser Selbstbild fixiert ist. Insofern ist es dem Selbstbild inhärent, ob und inwiefern ich mich selbst als selbstreflexives Wesen definiere. Das kann ich mir in der Regel nicht aussuchen, sondern dies hängt von den Ich-Idealen der Kultur ab, in die ich hineingeboren werde. Allerdings sind wir von Natur aus Wesen, die über Selbstreflexivität verfügen, zu deren Natur es gehört, Selbstbewusstsein auszubilden und die Prozessphasen selbst zu aktivieren. Dieser Prozess kann aber auch durch frühzeitige Indoktrination manipuliert werden. Ziel dieser Okkupation des „Selbst“ ist die Unterdrückung eines individuellen Selbstbildes, das individuelle Prozesse der Selbst- und Fremddistanzierung, der Selbst- und Fremdkritik unter Kohärenzforderung selbst initiieren kann. Da dieser Prozess aber niemals vollständig fremdgesteuert funktionieren kann – immerhin sind die kritischen Phasen der Distanznahme und der Selbstkritik unerlässlich -, kommt es beispielsweise in sehr autoritären, konformistischen und opportunistischen Kulturen zu einer Abspaltung des „sozialen Selbstbildes“ vom individuellen Selbst. Die Fähigkeit zur Selbstkritik ist im menschlichen Selbstbewusstsein in dem Sinn implizit vorhanden, in dem ich sagen kann, dass ich mein Handeln in seiner Übereinstimmung mit meinem Wollen, Denken, Planen überwache. „Übereinstimmung“ bedeutet hier Bedeutungsgleichheit der sprachlichen Handlungen, mit denen ich meine Handlungsabsicht und die sich auf diese Absicht beziehende Handlung selbst beschreiben würde. Anders wäre Handeln gar nicht möglich, wenn man Handeln als bewusstes und absichtliches Verhalten deuten möchte. Ich mag mir denken „Ich gehe jetzt zum Bäcker, um Brötchen für das Frühstück zu holen, damit die Kinder nicht hungrig in die Schule gehen müssen.“ – das mag ich vorhaben. Wenn ich stattdessen Blumen gieße, Schuhe putze oder über Moralphilosophie nachgrüble, wenn ich meine hungrigen Kinder vergessen würde, überhaupt jeden Kausalzusammenhang zwischen ihrer und meiner Existenz ignorieren würde, dann bestünde keine Äquivalenz zwischen meinem Denken und Handeln. Ich könnte mir den Zusammenhang zwischen meinem Denken und meinem Handeln kraft meines Selbstbewusstseins zwar sprachlich vielleicht noch zurechtlegen, aber diese Kunstbrücke könnte tatsächlich nur behauptet, nicht begangen werden. Zur Erhaltung meines Selbstbildes würde ich den partiellen Verlust der Kohärenzbildung leugnen oder ignorieren. Aber meine Mitmenschen würden das Vertrauen in meine Vernunft, aber auch in meine Person verlieren, wenn ich derart inkohärent mich verhielte. In diesem Sinn kann man sagen, dass Vernunft bedeutet, kohärent und konsistent zu denken und zu handeln. Das schließt empirische Prädikate ein, also beispielsweise Wahrnehmungsurteile, aber auch volitive Prädikate, also Absichtserklärungen. Eine vernünftige Person wäre dann eine, die auch angemessene Beschreibungen ihrer Handlungen mit in ihr Selbstbild integriert. Selbsterkenntnis ist also eine notwendige Bedingung dafür, uns als vernünftige Personen zu verstehen. Kohärenzstörungen in auch nur einer der genannten Relationen würden sofort einen kritischen Bewertungsprozess bei meinen Mitmenschen auslösen, möglicherweise mit der Folge einer Distanzierung von mir als ernstzunehmender und verantwortlicher Person. Es sei denn, es gelingt mir, den Kohärenzverlust als Schein darzustellen oder ihn durch Umstände zu erklären, die ihn für andere plausibel machen (Krankheit, Erschöpfung). Offenheit und „Mut zur Lücke“ werden in offenen Gesellschaften honoriert, weil dadurch die Übereinstimmung zwischen Reden und Handeln wiederhergestellt wird3. Diese Rechtfertigung meiner Inkohärenz würde mein Selbstbild und damit meinen Status als vernünftige Person rehabilitieren. Mit anderen Worten: vernünftig handle ich nicht nur dann, wenn ich kohärent handle, sondern auch, wenn ich selbst ex post Erklärungen für Inkohärenzen liefern kann und damit meine Einheit als Person restituiere. Aus dem Grund, dass Selbstreflexivität normativ unter dem Kohärenzgebot steht und wir über diesen Weg sowohl Person als auch Vernünftigkeit definieren, kommt der Selbsterkenntnis eine so gravierende Rolle zu. Wir müssen gleichsam permanent in der Lage sein, die Kohärenzprüfung vorzunehmen, damit wir uns als Personen nicht entgleiten. Die „Einheit des Subjekts“ ist eine dauernde Leistung, die wir ohne Selbstbewusstsein nicht erbringen können. Ein zentrales Motiv dieser Arbeit an uns selbst ist die Selbstzuschreibung unserer Bewusstseinsinhalte und unserer Handlungen. Nur so können wir unser Fühlen, Wahrnehmen, Denken, Wollen und Handeln aufeinander beziehen. Da wir das als kritische Mitmenschen aber automatisch und intuitiv bei anderen Menschen auch machen, müssen wir zusätzlich eine Auswahl in uns selbst treffen, welche Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Absichten wir uns selbst, welche wir anderen Menschen zuschreiben. Nur so können wir die Einheit unserer Person, die Übereinstimmung mit uns selbst und unsere Authentizität wahren. Das impliziert alles nicht, dass es ein unabhängiges Vermögen namens „Vernunft“ gäbe, der wir folgen müssen. Das wäre sicher der falsche Schluss. Stattdessen bezeichnen wir die oben beschriebenen Prozesse als Vernunft. Die Annahme eines gesonderten Vermögens würde eigene Probleme mit sich führen; sie scheint aber auch überflüssig, weil die Kohärenzforderung in Bezug auf unsere mentalen und pragmatischen Aspekte die Minimalbedingung für unsere Identität als Personen, die in der Zeit existieren, ist. Da sich erstens unsere Identität als Personen wesentlich unserem Selbstbewusstsein verdankt, das in einem Selbstverhältnis besteht, da wir ferner als sprachlich kommunizierende Wesen die Sprache der anderen als Mittel der Selbstreflexion und Selbstkritik haben, und da wir drittens in der Zeit und in sich wandelnden Räumen existieren, ist Inkohärenz der Normalfall, Kohärenz unser dauerndes Fernziel. Kohärenzspannungen mit immer wiederkehrenden Kohärenzverlusten ziehen sich durch unser ganzes Leben und bestimmen dessen Dynamik. Neben der Kohärenzspannung und gelegentlichem Kohärenzverlust spielt unsere zeitliche, räumliche, körperliche und szenische Existenz eine zentrale Rolle, wie oben erwähnt, weil sie uns permanenten Veränderungen aussetzt. In diesem Spannungsfeld sind wir immer durchgehend bestimmt, aber dies Bestimmt-Sein ist ein dynamischer Prozess, in dem wir pausenlos und unaufhörlich versuchen, uns selbst zu bestimmen. Das ist ein nervenaufreibender Wettlauf darum, die Nerven nicht zu verlieren im Agon um die Selbstbestimmung. Dabei müssen wir ständig Konkurrenten aus dem Feld schlagen: physische, psychische, soziale, familiäre Determinanten. In Bezug auf die Tatsache unseres Selbstbewusstseins kann man nicht von Unbestimmtheit sprechen, weil wir ab Geburt schon lernen müssen, uns selbst im Spannungsfeld von spezifischer Bedürftigkeit und Befriedigung zu bestimmen. Dies ist ein Reifungs- und Entwicklungsprozess, der die Annahme eines sich allmählich entwickelnden Selbstbewusstseins notwendig macht. Das impliziert auch Grade und Tönungen des Selbstbewusstseins. Wir bestimmen aber uns selbst immer schon aus einer Bestimmtheit und Bedingtheit heraus, die uns vorgegeben ist in Form eines bestimmten Körpers, bestimmter Bedürfnisse, bestimmter Eltern, Milieus, sozialer und kultureller Umwelten, bestimmter Veränderungen, die wir bewirken oder die mit uns geschehen, wodurch wir auch unsere Geschichte haben. In keinem Augenblick seines Lebens ist der individuelle Mensch das „unbestimmte Tier“ oder das „Mängelwesen“ (es sei denn, er hat eine Behinderung oder muss Mangel leiden). Dieser Eindruck entsteht durch die ontologische Differenz von Individuum und Gattungswesen, die ihren Grund aber nicht darin hat, dass Menschen in Konkurrenz zu anderen Spezies benachteiligt oder nicht festgelegt wären. Im Gegenteil. Die „Andersheit“ des Menschen ist in seiner starken Individualisierung zu suchen. Während es eher „normal“ für andere Spezies ist, dass die Individuen als typische Exemplare ihrer Art stehen, ist das beim Menschen ganz und gar nicht der Fall. Kann man bei anderen Spezies sagen, das Individuum sei wesentlich durch die Gattungsmerkmale festgelegt, und in dieser Hinsicht auch spezialisiert, funktioniert das beim Menschen nicht, jedenfalls nicht ohne gewaltsame Binnenselektion, wie sie im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder versucht wurde. Menschen kommen als hochspezialisierte Individuen zur Welt, als Gattungswesen insgesamt kann man uns daher als Generalisten bezeichnen. Aber die wenigsten menschlichen Individuen sind Generalisten, auch wenn sie ein breites Begabungsspektrum aufweisen mögen. Wir entwickeln schon frühzeitig Neigungen und Interessen, die durch unsere genetische und epigenetische Individualität bedingt sind. Das nicht zu erkennen ist eines der fundamentalen Probleme der Bildungs- und Erziehungssysteme in den Kulturen, deren Ziel darin besteht, das von Geburt an spezialisierte Individuum auf eine fiktive (von Kultur zu Kultur variierende) Gattungsnorm hin zu trainieren. Beispiel: das formale Allgemeinbildungskonzept, das aus Spezialisten Generalisten machen will. Wir kommen also durchgehend bestimmt auf die Welt, wobei zwei der bestimmenden Faktoren unser sich im Laufe des ersten Jahres entwickelndes Selbstbewusstsein ist und das sich allmählich unter dem Einfluss unserer Umwelt und der Sprache formende Selbstbild. Unsere Entwicklung steht unter dem Kohärenzgebot unserer biologischen und kulturellen Lebensformen und die Kohärenzspannungen machen uns schließlich im schlimmsten Fall zu Philosophen, nämlich dann, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns als harmonisches Ganzes zu entwickeln. Das philosophische Streben nach Selbsterkenntnis ist deshalb ein Krisenphänomen, eine Verlustanzeige.
1 Dies Urteil betrifft freilich nur die akademische Philosophie, während die „verwirklichte Philosophie” die politischen und wissenschaftlichen Paradigmen prägte und insofern sehr wirkmächtig war.
2 Beispielsweise wir seien aggressiv oder fair, mitfühlend oder egoistisch, faul oder fleißig, schnell oder langsam, dumm oder superintelligent.
3 In geschlossenen Gesellschaften dagegen steht man unter dem Zwang, das Selbstbild lückenlos zu schließen, was eine Spaltung nach innen fördert.
II
„Notwendige Illusionen“
Drei Metaphern des Sinns
Als Nietzsche (nach Hegel) den „Tod Gottes” bekanntgab, kündigte er sogleich auch noch den „Übermenschen” an. Es schien so, als wäre mit dem alten Gott auch der alte Mensch gestorben. Die „freien Geister” hatten jedenfalls nicht nur – in Nietzsches Lesart - Gott gemordet, sie empfahlen auch den übrigen Menschen den Freitod. Zumindest die Selbstüberwindung. Der Mensch sei das, was überwunden werden müsse, aber nicht im Sinne des alten Ideals, sondern im Sinne der Überwindung all dessen, was bis dato als normativ menschlich galt. Maß, Gerechtigkeit, Weisheit, Klugheit, Glaube, Liebe, Hoffnung, Tugenden: von Kant kategorisch destilliert zu Freiheit, gutem Willen, Vernunft und Würde. Das alte Menschenbild zumindest hatte ausgespielt. Das alte Ideal selbst war zu Fall gekommen. Mit dem Menschenbild aber auch der Mensch. Das alte Gottesbild hatte ausgespielt. Und mit dem Gottesbild auch Gott. Denn Bilder sind lebendig. Wer sie „tötet”, greift die Sache an. So jedenfalls glauben es diejenigen, die die Bilder und Zeichen mit den Sachen verwechseln. Schließlich war die Rede von der Ermordung des Weltschöpfers ein alter Hut. Die Apokalypse hat sie dennoch nicht herbeigeführt. Nur zweitausend Jahre Christentum. Und den Holocaust, die jüdische Apokalypse. Das blieb von zweieinhalb Jahrtausenden religiöser Moralerziehung übrig: die Verleumdung und Rache an den Religionsstiftern und ihren ahnungslosen und unschuldigen Nachkommen. Nietzsche hat nach dem jüdisch-christlichen Gottesbild gezielt, und er hat den Menschen fast tödlich getroffen, weil dies Gottesbild tief in die moralische Kultur der so geprägten Menschheit eindrang. Dies Bild hatte alles in sich aufgesogen: die antike Philosophie, den jüdischen Jahwe-Glauben, die Politik und Gesellschaftsordnung, die Moral, die Natur, die Welt, alles. Wer Bilder angreift, greift die Menschen an, für die die Bilder das Leben sind, weil sie ihr Leben nach ihnen bilden. Daher ist Religions-, Gesellschafts-, Identitäts- und neuerdings auch wieder Weltkritik niemals harmlos, selbst wenn man es mit dem Gestus des aufklärerischen Philanthropen nur gut meint. Und Nietzsche meinte es selbstverständlich nicht gut. Auch nicht böse, selbstverständlich. Aber jenseits von Gut und Böse, jenseits der Gegensätze lauert die gefährliche Dialektik, das abrupte Umschlagen des Guten ins Grässliche, seltener in entgegengesetzter Richtung. In der Regel ohne harmonisierende Synthese, ohne Aufheben des Gegensätzlichen in einem versöhnlichen Dritten. Tertium non datur. Bilderstürmer sind Brandstifter, wenn die Bilder, die sie zerstören, deren Ebenbilder mittreffen. Moral lebt von der Macht der Metaphern, der großen Bilder, mit deren Hilfe wir unser Selbst- und Weltverhältnis bestimmen und einrichten. Unsere Identität als Menschen hängt entschieden von diesen Metaphern ab, von unseren Welt- und Selbstbildern, ohne die wir keine Form fänden, die unserem Leben Sinn gibt: eine Richtung unserer Bildung, einen spezifischen und umfassenden Willen zum So-Sein. Diese Metaphern – Welt, Gott, Ich - zähle ich zu den Sinnkonstituenten des Menschen. So können wir scheinbar nicht anders, als die Bilder mit den Sachen zu identifizieren, denn die Bilder sind unsere tief eingefleischten Ur-Sachen, die uns in die offene Zukunft handeln lassen. Handeln heißt leben. Der Fall Nietzsche und auch, im gleichen monströsen und desaströsen Ausmaß, der Fall Marx zeigen, dass die Bilder aneinanderkleben, dass die Demontage des Gottesbildes mit der aktiven Zerstörung des Menschenbildes einhergeht. Also muss man schon nachfragen: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Gottes-, Welt- und Menschenbildern? Was passiert, wenn das eine von vernichtender Kritik oder sogenannten historischen Umwälzungen beschädigt oder zerstört wird, mit den anderen? Was passiert mit den Menschen, die ihr Leben nach diesen Bildern ausgerichtet, die diese Metaphern „eingefleischt” haben? Machen Menschen das ohne Weiteres mit? Lassen sie sich ihre Idole und Ideale zerstören und leben dann einfach ohne weiter? Mir scheint: Nein! Unklar ist aber vorerst, was historisch und sachlich zuerst kommt: Kritik der Religion, weil ein neues Weltbild bessere Chancen auf Erfolg hat? Kritik des Menschen- und Gesellschaftsbildes, weil ein alter Glaube morsch geworden ist? Kritik des Weltbildes, weil ein neuer Glaube aufzieht? Marx erklärte die Religionskritik zur Grundlage aller Kritik und ging von da zur Gesellschaftskritik über und proklamierte ein neues Menschenbild. Vielleicht ging er aber auch nur methodisch so vor, während sein Ziel schon längst feststand: der alte Mensch muss weg! Voraussetzung dafür ist aber der Siegeszug der Naturwissenschaften und modernen Technologie gewesen. Im Verbund damit: ein neues, materialistisch-evolutionäres Weltbild. Dies war auch für Nietzsche die Grundlage, die das Christentum unglaubwürdig machte und eine Revision des Menschenbildes geradezu notwendig einforderte. Vielleicht stand auch bei ihm die Sehnsucht nach dem „neuen Menschen” im Zentrum. Die Situation ist heute durch die Neurobiologie und die Genetik ähnlich, wenn nicht noch verschärft: die Grundlagen des Menschenbildes des Humanismus’ und der Aufklärung scheinen sich aufzulösen. Die Epoche des „Transhumanismus” scheint aufzuziehen, das von Nietzsche prophezeite Zeitalter des Übermenschen. Auch anlässlich der philosophischen Deklaration des Endes der Welt und aller Weltbilder kann man ins Nachdenken kommen. Markus Gabriels Rede von der „Welt, die es nicht gibt“ gehört eindeutig in diesen Zusammenhang. Man hat noch die theologische Rede von dem „Gott, den es nicht gibt”, im Ohr. Ihre Nähe zur Religionskritik ist offenkundig. Im 19. Jahrhundert wurde das jüdisch-christliche Gottesbild vom modernen Weltbild verdrängt, in dessen Zentrum die sich ziel- und zwecklos generierende Natur steht. Infolge dieses philosophischen Bebens wurde auch das hergebrachte Menschenbild ins Wanken gebracht. Dies ist ein Vorgang, der mit Galileos Galileis „und sie bewegt sich doch” eingeleitet wurde, und mit der Evolutionstheorie, der Psychoanalyse und mit der Neurobiologie seine Fortsetzung fand. Heute hat es den Anschein, als wäre die Welt selbst in die gleichen Existenznöte geraten wie einst Gott. Der „Tod Gottes” machte den Platz für das „absolute Sein” wieder frei; eine metaphysische Stelle war neu zu besetzen. Da ließ die alte Dame Welt sich nicht lange bitten. Sie soll nun weichen, weil die Stellenausschreibung eine Fehlanzeige gewesen war: Der Posten, den die Welt kommissarisch innehatte, war gar nicht frei. Es gibt ihn gar nicht. Und die Frage drängt sich auf: Was macht das mit uns, die wir in einem viel universelleren Sinn die Welt-Metapher „eingefleischt” haben, in einem viel globaleren Sinn die Idee einer realen, objektiv vorhandenen Welt zur Grundlage unserer Selbstverständnisse machen? Meine Vermutung ist, dass es mehrere Verbindungslinien zwischen den Gottes-, Welt- und Menschenbildern gibt, eine starke Vernetzung, die den Schluss stützt, dass sie in gewissem Sinn nicht getrennt ausgebildet und unterhalten werden. Zu dieser Hypothese gehört ebenfalls die Annahme von existentiellen Funktionen, die diese großen Metaphern im Gewebe des psychosozialen Lebens der Individuen und der Gesellschaften möglicherweise haben. Denn es wäre, bei den Kosten der ideologischen Baumaßnahmen, höchst unwahrscheinlich, hätten diese genuin philosophischen Konstruktionen keine existentielle Relevanz, keinen Nutzen oder Zweck. Zwar pflegen alle Menschen grosso modo