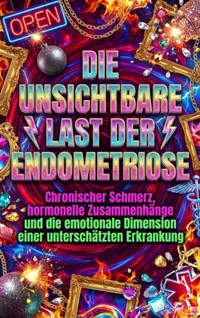12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor Thomas Kühn verteidigt in diesem moralphilosophischen Werk auf persönliche und streitbare Weise seine These, dass die Welt eine moralische Tatsache sei. So argumentiert er u. a. dafür, dass es überhaupt moralische Fakten gäbe - und Moral aber zugleich etwas zutiefst Persönliches sei; dass das Sollen nur vom Wollen her verständlich sei - und dies an die Einsicht in eine wünschbare Welt gebunden sei; und dass Moral in einer umfassenderen Sicht auf die Welt und nicht im Beherzigen und Befolgen von "Normen und Werten" bestehe. Dabei weist er gewohnte Denkformen - wie den Tatsachen-Werte-Dualismus - zurück. Er kritisiert en passant religiöse, deontologische, utilitaristische, naturalistische, tugendethische oder konstruktivistische Moralbegründungsprojekte, indem er Moral wieder in einem metaphysischen Weltverständnis situiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Kühn
Handeln und Sein
Moralphilosophische Essays
© 2019 Thomas Kühn
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-3197-0
Hardcover:
978-3-7323-3198-7
e-Book:
978-3-7323-3199-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Vorbemerkung
Habe Mut, dich deines eigenen Willens zu bedienen – denn er gehört dir. Im Zentrum dieser kleinen Essays zum moralischen Denken steht der Einzelne, steht die Existenz des Einzelnen. Ich bin dennoch überzeugt davon, dass Moral etwas Objektives ist, dass es moralische Tatsachen gibt und dass dem Einzelnen Existenz zugesprochen werden muss, damit er als moralischer Akteur nicht aus dem Blick gerät. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Grundlage der Moral scheint mir der Einzelne in seinem Bewusstsein von sich, den anderen und der Welt zu sein - in Interaktion mit all den anderen Einzelwesen in der Welt. Daher benötige ich einen starken Existenzbegriff, der auch Einzeldingen (Individuen) zukommt und den Begriff der Welt (was aktuell keine Selbstverständlichkeit ist). Diese kleinen Versuche kreisen daher auch – manchmal aus eher subjektiver, manchmal aus einer eher intersubjektiven oder gar objektiven Perspektive heraus (falls diese Attribute sinnvoll sind) – um ontologische Fragen. Schließlich und letztendlich glaube ich, dass Moral weniger mit Werten und Normen, Rechten und Pflichten zu tun hat. Es geht um das In-der-Welt-Sein und das Erkennen, das mit dem Begriff der Wahrheit verknüpft ist. Moral hat also mit dem zu tun, wie jemand sich und die anderen im Ganzen des Seins, des Kosmos oder Universums – in der Welt – erkennt. Und das gilt sogar dann, wenn es keine Welt „geben“ sollte, sondern nur ein Multiversum von unzusammenhängenden „Sinnfeldern“ (Markus Gabriel) oder ohnehin die Welt nur ein Konstrukt eines „realen“ (aber völlig unerkennbaren) Gehirns sei (Gerhard Roth). Es gilt nicht nur „sogar“ dann, sondern sogar dann besonders. Und, was ist Moral? Moral behandelt die Frage, wie wir mit uns und mit den anderen umgehen, wir - als Ich und als Wir - unser Leben als „philosophische Tiere“ im Universum leben wollen. Das Sollen findet daher hier eine ganz eigene und doch wieder ganz zwanglose Definition: das Sollen ergibt sich nämlich aus dem Wollen. Und das Wollen hat wieder viel mit dem Sein (wie wir sind, wie die Welt ist) zu tun. Und um darüber reden zu können, brauchen wir Wissen. Das müssen wir natürlich erkennen. Und anerkennen. Und so dreht sich, auch in der Moral, alles um das Sein (die „Welt) und um die „Wahrheit“ (unser Wissen ums Sein).
I
Postmoralität – Moral für Anfänger
1.
Wenn oftmals behauptet wird, Moral habe etwas mit Normen, Werten, Regeln, Rechten und Pflichten zu tun, ja, wenn dies der allgemeinen Auffassung entspricht, dann sollte man dem nicht einfach widersprechen. Es wird schon etwas daran sein. Aber der Verdacht drängt sich natürlich auf, dass soziale Verkehrsordnungen, die das gesellschaftliche Miteinander regeln, nicht den ganzen Bereich der moralischen Urteile abdecken. Von Platons metaphysischer Idee des Guten, die noch über der Wahrheit stehe, über Aristoteles‘ Arete (Tugend, Tüchtigkeit) als Entelechie des Menschen (seine angeborene, wesensmäßige Zielbestimmung) bis zum Kategorischen Imperativ Kants, über Benthams Lustkalkül bis zur Habermaschen Diskursethik oder den diversen Formen naturalistischer oder konstruktivistischer Ethiken – das moralische Denken eröffnet uns ein riesiges Kaleidoskop verwirrender Definitionen und Begriffe. Mal erscheint einem das Moralische als extrem simpel, als „selbstverständlich“, dann wieder als Verwirrspiel und Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Moralische Urteile können auch über die Existenz oder Inexistenz von Entitäten entscheiden: Für viele Menschen ist die Gottesfrage eine solche moralische Existenzfrage. Neuerdings ist auch wieder die Weltfrage – existiert die Welt? – dazugekommen.
2.
Moralische Urteile bezeichnen etwas oder jemanden als „gut“, „schlecht“, „böse“, „richtig“, „wert“ oder „unwert“ u. ä. und verknüpfen mit diesen Urteilen Handlungsaufforderungen: ein Handeln sei geboten, verboten oder erlaubt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von sprachlichen Nuancen, die ein Handeln oder eine Person als passend, schicklich, abstoßend, scheußlich, mitfühlend, rücksichtslos, hilfsbereit etc. beurteilen: all dies fällt natürlich auch in den Bereich der moralischen Urteile. Wenn in besonders unglücklichen Momenten das ganze Universum als Ort des Schreckens erscheint, dann handelt es sich um ein moralisches Urteil. Wenn im Glückstaumel einem plötzlich eine höhere Sinndimension aufleuchtet, die das Ganze des Seins als gut erscheinen lässt, dann handelt es sich auch um ein moralisches Urteil. Wenn Wittgenstein im Tractatus behauptet, die Welt des Glücklichen sei eine andere als die des Unglücklichen, dann ist das ein moralisches Urteil, denn auch Glück und Unglück (ob als Erfüllungs- oder Empfindungsglück) sind moralische Kategorien („Tugendglück“). Auch wenn Mephisto in Goethes „Faust“ meint, dass alles, was entstehe, wert sei, dass es zugrunde gehe, fällt er ein moralisches Urteil. Moral ist auch etwas Anderes als pragmatische Reziprozität und Universalität. Moral hat es nicht ausschließlich mit der Möglichkeit des Altruismus zu tun, auch nicht immer mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, ja nicht einmal nur mit der Frage, wie wir leben sollen oder wollen. Moralisches Denken wird da eigentlich erst interessant, wo es über die Grenzen der Erfahrung hinauswill, um ein Gesamtbild des Lebens, ja des Seins zu entwerfen.
3.
Ohne Nietzsche hätte ich vermutlich moralisches Denken nicht wirklich als Problem ernstgenommen. Auch jetzt denke ich selten spontan über Moral nach und frage mich noch seltener, ob ich richtig geurteilt oder gehandelt habe, ob ich hätte anders handeln können oder sollen oder nach welchen Zielen ich im Leben strebe oder streben sollte, nach welchen Maximen ich handle oder handeln sollte. Jedenfalls bringt mein Nachdenken selten nützliche Ergebnisse hervor – und ich habe auf keine der oben genannten Fragen eine generelle oder spezielle Antwort. Dennoch existiere ich fort und zwar als ein moralisch Denkender und Handelnder. Zweifel kommen mir erst, wenn die Perspektive des Anderen in meinem Denken Platz nimmt. In jüngeren Jahren – als Kind und Jugendlicher, auch noch als junger Erwachsener - habe ich mich allerdings sehr mit solchen Fragen herumgequält, aber weniger, weil ich die Forderungen der reinen praktischen Vernunft für unabweislich hielt, sondern weil mich die moralischen Urteile meiner Mitmenschen gequält und provoziert haben, weil das Leben sich als Füllhorn unlösbarerer Probleme präsentierte und weil ich mich pausenlos fragen musste, welche Rolle ich wohl auf dem stürmischen Meer spielen sollte, als das sich mein Leben darstellte. Moralisches Denken war eher ein Suchen nach Worten für mein Erleben meiner Realität, ein Suchen nach möglichen Identitäten und Haltungen. Und eine Verteidigung gegen die Anmaßung anderer Menschen, sich in meinem Denken einzunisten. Als Kern moralischen Denkens habe ich die Frage empfunden, ob Leben sich lohnt. Oder: Das ob das „Sein hat Sinn“ eine sinnvolle Formulierung ist. Mit Camus hätte ich sagen können, dass die einzige philosophische Frage die nach dem Sinn des Lebens bzw. nach dem Unausweichlichen des Selbstmordes sei und alles andere Beiwerk sei, das später komme. Ob nicht nur mein Leben, sondern das Sein selbst einen Sinn habe. Dabei hatte das Wort „Sinn“ selbst keinen bestimmten Sinn, sondern umfasste eine ganze Reihe von Erwartungen an das Leben: verständlich, widerspruchfrei, gelingend, ohne Kriege, Kämpfe und Konflikte, die in ihrer Absurdität grauenvoll waren und sind; vor allem auch sagbar und zusammenhängend zu sein. Augenblicke des Glücks, der Fülle, des Könnens und Gelingens, der Schönheit und Güte schienen den Weg zu weisen. Im Übrigen kann und muss man die Sinnfrage präzisieren und klären, nach welcher Art von Sinn man fragen will: nach einem religiösen, ästhetischen, moralischen, wissenschaftlichen, hermeneutischen Sinn? Kinder kommen schon aufgrund eines einfachen Schlusses zu dem Ergebnis, dass das Leben keinen Endzweck kennt, also kein Ziel und damit keinen Richtungssinn hat. Ebenso kommen sie zu dem einfachen Ergebnis, dass das Sein keinen Ursprung haben kann. Es ist die Warum- und die Wozu-Frage – (potentiell) unendlich iteriert. Kinder haben auch moralische Intuitionen, die in ihrer ungetrübten Klarheit a priori gewiss erscheinen: Das Miteinander erfordert Gerechtigkeit als Gleichheit und Selbstbestimmung für jeden (mein Sohn Felix, 4 Jahre alt). Dies Denken, das in der Kindheit beginnt, eröffnet den unendlichen Bereich der metaphysischen Phantasie, in die immer moralische Intuitionen mit verwoben sind. In diesen Phantasien geht es um Macht und Recht, Unsterblichkeit und Tod, Gewalt und Hilfe, Endlichkeit und Unendlichkeit, Rache und Vergebung – der Stoff, aus dem die Götter- und Heldensagen sind, die Religionen und die großen Tragödien der Literatur und der menschlichen Geschichte. In der sozialen Welt des Alltags allerdings unterliegt jede Lebensäußerung dem moralischen Urteil durch die Umwelt, der Billigung oder der Missbilligung durch den Blick der Anderen auf das Äußere des Lebens.
4.
Das fremde Urteil über mich - sei es erfreulich oder nicht – hat mich schon immer befremdet, starke Gefühle unterschiedlichster Art in mir entfacht, je nachdem, ob es sich mit meinem Urteil deckte oder nicht. Lob und Tadel, Kritik und Wohlwollen, Ablehnung und Zustimmung: diese moralischen Urteile schossen mir in jeder zwischenmenschlichen Begegnung, in jeder auch noch so kleinen Geste und Redewendung, in jeder Handlung entgegen und veränderten im Augenblick mein Denken, Fühlen und Handeln. Aber vor allem mein eigenes Wollen. Selbst mein Können. Unter dem Blick des Anderen verlor ich sogar grundlegende Fähigkeiten. Als moralischer Seismograf musste ich registrieren, dass Werturteile oft ein Chaos in mir verursachten und mein Wollen manchmal paralysierten. Obwohl ich vermutlich kein typischer Fall bin, meine ich doch, meine Erfahrungen verallgemeinern zu können: Die Wertungen, die wir empfinden und empfangen, beziehen wir in einem Ausmaß auf unsere gesamte Existenz oder die der anderen Menschen, ja mitunter sogar auf die Existenz der Welt, dass man zu dem Schluss gedrängt wird, dass moralische Urteile im Grunde ontologische Urteile über das Sein und Nichtsein von Handlungen, Personen, Eigenschaften oder Ereignissen und Situationen sind – und zwar aus der Sicht ihrer Wünschbarkeit. Von Handlungen oder Personen, die man moralisch verurteilt, wünscht man, dass sie nicht oder anders existieren mögen. Und umgekehrt wünscht man sich für moralisch wertgeschätzte Personen und Handlungen gleichsam ewiges Leben. Normative Urteile sind im Unterschied zu deskriptiven Urteilen darüber, was der Fall ist, Urteile darüber, was der Fall sein soll. Also sind moralische Aussagen Ausdruck eines Wunsches oder stärker eines Wollens, das sich auf ein künftiges Sein bezieht. Moralische Aussagen urteilen darüber, was (künftig noch oder erst) sein soll und was nicht. Man kann die Frage, was Moral sei, so beantworten: In der Moral stellen wir uns die Welt so vor, wie wir sie uns wünschen, wie wir sie wollen. Oder anders formuliert: Wir betrachten die Welt als moralisch richtig, insofern wir sie uns wünschen, sie wollen. Wichtig ist der Weltbezug, denn moralisches Denken betrachtet die „Welt als Wille und Vorstellung“. Einerseits. Andererseits ist dem moralischen Sinn die Welt ein unendliches offenes Feld des Sinns und des Glücks, des Absurden und der Verzweiflung. Moralische Urteile bestimmen nicht nur unser Verhältnis zu bestimmten Personen oder einzelnen Handlungen, sondern auch unser Verhältnis zu umfassenderen und komplexeren Entitäten wie die Bewohner einer Stadt oder eines Landes, die Angehörigen einer Kultur, Ethnie oder einer Epoche, schließlich der ganzen Menschheit, ja, der gesamte Kosmos. Wir überziehen alles, was wir als gleichartig betrachten, mit gleichartigen moralischen Urteilen und urteilen dabei meist sehr ungerecht. Beispielsweise, wenn wir in der soziokulturellen Begriffsbildung menschliche Individuen zu Klassen, „Rassen“, homogenen Mengen zusammenfassen und bejahend oder verneinend aburteilen. Ich habe in jungen Jahren auch die Existenz der Welt und ihr vermeintliches Wesen als moralisches Problem empfunden. Ich habe mein eigenes Schicksal verflucht und es in den Zusammenhang mit der Beschaffenheit der Welt gebracht und mir beider Inexistenz gewünscht. Warum? Weil ich die Welt als moralisches Chaos und mein Dasein als moralisches Leiden (als „notwendige Last“) erfuhr. Von Nietzsche kann man lernen, dass – was er bestreiten wollte – die Welt selbst ein moralisches Problem darstellt. Er wollte dies Problem ästhetisch lösen. Warum? Weil er glaubte, dass die moralische Sicht auf die Welt im Grunde eine theologische Fälschung des Originals sei und aus dem „Tod Gottes“ folglich das Ende des moralischen Dualismus von Gut und Böse resultiert. Ohne Gott sei die Welt jenseits von Gut und Böse. Er hat sich geirrt. Die Welt persistiert als moralisches Problem auch nach dem Tod Gottes und es lässt sich nur moralisch lösen – jenseits von „Übermensch“ und „Ewiger Wiederkehr“.
5.
Was moralisch wünschenswert ist oder verurteilt wird, hängt allerdings auch an der Person des Urteilenden. Moralische Autorität ist die Bedingung für die Wirksamkeit eines moralischen Urteils. Kinder sind vom moralischen Urteil anderer, die meist eine höhere Autorität genießen als die eignen, in einem Ausmaß abhängig, das sie zu Spielbällen fremder Urteile macht –. Ganze Lebenspläne erwachsener Menschen gründen sich auf Urteile, die sie in Kindertagen von anderen erhalten haben. Das kann über Wohl und Wehe, Sein und Nicht-Sein einer ganzen Existenz entscheiden. Autorität ist aber etwas, was zugeschrieben wird; sie ist ebenfalls eine moralische Kategorie. Dass moralische Urteile an Personen gebunden sind, verwundert nicht, stellen sie doch Zustimmung oder Ablehnung dar, die nur von Wesen stammen können, die beider fähig sind. Moralisches Urteil ist an den sozialen Status der Person gebunden. Das bedeutet nicht, dass nur ältere, erfahrene, in der sozialen Hierarchie hochstehende Personen moralische Autorität besitzen. Wenn Kinder ihr Unglück klar bekunden, besitzen sie auch moralische Autorität, die bezwingend wirken kann.
6.
Dass moralische und (kontrafaktische) ontologische Urteile ein geheimes Leben unter der sprachlichen Oberfläche teilen, ist nicht verwunderlich. Moralische Urteile können retrospektiv auf erfolgtes Handeln affirmativ oder negativ reagieren – oder präskriptiv noch nicht erfolgtes Handeln fordern, erlauben oder verbieten. Moralische Urteile entwerfen ja nicht nur ein gewünschtes Handeln oder Sein, sondern eine andere Welt. Sie erzeugen vor allem einen neuartigen Typ von Tatsachen: moralische Tatsachen. Denn alle Handlungen, sofern sie moralischer Natur sind, erzeugen Tatsachen, die ontologischer Natur sind.
7.
Ich empfinde die Fragen nach den Normen, Werten, Regeln, Rechten und Pflichten als oberflächlich und als mir gleichsam äußerlich. Vermutlich geht es den meisten Menschen so. Man handelt weitestgehend nach dem Prinzip: Moral versteht sich von selbst, jedenfalls die eigene. Die allgemeinen Normen und Werte beziehen sich mehr oder weniger auf die lästigen Pflichten des Miteinander oder eben darauf, vor fremder Willkür geschützt zu sein („Rechte“). Die Moral scheint etwas zutiefst Persönliches, Erlebtes zu sein, etwas, das sich wandelt, entwickelt, über das man ungern und selten spricht. Vermutlich, weil man nicht weiß: wie? Daher kennt man sie nicht genau und hält ihre Ergründung zwecks besserer moralischer Entscheidungsfindung für so überflüssig wie die Lektüre der Duden-Grammatik, die angeblich „unentbehrlich für richtiges Deutsch“ sein soll. So sind viele Konflikte zwischen Menschen moralische Konflikte, die daraus resultieren, dass jeder Moral für sich in Anspruch nimmt und zwar seine eigene. Dagegen geht die differenzierte „ethische Reflexion“ im Alltag gewöhnlich unter. Muss ich Goethes Diktum nicht zustimmen: Der Handelnde sei gewissenlos? Im Handeln verlasse ich mich meist auf eine grobe Realitätseinschätzung und – kontext-, und adressatensensitive – moralische Faustregeln, die keine exakte Analyse überleben würden. Bin ich von Leidenschaften getrieben, funktioniert der Tunnelblick tadellos und alle Faustregeln („Maximen“) gehen über Bord. Dennoch reizt mich die Herausforderung des moralischen Denkens: Was ist das überhaupt? Auch auf die Gefahr hin, als unmoralisch zu erscheinen, stelle ich ein paar Fragen und stelle ein paar Vermutungen an.
8.
Moral lässt sich nicht begründen, schon gar nicht denen gegenüber, die sie nötig hätten. Und nur für die sind die Begründungen ja gedacht. Die Diebe, Lügner, Betrüger, Mörder von (nicht unter) uns – klauen, lügen, betrügen und morden weiter, trotz all der schönen, ausgefeilten Moralbegründungen. Recht haben sie. Der Vorwurf der Irrationalität berührt sie nicht. Denn die Gründe für das moralische Denken sind allesamt fragwürdig. Das ist traurig und schade, aber leider nicht zu ändern. Es sei denn, wir überlegen, warum jemand so etwas tut und versuchen, die möglichen Ursachen für solch ein Handeln zu beseitigen. Die Motivation ist das A und O des moralischen Handelns. Was ich soll, hat immer mit dem zu tun, was ich will – und umgekehrt. Hinter jedem Sollen steht ein eignes oder fremdes Wollen. In dem einen oder anderen Fall kann man nach der Herkunft, der Quelle des Wollens – das als Sollen, als Forderung, erscheinen kann - fragen. Dabei spielen auch Gründe, nicht nur Ursachen eine Rolle – jedenfalls in den Handlungsbeschreibungen. Gründe zum Handeln sind aber niemals ohne Bezug auf natürliche oder soziale Gegebenheiten. Gründe sind immer empirisch imprägniert, ohne indes den Rang von Naturbeschreibungen zu haben. Und sie haben nicht den Gesetzescharakter von Naturgesetzen, da sie sich immer auf das menschliche Handeln aus der Ich-Perspektive beziehen und sie sich immer als Modalaussagen rekonstruieren lassen, in denen ein Modalverb vorkommt (wollen, müssen, können, dürfen…). Selbst wenn über das Handeln einer dritten Person berichtet wird, wird in der Beschreibung ein (nicht grammatischer, sondern mentaler) Perspektivwechsel hin zur ersten Person Singular vollzogen: Peter geht zum Bäcker, weil er Brötchen kaufen will. Was Peter will, weiß aber nur Peter, da nur Peter Urheber und Inhaber seines Willens ist. Erzähltechnisch nennt man diesen Trick personale Erzählperspektive: die Innensicht wird aus der Außensicht erzählt. Aus diesem Grund können Handlungsgründe auch niemals den Charakter einer objektiven Notwendigkeit haben. Gründe zum Handeln sind immer kontingent (zufällig, bedingt), jedes Wollen, also auch jedes Sollen ist hypothetisch, da es eben weder göttlichen Geboten, einem metaphysischen Sittengesetz oder dem kategorischen Imperativ je gelungen ist, restlos zu überzeugen. Denn was soll beispielsweise ein kategorisches Wollen bedeuten? Umgangssprachlich würde man sagen: jemand wolle etwas unbedingt. Ebenso wenig gibt es ein unbedingtes Sollen, wenn es kein unbedingtes Wollen gibt. Aus dem bedingten Willen folgt immer ein bedingtes Sollen.
9.
So wenig wie jemand Italienisch lernen kann, der nicht über eine angeborene Sprachfähigkeit verfügt, kann jemand „Moralisch“ lernen, ohne angeborene Moralfähigkeit. Man glaubt es kaum, aber auch Mörder und Diebe rechtfertigen ihre Handlungen moralisch. Nur eben in einem anderen Dialekt. Das Geben von Gründen mit dem Ziel, andere (oder sich selbst) zu überzeugen, ist das Geschäft des Begründens. Das ist die Tätigkeit, die normalerweise der Vernunft zugeschrieben wird. Ich sage nicht, dass es keine guten Gründe gibt, nicht zu lügen oder Kinder nicht zu missbrauchen. Obwohl es besser wäre, gar keine Gründe nötig zu haben, dergleichen nicht zu tun. Es gibt viele gute Gründe dagegen, wahrscheinlich sogar mehr als es dafür gibt. Aber gute Gründe sind keine zwingenden oder notwendigen Gründe. Notwendig nenne ich Gründe dann, wenn sie in jeder möglichen moralischen Welt gleichermaßen notwendig wären. Da man sich aber eine Welt denken kann, in der alle Menschen wie es ihnen gerade passt lügen (es ist unsere Welt), kann an dem Argument von Kant, dass Lügen als allgemeines Gesetz sich logisch ad absurdum führe, etwas nicht stimmen. Es lügen ja alle Menschen hin und wieder, nicht einmal selten, aber natürlich auch nicht immer. Abgesehen davon ist die Idee, Lügen zum Gesetz zu erheben, um es ad absurdum zu führen, gar nicht nötig. Man braucht das Lügen nur zu erlauben – der Effekt ist aber der Gleiche; es erlaubt sich nämlich schon jeder selbst. Dennoch gerät das Prinzip, dass Wahrhaftigkeit besser sei als Lügen, darüber nicht ins Wanken. Einen zwanglosen Zwang des besseren Arguments gibt es leider nicht, wenn der Gesprächspartner stur bei seiner „Meinung“, seiner Weltsicht bleibt, in der Lügen eben gut („klug“) und Pädophilie erlaubt („schön“) ist. Die betreffenden katholischen Priester wussten schließlich sehr genau, was sie nach herkömmlichen Moralstandards taten – sie sind ja ausgewiesene Profis im moralischen Denken…
10.
Ebenso wie die Gläubigen sich daran gewöhnen mussten, dass sie ohne notwendige und hinreichende Gründe an Gott glauben, müssen diejenigen, die moralisches Denken für wichtig halten, akzeptieren, dass sie dafür auch keine notwendigen und hinreichenden Gründe haben. Die Mörder usw. übrigens auch nicht. Moraltheorie – Ethik – hat es mit der Analyse und Begründung moralischer Urteile und Handlungen zu tun. Im Lauf ihrer Geschichte wurde immer wieder versucht, moralische Forderungen in einem strikten Sinn so zu begründen, so dass sie zwingend und unbedingt erscheinen. Die theologische Begründung ist dabei die konsequenteste, weil sie das moralische Sollen kosmisch dimensioniert. Aufgrund des antiken bzw. mittelalterlichen Menschenbildes, demzufolge der Mensch vereinfacht gesagt aus zwei Hälften besteht, der Vernunft (Geist, Seele) und dem Körper, haben sich im 18. Jahrhundert zwei große Moralkonzepte herausgebildet, die Moralphilosophie Kants, die die Moral durch die Vernunft begründet (Deontologie) und der Utilitarismus, der die Moral durch den Körper (Lust) begründet (Teleologie, Konsequentionalismus). Beide Positionen verzichten auf eine externe Moralbegründung durch ein Prinzip, das dem Menschen äußerlich ist (Gott, Evolution). Die Moralbegründung erfolgt intrinsisch durch die menschlichen Eigenschaften, also auf der Grundlage eines Menschenbildes. In dem einen Fall ist die Vernunft die differentia specifica, durch die das Menschsein definiert sei. In dem anderen Fall ist das Luststreben etwas, wozu der Mensch von Natur aus strebt. Kant führte den Gesetzescharakter des moralischen Sollens auf das Universalisierungsgebot bezüglich praktische Handlungsmaximen zurück. Bentham u.a. führten moralische Pflichten auf das Maximierungsgebot der Lust zurück. In beiden Fällen wurzelt das moralische Sollen im Wollen. In beiden Fällen wird das individuelle Wollen verallgemeinert – genau dieser Schritt sei eben das Moralische (im Gegensatz zum egoistischen, selbstbezüglichen Partikularwillen) und führe zum Sollen. In beiden Fällen führte die Einsicht in die Allgemeinheit von Gründen – gute Gründe seien unabhängig von dem, der sie vorbringt – zum Glauben, damit unwiderleglich das Fundament der Moral entdeckt zu haben: im Subjekt selbst, in seiner Natur (Kant) und in seinem angeborenen Streben (Bentham). In beiden Fällen wurde aber das Motivationsproblem unterschätzt: Was bewegt Menschen dazu, ihr Handeln nach allgemeinen Regeln auszurichten, wenn – wie sowohl Kant als auch Bentham annehmen – Menschen nur egoistisch-sinnlich motiviert seien? Wäre die Motivation nicht egoistisch, dann bräuchte es keine Moral. Da menschliche Motivation aber egoistisch ist, nützt keine Moral. So der Schluss. Schopenhauer erkannte das Motivationsproblem und stellte es ins Zentrum seiner Überlegungen. Da er außerdem davon ausging, dass die Motivation im Willen liegen muss, der im ganzen Universum als ursprüngliche Triebkraft wirkt, lag die Lösung für ihn auf der Hand: Da der eine Wille in jedem Individuum der gleiche sei, sich aber durch die Individuation aufspaltet, kommt es zu Konflikten und folglich Leiden (der metaphysische Wille blockiert sich selbst). Um die Blockade aufzuheben (das Leiden), müssen die vereinzelten Willensfragmente zusammenwirken. Schopenhauer nannte dies Mitleiden. Heute sagt man Empathie dazu. Durch die Jahrhunderte der Herrschaft christlicher Moral aber war der individuelle Wille als Träger des Bösen verpönt und wurde unterdrückt. Die Überlegung muss daher erlaubt sein, ob nicht gerade die traditionellen Moralen den Egoismus nicht noch gefördert haben (religiöse Moral, die mit der Angst vor Höllenstrafe droht oder unsere alltägliche Moralerziehung, die mit Angst vor Strafe erzieht). Kant ersetzte schließlich die antiquierten Konzepte von Geist und Seele (als die göttlichen Organe) durch die Vernunft, deren Wesen er als universelle Einheit ohne Widersprüche und empirische Beigaben auffasste. Dass der an ein Subjekt gebundenen Vernunft und ihren allgemeinen Gründen schließlich ganz das Vertrauen entzogen wurde und stattdessen eher der „Vernunft“ (im Sinne von Rationalität, Gesetzmäßigkeit) in der Geschichte (Marxismus) oder in der Biologie (Faschismus) vertraut wurde, lag natürlich an dem Vordringen des wissenschaftlichen Ideals in die Sphären des Menschen. Als Träger der historischen oder biologischen Gesetze wurden nun pseudowissenschaftliche, umfassendere Entitäten postuliert – Klassen und Rassen -, die als Agenten und eigentliche Handlungsträger in der Geschichte herrschen. Im 19. Jahrhundert wurde das Individuum als Quelle der Moral durch kollektivistische Moralideen verdrängt. So kategorisch das Auftreten der praktischen Vernunft auch war, als sie das Licht der Welt erblickte, so kläglich war ihr Stimmchen im Orkan der Weltrevolution und der beiden Weltkriege. Die Frage, was Menschen bewegt – motiviert –, scheint also die vordringlichere moralische Frage zu sein, nicht, wie man Moral begründet. Auch scheint die Annahme, Moral sei an die Existenz von individuellen Personen gebunden, nicht sehr überzeugend für diejenigen gewesen zu sein, die Moral und Individualismus als bürgerliche Dekadenz diffamierten (übrigens auch ein moralisches Urteil und zwar ein vernichtendes). Verblüffend ist: Menschen handeln nie ohne Überzeugung von der Richtigkeit ihres Tuns. Zweifel und Bedenken wirken eher als Bremsen. Was uns bewegt, ist nicht immer das, was uns die Vernunft rät. Gerade der Faschismus war und ist von der Überzeugung getragen, dass die Vernunft irrt, nein lügt, dass sie nur ein Werkzeug der Triebe, eine Sklavin der Affekte, ein virtuelles Produkt neuronaler Schaltkreise sei. Man kann also den ganzen Bereich der Moral moralisch diffamieren (Lüge, „Überbau“, Illusion), ohne sich zu widersprechen, jedenfalls ohne, dass diejenigen, die den Widerspruch bemerken, großartig dagegen opponieren konnten. Denn beide Massenbewegungen – der Marxismus und der Faschismus – waren sich in der Ablehnung der herkömmlichen Moral und des Individualismus allzu einig. Moral setzt immer die Gleichheit und die Singularität aller Menschen („Personen“) voraus. Wird dies Prinzip – aus welchen „höheren“ moralischen Gründen auch immer – aufgegeben, verschwindet die Moral aus dem Leben und übrig bleibt der Kampf aller gegen alle.
11.
Wer eine der folgenden Thesen vertritt, verlässt den Bereich des moralischen Denkens zwar nicht, aber er verirrt sich leicht in dessen Schattenseiten: 1. Menschen lassen sich in unterschiedliche Güteklassen einordnen, denen unterschiedliche Werte zukommen. 2. Nicht die menschlichen Individuen handeln, sondern „Systeme“, „Klassen“, „Rassen“, „DNA“, „Gehirne“. 3. Moralische Werte sind Instrumente der Herrschenden (siehe 2.). Normalerweise werden alle drei Positionen zugleich vertreten. Alle drei sind falsch, werden aber gelegentlich sehr überzeugend behauptet. Dabei lassen sie sich alle sehr leicht widerlegen: (1) Natürlich sind die Menschen extrem verschieden, es gibt auch bestimmt einige, die nichts taugen. Aber es gibt keine natürlichen Güteklassen, denen ein objektiver Wert zukäme. Wenn eine solche Klassifikation vorgenommen wird, dann in Hinblick auf einen bestimmten Zweck, auf ein bestimmtes Interesse. Wer Güteklassen unter dem Merkmal „hervorragende/r Physiker/in“ einrichtet, kommt zu einem anderen Ergebnis als wer das Merkmal „hervorragender Killer“ anwendet (mit Überschneidungen, s. Juli Zehs „Schilf“). (2) „Systeme“, „Rassen“ und „Klassen“ können nicht in Sprechakten Absichten bekunden. Absichten sind aber die Grundlage von Handlungen. (3) Moralisches Denken ist per se gegen einseitige Herrschaft von Menschen über Menschen gerichtet und kann sie nicht legitimieren (oder nur unter Zuhilfenahme von Ad-hoc-Annahmen). Aber auch, wenn die kollektivistischen Moralkonzepte in den geschichtlichen Alptraum geführt haben: Etwas stimmte nicht an der bisherigen Moralbegründung. Gott, der stimmte natürlich nicht. Aber der war nicht das einzige Problem. Der Mensch als Grund – das war das Problem. Wie konnte Kant nur Moral auf das Sein-Sollen des Menschen gründen?
12.
Kant begründet die Notwendigkeit moralischen Urteilens und Handelns auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, die im Grunde erst durch Hans Jonas‘ Essay über „Das Prinzip Verantwortung“ explizit zum Ausdruck kommen sollte: Moral wurzelt in einem einzigen Imperativ: dass die Menschheit sein solle. Dies ist der Felsen, an dem sich Kants Spaten zurückbiegt. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund, warum es Menschen gebe sollte. Es gibt keinen Grund, warum es überhaupt etwas geben sollte. Zum einen hat Kant in seinen Antinomien die Unmöglichkeit nachgewiesen, kohärente Begriffe der Welt, der Freiheit und der Natur-Notwendigkeit zu konzeptualisieren. Schopenhauer hat dann in seiner bahnbrechenden Arbeit „Über die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde“ überzeugend nachgewiesen, dass die Ausdehnung des Kausalprinzips über den Horizont der Erfahrung hinaus nur logischen Unsinn produziert. Wir wollen über die Grenzen der Erfahrung hinausdenken, wir können es aber nicht. Diese grundlegende Einsicht hatte bereits Kant in seiner Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft festgehalten. Die Annahme, dass es einen Grund geben sollte, warum überhaupt etwas existiert, transzendiert jede Erfahrung und ist übrigens schon moralischer Natur und unterstellt, dass die Welt nur als moralisches Phänomen gerechtfertigt werden könne. Das bedeutet aber – glaubte man -, dass als Grund nur eine Person in Frage kommt, die sich im Handeln Zwecke setzt und dass die Handlungsfolge in diesem besonderen Fall die Existenz der Welt sei. Offenkundig ist die Frage nach dem Grund der Existenz von dem Typ, der bislang stets von theologischen Konstruktionen beantwortet wurde – und zwar quer durch alle Epochen und alle Kulturen hindurch. Das bedeutet nicht, dass diese Annahme wahr sein müsse. Aber es bedeutet, dass das menschliche Denken immer wieder an die gleiche Grenze gerät, jenseits derer die Phantasie beginnt. In der Frage nach dem Grund des Seins wird schon eine transzendente Person präsupponiert, denn nur Personen haben Gründe. Nach der Ursache kann man eben so wenig fragen, denn Ursachen sind eben selbst schon „Sachen“, die es geben muss. Tatsächlich ist das der blinde Fleck der Vernunft, an dem sich immer wieder diverse Schöpfungen der Vorstellungskraft tummeln. Aber genau dieser blinde Fleck, dies Mysterium des Seins, seine Grundlosigkeit, ist die Wurzel der Moral. Nicht wir sind frei. Das Sein ist frei. Das Sein, einschließlich des materiellen Universums, ist in seiner Grund- und Bedingungslosigkeit frei. Kant hatte bekanntlich die Bedingung der Möglichkeit praktischer Vernunft, die Freiheit bzw. Autonomie des menschlichen Denkens und Urteilens, zugleich als Bedingung der Möglichkeit moralischen Handelns gefasst: Man kann sich ja durchaus fragen, warum Freiheit die Bedingung von Moral sein sollte. Die üblichen Antworten gehen meines Erachtens am entscheidenden Punkt vorbei: Weder das Andershandeln-Können noch die Urheberschaft oder die Zurechenbarkeit sind an die Freiheitskonzeption geknüpft bzw. Bedingung für Moral. Kants Antwort ist doppeldeutig: Frei sei der Mensch als Selbstzweck, denn er solle nicht als Mittel zu einem weiteren Zweck dienen (jedenfalls nicht ausschließlich). Jenseits des Menschen kommt, so Kant, nichts mehr. Das sei sein unendlicher Wert, seine Würde. Wert hat etwas nämlich nur als Grund für ein Streben, ein Wollen. Da der Mensch aber keinen Zweck hat, keinen Wert, keinen Sinn – außer er will sich selbst, strebt nach sich selbst, setzt Kant kurzerhand den Menschen zum Ziel des Menschen. Daher das Selbstmordverbot bei Kant im Anschluss an die christliche Tradition. Das Fundament der Moral – warum der Mensch für sich und die anderen da sein und handeln soll – ist die Existenz des Menschen. Ist das überzeugend? Der ontologisch-metaphysische Zugang scheint mir sinnvoller: Weil das Sein nicht notwendig ist, ist es frei. Moralisch denken wir erst, wenn wir unsere ontische Freiheit entdecken, wenn wir uns die Grund- und Sinnlosigkeit des Seins klarmachen. Dann erst wissen wir, dass wir – jeder für sich – frei sind, das Sein in seinem So-Sein zu wollen. Der erste und letzte moralische Grundsatz muss also lauten: Anerkenne, was ist! Im Übrigen: Die Würde, die Kant dem Menschen ob seiner Freiheit zuschrieb, kommt dem Sein selbst zu.