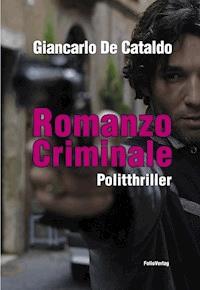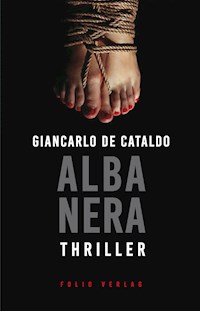Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1960er-Jahre: Woodstock, Blumenkinder, rebellische Jugend – ein Agent soll sie manipulieren. Die westliche Jugend ist in Aufruhr, sie ruft nach einer neuen Gesellschaftsordnung. Eine unsichtbare Macht will die Bewegung vernichten. Der amerikanische Anwalt Flint kontaktiert einen römischen Autor und erzählt ihm die "wahre" Geschichte eines Mannes: Jay Dark. Dieser soll Chaos stiften und die Szene der Rebellierenden mit Drogen überfluten, damit sich der Protest im LSD-Rausch verliert. Wer ist Jay Dark? Superhirn, Agent Provocateur, Hand des Bösen? Flint entfaltet ein Szenario von internationaler Dimension: fehlgeleitete Nachrichtendienste, alte Nazis als Strippenzieher, Menschenhändler, Terroristen und korrupte Polizisten – Sex, Ideale, Rock 'n' Roll und Drogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GIANCARLO DE CATALDO
DER AGENTDES CHAOS
ROMAN
AUS DEM ITALIENISCHEN VON KARIN FLEISCHANDERL
Inhalt
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Wie Jay Dark zur Welt kam
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Doktor Kirk und die Theorie des Chaos
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Harvard und Umgebung
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Wholly Communion
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
California Dreamin’
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Der Agent des Chaos
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Fuck-the-Rat
Rom, heute
Die wahre Geschichte Jay Darks, von Anwalt Flint erzählt
Der Anfang vom Ende und das Ende vom Anfang
Epilog
Rom, heute
Rom, heute
– Tot? Jay Dark? Haha! Meiner Meinung nach ist der Hurensohn noch immer quicklebendig. Wie immer richtet er irgendwo Schaden an.
Anwalt Flint hatte eine heitere, wohlklingende Stimme. Er war ein großer, hagerer älterer Herr, trug einen eleganten grauen Anzug und eine gestreifte Regimentskrawatte, hatte dichte schneeweiße Haare und blaue Augen, sein Blick war abwechselnd kalt und spöttisch. Er war entweder sechzig und schon etwas gebrechlich oder fünfundsiebzig und in Hochform. Behände lief er über die Wege des Monumentalfriedhofs Verano und rauchte eine lange kubanische Zigarre. In der Hand hielt er die englische Ausgabe meines letzten Romans: Blue Moon.
Wir trafen uns zum ersten Mal persönlich.
Einige Zeit davor war ich zufällig auf die Geschichte von „Jay Dark“ gestoßen. Über sein abenteuerliches Leben gab es zwar zahlreiche Geschichten und Gerüchte, doch sehr wenige Aussagen aus unmittelbarer Kenntnis. Die Quellen, wenn man sie überhaupt so nennen wollte, waren zumeist zweifelhaft und aus dritter Hand, sie bestanden fast ausschließlich aus Blogs, die von Anhängern der wildesten Verschwörungstheorien betrieben wurden. Von Leuten, die glaubten, Neil Armstrongs Mondlandung sei ein von der NASA inszenierter Betrug, oder der Mossad habe den Terroranschlag 9/11 in Auftrag gegeben, um Osama Bin Laden, einem Unschuldslamm, das Verbrechen in die Schuhe zu schieben.
Allerdings gab es zu „Jay Dark“ auch seriösere Dokumente. Amtliche Feststellungen. Gerichtsprotokolle. Ermittlungsprotokolle. Ermittlungen der Behörde zur Bekämpfung des Terrorismus. Publikationen von Experten für nationalen und internationalen Terrorismus.
Doch auch die waren mit Vorsicht zu genießen. Die offiziellen Quellen schienen zirkulär zu sein: Eine Information, die von drei oder vier unterschiedlichen Autoren bestätigt wurde, stammte aus ein und derselben Quelle.
Irgendwann hatte die italienische Polizei diesen Typ festgenommen, der mit einem Koffer voller Drogen herumlief und die Telefonnummern hoher Tiere vom Geheimdienst, den Freimaurern und der Politik in der Tasche hatte. Einige Tage nach seiner Festnahme stellte sich heraus, dass sein Pass weder gestohlen noch gefälscht, er in Wirklichkeit jedoch Amerikaner war. Demnach hieß er „Jay Dark“ und sprach elf Sprachen.
Seine Herkunft war ungewiss, bis zu seiner Festnahme hatte er mehr als zwanzig verschiedene Identitäten benutzt. Die DEA, die amerikanische Drogenbehörde, hatte ein Kopfgeld von zweihunderttausend Dollar auf ihn ausgesetzt, sie hielt ihn für den größten LSD-Dealer des Westens. Dennoch hatten die Amerikaner nie seine Auslieferung beantragt. Im Gegenteil. Während seiner vierjährigen Haft in Italien hatte ihm das amerikanische Konsulat Unterstützung, Zuspruch und Geld zukommen lassen. Er war wegen Drogenbesitzes zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, dann war ein neuer Haftbefehl wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gegen ihn erlassen worden. Als der Untersuchungsrichter erkannt hatte, dass der „Terrorist“ einem verbündeten Geheimdienst angehörte, hatte man ihn freigelassen. Sobald er frei war, war er verduftet und, wie mir schien, bald darauf gestorben.
Nun, ich hielt das für eine sehr interessante Geschichte und schrieb einen Roman darüber. Mit dem Titel Blue Moon, das war der Name einer Geheimdienstoperation, von der mir ein paar junge Journalisten erzählt hatten.
Das Ziel der Operation soll darin bestanden haben, die Straßen Italiens mit Heroin zu überschwemmen und so den revolutionären Furor einer ganzen Generation zu brechen. Mit dieser Aufgabe habe das System, wie man in den Sechzigerjahren zu sagen pflegte, Figuren wie eben diesen „Jay Dark“ betraut.
Als mir die jungen Journalisten von dieser These erzählten, war ich skeptisch. Drogen waren zweifellos die große Geißel meiner Generation, doch meiner Meinung nach hatte es keiner Verschwörung bedurft. Heroin war schnell zu einer Mode geworden, zu einem „Must“, wie man in den Jahren darauf sagte.
In Wirklichkeit glaubten die armen Teufel einfach daran. Im Klima dieser Jahre glaubte man an Rauschgift wie an viele andere Utopien: an den bewaffneten Kampf, die bevorstehende Revolution, dass es keine psychischen Krankheiten gab, dass die Kriminellen unsere Brüder waren, blablabla. Unmöglich, dass ein derart verbreitetes Phänomen die schmutzige Idee einer Truppe kaltschnäuziger Spione gewesen sein sollte.
Aber dieser ominöse „Jay Dark“ war irgendwie spannend, und die Idee einer weltumspannenden Geheimdienstoperation kam mir mehr und mehr wie ein guter Plot für einen Roman vor.
Blue Moon
In meinem Roman Blue Moon hatte ich einen jungen mutigen, natürlich von demokratischen Idealen beseelten Polizisten namens Paco Durante erfunden, der hinter dem unaufhaltsamen Siegeszug des Heroins die Handschrift von Spionen erkannt hatte. Paco macht einen geheimnisvollen Großdealer ausfindig, den ich der Einfachheit halber JD nannte (ein kleines Spiel mit der Wirklichkeit schadet nie der Auflage) und mithilfe eines alten, genauso mutigen, wenn auch etwas zynischen Richters gelingt es ihm, den Dealer festzunageln. Als er ihn festnimmt, sind sie einander sympathisch. Als ob sie ein merkwürdiger Einklang einte. Als Aldo Moro entführt wird, bittet der Polizist JD um Hilfe. Der gibt ihm einen Tipp, warnt ihn aber auch: Wenn man bei gewissen Geschichten zu sehr nachforsche, riskiere man Kopf und Kragen. Prompt stoppt jemand Durantes Untersuchungen. Und da der Kriminalist nicht klein beigibt, wird er mit der bewährten Methode des Verkehrsunfalls beseitigt. JD wird aus der Haft entlassen. In der Folge ist er noch in andere dunkle Geschichten involviert. Die italienischen Staatsanwälte suchen ihn und wenden sich an die Amerikaner um Unterstützung. Die Antwort ist kurz und bündig: ein Totenschein.
Adieu. JD. Finis.
Damit wir uns recht verstehen: Ich hatte mich zwar auf einige wenige Fakten gestützt, doch Blue Moon war ein Roman mit sehr dünnen Wurzeln in der Wirklichkeit. Einen Paco Durante hat es nie gegeben. Doch ein Polizist war bei seinen Untersuchungen tatsächlich durch einen geheimnisvollen Verkehrsunfall umgekommen. Verkehrsunfälle waren jahrzehntelang tatsächlich das Erkennungszeichen unserer Geheimdienste.
Einige Tage nach Erscheinen der englischen Ausgabe hatte ich eine Mail von einer Anwaltskanzlei in Los Angeles erhalten. Beziehungsweise von Anwalt Flint. Er hatte das Buch gelesen und fragte mich, ob ich die Absicht hätte, mich noch einmal mit Jay Darks Geschichte zu beschäftigen.
Mit einen schnellen Blick auf die Website der kalifornischen Bar Association stellte ich fest, dass es eine Kanzlei Flint & Loewenstein tatsächlich gab, sie hatte ihren Sitz in einer Suite der Lonegan Apartments am Wilshire Boulevard. Ich wählte die in der Website angegebene Nummer, und nachdem ich auf unzählige Anrufbeantworter gesprochen hatte, war endlich Anwalt Alwyn Flint am anderen Ende der Leitung. Flint sprach hervorragend Italienisch, er verteidigte nämlich viele Landsleute von mir – wie er mir nach den einleitenden Floskeln sagte. Zu meiner nicht geringen Verwunderung erklärte er mir, seine Kanzlei kümmere sich um die Interessen der Fire-of-Chaos-Foundation, die vor Jahren von Jay Dark höchstpersönlich gegründet worden war. Unternehmenszweck der Stiftung sei unter anderem, die Berichte über Mr. Darks Aktivitäten, egal in welcher Form, zu kontrollieren. Laut Flint durfte also keine TV-Sendung, kein Film, kein Theaterstück und kein Roman Darks Leben und Wirken zum Thema haben, sofern die Stiftung, also Flint, nicht ihren Segen dazu gab. Ich sagte zu ihm, er solle sich an meinen Anwalt wenden, gab ihm jedoch auch entschieden zu verstehen, dass mein Jay Dark, also JD, eine fiktive Figur und jedwede Forderung somit absurd sei.
Flint hatte meine Aussage hingenommen und wir hatten uns verabschiedet.
Nach zweimonatigem Schweigen rief er mich wieder an. Er sei in Rom und wolle mich kennenlernen.
Ich sagte ihm klipp und klar, dass die Frage der Rechte geklärt sei und ich ihm gegenüber überhaupt keine Verpflichtungen habe. Ich duldete keine Einflussnahme auf meine Arbeit, wenn er anderer Meinung sei, solle er wieder meinen Anwalt kontaktieren.
Ich höre noch immer das Echo des sonoren Lachens, mit dem Flint auf meinen entrüsteten Tonfall reagierte.
– Sie verstehen nicht. Ich möchte, dass Sie die wahre Geschichte Jay Darks erzählen. True Crime statt romantischem Noir.
Nun standen wir einander im ägyptischen Tempel auf dem Friedhof Verano gegenüber, wo die verabschiedet werden, die nicht ans Jenseits glauben. Flint offenbarte mir, warum er sich für diesen ungewöhnlichen Ort entschieden hatte: An einem Sommernachmittag vor dreißig Jahren hatte Jay Dark auf einem anderen römischen Friedhof das Privileg genossen, dem eigenen Begräbnis beizuwohnen.
– Ihrer Erzählung fehlt es an Niedertracht. Sie sind sogar etwas zu sentimental …
– Sagen Sie das meinem Verleger. Er wirft mir genau das Gegenteil vor. Seiner Meinung nach gibt es in Blue Moon zu viel Politik und zu wenig Gefühl.
– Wirklich? Das tut mir leid. Aber darum geht es nicht. Ihre Erzählung ist seelenlos.
– Ich habe schon schlimmere Kritiken gehört, glauben Sie mir.
– Leblos, weil ihr das wichtigste Element fehlt, fuhr Flint unbeirrt fort.
– Und worin bestünde das wichtigste Element?, fragte ich ihn sarkastisch. Schön langsam verlor ich die Geduld.
Flint schaute belustigt drein.
– Das Chaos. Es fehlt das Chaos.
Gut. Ich hatte es offensichtlich mit einem originellen Typ zu tun. Vielleicht einem echten Verrückten. Wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich ihm in genau diesem Augenblick den Rücken zugekehrt. Aber kennen Sie einen klugen Schriftsteller? Ich bin es jedenfalls nicht.
Flint machte einen langen Zug an seiner Zigarre.
– Ist Ihnen niemals der Zweifel gekommen, jemand, der elf Sprachen spricht, könnte etwas anderes sein als ein Amerikaner, der die schlimmsten Alpträume seiner demokratischen Landsleute bevölkert? Glauben Sie wirklich, dass die Geschichte so banal ist?
– Ich habe mich an meine Quellen gehalten, protestierte ich. Trotz allem ließ es mich nicht kalt, wie Flint über die Dinge sprach.
– Die Quellen! Sie dürfen nicht alle Informationen glauben, die Tag für Tag verbreitet werden. Vertrauen sie sich lieber glaubwürdigen Zeugen an. Wenn man schon das Glück hat, einem zu begegnen.
– Wie Ihnen?
– Natürlich.
– Und warum sollte ich das tun?
Flint zuckte mit den Achseln.
– Weil ich dabei war.
DIE WAHRE GESCHICHTE JAY DARKS, VON ANWALT FLINT ERZÄHLT
WIE JAY DARK ZUR WELT KAM
1.
1960 hieß Jay Dark noch nicht Jay Dark. Sein Name war Jaroslav Darenski, genannt Jaro, er war zwanzig Jahre alt und ein Dieb. Er brach in die Wohnungen der Reichen in Manhattan ein, raffte ein wenig Zeug an sich, Halsketten, Uhren, goldene Krawattennadeln, und verscherbelte die Beute an Avram den Hinkenden, einen armenischen Hehler, der ihn immer wieder über den Tisch zog, dem er jedoch trotz allem vertraute. In seiner Gegend hatte er keine andere Wahl. Williamsburg war damals ein desolater Stadtteil, Banden und rebellische ethnische Minderheiten lieferten einander wilde Straßenkämpfe, ein Vorort, in dem das „Volk“ zu Hause war und von dem sich anständige Leute tunlichst fernhielten, sogar die Bullen steckten dort nicht gern die Nase hinein. Ein Niemandsland, das sich hervorragend für die Raubzüge eines Jungen wie Jaro eignete: ein idealer Ort, um im Trüben zu fischen, in Erwartung …
Tja: in Erwartung wovon?
Wahrscheinlich wusste oder ahnte er zumindest schon damals, dass er „anders“ war. Fürs Erste war er ein Einzelgänger. Er hatte keine Freunde. Wollte auch keine haben. Seine Einsamkeit war ihm Freundin, Gefährtin, Schwester, Mutter. Doch er war nicht nur anders. Er war anders und besonders. Seine Besonderheit äußerte sich auf dem Gebiet der Sprache. Beziehungsweise der Sprachen.
Es begann mit einem Zufall. Da war diese Buchhandlung auf der Sixth Street, die Bombengeschäfte machte. Der Besitzer, ein kleiner Mann um die fünfzig, nahm einmal pro Woche die Einnahmen aus der Kasse, zwischendurch füllte sich diese mit Bargeld. Eines Abends ließ Jaro sich einsperren, wartete, bis der Angestellte den Rollladen herunterließ, wartete noch eine Stunde, bis der Nachtwächter vorbeikam, und als er sich sicher fühlte, verließ er sein Versteck und ging zur Kasse. Er wollte schon den Dietrich ansetzen, als sein Blick auf ein Englisch-Spanisch-Wörterbuch fiel. Auch Jaro habe es sich nicht erklären können, doch plötzlich waren ihm die Kasse und das Geld – der einzige Grund, warum er überhaupt eine Buchhandlung betreten hatte – völlig egal, stattdessen war er fasziniert von dem Wörterbuch. Bei den Jungs einer puerto-ricanischen Gang, die sich in der Nähe der Bruchbude, in der er wohnte, herumtrieben, hatte er bereits ein paar spanische Vokabeln aufgeschnappt. Schüchtern und mit beinahe religiöser Ehrfurcht durchblätterte er das Wörterbuch, er versuchte die wenigen Wörter zu finden, die er kannte, und sie nachzusprechen. Er stellte fest, dass er sogar schwierige Sätze mit Leichtigkeit bilden konnte. Es war eine Offenbarung. Er las, las, las und eignete sich die Sprache so konzentriert an, dass er gar nicht bemerkte, wie die Zeit verging. Als am Morgen der Rollladen hochgezogen wurde, schreckte er hoch, er war gerade beim Buchstaben P angelangt. Er flüchtete sich in einen Winkel zwischen zwei riesigen Regalen und mischte sich dann unter die ersten Kunden, mit dem kostbaren Schatz unter der Jacke verließ er den Laden.
In diesem Augenblick ahnte er es noch nicht, doch das waren seine ersten Schritte in Richtung eines neuen Lebens.
Von nun an klaute er fremdsprachige Bücher. Er las begierig, wiederholte laut Sätze. Er bemächtigte sich sogar feinster Akzente und Tonfälle, bis er sie beherrschte. Er lief durch das Viertel und versuchte jeden einzelnen exotischen Laut aufzuschnappen, er nahm jede Gelegenheit wahr, um mit Menschen aller möglichen Ethnien ein paar Wörter auszutauschen, er versuchte, Sinn und Bedeutung ihrer Worte zu erraten. Um zu überleben, klaute er Uhren und Schmuck, um sich lebendig zu fühlen, nährte er sich mit fremden Sprachen.
Es war ihm zuteilgeworden, was er später als „die Gabe“ bezeichnete.
2.
Am 8. November 1960 wurde Jaroslav Darenski wegen Einbruchs festgenommen. Er hatte zu lange in einem Luxusapartment auf der Fifth Avenue herumgetrödelt und war von der Rückkehr des Hausherrn überrascht worden. Doch diesmal war keines seiner geliebten fremdsprachigen Bücher schuld, sondern ein Foto. Stundenlang hatte er über dem gerahmten Bild sinniert: Darauf war ein sechzigjähriger Mann mit dem typischen markanten Kiefer zu sehen – der Besitzer des Apartments –, wie er gerade Präsident Kennedy und seiner hübschen kleinen Frau die Hand drückte. Eigentlich war JFK damals noch nicht Präsident, doch er hatte das Zeug dazu, es bald zu werden. Tatsächlich wurde er zu dem Zeitpunkt gewählt, als Jay festgenommen wurde. Jays Gefühle den Brüdern Kennedy gegenüber waren ambivalent. Er hielt sie abwechselnd für die Hoffnung Amerikas und dann wieder für zwei arrogante Herren, deren riesige Macht ihn gleichgültig ließ. Hin und wieder dachte er, er solle sich von ihrem jugendlichen Überschwang inspirieren lassen, und er versuchte, JFKs unwiderstehliches Lächeln zu imitieren. Dann empfand er wieder eine unbändige Wut: Warum hatten sie es derart einfach im Leben, und warum war sein Leben so erbärmlich? Jaro hatte überhaupt nichts Rebellisches an sich, er war frei von jeglichem politischen Bewusstsein, er würde nie zu einer Wahl gehen und einem Kandidaten seine Stimme geben. Er fühlte einfach den tiefen Wunsch, dass etwas passierte. Irgendetwas, das ihn von seinem Schicksal erlöste, in dem er hockte wie in einem engen Käfig. An diesem Abend dachte er: Tauschen wir, JFK: Ein Jahr, ein Monat, eine Woche oder einen Tag lang bist du ich und ich bin du. Du brichst in die Wohnungen deiner Geldgeber in Manhattan ein und ich ficke Jackie, ich setze mich an deinen Schreibtisch und gebe den Befehl, eine Bombe auf Moskau fallen zu lassen.
Man könnte sagen, dass Jay bereits das Bedürfnis nach Chaos in sich spürte. Er war bereit. Auch wenn er noch nichts davon wusste.
Als der Besitzer der Wohnung die Pistole zückte, hob Jay instinktiv die Hände. Eine Stunde später war er auf der Polizeiwache, man steckte ihn vorübergehend in eine Sicherheitszelle, er teilte sie sich mit zwei Latinos, in deren Gesichtern sich hässliche Narben von Messerschnitten befanden.
– Ich will keine Probleme in meinem Revier, sagte der fette Sergeant warnend, als er ihn in die Zelle sperrte.
Von Jaro war in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Er war zwar auf der Straße aufgewachsen, jedoch nie ein Raufbold gewesen, und das Messer benutzte er allenfalls, um Fleisch zu schneiden. Die Latinos waren das Problem. In ihren Augen war der dünne, bleiche und verängstigte Junge ein leichtes Opfer. Eine Zeit lang gaben sie Ruhe. Solange der Sergeant in Blickweite war. Doch dann stand er auf, verkündete, dass er dringend ein Bier brauche: Ihr könnt ja nicht davonlaufen, oder? Keine Faxen, oder ich schlage euch die Schädel ein, wenn ich zurückkomme. Und Jay blieb im Vorzimmer der Polizeiwache allein mit den beiden Ganoven.
– Hier stinkt es, Pepe.
– Ja, ich rieche es auch, Sancho.
Sie sprachen Spanisch, mit dem Akzent der Chicanos, der mexikanischen Einwanderer.
– Es stinkt nach weißem Fleisch, Sancho.
– Ja, ich rieche es auch, Pepe.
Als sie mit glänzenden Augen und bösartigem Grinsen näher kamen, hob Jaro wie kapitulierend die Arme und sagte:
– Yo también, hermanos. Es quel poli. Huele a muerto. Ich auch. Der Polizist stinkt wie ein Kadaver.
Die beiden blieben verdutzt stehen.
Der Typ sprach nicht nur ihre Sprache, er sprach sogar die Sprache der Straße. Sehr seltsam.
– Blödsinn. Was für ein Name ist Darenski? Bist du ein Scheißrusse?
– Eigentlich Pole.
– Pole, Russe, derselbe Scheiß. Bist du ein verdammter Kommunist?
– Meine Mutter war Mexikanerin, aus Tijuana, Gott hab sie selig.
Bei der Erwähnung von Jaros toter Mutter hob Pepe die Arme, bereit klein beizugeben. Sancho, der Argwöhnischere der beiden, fluchte im Dialekt. Jaro erwiderte im selben Tonfall. Die beiden Brüder blickten einander an, nickten, und gleich darauf umarmten sie ihren neuen Freund.
Der Gott der Sprachen hatte zum ersten Mal seine Macht offenbart.
Der Sergeant kam zurück und schwang den Knüppel, bereit, eine Lektion zu erteilen. Als er sah, dass sich die drei Jungs hervorragend verstanden, war er enttäuscht. Als Jaro am Tag darauf abgeholt wurde, flüsterte ihm Sancho einen Rat zu, der sein Leben verändern würde.
– Bei dem, was sie dir vorwerfen, riskierst du, ein bis drei Jahre in einem Gefängnis der mittleren Sicherheitsstufe zu bekommen. Ein Scheißort. Lass dich ins Bellevue Hospital schicken. Dort geben sie dir Pillen, und wenn du sie nimmst, bekommst du Straferlass.
– Und wie komme ich dort hin?
– Tu, als ob du verrückt wärst.
– Aber ich bin nicht verrückt.
– Lass dir was einfallen. Reden kannst du ja, hermano!
Jaro befolgte den Rat. Beim Prozess sprach er Griechisch und Polnisch, versuchte den riesigen schwarzen Wärter auf den Mund zu küssen, und zum krönenden Abschluss ließ er die Hose runter, zog den Schwanz raus und drohte, Euer Ehren zu besprenkeln. Er steckte ein paar Ohrfeigen ein, doch der Prozess wurde verschoben und Jay wurde ins Bellevue Hospital eingewiesen.
Dort forderte man ihn auf, am „Programm“ teilzunehmen.
3.
Der Insasse verpflichtete sich, ein halbes Jahr lang bei einem medizinischen Experiment mitzumachen, danach wurde das Urteil aufgehoben oder widerrufen, oder es würde, wie in seinem Fall, einfach keinen Prozess mehr geben. Sancho hatte nicht gelogen: eine Handvoll Pillen im Tausch gegen Freiheit. Nachdem er die ersten zwei Tage mit verschiedenen medizinischen Untersuchungen zugebracht hatte, erklärte ihm die Leiterin des Bellevue, Frau Doktor Mary Lou Di Caro, eine steife Italo-Amerikanerin, die von den Krankenpflegern zärtlich „Besenstiel“ genannt wurde, was Sache war.
– Die Teilnahme am Programm ist freiwillig, Sie müssen die Zustimmungserklärung im Beisein zweier Zeugen und in meinem Beisein unterschreiben. Sie können den Vertrag jederzeit auflösen, also aufhören, wann immer es Ihnen beliebt. In diesem Fall tritt jedoch das Strafgesetz wieder in Kraft und Sie wandern zurück ins Gefängnis. Außerdem müssen Sie bezüglich der Angelegenheit Stillschweigen wahren. Das heißt, sobald Sie wieder in Freiheit sind, dürfen Sie mit niemandem über die Experimente sprechen, an denen Sie teilgenommen haben, sonst werden Ihnen die Vergünstigungen wieder aberkannt. Anders gesagt, wenn Sie auch nur eine winzige Bemerkung über das fallen lassen, was wir hier im Bellevue tun …
– Wandere ich wieder ins Gefängnis, Frau Doktor.
Jaro unterschrieb hastig im Beisein zweier Zeugen, bevor er es sich anders überlegte. Damit war er offiziell ins Programm aufgenommen.
Ein Krankenpfleger namens Wojcech, ein Pole wie Jaros Mutter (seine echte Mutter), führte ihn in Zimmer 25 der Abteilung P (P für Programm, die Institution war nicht sehr einfallsreich), das er mit zwei Leidensgenossen teilen würde. Auf dem Weg dorthin sang Jaro. Wojcech schüttelte verärgert den Kopf.
– Ich wäre an deiner Stelle nicht so euphorisch, Junge.
– Was redest du? In sechs Monaten bin ich draußen, frei wie ein Vogel!
– Wenn du überlebst.
– Was soll das heißen?
– Ein paar sind nicht zurückgekommen. Du wirst sehen, Junge, das Programm ist mörderisch.
Was wollte Wojcech damit sagen? Wovor wollte er ihn warnen? Die zwei neuen Zimmergenossen waren wirklich zum Fürchten. Einer war groß und knochig und hatte eine Glatze, er saß im Lotussitz auf dem Bett und starrte auf die makellos weiße Wand, wobei er mit dem Kopf rhythmisch vor und zurück wippte. Er hieß Jürgen, war Deutscher und hätte sechs Jahre wegen Steuerbetrugs absitzen sollen. Ein Spekulant, der Pech gehabt hatte, einer von den Doofen, die sich hatten erwischen lassen. Der andere war ein halber Ire mit kurzen, weißlichen Haaren, Joel McKenna, er erzählte, seitdem er die Pillen nahm, würde er von einer Meute schwarzer Hunde verfolgt, die ihn in den Arsch beißen wollten. Was für ein Teufelszeug wurde einem im Bellevue verabreicht? McKenna, eine Seele von einem Menschen, solange er nicht seine eingebildeten Tiere knurren hörte, sagte zu Jaro, er habe sich für das Programm entschieden, um einer vierjährigen Haft wegen Betrugs zu entgehen.
– Sie nehmen nur friedliche Menschen wie mich und dich in das Programm auf, erklärte er ihm, – keine gewalttätigen Kriminellen. Weißt du auch, warum, Darenski? Weil das Zeug dich gewalttätig macht …
Doch bei Jaro lief es anders.
– McKenna?
– Hunde, Frau Doktor. Heute Nacht haben sie versucht, die Tür niederzutreten, doch ich habe mich verbarrikadiert und habe sie nicht hereingelassen.
– Sehr gut. Galassi?
– Ich bin geflogen, Frau Doktor, ich schwöre es Ihnen. Über ein riesiges Lilienfeld.
– Haben Sie sie gerochen?
– Sehr intensiv.
– Sehr gut. Wie war die Wahrnehmung?
– Ich war wie in Ekstase, Frau Doktor.
– Darenski?
– Ich? Nun … da war ein Hof und ich habe mit ein paar Jungs Baseball gespielt.
– Ach ja. Und wie waren diese Jungs?
– Wei… Weiß und schwarz, Frau Doktor.
– Und wie war der Hof?
– Ganz normal, würde ich sagen, ein ganz normaler Hof.
– Sind Sie sich sicher?
– Wenn ich darüber nachdenke, war die Form etwas … unregelmäßig.
– Wie unregelmäßig?
– Nun, keine Ahnung, alles war verzogen … genauer gesagt, die Form hat sich ständig verändert, ich fühlte eine Art …
– Beklemmung?
– Genau, Frau Doktor.
– Hmm. Duvalier, ihre Kängurus?
– Heute Nacht keine Kängurus, Frau Doktor. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll …
– Nur zu.
– Ich habe mit jemandem geschlafen …
– Mit wem?
– Mit einer wunderschönen Frau. Aber sie hatte kein Gesicht. Anstelle des Gesichts trug sie … eine Art Maske, eine weiße Maske …
Es war offensichtlich, dass im Bellevue im großen Stil Drogen verabreicht wurden und man ihre Reaktionen untersuchte. Und diese Drogen hatten nichts mit dem Rauschgift zu tun, das man auf der Straße kaufen konnte. In Williamsburg bekam man so gut wie alles, von Gras bis Heroin, und wie jeder anständige Straßenjunge hatte Jaro alles probiert.
Jaro simulierte also.
So vergingen ein paar Monate. Eines Abends, nach dem Essen – Truthahn mit Bratkartoffeln –, rief Di Caro ihn zu sich und reichte ihm einen Zuckerwürfel.
– Schlucken Sie das, Darenski.
– Was ist das?
– Ein neues Medikament. Sie sind auserwählt worden, es auszuprobieren.
– Das heißt, die anderen …
– Nur Sie. Die anderen wissen nichts davon. Und sie dürfen auch nichts davon erfahren, haben Sie verstanden? Wir sehen uns morgen.
Jaro nahm den Würfel und drehte und wendete ihn in den Händen. Er sah aus wie ein ganz normaler Zuckerwürfel. Oben lagen zwei braune Kügelchen.
– Ist das das Medikament, Frau Doktor?
– Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Scharfsinn und erinnere Sie daran, dass Sie einen Vertrag unterschrieben haben. Sie können zurücktreten, wann immer Sie wollen.
Er legte sich den Würfel auf die Zunge und spürte sofort etwas Bitteres im Vergleich zur Süße des Zuckers. Je mehr sich der Zucker auflöste, desto intensiver wurde der bittere Geschmack, schließlich übertönte er die Süße.
– Ich habe einen scheußlichen Geschmack im Mund, Frau Doktor.
– Gute Nacht, Darenski.
Auf dem Rückweg in Zimmer 25 dachte Jaro an die düstere Warnung des Krankenpflegers Wojcech. Er beschloss, nicht zu schlafen. Er hatte eine Heidenangst, nicht mehr aufzuwachen. Er suchte etwas zum Lesen, doch das einzige Buch war wie immer die Bibel. Besser als nichts. Er schlug eine beliebige Seite auf, legte sich auf die Pritsche und begann das Buch des Propheten Hosea zu lesen.
Nach fünf Wörtern schlief er schon tief und fest.
Als er aufwachte, war er noch immer da. Er lebte noch. Man hatte ihn nicht vergiftet. Und wie immer war nichts geschehen. Er erzählte Di Caro, er sei in einen wunderbaren, von Elfen und Riesen bevölkerten Garten eingedrungen, und sie machte kommentarlos Notizen.
Die Sache mit dem Zuckerwürfel wiederholte sich eine Woche lang: Die dunklen Körnchen wurden immer zahlreicher, der Geschmack wurde immer bitterer und er schlief wie immer tief und fest.
Am Morgen des achten Tages traf Jaroslav Darenski zum ersten Mal Doktor Kirk.
4.
Wojcech und ein anderer Krankenpfleger brachten Jay in den Gemeinschaftsraum und fesselten ihn an eine Art Zahnarztstuhl. Er wurde an Armen und Beinen festgebunden, konnte jedoch die Hände bewegen. An seinem Kopf wurden mehrere Elektroden befestigt, die Kabel daran mündeten in eine Art Monitor, und dahinter saß Doktor Di Caro in weißem Kittel. Neben ihr saß ein kleiner, dünner, ungefähr sechzigjähriger Mann, er hatte einen kurzen grau melierten Bart und trug eine Brille mit Goldrand. Wojcech stellte einen Kübel neben den Stuhl.
– Heb die rechte Hand, wenn dir schlecht wird. Dann bringe ich dir den Kübel.
– Warum zum Teufel sollte ich kotzen, Wojcech?
Der Krankenpfleger gab keine Antwort und stellte sich auf eine Geste der Ärztin hin links neben Jaro auf. Der kleine Mann mit der Brille ergriff das Wort.
– Mister Darenski, darf ich mich vorstellen. Ich bin Doktor Harry Kirk. Wir unterziehen Sie einem Test namens Pneumoenzephalografie. Auf diese Weise erhalten wir ein eindeutigeres Bild von Ihrem Hirn …
– Ist mit meinem Hirn etwas nicht in Ordnung?
„Besenstiel“ mischte sich ein.
– Unterbrechen Sie Doktor Kirk nicht!
– Ich bitte dich, Mary Lou.
Kirks Tonfall war ruhig. Sein Englisch wies einen starken deutschen Akzent auf.
– Die Neugier unseres jungen Patienten ist mehr als berechtigt. Nein, Mister Darenski, ich würde nicht sagen, dass mit Ihrem Hirn etwas nicht in Ordnung ist, schon gar nicht im engeren klinischen Sinn. Wir wollen Sie nur beobachten. Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, wird sich mehrmals im Uhrzeigersinn und dagegen drehen und auf und ab kippen. Die jähen Lageänderungen, denen Sie unterzogen sind, gestatten uns, die Bewegungen der Hirnflüssigkeit zu verfolgen, so erhalten wir ein aussagekräftiges Bild Ihres Hirns. Solange uns die Wissenschaft keine anderen Hilfsmittel zur Verfügung stellt, sind wir leider gezwungen, einen relativ invasiven Eingriff durchzuführen …
– Was meinen Sie damit?
– Möglicherweise, seufzte Kirk, – werden Sie Kopfweh, Herzrasen, Panik, Übelkeit verspüren …
Plötzlich kam sich Jaro vor wie eine Maus in der Falle. Er begann zu zappeln, schrie, er wolle an keinem verdammten Experiment teilnehmen, versuchte sich von den Fesseln zu befreien. Wojcech und der schwarze Krankenpfleger packten ihn. Doktor Kirk wandte sich in einem nahezu herzlichen Tonfall an ihn.
– Ich weiß, wir verlangen viel von Ihnen, Mister Darenski, doch die Ergebnisse dieser Untersuchung und deren Ausgang könnten für Sie sehr erfreuliche Folgen haben …
– Ich pfeife auf eure Folgen! Bindet mich los. Der Vertrag ist eindeutig. Ich kann jederzeit zurücktreten. Also bindet mich los!
Jaro sprach deutsch. Als ob er unbewusst den Gott der Sprachen heraufbeschworen hätte. Kirk warf Doktor Di Caro einen verdutzten Blick zu.
– Er spricht Deutsch? Dieser junge Mann spricht auch Deutsch?
– Ja, gab „Besenstiel“ finster zu und fügte hinzu: – Beim Prozess Griechisch und Polnisch, seine Muttersprache. Englisch natürlich. Danach zu schließen, wie er mich ansieht, wenn ich ein paar Worte in meiner Muttersprache fallen lasse, versteht er leider auch Italienisch. Ein Patient sagt, er spricht auch Spanisch.
– Du hast mir nachgeschnüffelt, du Idiotin!, protestierte Jay auf Italienisch.
– Mister Darenksi, Sie sprechen also … fünf, sechs Sprachen?
– Ich spreche alle Scheißsprachen, die ich sprechen will. Bindet mich los, ihr Arschlöcher!
– Wunderbar!, sagte Kirk strahlend. – Wir müssen das Experiment unbedingt durchführen.
– Das dürfen wir nicht, unterbrach ihn Di Caro. – Nicht ohne seine Zustimmung. Das Programm ist …
– Meine liebe Freundin, sagte Kirk mit honigsüßer Stimme, – bei allem Respekt, aber ich habe das Programm erfunden, ich darf diese Untersuchung auch ohne die Zustimmung des Patienten anordnen.
– So war das nicht abgemacht!, schrie Jaro, doch „Besenstiel“ drückte nahezu erleichtert auf einen Knopf.
Um Jaro begann sich alles zu drehen.
5.
Die Sitzung dauerte eine Stunde, doch abgesehen von einem leichten Schwindel hinterließ sie keine Spuren am Körper des Versuchskaninchens. Als alles vorbei war, band Wojcech Jaro los, gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter und führte ihn unter Kirks mitleidigem Blick in Di Caros Untersuchungszimmer.
– Was darf ich Ihnen anbieten, junger Mann?
– Eine Tasse heiße Schokolade.
Er saß wieder vor Kirk und seinen Unterlagen. Di Caro durfte am Gespräch nicht teilnehmen. Kirk strich sich den Bart glatt und lächelte ihn aufmunternd an. In diesem Augenblick verspürte Jaro zum ersten Mal Wärme. Das Gefühl, von jemandem anerkannt und sogar geschätzt zu werden. Als würde man zur Familie gehören. Als hätte man eine Familie und käme nach einem langen Arbeitstag nach Hause oder, noch schlimmer, aus dem Krieg, den man aufgrund einer glücklichen Fügung überlebt hatte. Kirk lächelte und Jaro ließ sich von diesem Lächeln einlullen, allmählich löste sich das Eis, das er in sich trug, das Eis der Straßen von Williamsburg.
– Das große Interesse für Fremdsprachen … Können Sie mir sagen, wann das begonnen hat, Mister Darenski?
– Nein. Es ist einfach passiert. So was passiert halt. Und aus.
– Erzählen Sie mir etwas von sich, Mister Darenski.
– Da gibt es nicht viel zu erzählen …
Das stimmte nicht. Jaro sprach lange über sich. Ausnahmsweise log er nicht und er war auch nicht widerspenstig. Er erzählte von seiner Mutter, die er eines Tages tot in der Wohnung aufgefunden hatte, mit der Wodkaflasche in der Hand.
– Und Ihr Vater?
– Den habe ich nicht kennengelernt. Aber als meine Mutter einmal …
– Ihre Mutter? Los, nur zu … Ihre Mutter?
– Meine Mutter … hatte wie immer getrunken. Aber im Rausch wurde sie melancholisch, wenn Sie wissen, was ich meine.
– Natürlich, reden Sie weiter …
– Nun, für gewöhnlich wechselte sie das Thema, wenn ich mich nach meinem Vater erkundigte, sie begann zu schreien oder drohte, mich zu verprügeln. Doch diesmal … diesmal passierte etwas Seltsames. Sie erzählte mir von ihm.
– Und was sagte Sie?
– Dass mein Vater ein schöner Mann war. Ein Fremder, der übers Meer gekommen war.
Kirk rieb sich die Hände.
– Dem berühmten Doktor Freud zufolge erklärt das alles. Haben Sie jemals von Doktor Freud gehört?
– Ich habe sogar etwas gelesen. Aber nur flüchtig.
– Interessant, sehr interessant … Welche Sprache lernen Sie im Augenblick?
– Arabisch.
– Soweit ich verstanden habe, reproduzieren Sie Laute mit großer Leichtigkeit, kann man das so sagen?
– Ja, das kann man so sagen. Das ist das richtige Wort.
Kirk dachte eine Zeit lang nach, dann zog er eine kleine Pfeife und einen Tabakbeutel heraus, stopfte die Pfeife, machte ein Streichholz an und bot Jaro an, ihm eine Zigarette zu besorgen, sofern er eine wollte. Der junge Mann war perplex. Im Bellevue galt Tabak als Gottseibeiuns. Den Patienten wurden zwar alle möglichen Drogen verabreicht, doch Tabak war strengstens verboten.
– Ein weiterer Widerspruch unseres Systems, kicherte Kirk, – und typisch für die protestantische Mentalität. Genauso verlogen, wie alkoholische Getränke in einer Papiertüte zu verstecken … Prohibition und insgeheime, private Laster. Darüber sprechen wir später. Jetzt machen wir weiter. Die Pneumoenzephalografie hat eine deutliche Ausbildung … eine abnorme Ausbildung des sogenannten Broca-Areals ergeben. Wir nehmen an, dass in diesem Areal das Sprachzentrum liegt. Das ist ein Hinweis, warum Sie so leicht Sprachen lernen. Gleichzeitig stammen Sie aus einem ethnisch und linguistisch gemischten Milieu, was ebenfalls den Spracherwerb fördert. Ihre Mutter war Polin, Ihr Vater ein Fremder, der über das Meer gekommen war, vielleicht ein Grieche oder Italiener, Sie sind in Williamsburg aufgewachsen, hatten Umgang mit Italienern und … All das erklärt das Phänomen zum Teil. Ansonsten …
– Ansonsten?
– Ich nehme mir vor, Ihren Fall äußerst sorgfältig zu prüfen. Ich habe noch keine wirkliche Erklärung. Aber ich kann Ihnen versichern, Mister Darenski, dass es sich um einen sehr anregenden Fall handelt. Von höchstem Interesse! Und vielleicht hat Doktor Freud ausnahmsweise noch etwas zu sagen …
– Ich habe mich immer anders gefühlt, Herr Doktor.
– In diesem Zimmer sind zumindest zwei Menschen, die anders sind, wie Sie es nennen.
In einem Tonfall, den Jaro nie vergessen würde, fügte er dann mein Junge hinzu. Noch nie hatte ihn jemand so genannt. Jaro empfand so etwas Ähnliches wie tiefe Rührung. Am liebsten hätte er geweint wie ein Kind. Er schluckte die Tränen hinunter, er war ja ein Junge aus Williamsburg. In Williamsburg galt: Wenn du heulst, bist du schwul. Und Schwulen zerschneidet man das Gesicht.
Dann veränderte sich Kirks Tonfall. Seine Stimme wurde plötzlich schneidend.
– Sie sind ein Simulant. Die Untersuchungen sind eindeutig, die Ergebnisse unwiderlegbar. Man hat Ihnen immer größere Dosen Psilocin und Psilocybin verabreicht, Ihr Körper hat sie resorbiert, doch sie haben bei Ihnen überhaupt keine psychische Reaktion hervorgerufen. Aus meiner Sicht ist das nicht nur abnormal, sondern unglaublich. Jetzt antworten Sie ehrlich: Warum haben Sie gelogen?
– Weil ich Angst hatte, dass Sie mich wieder in den Knast schicken, wenn Sie herausfinden, dass das Zeug bei mir nicht wirkt.
Kirk lachte. Sein Lächeln war warm und väterlich, dachte Jaro, doch aufgrund seines Lachens, einer Art Hyänenlachen, wirkte er gleichzeitig kalt und abweisend.
– Irrtum, Mister Darenski, schwerer Irrtum. Die Experimente sind genau dazu gut. Um eine Theorie zu beweisen oder, wie es mir persönlich lieber ist, um sie zu widerlegen. Aber wir werden uns später noch darüber unterhalten … sofern wir uns, was ich sehr hoffe, wiedersehen. Sagen Sie mir noch etwas: Nehmen wir an, Sie schließen das Programm positiv ab … Welche Pläne haben Sie für die Zukunft, Mister Darenski?
– Wenn ich hier rauskomme, meinen Sie?
– Genau.
Auf diese Frage hatte er keine Antwort. Bis jetzt hatte er gedacht, sobald er wieder in Freiheit war, würde er sein übliches Leben wieder aufnehmen. Die Diebstähle und alles andere. Kirk hatte ihn mit dieser einfachen Frage und mit seinem Charisma völlig aus der Fassung gebracht. Jetzt wusste er gar nichts mehr. Weder über sich noch über die Zukunft.
– Keine Ahnung, Herr Doktor.
Kirk antwortete nicht. Er schaute ihn nur lange an und nickte kurz, dann stand er auf und ging, ohne ihn eines Grußes zu würdigen.
Mitten in der Nacht, als Jaro schlaflos im Bett lag, was für ihn sehr ungewöhnlich war, tauchten zwei Männer in grauen Anzügen auf, befahlen ihm, sich anzuziehen, und setzten ihn in einen Ford Galaxy Mayberry, eine Limousine, wie sie amerikanische Polizisten fuhren.
Doch diese hatte weder einen Schriftzug noch ein Blaulicht.
6.
Im Morgengrauen gelangte Jaro ins Schloss: So bezeichnete Kirk sein weder bescheidenes noch übermäßig luxuriöses, sondern allenfalls würdevolles Anwesen am Rande von River Wells, New Jersey, sechzig Meilen südlich von Manhattan. Kirk stellte ihm seine Frau Gretchen vor, eine pausbäckige und ständig lächelnde Blondine, die aus einem Märchen der Brüder Grimm zu stammen schien. Beide trugen weite Nachthemden aus grober Wolle und Sandalen: Offensichtlich machte ihnen die intensive Kälte des frühen Morgens nichts aus. Jaro folgte beiden zu einem kleinen Stall, wo eine Ziege sie mit freudigem Meckern begrüßte.
– Das ist Lotte, mein Sohn. Unsere liebe Charlotte. Aber im Gegensatz zu der, die von unserem großen Goethe verewigt worden ist, hat die da keine Launen, nicht wahr, Lotte?
Kirk betrat das Gehege, ging zu der Ziege, streichelte ihr über die Stirn (was dem Tier eindeutig gefiel), dann nahm er einen Kübel und begann sie zu melken.
– Glaubst du an Gott, mein Sohn?, fragte er, ohne mit dem Melken aufzuhören. Er duzte ihn jetzt. Jaro durchflutete wieder Wärme.
– Ehrlich gesagt, das habe ich mich noch nie gefragt.
Gretchen nickte und kicherte dabei genauso freudig wie die Ziege.
In all den Jahren, in denen sie und Kirk ihn wie den Sohn behandelten, der ihnen nicht geschenkt worden war, hörte Jay Dark – nun nicht mehr Jaroslav Darenski – sie niemals sprechen. Doch sie war nicht stumm. Kirk sagte, sie spräche nicht, außer hin und wieder mit ihm und Lotte, denn sie habe es nicht notwendig, ihre Gefühle verbal zu äußern: allem voran ihre Freude, wenn wieder ein neuer Tag anbrach, an dem die Sonne schien, Regen oder Schnee fiel oder sich dunkle Schatten bewegten.
– Ich hingegen, sagte Kirk, habe mir wie viele andere vor mir jahrelang immer wieder die Frage gestellt, ob es Gott gibt. Und am Ende des vielen Nachdenkens bin ich zu demselben Schluss gekommen wie du: Man braucht sich die Frage gar nicht zu stellen. Eines Tages wird die Wissenschaft vielleicht eine adäquate Antwort auf die einfachsten Fragen liefern. Warum gibt uns Lotte die viele gute Milch, von der wir uns nähren? Um ihr Zicklein zu säugen, wirst du sagen. Einverstanden. Aber warum produziert sie nach wie vor Milch, obwohl sie kein Zicklein mehr hat? Um im Training zu bleiben? Warum verlangt die Natur ihr das ab? Warum hat Gott das so verfügt? Oder ist sie einfach ein unschuldiges Tier, dem es gefällt, uns seine Milch zu schenken? Wir werden es nie erfahren. Doch wir werden uns immer Fragen stellen. Genau. Was ich damit sagen will: Es ist unsere Pflicht, uns Fragen zum Sinn des Lebens zu stellen, doch genauso ist es unsere Pflicht, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Im Grunde sind Wissen und Nichtwissen dasselbe, es ist in gleicher Weise würdig und anerkennenswert, sich den Kopf zu zerbrechen, wie sich nicht darum zu kümmern … Bei allen Gläubigen, und zwar jeglicher Religion, irritiert mich jedoch diese obsessive Suche nach dem sogenannten Ordnungsprinzip … ich meine, nach dem Motor, nach dem Urgrund, mit einem Wort, nach dem Prinzip, das die Aufgabe hat, für die Ordnung des Universums zu sorgen … Wenn es aber gar keine Ordnung gäbe? Wenn hingegen unsere ganze Existenz auf einem entgegengesetzten Prinzip beziehungsweise auf dem absoluten Fehlen eines Prinzips beruhte … Wenn wir, jeder Einzelne und alle miteinander, die organische Synthese einer unkontrollierbaren Urkraft … des Chaos … wären? Was sagst du dazu, Jaroslav?
– Du weißt nicht, was du dazu sagen sollst, stimmt’s? Also sag nichts: schweig. Das ist die beste Option. Lass es auf dich wirken und schweige. Wenn du bereit bist, wirst du das Wort ergreifen. Brav, Lotte, brav. Wie immer.
Als Kirk mit dem Melken fertig war, zog er eine Handvoll Salz aus der Tasche und die Ziege leckte es von seiner Handfläche. Dann streichelte er sie ein letztes Mal, reichte Gretchen den vollen Kübel und forderte Jaro auf, mit ihm ins Haus zu gehen.
In einer gemütlichen Bauernstube nahmen sie das Frühstück zu sich: Milch, Roggenbrot, von Gretchen selbstgemachte Blaubeermarmelade. Bis zuletzt rühmte Kirk sich seiner vegetarischen Ernährungsweise.
Während Gretchen den Tisch abräumte, sperrte der Doktor ein Mahagonimöbel auf, unter dem Deckel kam ein moderner Plattenspieler zum Vorschein. Auf mehreren Regalen standen zahlreiche Platten. Der Doktor wählte eine aus, machte den Apparat an und suchte eine Nummer. Die Klänge erfüllten das Zimmer. Eine machtvolle Musik verbreitete sich. Jaro hatte noch nie etwas Derartiges gehört. Gegen seinen Willen überlief ihn ein Schauer.
– Gewaltig, was? Die Carmina Burana … Eines Tages werde ich sie dir erklären, aber im Augenblick genügt es, um dir eine Vorstellung zu vermitteln …
– Wovon? Von Unordnung?, antwortete der Junge, kalt erwischt.
– Versuch es aus einer anderen Perspektive zu sehen. Chaos als Ordnung. Oder besser gesagt: Gleichgewicht. Aufgrund von Chaos erlangtes Gleichgewicht.
– Ich fürchte, das ist mir ein wenig zu hoch, Herr Doktor.
Kirk lächelte.
– Lass es wirken und denke nach. Du wirst es schon verstehen. Aber inzwischen ist mir das Wort wieder eingefallen.
– Welches Wort, Herr Doktor?
– Das deinen … Zustand beschreibt, mein Sohn.
– Und das wäre?
– Gabe.
– Eine Gabe, ein Geschenk?
– Genau. Eine Gabe, eine außergewöhnliche, einzigartige, unverwechselbare Gabe!
Kirk fügte hinzu, Jaro solle die wissenschaftlichen Erklärungen einfach vergessen, die er ihm am Tag davor nach ihrer Sitzung gegeben hatte.