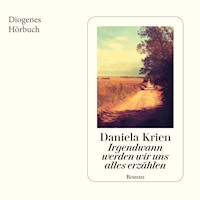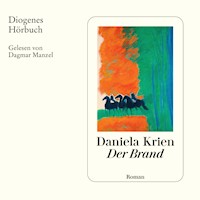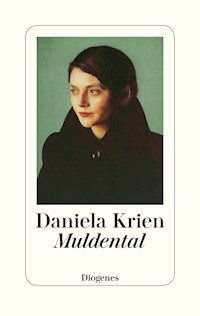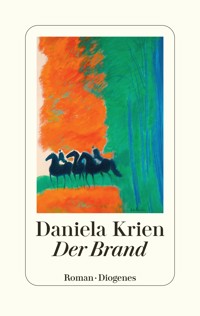
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rahel und Peter sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie sind angekommen in ihrem Leben, sie schätzen und achten einander, haben zwei Kinder großgezogen. Erst leise und unbemerkt, dann mit einem großen Knall hat sich die Liebe aus ihrer Ehe verabschiedet. Ein Sommerurlaub soll bergen, was noch zwischen ihnen geblieben ist, und die Frage beantworten, wie und mit wem sie das Leben nach der Mitte verbringen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Daniela Krien
Der Brand
Roman
Diogenes
Widerspruch ist ein Grundmoment des menschlichen Daseins.
Ernst Cassirer
An einem Freitag im August läuft Rahel Wunderlich mit schnellen Schritten die Pulsnitzer Straße Richtung Martin-Luther-Platz entlang. Den ganzen Weg schon fühlt sie sich leicht, fast unbeschwert und überholt die meisten Passanten mit Schwung.
Den Papierkram in der Praxis hat sie erledigt, die Pflanzen gegossen und der Reinigungskraft einen Zettel mit Anweisungen hinterlassen. In ihrer Stammbuchhandlung hat sie ein Buch auf Empfehlung gekauft und eines von Elizabeth Strout, das schon lange auf ihrer Wunschliste stand – eine hochgelobte Mutter-Tochter-Geschichte.
Peter müsste in einer guten Stunde zu Hause sein. Er hat ihr von einem Radebeuler Weingut aus geschrieben, Fotos verschiedener Grau- und Weißburgunder geschickt und gefragt, ob sie mit der Auswahl einverstanden sei. Sie hat sich noch eine Scheurebe dazu gewünscht und ein knappes »ok« zurückbekommen.
Im Hausflur leert sie den Briefkasten und geht die Post durch: Werbung für einen neuen Pizza-Service, die Rechnung des Malers, der kürzlich die Küche renoviert hat, ein förmlich zugestellter Brief von der Stadt: ihr Bußgeldbescheid für den Blitzer vor ein paar Wochen. Neunzig Euro plus fünfundzwanzig Euro Gebühren plus ein Punkt an das Fahreignungsregister. Hätte schlimmer kommen können, sie hatte immerhin eine rote Ampel überfahren.
Rahel steigt die Treppen bis in die zweite Etage des Altbaus hinauf und legt die Briefe auf der Kommode im Korridor ab. Als sie sich die Schuhe abstreift, klingelt das Telefon in ihrem Zimmer. Sie zögert einen Augenblick. Eigentlich muss sie auf die Toilette, doch sie meint, dem Klingeln eine Dringlichkeit anzuhören, die keinen Aufschub duldet.
Während des Anrufs muss sie sich setzen.
Der Mann am Telefon berichtet mit brüchiger Stimme, das Ferienhaus, von Rahel vor Monaten gebucht, sei abgebrannt. Nach fast einem Jahrhundert in Familienbesitz sei das Haus in den Bergen für immer zerstört.
Rahels Mitgefühl bleibt aus. Während der Mann weiter spricht, ihr Informationen zur Rückerstattung der Anzahlung gibt und eine alternative Unterkunft vorschlägt, denkt sie nicht eine Sekunde an den Verlust der Eigentümer, sondern lediglich an Peter und seinen Blick, wenn sie es ihm erzählen wird.
»Also nehmen Sie die Ferienwohnung im Dorf?«, fragt der Mann, nun ganz geschäftsmäßig.
»Nein«, sagt Rahel. »Bitte erstatten Sie uns das Geld zurück.«
Fast zwei Monate lang hatte sie nach einem Quartier wie diesem gesucht. Gleich zu Anfang des Jahres, als die ersten Meldungen über das Virus kamen, hatten sie sich darauf geeinigt, den Sommer im Inland zu bleiben.
Es war der perfekte Treffer gewesen: Eine Hütte in Oberbayern, in den Ammergauer Alpen, in völliger Alleinlage auf einem Wiesenhügel, ein Brunnen mit Pumpe und Steinbecken davor, nur zu erreichen über einen holprigen Serpentinenweg durch den Wald. Kein Internet, kein Fernsehen, keine Ablenkung.
Seit Wochen studiert Peter Karten und stellt Wanderrouten zusammen. Er hat sich teure Trekkingstiefel gekauft, einen Rucksack für Tagestouren, T-Shirts und Hosen aus leicht trocknendem und regenabweisendem Material, eine erstklassige Jacke einer Schweizer Firma und spezielle, fußstabilisierende Socken. Und auch Rahel hat sich aufwendig ausgerüstet und in Vorbereitung der Wanderungen fast täglich Sport getrieben.
In drei Tagen wären sie gefahren. Unmöglich, auf die Schnelle etwas Vergleichbares zu finden, nicht in diesem Jahr, nicht unter den gegebenen Bedingungen. Ohne große Hoffnung gibt sie auf einer Website für Ferienwohnungen ihre Wünsche ein. Null Treffer. Sie versucht es auf einer weiteren – mit dem gleichen Ergebnis.
Dann ruft sie die Seite der Berghütte auf. Sie klickt sich von Bild zu Bild, von den Geranien in den Balkonkästen zu der kleinen Veranda mit Blick auf das gegenüberliegende Bergmassiv und wieder zum Haus, diesmal aus einer anderen Perspektive. Dann zu dem steinernen Brunnenbecken und den bunten Wildblumen auf der Wiese, und plötzlich kann sie das lodernde Feuer auf dem Berg sehen. Sie sieht fliehende Tiere und eine Rauchsäule, die in den nächtlichen Sternenhimmel steigt, und mittendrin Peter und sich – wie auf einem Scheiterhaufen.
Wäre das Ganze vor zehn Jahren passiert, hätten sie gemeinsam darüber den Kopf geschüttelt. »Wer weiß, wofür es gut ist …«, hätte Peter vermutlich gesagt und sie getröstet. Doch die Gelassenheit war ihm abhandengekommen. Sein feiner Humor kippt nun öfter ins Zynische, und an die Stelle ihrer lebhaften Gespräche ist eine distinguierte Freundlichkeit getreten. Damit einhergehend – und das ist das Schlimmste – hat er aufgehört, mit ihr zu schlafen.
Eine halbe Stunde ist seit dem Anruf vergangen. Rahel steht am Fenster ihres Zimmers und wippt barfuß auf den Zehenballen auf und ab. Ihr von Grau durchsetztes schwarzes Haar trägt sie hochgesteckt. Das Leben draußen, die Stimmen der Jugendlichen, die sich auf den Bänken vor der Kirche versammelt haben, nimmt sie wie von ferne wahr. Die Enttäuschung hat sie kraftlos gemacht.
Als das Telefon erneut klingelt, rührt sie sich nicht. Mit geschlossenen Augen wartet sie, dass es aufhört.
Aber es hört nicht auf.
Sie wirft einen Blick auf das Display: Es ist Ruth. Unwillkürlich strafft Rahel die Schultern, räuspert sich, prüft den Ausdruck ihres Gesichts im Spiegel neben dem Schreibtisch und nimmt den Hörer ab.
Schon an der Begrüßung hört sie die Veränderung in Ruths Stimme – das zackig Selbstbewusste fehlt. Dennoch kommt sie ohne Umschweife zur Sache: Viktor habe vor ein paar Tagen einen Schlaganfall erlitten. Es sei alles so viel gewesen, darum melde sie sich erst jetzt. Seit heute befinde er sich für sechs Wochen in der Rehaklinik Ahrenshoop. Dort sei unverhofft ein Platz frei geworden. Sie wolle ihn unterstützen, habe auch schon eine Unterkunft gefunden bei ihrer gemeinsamen Freundin Frauke, einer Malerin, die in Ahrenshoop lebe. Nun suche sie jemanden, der sich um das Haus und die Tiere in Dorotheenfelde kümmern würde. Es sei sonst nicht ihre Art, zu bitten, aber –
Sie bricht ab, setzt erneut an: Ob Rahel und Peter die ersten beiden Wochen übernehmen könnten. Viktor und sie wären überaus dankbar.
Beinahe hätte Rahel Nein gesagt. Nein, das geht leider nicht. Wir fahren in die Berge. Doch dann fällt ihr der Brand wieder ein, und sie antwortet: »Ja natürlich, das machen wir gern. Und wenn du willst, bleiben wir drei Wochen.«
Peter schweigt. Er schüttelt den Kopf, hebt ratlos die Hände.
»Das kann doch nicht wahr sein!«, entfährt es ihm schließlich. »Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgerechnet die eine Ferienunterkunft bucht, die kurz vor der Anreise abbrennt?«
Dann geht er mit gesenktem Kopf in sein Zimmer hinüber. Früher war es Selmas Zimmer gewesen. Nach ihrem Auszug war Simon nachgerückt, und als auch er das elterliche Nest verlassen hatte, war Peter gefolgt. Simons altes Zimmer dient als Gästezimmer, Peters ursprüngliches Arbeitszimmer gehört nun Rahel. Die Neuaufteilung der Wohnung haben sie gleich nach Simons Auszug vorgenommen. Eine Weile haben sie nach einer kleineren Bleibe gesucht, aber alle Wohnungen, die in Betracht kamen, waren trotz der geringeren Fläche teurer und dabei schlechter gelegen. Hier grenzte die Äußere Neustadt an die Radeberger Vorstadt, und sie gelangten ebenso schnell an die Elbwiesen wie in die Dresdner Heide; darauf wollten sie nicht verzichten.
Für den Augenblick atmet sie auf. Noch weiß sie nicht, wie sie ihm die Zusage für Dorotheenfelde beibringen soll. Sie geht zum Fenster, beugt sich ein Stück hinaus, blickt auf die Passanten hinunter und hört plötzlich Peters Stimme hinter sich.
»Was machen wir jetzt, hm?«, fragt er. Er setzt sich auf die nachtblaue Chaiselongue, die sich Rahel erst kürzlich gekauft hat.
Sie zögert die Antwort hinaus, doch schließlich siegt ihr Pragmatismus.
»Wir fahren in die Uckermark nach Dorotheenfelde, schon morgen.«
Ihr Lächeln verrutscht, ihr Blick hält seinem nicht stand. Während sie ihre lackierten Fußnägel betrachtet, erzählt sie ihm von Ruths Anruf. Peter macht ein Geräusch, als habe er sich verschluckt.
»Ohne mich zu fragen …«, sagt er und erhebt sich. »So weit sind wir jetzt also gekommen.«
Ihre Füße stehen wie festgeklebt am Boden, die Zunge lässt sich nicht vom Gaumen lösen, und Peter verlässt das Zimmer mit dem Gesichtsausdruck eines Besiegten.
Rahel setzt sich auf die Chaiselongue, genau auf die Stelle, wo er gesessen hat. Dann streckt sie sich aus und legt einen Arm über die Augen. Sie blickt nach innen und wünscht sich sogleich, es nicht getan zu haben.
Später, als sie wahllos Kleider aus dem Schrank nimmt und in den Koffer packt, denkt sie an Ruth. Ihr Gesicht steht ihr lebhaft vor Augen. Über die Jahre haben sich winzige Verschiebungen in die Symmetrie ihrer Züge eingeschlichen, doch noch immer tritt Ruth nie anders auf als tadellos zurechtgemacht. Besonders an schlechten Tagen ist die äußere Vollendung ihre Rüstung gegen die Zumutungen der Welt. Seit jeher schien diese Haltung auch auf Rahel überzugreifen. Nie hat sie sich gehenlassen in Ruths Anwesenheit, nie nachlässig gekleidet oder bewegt. Diese unhinterfragte Disziplin hatte Ruth in den Jahren auf der Palucca-Schule verinnerlicht. Sie und Rahels Mutter Edith hatten als Kinder ihre klassische Tanzausbildung zur gleichen Zeit begonnen. Edith hatte nach drei Jahren hingeschmissen, Ruth war geblieben. Die Freundschaft der Mädchen hielt, bis sie erwachsen waren.
Rahels Verhältnis zu Viktor und Ruth ist bruchlos und so alt wie sie selbst. Bei ihnen in Dorotheenfelde kam ihr Leben zur Ruhe. Ediths rastloses Dasein, das Rahel und ihrer Schwester Tamara eine Kindheit mit wechselnden Stiefvätern, etlichen Umzügen kreuz und quer durch Dresden und verschiedenen Schulen beschert hatte, war wie ein Sturm auf hoher See gewesen, und obwohl auch Dorotheenfelde kein dauerhafter Hafen wurde, so hatte es hier doch immerhin heilsame Flauten gegeben.
An den Tagen in Dorotheenfelde waren Edith und Ruth unzertrennlich. Die Bindung der Freundinnen war trotz aller Gegensätze eng, und als vor ein paar Jahren der Krebs in Ediths Körper zum dritten und letzten Mal ausbrach, ist Ruth gekommen und geblieben. Bis zum Schluss.
Sie fahren ohne Pause durch. Drei Stunden und dreizehn Minuten hat das Navi ihnen angezeigt; Peter fand, das sei eine gute Zeit.
Unterwegs ruft sie die Kinder an und stellt das Telefon laut. Selma hat den quengelnden Max auf dem Arm. Sein Quäken übertönt Selmas Stimme.
»Tut mir schrecklich leid, dass ihr jetzt woanders Urlaub machen müsst, Mama!«, schreit sie ins Telefon, »wenn ich heute gegen Mitternacht mal ne Minute für mich hab, bedaure ich euch.« Dann legt sie auf.
Peter beschwichtigt sofort. »Lass sie! Sie hat zwei Kleinkinder zu versorgen.«
»Sie hat einen Mann, der sich beide Beine für sie ausreißen würde.«
»Klingt, als wärst du neidisch.«
Rahel beschließt, nicht darauf einzugehen, und wählt Simons Nummer.
»Wetten, er geht nicht ran?« Peter schmunzelt. Es ist das erste Lächeln seit Tagen, und obwohl ihr der Anlass nicht gefällt, wird ihr leichter ums Herz. Nach dem dreizehnten Klingeln legt sie auf.
»Wozu hat er eigentlich ein Telefon?«, schimpft sie.
»Er wird irgendwo im Gebirge unterwegs sein.«
Rahel nickt und lässt das Telefon in ihre Tasche zurückgleiten.
Kurz nach dem Ortsausgangsschild des Dorfs biegen sie rechts in einen Weg ein. Das Sackgassenschild ist verblichen und steht schief. Bevor Viktor den Führerschein endgültig abgeben musste, ist er ein paar Mal dagegengefahren. Sie ruckeln über den alten Plattenweg, in dessen Mitte das Gras wuchert, dann enden auch die Platten, und sie fahren über Kies und Sand die leichte Anhöhe hinauf.
Ruth steht in der Einfahrt. Groß, gerade und in einem tief dekolletierten Kleid, das ihren beeindruckenden Busen betont. Keine Spur von Altersschwäche, obwohl sie nun auch schon fast siebzig ist. Rahel steigt aus und geht ihr entgegen, während Peter das Auto in den Hof fährt und parkt.
Neben dem Haupthaus schließen sich links die Stallungen an, rechts eine große Scheune. Nach Kriegsende lebten Flüchtlinge hier, später beherbergte der Gutshof die örtliche LPG-Verwaltung, und danach lebten Viktor und Ruth mit zwei weiteren Familien in dem alten Haus des Verwalters – mit Ofenheizung und Plumpsklo. In den frühen 70ern war die erste Familie weggezogen, Anfang der 80er die andere.
Nach der Wende kauften Viktor und Ruth den mittlerweile halb verfallenen Hof und sanierten ihn über viele Jahre hinweg Stück für Stück. Nun beginnt er erneut zu verfallen.
Ruth entzieht sich der Umarmung. »Ich bin ganz verschwitzt«, sagt sie und läuft los, um auch Peter zu begrüßen.
Auf dem Gartentisch stehen eine Wasserkaraffe, ein Kuchenteller mit einer Insektenschutzhaube und Kaffee in einer Thermoskanne. Ruth schenkt ein und beginnt von Viktor zu erzählen. Während sie spricht, fragt sich Rahel, ob sie eines Tages in ebenso liebevoller Weise über Peter reden würde. Tiefe Verbundenheit leuchtet aus Ruths Worten, und Rahel spürt Peters Blick auf sich gerichtet.
Nach dem Kaffee holen sie das Gepäck aus dem Auto und folgen Ruth die Treppen hinauf. Im ersten Stock weist sie nach rechts auf ein Zimmer am Ende des Gangs.
»Am besten schlaft ihr dort, im Nordostzimmer. Es ist schön kühl darin. Oder aber …«, sie zeigt in die entgegengesetzte Richtung, »… ihr nehmt das Zimmer da hinten. Südwest, von dort sieht man den See zwischen den Bäumen durchschimmern. Aber was rede ich, ihr kennt euch ja aus.«
Dann dreht sie sich um und steigt die Treppen wieder hinunter. Ohne sich anzusehen, gehen sie auseinander – Peter nach Nordost, Rahel nach Südwest. Sie schließen ihre Türen leise.
Später weist Ruth sie ein. Allein das Gießen aller Pflanzen braucht eine gute Stunde pro Tag, sie sollen sich aus den Tonnen bedienen, die rund ums Haus Regenwasser auffangen.
Viktors Atelier liegt im vorderen Teil der Scheune, doch sie betreten es nicht. In den letzten Jahren, erzählt Ruth, seien seine Arbeiten kleiner geworden. Seine körperliche Kraft habe nachgelassen, seine handwerkliche und imaginäre keineswegs.
Die Tiere sind der schwierigste Teil. Weder Peter noch Rahel haben je mit Tieren zu tun gehabt. Nun liegt das Wohl eines Pferdes, einiger Katzen, eines Dutzends Hühner und eines flugunfähigen Weißstorchs in ihren Händen.
Sie umrunden einmal den ganzen Hof. Ein Fenster vom Stall soll immer offen bleiben, damit die Schwalben ungehindert hinein und wieder heraus fliegen können. Im Hühnergarten hinter dem Stall tragen die Apfelbäume reiche Frucht. Der Maschendrahtzaun ist hier und da notdürftig geflickt. An allen Ecken und Enden gäbe es Arbeit. Die zahlreichen Rosenstöcke an der Scheunenwand im Innenhof sind lange nicht geschnitten worden, der rankende Wein unter dem Vordach des Stalls verdorrt, drei kaputte Fenster zählt Rahel während des Rundgangs, und überall liegen Laub und dürre Äste noch aus dem letzten Jahr.
Ruth gibt sich, als wäre alles in Ordnung.
Plötzlich schaut sie schräg in den Himmel.
»Gleich sieben«, sagt sie. »Zeit fürs Abendessen.«
Sie essen im Innenhof an einem schön gedeckten Tisch, während die einbrechende Dunkelheit die Zeichen des Verfalls verschluckt. Es gibt Soljanka, Brot, Rotwein und Wasser, und Peter sagt in einem Augenblick höchster Zufriedenheit in breitem Sächsisch: »Eimannfrei!«
Ruth bricht in schallendes Lachen aus, von dem auch Rahel sich anstecken lässt, und beide wiederholen das Wort im Chor, Eimannfrei, und in Rahel blitzt eine Erinnerung auf.
Es ist gar nicht so lange her, zwei Jahre vielleicht, da haben sie auch hier gesessen und gelacht, mit Viktor und Ruth und Simon, und es gab Soljanka, Brot und Wein. Simon trank keinen Alkohol und, von Viktor darauf angesprochen, erklärte er den Grund. Rahel und Peter wussten es schon. Nach dem Studium der Sportwissenschaft an der Bundeswehruni wollte ihr Sohn die Aufnahmeprüfung zum Heeresbergführer machen. Etwa zwei bis drei Jahre benötigte er, um sich vorzubereiten. Klettern und Skifahren auf höchstem Niveau im unwegsamen hochalpinen Gelände bei schwierigsten Wetterbedingungen gehörten zum Training ebenso dazu wie Ausdauer und mentale Stärke. Für ihn begann das Ganze mit dem Verzicht auf Alkohol. Schon die Entscheidung für die Offizierslaufbahn des Truppendienstes hatte Rahel entsetzt. Ihr Sohn als Zugführer einer Gebirgsjägertruppe war ein weiterer Schock gewesen. Seine Beteuerungen, dass das Ganze eine eher sportliche Herausforderung bedeute, beruhigten sie nicht. Viktor war an jenem Nachmittag ebenso wenig überzeugt. »Und dann hältst du im Ernstfall deinen Kopf für dieses Land hin«, rief er fassungslos. »Es wird dir niemand lohnen.«
Manchmal ist Ruth ihr unheimlich. Als hätte sie Rahels Gedanken gelesen, fragt sie plötzlich nach Simon.
»Immer noch in München an der Bundeswehruni«, antwortet Peter.
»Er hat mich noch gar nicht zurückgerufen, unser Offiziersanwärter«, murmelt Rahel mit sorgenvollem Blick auf ihr Telefon. Dann öffnet sie den Ordner mit den Fotos, von denen die meisten ihre Kinder oder Enkel zeigen, doch Ruths Kommentare beschränken sich auf höfliche Floskeln. An den passenden Stellen sagt sie mit tiefer Stimme Ach ja und Wie schön und Aha, doch ihr Blick irrt immer wieder ab, und ihr Lachen klingt nicht echt. Sie gähnt hinter vorgehaltener Hand und kündigt an, früh aufbrechen zu wollen.
»Ihr müsst nicht mit mir aufstehen. Wir verabschieden uns jetzt, und dann ist gut«, sagt sie mit ihrer üblichen Bestimmtheit.
Woche 1
Montag
Als Rahel aufsteht, ist es kurz vor acht. Sie muss den Wecker ausgemacht haben, kann sich jedoch nicht daran erinnern. Viel Schlaf hat sie nicht bekommen. Erst gegen ein Uhr nachts hat Simon ihre Nachricht beantwortet.
Hey Mama, tut mir ehrlich leid, dass Bayern nicht klappt. Ich wäre auf jeden Fall vorbeigekommen und hätte euch ein paar schöne Routen gezeigt. Naja, ein andermal! Mir geht’s gut. Trainiere gerade im Karwendel-Gebirge. Grüß alle von mir! Simon
Für den Augenblick war sie erleichtert, aber sie wusste natürlich, dass ihn das Risiko immer begleiten würde. Die nächtlichen Angstdämonen hatten ihr Bilder seines zerschmetterten Körpers vorgegaukelt.
Hin und wieder kommen sie in ihre Praxis – die Mutter, deren einziges Kind beim Überqueren einer Straße überfahren worden ist, oder der Vater, der seine Tochter in der Ostsee hat untergehen sehen. Wie erloschene Lichter sitzen sie vor ihr, zu freudlos für das Leben, zu kraftlos, um sich umzubringen.
Rahel steht auf, geht ins Badezimmer nach nebenan und nimmt ihre Aufbissschiene aus dem Mund. Auch sie würde zu einer dieser ausgeglühten Existenzen, wenn eins ihrer Kinder ums Leben käme. Sie schüttelt den Gedanken ab, reinigt die Schiene, steckt sie zurück in die Plastikbox und trinkt aus dem Wasserhahn. Dann geht sie in ihr Zimmer, tauscht das Nachthemd gegen ein schwarzes Leinenkleid und sieht aus dem Fenster. Eine Gestalt verschwindet im Wald Richtung See. Rahel holt ihre Brille vom Nachttisch und sieht erneut hinaus. Der Mensch ist verschwunden, nur der Storch stakst mit eingezogenem Kopf hinterm Haus entlang.
»Schlangen, Mäuse, Maulwürfe. Lebend natürlich«, hat Ruth auf die Frage nach den Fressgewohnheiten des Storchs geantwortet und keine Miene dabei verzogen. Nachdem sie die verdutzten Gesichter ausreichend genossen hat, ist doch ein Lächeln über ihr Gesicht gehuscht. »Ihr könnt aber auch die kleinen Fische nehmen, die im Kühlschrank liegen. Oder die Küken und Mäuse aus der Tiefkühltruhe. Und sollte es mal wieder regnen, dann könnt ihr die Schnecken von den Lupinen und den Funkien absammeln – der Storch wird’s euch danken.«
Das Tier hat keinen Namen.
Barfuß geht Rahel den langen Flur zu Peters Zimmer hinüber. Sie klopft und wartet, klopft noch einmal, dann tritt sie ein. Die Fenster stehen weit offen, im Holunderstrauch, dessen Äste beinahe bis in den Raum hereinreichen, krakeelen die Spatzen, sein Bett ist leer, die Bettdecke ordentlich gefaltet. Sie setzt sich auf die Kante und fährt mit der Hand unter die Decke, um seiner Wärme nachzuspüren. Doch das Laken fühlt sich glatt und kühl an.
Auf dem Schreibtisch hat er die Bücher gestapelt, die er lesen will: Propaganda von Steffen Kopetzky, den ersten Band von Ricarda Huchs Im alten Reich. Lebensbilder deutscher Städte, die gesammelten Essays von Montaigne, die Sämtlichen Gedichte von Tomas Tranströmer, Pier Paolo Pasolinis Freibeuterschriften und Der Waldgang von Ernst Jünger.
In der Mitte liegt ein frisch gespitzter Bleistift auf einem neuen Heft, dahinter seine Brille und eine Packung Taschentücher. Aus irgendeinem Grund löst dieses sorgfältige Arrangement eine tiefe Rührung in ihr aus. Sie verlässt das Zimmer, ohne eine Spur zu hinterlassen, und geht die Treppe hinunter.
Etwas ratlos betritt sie die Küche. Was gäbe sie jetzt für einen Cappuccino aus ihrer eigenen Maschine, mit cremigem Milchschaum und einer Prise braunem Zucker. Sie geht umher, öffnet Schränke, und begreift langsam die Ordnung hinter Ruths scheinbarem Chaos. Eine Kaffeemaschine gibt es nicht, nur eine Pressstempelkanne. Ruth und Viktor sind leidenschaftliche Grünteetrinker. Die große Auswahl an Kannen, Tees und Trinkschalen war Peter gleich nach der Ankunft mit Freude aufgefallen.
Sie spült die Stempelkanne mit heißem Wasser aus und findet Kaffeepulver in einer schwarzen Blechdose. Sie schnuppert daran, es scheint frisch zu sein. Dann hört sie die Haustür ins Schloss fallen und gleich darauf Peters Schritte im Flur. In guter Stimmung kommt er zur Tür herein und berichtet von seinem Bad im See.
»Ach, du warst der Mensch im Wald«, sagt sie.
Er nickt. »Ich war der einzige Schwimmer im ganzen großen See.«
»Soll ich dir Tee aufgießen?«, fragt sie und legt die Hand an seinen Arm.
»Nein, das mache ich selbst.«
Während Peter begeistert entdeckt, dass der Wasserkocher über eine Temperatureinstellung verfügt und der Tee somit problemlos bei 70 Grad aufgegossen werden kann, kocht Rahel Porridge. Unterdessen verteilen sie die Aufgaben. Peter, der nie etwas für Tiere übriggehabt und auf das Bitten und Betteln der Kinder um ein Haustier stets mit unnachgiebiger Ablehnung reagiert hat, verkündet zu ihrem Erstaunen:
»Ich übernehme die Tiere.«
Rahel ist froh darüber. Der Garten ist ihr lieber.
Peter verlässt den Frühstückstisch eilig. Sie sieht ihn Richtung Stall laufen, wo er kurz darauf mit dem gehalfterten Pferd wieder herauskommt.
Das Pferd ist eine dreiundzwanzig Jahre alte Fuchsstute namens Baila. Seit fünf Jahren bekommt sie hier ihr Gnadenbrot, nachdem sie wegen einer Verletzung aus dem Springsport ausscheiden musste. Sie trottet hinter Peter her und scheint wenig davon angetan zu sein, auf die Koppel umzuziehen. Immer wieder bleibt Baila stehen, legt die Ohren an und stemmt die Hufe in den Boden. Ziehen und gut Zureden bleiben wirkungslos. Plötzlich nimmt Peter den Halfterstrick, wirbelt ihn herum, gibt der störrischen Baila mit dem Strickende eins auf den Po, und schon setzt sie sich in Bewegung und läuft ordentlich neben ihm her.
Wenig später beobachtet sie ihn beim Füttern des Storchs. Er bekommt seinen Fisch in einer Plastikschüssel serviert und macht sich gierig darüber her. Die Hühner hat Ruth noch vor ihrer Abfahrt herausgelassen und gefüttert, und auch die Katzen scheinen satt und zufrieden zu sein. Sie liegen und streunen im Hof herum oder schlüpfen durch eine Katzenklappe ins Haus, wo sie sich im Untergeschoss verteilen.
Rahel lässt das Geschirr in der Küche stehen und geht nach draußen. Sie nimmt sich eine Gießkanne, doch die Regenfässer sind leer. Auch in dieser Region werden die Sommer heißer, trockener, staubiger. In den Wäldern sterben die Fichten und Buchen, und schon im August sieht es aus wie im Herbst. Sie dreht den Wasserhahn neben der Eingangstür auf, rollt den daran befestigten Schlauch ab und beginnt das Wässern bei jenen Pflanzen, die ihres Erachtens die besten Überlebenschancen haben. Gartenhibiskus, Stockrosen, ein Rhododendron, diverse Hortensien, Ringelblumen und Herzblattlilien neigen sich zwar schlaff zu Boden, richten sich aber nach einer Weile wieder auf. Lediglich der Lavendel gedeiht auch ohne Hilfe prächtig und bildet herrlich duftende Inseln. Wie die bald siebzigjährige Ruth und ihr zehn Jahre älterer Mann das Haus und den Hof bewältigen, ist ihr ein Rätsel, und sie mag sich kaum ausmalen, was passieren wird, wenn sich Viktor nicht erholt.
Bis zum Mittagessen ist Peter beschäftigt. Rahel hat den Inhalt des Gemüsefachs auf dem Tisch ausgebreitet, die vergammelten Sachen weggeschmissen und beschlossen, aus dem Rest eine Suppe zu kochen. Brot ist noch reichlich da. Sie deckt den Tisch draußen, spannt den Sonnenschirm auf, wässert den tönernen Weinkühler, bis er sich dunkel färbt, und wählt aus ihren mitgebrachten Weinen einen Weißburgunder.
Im Kühlschrank findet sie noch zwei Lammknacker, die sie mit einem Seufzer beide Peter überlässt. Seit einiger Zeit isst sie weniger, um ihre Figur zu halten.
Während des Essens kündigt Peter an, mit Baila am Nachmittag einen längeren Spaziergang unternehmen zu wollen. Ruth habe ihm aufgetragen, die Stute mindestens eine Stunde pro Tag zu bewegen. Er schaut Rahel dabei nicht an und fragt auch nicht, ob sie ihn begleiten möchte.
Beim Geschirrabräumen fällt ihm ein Glas zu Boden. Es zerbricht auf den Steinen vor der Haustür. Peter hält in der Bewegung inne, sein Blick auf den Splittern, die sich am Boden verteilt haben. Sekundenlang rührt er sich nicht, schaut nur, und es ist dieser Blick, der sie zurückhält, ihm zu helfen. Rahel wendet sich ab. Ein Sonnenstrahl trifft ihr Gesicht, sie schließt die Augen. Als sie sie wieder öffnet, hockt er mit einem Handfeger am Boden und fegt die Scherben zusammen.
Peter macht sich mit Baila auf den Weg, Rahel streift durchs Haus. Seit mehr als hundertfünfzig Jahren steht es hier, wie ein Organismus mit eigenen Gesetzen nimmt es immer wieder neue Menschen auf, umhüllt sie, verleibt sie sich ein, durchdringt sie, wirkt erst in ihnen und schließlich durch sie.
Das helle Holz der Böden hat tiefe Kratzer, die Terrakottafliesen in der Küche sind teils gesprungen, teils abgeplatzt, freie Flächen gibt es nicht. Alles Waagerechte ist belegt – jeder Fenstersims, jede Kommode, jeder Tisch trägt Stapel von Zeitungsartikeln, Ausstellungskatalogen, Büchern, Fotos, CDs, Notizen, Skizzen und Heerscharen geschnitzter Figuren für die Kinder, die Ruth nie geboren hat.
Rahel erkennt jene wieder, die Viktor damals für sie gemacht hat. Eine davon – eine Elfe – nimmt sie mit auf ihren Rundgang.
Als im Korridor das Telefon klingelt, zögert sie. Ruth hat keine Instruktion für eventuelle Anrufe gegeben. Der Apparat ist neu. Die Bedienungsanleitung und der Kassenzettel liegen daneben. Bevor der Anrufbeantworter anspringen kann, geht sie ran.
»Hallo Rahel«, sagt Ruth. »Ich bin gut bei Viktor angekommen und soll dich sehr herzlich von ihm grüßen. Er hat es mir dreimal gesagt, es scheint ihm ausgesprochen wichtig zu sein.«
»Danke! Wie geht es ihm?«
»Den Umständen entsprechend. Höre, ich muss leider gleich wieder auflegen, weil ein Arzt wegen des Therapieplans vorbeikommt. Sag schnell, wie geht es den Tieren?«
»Gut! Sehr gut! Mach dir keine Sorgen, wir haben alles im Griff.«
»Das freut mich. Ich rufe wieder an. Ade, meine Liebe, und grüß Peter.«
»Mach ich.«
Als Ruth aufgelegt hat, fallen Rahel all die Fragen ein, die sie hätte stellen sollen.
Wo ist der Staubsauger? Wann kommt die Müllabfuhr? Soll ich dir die Post nachsenden?
Einen Augenblick verharrt sie vor dem Apparat, dann steckt sie die Elfe in die Tasche ihres Kleids, tritt aus dem Haus, überquert den Hof und öffnet die Tür zu Viktors Atelier.
Weit hinten im Raum, wo das Sonnenlicht nicht hinreicht, steht eine lebensgroße Skulptur auf einem Sockel. Eine nackte Frau, mit leicht auseinanderstehenden Beinen, Oberkörper und Arme nach hinten gebogen. Eine Tänzerinnenpose oder ein Ausdruck von enormem Schmerz. Rahel tritt näher und erschrickt: Zwischen den Beinen, direkt unter dem Schambereich, hat eine große Spinne ihr Netz gewebt. Abgestoßen und fasziniert zugleich beobachtet Rahel das Tier, das sich plötzlich zurückzieht.