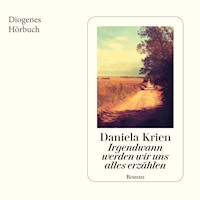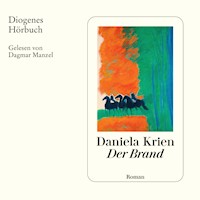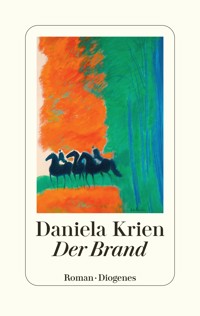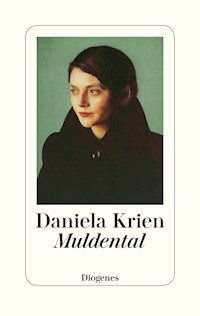11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die alles hinwegfegt. Zu einem Mann, der mehr als doppelt so alt ist wie Maria und der ein dunkles Geheimnis trägt. Während die Weltgeschichte im heißen Sommer 1990 Atem holt, während ein ganzes Land sich umwälzt und die Atmosphäre vibriert von Möglichkeiten, wird ein junges Mädchen zur Frau und Geliebten. Es geschieht Erschütterndes, außen wie im Inneren, und die fatale Verstrickung der zwei Liebenden endet brutal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Daniela Krien
Irgendwann werden wir uns alles erzählen
Roman
Mit einem Vorwort der Autorin
Diogenes
Und die Liebe ward der Ursprung der Welt und die Beherrscherin der Welt;
aber alle ihre Wege sind voll von Blumen und Blut, Blumen und Blut.
Knut Hamsun, aus der Erzählung Victoria
Vorwort
Bei all meinen Büchern, aber besonders oft nach dem Erscheinen meines Erstlings Irgendwann werden wir uns alles erzählen, begegneten mir die gleichen Fragen. Es handelt sich um jene Fragen, die (fast) jeder Schriftsteller ungern beantwortet und (fast) jeder Leser gerne stellt.
Wo kommt diese Geschichte her? Haben Sie sie selbst erlebt?
Auf die letzte Frage lässt sich leicht Auskunft geben. Stellen Sie sich vor, jeder Autor müsste das, was er schreibt, selbst erlebt haben. Die Gefängnisse wären voller Krimiautoren, weil man sie natürlich nach dem ersten Mord, den sie literarisch verarbeitet hätten, festnehmen würde.
Also wo kam diese Geschichte her, wenn ich sie nicht selbst erlebt habe?
Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich darüber sagen kann ist dies: Eines Tages, in einer ausweglos scheinenden Lebenssituation, habe ich mich an einem Winterabend, als die Kinder schliefen, hingesetzt und einen Satz aufgeschrieben, der wie aus dem Nichts in meinem Kopf aufgetaucht war:
Siegfried, der Vater, sitzt am Tisch.
Aus diesem Satz entstand ein Bild von einer bäuerlichen Küche und diesem Tisch, an dem, wie aus Nebel aufsteigend, noch mehr Personen saßen und Gestalt annahmen. Auch ein Mädchen war dabei, das sichtlich nicht zur Familie gehörte. Das Bild begann sich zu bewegen, die Figuren traten in Kontakt, sie sprachen miteinander, und mir wurde klar, dass das Mädchen und der ältere Sohn der Familie ein Paar waren. Von da an schrieb ich eigentlich nur noch dem Film hinterher, der vor meinem inneren Auge ablief. Eins ergab sich aus dem anderen, alles fügte sich ineinander – Fantasie, Erlebtes, Gedachtes, Gewünschtes, Beobachtetes, Gefürchtetes –, und etwa drei Wochen später schrieb ich ziemlich erschöpft den letzten Satz und war mir sicher, dass diese Geschichte erzählt werden musste.
Während des Schreibens hatte es merkwürdige Momente gegeben, in denen ich mich mit etwas Größerem verbunden fühlte. Dann schrieb ich ohne nachzudenken, gleichsam ohne zu wissen, woher die Worte kamen. Heute weiß ich, dass dieser Zustand ein unverdientes Geschenk ist; ich kann ihn herbeiwünschen, aber nicht erzeugen. Er bleibt ein Rätsel.
Das Schreibhandwerk zu lernen ist das eine, aber der Zustand, von dem ich spreche, zeitigt eine andere Art des Schreibens. Erst hier beginnt der Bereich der Kunst. In unserer entzauberten, rationalen Welt hat die Erkenntnis, dass sich der künstlerische Schaffensprozess letztendlich jeder Kontrolle entzieht, etwas zutiefst Beruhigendes.
Auch die Regisseurin Emily Atef berichtete mir immer wieder von solch magischen Augenblicken beim Drehen ihrer Filme, von einem Flow, in den manchmal das gesamte Filmteam gerät. Auf den Tag genau heute, am 30. Juli 2022, gut zwölf Jahre nach dem Entstehen des Romans Irgendwann werden wir uns alles erzählen, fiel die letzte Klappe beim Dreh des Films. Emily Atef und ich hatten zusammen das Drehbuch geschrieben, und ich durfte erleben, wie aus meinem ehemaligen Kopfkino echtes Kino entsteht.
Ich schreibe, seit ich lesen und schreiben gelernt habe, aber als Schriftstellerin sah ich mich erst nach der Veröffentlichung meines Erstlings. Es folgten ein Erzählband und zwei weitere Romane, die mir Versicherung und Beweis dafür waren, dass der beinahe rauschhafte Schreibzustand wieder entstehen kann. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Jedes neue Buch ist ein Wagnis, und die Fallhöhe steigt und steigt. Das alles wusste ich zum Glück nicht, als ich das erste Mal einen Roman schrieb, und darum wird er für mich immer einen besonderen Stellenwert haben. Ich schrieb ihn ohne Angst vorm Scheitern, ohne einen Gedanken an die Erwartungen anderer, mit vollem Risiko und voller Freude. Es war die erste Station einer großen Reise, die hoffentlich noch lange dauert.
Daniela Krien im Sommer 2022
Kapitel 1
Es ist Sommer, heißer, herrlicher Sommer. Der Hof ist ein Dreiseithof. Das langgestreckte freistehende Wohnhaus in der Mitte hat zwei Etagen und einen großen Dachboden; linker Hand schließt sich die Scheune an; ein großes hölzernes Tor führt vorn hinein und an der Rückseite wieder heraus. Einige Meter dahinter gibt es einen breiten, flachen Holzbau – das Sägewerk. Wiesen und Weiden erstrecken sich bis zum Fluss; ein Stück flussaufwärts, kurz vor einem alten Wehr, steht ein halb verfallener Schuppen. Am anderen Ufer erhebt sich steil ein dicht bewaldeter Hang.
Das rechte Seitengebäude beherbergt die Rinder und Hühner. Dahinter, in einem aufgeständerten Holzhäuschen, das mit Sägespänen und Heu eingestreut ist, haben die Gänse ihren Platz. In einem Anbau, der den gut dreißig Meter langen Stall um weitere zehn Meter verlängert, stehen die Fahrzeuge. Schaut man von dort aus nach links, erblickt man am Rande des Gemüsegartens den Schafstall; geradeaus sieht man eingezäunte Wiesen und den Bahndamm und, hinter den Schienen, in einiger Entfernung, doch klar erkennbar: den Henner-Hof.
Der Brendel- und der Henner-Hof sind die größten Höfe im Ort. Beim Henner, sagt man, sei alles noch wie vor dem Krieg: die Möbel, die Öfen, die Fußböden, die undichten kleinen Fenster. Kalt muss es dort sein im Winter. Die Brendels sind da moderner; sogar eine Zentralheizung haben sie. Betritt man das Haus, geht man ebenerdig in einen kleinen Vorraum. Links und rechts führen Türen in Küche und Wohnräume, geradeaus geht eine Treppe nach oben; hinter der Treppe befinden sich die Tür zum Gemüsegarten und der Eingang zum Keller.
Die unteren Zimmer werden von Siegfried, Marianne und Lukas bewohnt, die oberen von Frieda und Alfred, der Dachboden gehört uns, Johannes und mir.
In der Küche, dem größten aller Räume, steht noch der alte Küchenofen, auf dem auch gekocht werden kann. Die Großmutter Frieda aber hat sich längst an den Elektroherd gewöhnt. Die Sitzmöbel sind älter als die Frieda, der große Esstisch in der Mitte und das wuchtige Küchenbüfett ebenfalls. Nur die Hängeschränke und eine Arbeitsplatte stammen aus der DDR-Zeit. Alles ist sauber und aufgeräumt; doch düster ist es immer. Jetzt, im Sommer, stehen die Fenster meistens offen. Es sind alte Fenster mit drehbaren Knäufen; weiße Lackfarbe bröckelt von den Rahmen. Die niedrige Decke bedrückt und beschützt zugleich.
Siegfried, der Vater, sitzt am Tisch. Der mächtige Schatten der Kastanie im Hof lässt nur kleine Fetzen Abendlicht durch die Fenster hinein. Keiner spricht; die Gesichter der Familie sind so spärlich beschienen, ich erkenne sie kaum.
Nach und nach setzen sich auch die anderen. Die Mutter Marianne, Frieda, die Großmutter, der alte Alfred, den man früher Knecht genannt hätte, die Brüder Johannes und Lukas.
Siegfried schneidet eine daumendicke Scheibe vom groben Brot ab und streicht Butter darauf. Dazu nimmt er einige Stücke einer roten Paprika, die seine Frau vorgeschnitten hat. Er isst langsam, wortlos. Dann lächelt er und sagt: »Es ist gut, dass wir jetzt Paprika kaufen können, ist sehr gesund, wusstet ihr das?« Er schaut hoch, ohne den Kopf zu heben.
Die Söhne antworten nicht. Marianne, seine Frau, nickt und sagt: »Bald wird’s noch viel mehr geben.« Siegfried nimmt den Teller mit der Paprika und hält ihn Frieda entgegen: »Probier mal, Mutter«, sagt er und nickt ermunternd.
Ich schaue in die Gesichter, versuche die Regeln zu verstehen, nach denen hier gelebt wird; ich bin noch nicht lange da. An einem Sonntagmorgen im Mai hat der Johannes zu mir gesagt: »Heute bringe ich dich nicht nach Hause. Die Eltern wollen dich jetzt kennenlernen.« Da bin ich geblieben und nicht mehr fortgegangen. Jetzt haben wir schon Juni.
Wir essen nun wieder schweigend. Ich höre auf die Kaugeräusche der anderen. Beim Alfred gibt es am meisten zu hören. Er murmelt, ohne den Siegfried dabei anzusehen: »Die Liese kalbt heute Nacht. Alle Anzeichen sind da.« Siegfried nickt und sieht aus dem Fenster rüber zum Stall.
Johannes erhebt sich schwerfällig und mit gesenktem Blick. »Ich geh noch mal los, Freunde treffen – in der Stadt.«
»Etwa mit dem Motorrad?«, fragt die Marianne und steht ebenfalls auf.
»Setzt euch wieder!« Die Stimme des Vaters hat nun den leisen, drohenden Klang, den ich mag und ein wenig fürchte. Die anderen fürchten sich nicht.
»Nimmst du mich nicht mit, Johannes?«, frage ich ihn und bohre meinen Blick in seinen gesenkten Kopf. Er jedoch schaut nicht. Antwortet auch nicht. Steht noch immer und verlässt den Raum. Schweigend.
Eine Landstraße geht an den zwei Höfen vorbei, und zwei schmale Wege führen zu den Häusern.
Auf der anderen Seite der Straße, etwa dreihundert Meter von den Höfen entfernt, liegt das Dorf. Die Dorfstraße wird beidseitig von Lindenbäumen gesäumt, die jetzt, im Juni, einen schweren Duft verströmen. Nahe der Brücke, die den Fluss überquert, steht die Lindenschenke.
Dahinter ordnen sich die Häuser und kleineren Höfe, die Post, der Konsum und die Kirche kreisförmig um den Dorfteich herum an. Schmale Gassen schlängeln sich zwischen ihnen hindurch und führen zu weiteren Häusern und Höfen. Einer dieser von der Dorfmitte aus strahlenförmig wegführenden Wege geht schnurgerade auf zwei flache Betongebäude zu, die wirken, als wären sie versehentlich in die Wiesen gefallen – die örtliche LPG-Verwaltung. Dahinter prangt stolz der große Genossenschaftsschweinestall.
Es ist ein besonderes Dorf. Weder Krieg noch DDR haben es zerstören können, so sagt es die Frieda gern. Außer ein paar Wohnhäusern und der LPG gibt es nur wenig Neues. So etwas findet man nicht mehr oft, und an den Wochenenden kommen Leute aus der Stadt und gehen hier spazieren.
Draußen auf dem Hof laufen die Hühner umher. Marianne hat vergessen, sie einzusperren. Aus einem der oberen Fenster schaut die Frieda und schreit: »Marianne, der Fuchs wird die Hühner holen, nach zwanzig Jahren hast du es noch immer nicht begriffen. Wenn es dunkel wird, müssen die Hühner in den Stall.«
Die alte Kastanie wirft Schatten auf das ganze Haus, doch bald, so hat es der Siegfried angekündigt, wird sie gefällt. Er will eine neue pflanzen, die alte ist zu groß geworden.
Marianne läuft bis zum Rand der Scheune und sieht ihrem Sohn hinterher, wie er davonbraust mit seiner schwarz lackierten MZ. Ich habe mir einen ihrer Schals geholt und um die Schultern gelegt. Von der Haustür aus beobachte ich sie. »Steht dir gut«, sagt sie, als sie zurückkommt, und: »Ihm passiert schon nichts.«
Ich sorge mich nicht. Sie ist es, die nicht ruhen wird, bevor er nicht wieder daheim ist. In letzter Zeit sind mehrere tödliche Unfälle auf der Landstraße passiert. Auch ein Freund vom Johannes war dabei. Ich stehe ruhig, blase Zigarettenrauch in die frische Landluft hinaus; dann helfe ich beim Hühnerscheuchen.
Es ist schon fast Mitternacht, als ich das Knattern der Maschine höre und schließlich den abklingenden Motor. Die Dachzimmer speichern die Hitze des Tages; ich habe mein Sommerkleid gegen ein weißes Nachthemd getauscht, das ich in einer der vielen Truhen auf dem Dachboden fand. Sicher trug es früher die Frieda.
Sehe ich aus dem hinteren Fenster, dann weiten sich vor meinem Blick das hügelige Land und der rauschende Fluss; ich sehe die Wälder und die Rinder auf den Wiesen. Nach vorne schaue ich in den Hof und in das Laub der Kastanie, die von Vögeln bevölkert wird, und aus dem Giebelfenster über die Weiden, den Schafstall und die Bahnstrecke bis hinüber zum Henner-Hof. Erst als ich hier einzog, begriff ich, wie schön diese Landschaft ist. Für den Moment kann ich mir keinen besseren Ort denken.
Doch nun ist es Nacht, und ich sehe nur Johannes, der sein Motorrad in den Schuppen schiebt, wieder herauskommt, sich eine Zigarette anzündet und nach oben schaut. Er kann mich nicht sehen. Ich habe das Licht gelöscht, damit ich die Spinnen, die sich ununterbrochen an durchsichtigen Fäden von der Decke lassen, nicht mehr ertragen muss. Sie widern mich an, und ich weiß, er findet sie lächerlich, meine kindische Angst.
Er war in der Stadt, bei den Künstlern.
Als er ins Zimmer kommt, stelle ich mich schlafend. Er wirft seine Kleider achtlos auf den Boden, putzt sich die Zähne, zu kurz, wie immer. Es ist spät, und morgen müssen wir früh raus. Ich werde wieder einmal lügen, werde sagen, ich hätte erst zur dritten Stunde, und schließlich bleibe ich einfach im Bett, bis er wiederkommt. Johannes ist im letzten Jahr; wir gehen auf dieselbe Schule, er in die zwölfte und ich in die zehnte Klasse. Als ich noch bei der Mutter und den Großeltern wohnte, musste ich jeden Tag den Berg hinunter in die kleine Stadt laufen – eine Dreiviertelstunde Marsch war das – und dann mit dem Bus weiter in die Kreisstadt. Insgesamt habe ich etwa eine Stunde und fünfzehn Minuten gebraucht. Zurück ging es nicht so schnell, denn da musste ich den Berg wieder hinauf.
Jetzt fahre ich meistens mit dem Johannes auf dem Motorrad zur Schule, aber seit einiger Zeit gehe ich nicht mehr oft hin. Ich habe aufgehört, die Fehlstunden zu zählen. Die Vormittage verbringe ich mit Büchern und Zigaretten; am Nachmittag fahren wir oft übers Land, manchmal in die Stadt, in das Künstlercafé. Dort trinkt man schon vor dem Dunkelwerden Wodka und Wein, und andauernd wird geredet. Dem Johannes gefällt das; ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Später dann steigen wir die Treppen hinauf in unsere Spinnenzimmer und lieben uns. Johannes löscht das Licht, er ist zärtlich und sanft unter der Bettdecke; noch niemals hat er mir wehgetan. Er ist mein erster Mann. Ich glaube, ich liebe ihn.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen um zehn – Johannes ist längst in der Schule – vibriert der Fußboden unter meinen bloßen Füßen. Ich stehe am Waschbecken vor dem Spiegel und bürste stolz mein langes Haar; das Klopfen jedoch kann ich nicht ignorieren. Es kommt aus der Wohnung unter uns, es kommt von der Frieda. Sie steht in der Stube vom Alfred, mit dem Besen in den abgearbeiteten Händen, und schlägt das Stielende gegen die Decke. Es hilft nichts, ich muss hinuntergehen. Wenn ich nicht käme, würde sie mit einem Kochlöffel gegen den Heizkörper schlagen – so lange, bis ich käme. Sie weiß, ich schwänze die Schule. Sie ist nicht einverstanden damit, aber wo ich schon einmal da bin, kann ich ebenso gut beim Kochen helfen. Die Frieda ist eine praktische Frau.
Auf dem Giebelfenstersims liegt mein Buch; eigentlich wollte ich in den Garten gehen und lesen. Ein bisschen ärgerlich bin ich jetzt doch über die Frieda, aber Dmitri Karamasows Schicksal muss warten, bis die Kartoffeln geschält sind und die Zwiebeln geschnitten.
Armer Dmitri, wird Gruschenka dich erhören?
Als Zeichen, dass ich verstanden habe, klopfe ich mit dem Holzstiel meiner Haarbürste dreimal gegen den Heizkörper. Ich soll nicht mit den Füßen stampfen, dann bröckelt Farbe auf den Stubenboden, und der Alfred muss sie wegfegen. Bevor ich gehe, öffne ich die Fenster, gieße den Lavendel in den Blumenkästen und rauche eine erste Zigarette. Ein herrlicher Schwindel erfasst mich, und ich stütze mich auf die Fensterbank und sehe in den Hof hinaus. Dort steht Marianne vor dem Stall und beschaut das frische Kalb. Die Liese hat es geschafft. Von drei bis fünf Uhr morgens hat sie gekämpft und schließlich, nicht ganz ohne Hilfe, ein gesundes Kälbchen geboren. Siegfried ist gegen vier Uhr dazugekommen, hat lange zugesehen und sich schlussendlich den langen Gummihandschuh über den starken Arm gezogen, ein Seil an die Vorderbeine des Kalbs gebunden und es herausgeholt. Nun steht es mit wackligen Beinen unter der Mutter und saugt an den Zitzen seine erste Milch. Es ist ein sonniger Tag. Später werde ich vielleicht mit Johannes am Flussufer liegen und in seinen blonden Haaren wühlen. Sie scheinen das Einzige zu sein, was er vom Vater hat: die dicken blonden Haare. Wenn uns die Hitze aufgeladen hat, gehen wir zum alten Schuppen am Wehr und machen Liebe. So nennt es die Marianne, wenn sie vor der Badezimmertür steht, die nicht abgeschlossen werden kann, und Johannes und ich gemeinsam baden. »Macht ihr Liebe, oder warum dauert das so lange? Der Siegfried wird gleich hereinkommen, er soll dich nicht nackig sehen, Maria.« Dann muss ich immer kichern, und Johannes taucht den Kopf unters Wasser.
Zum Mittag gibt es Eintopf mit Fleischeinlage, Selbstgeschlachtetes, versteht sich. Ich bin eigentlich Vegetarierin. Seit mir die Oma Traudel meinen Lieblingshasen Matze an einem Ostersonntag als fertigen Braten vorsetzte und mir der Opa Lorenz erst nach dem Essen sagte, dass es der Matze gewesen ist, habe ich kein Fleisch mehr angerührt. Den armen Matze habe ich wieder ausgespien. Da war ich zwölf; das ist nun fast fünf Jahre her.
Der Siegfried mag keine Vegetarier, obwohl er vorher noch nie einen getroffen hat. An Sonntagen legt er mir wortlos das beste Stück Fleisch auf den Teller, ich lege es dann ebenso wortlos zurück. Aber ein paarmal probierte ich heimlich ein Stück; es schmeckte wirklich gut.
Gesprochen wird wie immer wenig. Der Siegfried macht nicht viele Worte, da ist er wie die meisten Männer des Dorfs. Doch wenn er spricht, dann schweigen wir und hören zu, auch wenn es Unsinn ist, doch das kommt selten vor.
Müde sieht er aus. Seit acht Stunden ist er schon auf den Beinen, und es werden weitere acht sein. Im Sägewerk müssen Stämme in Bretter verwandelt werden, die Schafe sollen auf eine andere Weide getrieben, ein kaputter Zaun repariert und der Kuhstall ausgemistet werden. Zweimal am Tag wird gemolken, fünf Uhr früh und siebzehn Uhr am Abend. Der Milchwagen kommt alle zwei Tage und leert den gekühlten Tank.
Marianne hat im Lädchen zu tun. Im Frühjahr hat ihr der Siegfried die ehemalige Abstellkammer neben der Küche zu einem kleinen Hofladen umgebaut. Wirklich klein ist er, nicht einmal neun Quadratmeter groß. Eine weiß gestrichene schmale Tür, die im Sommer offen steht, führt in den fensterlosen Raum, an dessen Wänden einfache Regale von bienengewachsten Brettern aus dem hauseigenen Sägewerk angebracht sind. Kaufen kann man, was der Hof hergibt: Eier, Milch, Brot – von der Frieda gebacken –, Fleisch und Wurst von Schaf, Rind und Huhn, einiges Gemüse und Obst, Strümpfe aus eigener Wolle und später, in der Vorweihnachtszeit, Gänse. Schafe und Rinder werden auswärts geschlachtet, Hühner und Gänse dagegen im Keller.
Beim Betreten des Ladens erklingt das dunkle Läuten eines Windspiels, das Allererste, was die Marianne im Westen gekauft hat, einige Monate nachdem die Grenze fiel. Das war hier auf dem Hof beinahe unmerklich vorübergegangen. Man hatte ferngesehen, die Bilder aus Berlin wie aus einem anderen Land betrachtet, die Frieda hatte gesagt: »Dass ich das noch erlebe …«, Marianne hat geweint und Siegfried genickt. Immer wieder bewegte er seinen großen Schädel auf und nieder, dann war er die Tiere füttern gegangen. So erzählt es der Johannes, der damals kaum zu halten gewesen war und am liebsten gleich hingefahren wäre. Aber der Siegfried hat ihn nicht gelassen.
Wir sitzen am Tisch, an den Stirnseiten Siegfried und Frieda, an der Längsseite, mit den Rücken zum Fenster, Alfred und Marianne, gegenüber sitze ich. Die Söhne sind noch in der Schule. Siegfried ist trotz der Erschöpfung guter Stimmung. Er wirft seiner Frau einen zweideutigen Blick zu. Sie lächelt still. Es ist Sommer 1990. Heuwendezeit.
Am Nachmittag stehen wir alle mit Heurechen auf einer der großen Wiesen am Fluss. Siegfried, Frieda, Marianne, Lukas, Johannes, ich und der Alfred.
Der Alfred hat sein ganzes Leben hier verbracht. Nur ein einziges Mal verließ er den Hof für ein paar Wochen.
Alfreds Mutter Marie war Küchenmagd gewesen und hatte 1933 den Knecht Alwin geheiratet. Fünf Monate später kam Alfred auf die Welt. Frieda war damals bereits drei Jahre alt; es gibt Bilder von ihr. Ein kleines, rundliches Mädchen war sie mit dicken Zöpfen und einer großen Leidenschaft für den kleinen Alfred. Sie war die jüngere der beiden Schenke-Schwestern. Anneliese ging schon zur Schule, während Frieda von früh bis spät den kleinen Alfred über den Hof schleppte, ihn zwischen Wiesenblumen bettete oder ihn mit einem kleinen Schubkarren durch den Gemüsegarten schob. Friedas Brüder waren beide, drei- und fünfjährig, an einer schweren Grippe gestorben. Sie wurden nach ihrem Tod in die guten Sonntagsanzüge gesteckt, auf weißes Leinentuch gelegt und vom Fotografenmeister aus der kleinen Stadt G. zum ersten und letzten Mal abgelichtet. Die gerahmten Bilder hängte man in die gute Stube, über die Kommode mit der Tischwäsche.
Mir rinnt der Schweiß übers Gesicht. Widerwillig laufe ich ins Haus zurück und binde mir wie die anderen Frauen ein Kopftuch um. Meine Augen brennen vom herumfliegenden Heustaub, meine Beine – von Mückenstichen übersät, vom Heu zerkratzt – jucken fürchterlich. Der Rechen kommt mir unerträglich schwer vor. Frieda, trotz ihrer sechzig Jahre, schuftet unermüdlich und ohne zu klagen. Auch Marianne arbeitet still vor sich hin. Johannes wirft mir einen warnenden Blick zu; es ist höchstens vier Uhr, wir werden noch Stunden beschäftigt sein. Ich sehe, wie der Alfred einen kleinen Flachmann aus der Hosentasche zieht und verstohlen, aber genüsslich aus ihm trinkt. Auch ich habe Durst, und die Frieda muss Gedanken lesen können. Sie hält in der Arbeit inne, stützt sich auf ihren Rechen und ruft mir zu: »Hol sie doch ein paar Flaschen Wasser aus der Küche und Butterbrote. Wir machen eine Pause.«
»Ja, mach ich!«, rufe ich zu ihr hinüber und renne über die Wiesen Richtung Haus.
Als ich wiederkomme, kreischen die Maschinen im Sägewerk. Wir Frauen sind nun allein auf den Wiesen. Das heißt, nicht ganz unter uns, Alfred ist noch da, aber der zählt nicht. Das einzig Eigenständige am Alfred ist seine Trinkerei, die ebenso schweigend hingenommen wird wie fast alles hier. Sonst ist er Friedas Untertan; das ist er schon seit jener Zeit, als Frieda ihn kreuz und quer über den Hof schleppte und ihre kindlich-plumpe Fürsorge dem Säugling der Magd angedeihen ließ. Nun ist es längst zu spät für eine Geste der Emanzipation. Ohne eigene Frau und Kinder ist der Alfred ein Anhängsel der Familie geworden, die ihn beinahe wie einen eigenen Sohn behandelte. Nach dem Tod der beiden Schenke-Buben war er der einzige Junge, und eine gewisse Hoffnung veranlasste seine leiblichen Eltern dazu, den Sohn mehr und mehr der Obhut von Ingeborg und Wieland Schenke, Friedas Eltern, zu überlassen. Frieda liebte den kleinen Alfred über alle Maßen, und wer weiß, dachten sie wohl, vielleicht würde sie ihn auch später noch lieben, wenn die Zeit käme, zu heiraten und den Hof zu übernehmen. Tatsächlich wird noch immer gemunkelt, Volker, Friedas Ältester, sei Alfreds Sohn. Trinken tut er jedenfalls auch. Aber geheiratet hat sie dann den Brendel-Sohn, den Heinrich, einen kräftigen und tüchtigen Spross der Familie des Dorflehrers. Auch er spielte schon als kleiner Junge häufig auf dem Hof, auch ihn bemutterte die kleine Frieda mit unbarmherziger Leidenschaft, die später, als Frieda knapp siebzehn war, in aufopferungsvolle Liebe umschlug. Und später wurde der Schenke-Hof in Brendel-Hof umbenannt.
Kurz nach der Hochzeit mit Heinrich, im Jahre 1948, kam Friedas erster Sohn Volker zur Welt. Einige Wochen vor der Geburt verschwand der Alfred plötzlich – ein Hinweis auf eine mögliche Vaterschaft des Ausreißers? Frieda bestritt dies aufs Heftigste, und so wurde der Mantel des Schweigens über die unliebsame Vermutung gelegt. Einige Zeit später tauchte er wieder auf, der Alfred, abgerissen und dünn – ein geschlagener Hund. Seine Mutter brach bei seinem Anblick vor dem Herd zusammen.
Marianne lässt sich plötzlich in einen Heuhaufen fallen. Ihr rotes Kopftuch ist nach hinten gerutscht und gibt den Blick frei auf ihr dichtes Haar. Jung sieht sie aus, wie sie dort liegt, mit vom frischen Wasser benetzten Lippen, ihrem hochgerutschten Rock und den starken Beinen darunter. Neununddreißig Jahre ist sie alt, die Söhne achtzehn und zwölf. »Mutti«, sagt Johannes, »dein Rock …« Sie lacht und nimmt noch einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Dann steht sie wieder auf und sieht zum Sägewerk hinüber. »Ich bin gleich wieder da«, ruft sie uns im Gehen zu, »es dauert nicht lang.« Johannes lässt sich neben mir nieder und legt den Kopf in meinen Schoß. Mit einer Handvoll Wasser wasche ich ihm den Staub vom Gesicht und lege ihm meine gekühlten Hände auf die Augen. Von links spüre ich einen Blick – der Lukas beobachtet uns. Nur Frieda schaut auf den Fluss; mit wie in der Erde verwurzelten Füßen steht sie breitbeinig auf den Rechen gestützt und schaut. Auch wir sehen dorthin, können aber nichts Besonderes erkennen – nur das Wasser, das fließt, wie jeden Tag. Im Sägewerk drüben sind die Maschinen verstummt.
Es ist schon nach zehn, als wir schließlich am Esstisch sitzen. Auf einer großen Porzellanplatte ist kalter Braten in dünnen Scheiben angerichtet. Daneben stehen ein Korb mit dunklem Brot, Butter in einem Keramikfässchen, eine Flasche Wein und ein Zitronenkuchen. Ich esse, als hätte ich tagelang gehungert, sogar ein Stück Fleisch. Das bringt mir ein anerkennendes Nicken vom Siegfried ein. Er meint, wir müssten ein paar Helfer für die Heuernte holen, der Volker könnte sich ja auch mal wieder blicken lassen. Aber der Volker sei nun einmal nicht da, entgegnet die Frieda, und ihre Stimme hat einen gereizten Klang. Die Brüder vom Siegfried sind die Lindenblattstelle in Friedas Leben. Volker, der Älteste, ist mit sechzehn zur LPG gegangen, in den Schweinestall. Dort fing er mit einigen anderen das Trinken an. Heute lebt er in einer kleinen Wohnung in der Kreisstadt, und obwohl er gerade einmal zweiundvierzig Jahre alt ist, arbeitet er nicht mehr. Eine Frau hat er nicht, auch keine Kinder. Das alles klingt so sehr nach dem Alfred, dass wir betreten schweigen, wenn die Rede auf den Volker kommt. Nur der Alfred schaut dann freundlich zur Frieda rüber, die ihn ihrerseits mit Nichtbeachtung straft. Der mittlere Sohn, Hartmut, stellte gleich nach seinem achtzehnten Geburtstag einen Ausreiseantrag, dessen Inhalt zu seiner sofortigen Verhaftung führte. Zweieinhalb Jahre später wurde er, ohne dass Frieda und Heinrich davon erfuhren, an den Westen verkauft. Sie hörten erst wieder von ihm, als er in Rosenheim, in Bayern, Wohnung und Arbeit gefunden hatte. Von seinen Plänen, das Land zu verlassen, hatten sie nichts geahnt; das wirft die Frieda ihm heute noch vor. Friedas Mann Heinrich dagegen, der vor einigen Jahren an Krebs starb, war bis zum Schluss stolz auf seinen Sohn, obwohl er ihn nie wiedersah.
Ich trinke ein Glas Wein und bin so müde, wie ich es noch niemals vorher war. Es ist mein erster Sommer auf dem Brendel-Hof, mein erster Sommer ohne Mutter, mein erster Sommer mit einem Vater, wenn auch nicht mit meinem eigenen.
Nach dem Essen schleppen wir uns die Treppen hinauf und gehen, ohne uns gewaschen zu haben, sogar ohne die Zähne zu putzen, ins Bett. Bevor mich ein Schlaf von ungeahnter Schwere übermannt, beschließe ich, morgen keinesfalls zur Schule zu gehen. Nächste Woche beginnen ohnehin die Ferien; es lohnt sich nicht mehr – dieses Jahr ist verloren.
Kapitel 3
Ich wache auf und bin allein. Johannes ist zur Schule gefahren.
Heute muss ich wissen, ob Alexej Karamasow rechtzeitig das Kloster erreicht, um in dessen Sterbestunde beim Starez Sossima zu sein. Und warum hat sich der Starez vor Dmitri bis zum Boden verneigt? Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, muss es fast Mittag sein. Unten in der Küche steht ein Teller für mich bereit, es gibt gut gekühlte Butter und Marmelade – die erste selbst gekochte des heurigen Sommers, Brot liegt in einer Holzschale. Siegfried begrüßt mich im Treppenhaus mit einem ungewöhnlich freundlichen Lächeln, und Marianne höre ich im Lädchen gackern. Die Katze Selma streicht um meine Beine, die ganz zerschunden sind vom gestrigen Heueinsatz. Selten war ich so glücklich. Meine Wangen sind sonnengebräunt, die Arme und der Nacken sogar dunkelbraun, obwohl doch der Sommer noch ganz jung ist.
Die Zwischentür zum Hofladen steht offen. Marianne lacht. Es ist der Henner dort im Laden, mit dem sie scherzt. Wahrscheinlich macht er ihr Komplimente. Die Marianne ist noch immer eine schöne Frau, kräftig gebaut, mit einem langen, dicken, dunklen Zopf und rosigen Wangen, und für den Henner hat sie eine Schwäche. Sicher kauft er Brot, aber vielleicht ist er auch nur gekommen, um zu reden, einsam, wie er ist. Der Henner sei ein Wüterich, behauptet die Frieda. Seit ihm vor vielen Jahren die Frau weglief, worüber verschiedene Geschichten kursieren, treibt er es wohl ziemlich wild. Hat seinen Hof vom Vater geerbt und ihn in wenigen Jahren heruntergewirtschaftet, so heißt es im Dorf. Nur für die Pferde habe er ein Händchen und wohl auch eine Leidenschaft. Es sollen erstklassige Trakehner sein.
Der Siegfried sagt, es sei die DDR, die ihn zerbrochen habe. Ein Mann mit solcher Kraft, der muss sein eigenes Land bestellen und nicht noch in der LPG arbeiten. Einer wie der Henner muss sein eigener Herr sein.
Selbst die Hunde vergisst er manchmal zu füttern, wenn er auf Frauenfang und auf Sauftour geht. Dann kommt es vor, dass sie umherstreunen und Schafe reißen. Auch Siegfried hat schon Lämmer an die Doggen verloren und wird es nicht gern sehen, wenn seine Frau mit dem Wüstling Scherze treibt. Aber ein stattlicher Mann ist er allemal, der Henner, sogar belesen soll er sein. Hat ein ganzes Bücherregal im Haus stehen, so etwas habe man noch nicht gesehen. Die Leute im Dorf sagen, er sei ganz nach der Mutter geraten, die sei aus der Stadt gekommen und auch schon so verschroben gewesen.