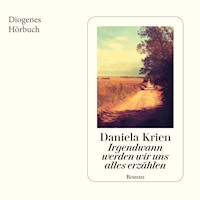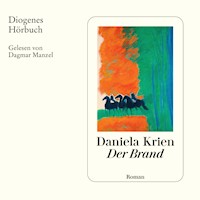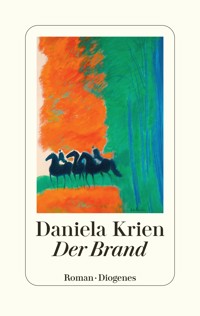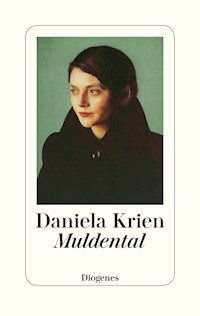22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2024! Sie hat alles gehabt und alles verloren: Sekunden der Unachtsamkeit kosten ihre einzige Tochter das Leben. Tief sieht Linda in den Abgrund und wäre beinahe gefallen, doch da sind hauchfeine Fäden, die sie halten – die Hündin Kaja, die steten Handgriffe im Garten, das Mitgefühl für andere. Wie viel Kraft in ihr steckt, ahnt sie erst, als sie zurückfindet in einen Alltag und zu sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniela Krien
Mein drittes Leben
Roman
Diogenes
Wir wissen, dass alles, was kommt, auch wieder geht,
warum tut es dann immer wieder und immer mehr weh?
Gerhard Gundermann
TEIL I
1
Heute Morgen kam ein Bussard vom Himmel geschossen und stürzte sich auf eine meiner jungen Hennen. Sie hatte sich aus dem Schutz der Obstbäume herausgewagt und abseits von den anderen gepickt. Ich war gerade dabei, eine Schubkarre voller Laub, Dreck und dürrer Äste am Hühnergarten vorbei Richtung Komposthaufen zu schieben, als ich den Raubvogel aus den Augenwinkeln herankommen sah. Ich ließ die Schubkarre los, riss die Pforte zum Hühnergarten auf und rannte. Meine Hände steckten in Arbeitshandschuhen, und so griff ich, ohne nachzudenken, nach ihm. Mit seinem kurzen, gebogenen Schnabel hackte er nach mir, stieß schrille Töne aus, schlug wild mit den Flügeln, ohne seine Beute loszulassen. Es war eine Kraft in dem Tier, mit der ich nicht gerechnet hatte, und ich drehte den Kopf zur Seite, um mich vor seinen Hieben zu schützen. Als ich ihn richtig zu fassen kriegte, schleuderte ich ihn mit ganzer Kraft in die Luft zurück.
»Hau ab!«, schrie ich mit fremder Stimme.
Für einen Moment sah es so aus, als sei er verletzt. Seine Flügel schienen den Rhythmus nicht zu finden. In geringer Höhe taumelte er über mir. Doch plötzlich entfernte er sich mit kräftigen Flügelschlägen, kreiste noch einmal über dem Hühnergarten und drehte schließlich ab.
Eine Weile blieb ich stehen, um abzuwarten, ob er einen zweiten Versuch wagen würde. Mein Herz raste; ich spürte mein Blut bis in die Fuß- und Fingerspitzen hinein pulsieren. Laut und stoßweise ging mein Atem, und zu meinen Füßen lag die Henne und rührte sich nicht. Ich riss mir die Handschuhe von den Händen, bückte mich und wollte sie gerade berühren, als sie plötzlich quicklebendig davonstob. Lediglich ein paar Federn hatte sie gelassen.
Für einen Augenblick stand mir mein früheres Ich vor Augen: die Frau mit den gut sitzenden Haaren, der Vorliebe für Kaschmir, Seide und teures Leinen, ihre gepflegten Nägel, die stets sorgfältig geschminkten Augen und Lippen und ihr Widerwille gegen alles Grobe und Schmutzige. Die Hypochonderin, die jedes Krankheitssymptom googelte und immer Krebs vermutete. Die Vorsichtige, die jedes Lebensmittel schon am Tag nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums wegwarf. Die Saubere, die der Putzfrau noch einmal hinterherwischte.
Unwillkürlich schüttelte ich den Kopf, ging zur Schubkarre zurück, schob sie zum Kompost und entleerte sie. Mit einer Mistgabel arbeitete ich die Fuhre unter und suchte noch einmal den Himmel nach dem Räuber ab. Beim nächsten Mal käme er nicht so ungeschoren davon. Sollte er wiederkehren, würde ich seinen Kopf mit den starren gelben Augen gegen den nächstbesten Baum schlagen.
Mein Name ist Linda.
Linda bedeutet die Milde, die Freundliche, die Sanfte. Dieser Name hat nichts mehr mit mir zu tun.
Es ist noch kalt im Haus. Das Feuer im Ofen brennt erst seit wenigen Minuten. Ich trage ein langes Unterhemd aus dicker Baumwolle und einen Rollkragenpullover mit einer Daunenweste darüber. Das Teewasser kocht, ich schneide den Ingwer hinein und stecke mir eine hauchdünne Scheibe in den Mund. Dann setze ich Wasser für Kartoffeln auf und widerstehe dem Drang, eine Nachricht an Richard zu schreiben. Ich will irgendwem von dem Bussard erzählen, und er ist der Einzige, den ich nicht aus meinem Leben vertrieben habe.
Kaja weicht mir nicht von der Seite. Die Hündin spürt alles, reagiert unmittelbar. Während ich unruhig von Raum zu Raum gehe, bleibt sie dicht neben mir. Das Tier versteht mein Verhalten nicht; es macht ihm Angst. Es will ein souveränes Frauchen, ich dagegen sende Signale, die es verwirren und seine unterwürfige Anhänglichkeit noch verstärken.
Ich schalte das Radio ein, setze mich an den Tisch, beginne, die Kartoffeln zu schälen, und weise Kaja auf ihren Platz neben dem Ofen, der nun vor Hitze glüht. Sie gehorcht sofort. Der Wetterbericht kündigt Regen an; in den Verkehrsmeldungen werden die wegen des gestrigen Sturms gesperrten Straßen in ganz Mitteldeutschland aufgezählt.
Im Landkreis Harz, zwischen Elend und Sorge …
Ich lache laut auf, und Kaja hebt den Kopf und blickt mich erschrocken an.
Nun ist es windstill.
Im fahlen Winterlicht dieses Januartages sitze ich am Küchenfenster, trinke frischen Ingwertee mit reichlich Honig und sehe in den Hof hinaus. Hell wird es seit Wochen nicht. Ein gleichmäßiges Grau hängt über der Gegend und schluckt jeden Übermut; es dämpft die Empfindungen, die guten wie die schlechten. Ich fühle etwas, doch dieses Etwas will nicht hoch hinaus. Es ist ein kleines, unscheinbares und doch lebenserhaltendes Glimmen.
Ich ziehe die Daunenweste aus und auch den dicken Pullover. Von meinen Achselhöhlen geht ein strenger Geruch aus; ich muss mich wieder einmal richtig waschen. Die Haare sind nicht so wichtig, regelmäßiges Bürsten genügt. Shampoo benutze ich schon lange nicht mehr. Die Talgproduktion regulierte sich innerhalb weniger Monate, und Haut und Haar scheinen gesünder als je zuvor.
Ich hocke mich in die kalte Badewanne und drehe den Duschhahn auf. Kurz heiß, dann kalt, dann einseifen und lange kalt abspülen. Nach dem Trockenrubbeln kribbelt die Haut, und mir ist warm. Im trüben Spiegel über dem Waschbecken sehe ich mein Gesicht nur verschwommen. Die Finger meiner rechten Hand fahren die lange Narbe über dem Schlüsselbein entlang. Jeden Tag bestreiche ich sie mit Salbe. So bleibt die Haut elastisch, und nach und nach verblasst die blau-lila Färbung. Darunter war einmal meine Schilddrüse. Der Krebs hat sie zerstört, und die Ärzte nahmen sie heraus, um mein Leben zu retten, das ihnen mehr wert war als mir selbst. Die Rettung von Leben ist ihre Aufgabe. Es interessiert sie nicht, in welches Leben sie den geheilten Patienten zurückschicken.
Die Angst und die Verzweiflung, die oft auf eine Krebsdiagnose folgen, blieben bei mir aus. Tatsächlich empfand ich eine merkwürdige Freude, eine Art gesteigerte Lebendigkeit im Angesicht des Todes, und ein Gefühl, wie es ein Marathonläufer kurz vor dem Ziel haben muss. Richard, meine Mutter und meine Freunde waren fassungslos. Nicht noch ein Schicksalsschlag nach dem, was schon geschehen war. Warum, fragten sie, warum ausgerechnet Linda, nach allem, was sie durchgemacht hat?
Warum nicht?, dachte ich.
Der Krebs erschien mir folgerichtig und konsequent. Mein Körper hatte seine Widerstandskraft verloren. Die Trauer hatte sich seit über einem Jahr durch meine Zellen gefressen. Sie waren zu schwach geworden. Ein logischer Vorgang.
Richard tat, was Männer in Krisen eben tun: Lösungen finden. Ganze Nächte verbrachte er mit der Recherche im Netz. Er kaufte Grüntee, Kurkuma und Brokkoli, wegen ihrer angeblich wachstumshemmenden und Krebszelltod hervorrufenden Wirkung, er verbannte Zucker aus unserem Haushalt und organisierte Arzttermine für Zweit- und Drittmeinungen. Die Diagnose blieb die gleiche.
In Richard ging ein Wandel vor, es war offensichtlich. Die dunkle Müdigkeit der letzten Monate wich aus seinem hager gewordenen Gesicht. Die tiefen Falten von der Nase zum Mund schienen sich ein wenig zu glätten, und sein Gang wirkte dynamischer. Endlich gab es einen Grund, die Trauer hinter sich zu lassen und wieder zu handeln. Meinen Krebs zu bekämpfen wurde zu seiner Mission. Ab hier ging es wieder vorwärts.
Mein eigener Kampf dagegen war kein echter Kampf, sondern lediglich ein Reflex, der durch die Möglichkeit des Todes ausgelöst worden war. Der Mörder mit dem Namen Krebs legte seine Hände um den Hals des Opfers und drückte zu. Das Opfer wehrte sich unwillkürlich, beinahe wider den eigenen Willen, denn jede Kreatur wehrt sich gegen den Tod. Der Selbsterhaltungstrieb ist uns genetisch eingeschrieben. Richard nahm mir diesen Gedanken übel, denn in dieser Version der Geschichte kam er nicht vor.
Ich denke viel an Richard. Er ist mein Mann – ein guter Mann, aus einer freundlichen, intakten Familie, mit einem Stammbaum, in dem es Kinder, Eltern, Geschwister, Nichten, Neffen und sogar noch zwei Großmütter gibt, während meine Familie fast nur aus Toten und Unbekannten besteht. Ich habe ihn gewählt, diesen Mann, der meinen Mangel ausglich, und ich kann, ohne zu heucheln, sagen: Ich liebe ihn.
Beinahe täglich stelle ich mir die Frage, ob ich ihm unrecht tue. Könnte ich anders handeln, täte ich es. Die meisten Menschen verletzen nicht bewusst. Sie tun ihr Bestes, nur ist ihr Bestes nicht gut genug. Auch Richard hat nichts falsch gemacht. Hat sich nur eines Tages umgedreht und nach vorn gesehen, während mein Blick in die Vergangenheit gerichtet blieb.
Wenn er mich besucht, betrachtet er schweigend meine kräftig gewordenen Hände, macht Bemerkungen über meine abgelegte Eitelkeit, die strenge Disziplin. Letztens schaute er zu, wie ich das Holz im Hof mit der Axt spaltete, wie die Scheite nach links und rechts wegflogen und ich sie hernach in die Schubkarre warf, um sie später an der Schuppenwand zu stapeln. Auf seiner Stirn bildeten sich feine Falten. Ich konnte sehen, wie fremd ich ihm geworden bin.
Auch im Wohnzimmer brennt nun ein Feuer im Ofen. Ich schiebe den Ohrensessel in die Mitte des Raums und setze mich. An der den Fenstern gegenüberliegenden Wand hängen die Bilder der Vorfahren, Kinder und Enkel von Grete Adomeit, der Vorbesitzerin des Hauses. Meine eigenen Bilder habe ich einfach dazugehängt.
Zuweilen, besonders in den späten Nachmittagsstunden, sitze ich hier im Sessel und blicke so lange auf die Fotos, bis die einsetzende Dunkelheit die Konturen verwischt und sie schließlich ganz verschwinden. Dann kommt es vor, dass ich Sonja höre. Ganz deutlich höre ich ihre Stimme. Mama, ruft sie, Mama, guck mal. Oder sie plappert, in irgendein Spiel versunken, vor sich hin. Auch ihre spätere jugendliche Stimme habe ich schon gehört. Meistens sind es nur wenige Sekunden, bis sie leiser wird und schließlich ganz verklingt. Manchmal legt sich kurz vor dem Verschwinden ein seltsamer Hall auf ihre Stimme, und jedes Mal höre ich auf zu atmen und halte in der Bewegung inne, voller Angst, Sonja mit einem unbedachten Geräusch zu vertreiben. Ein einziger Ton genügt, und sie verschwindet. Ich muss erstarren, dann bleibt sie. In diesen Momenten spitzt die Hündin die Ohren, springt auf und läuft fast immer in jene Richtung, aus der die Kinderstimme kommt.
2
Vor Jahren fuhren wir einmal mit dem Auto durch dieses Dorf. Das Auto hatten wir erst kurz zuvor gekauft, es war unser erster Ausflug mit dem Wagen, der noch neu roch und so sauber war, dass wir uns alle die Schuhe abklopften, bevor wir einstiegen. Sonja saß hinten und hatte Kopfhörer auf, Richard und ich blickten aus dem Fenster, während wir wegen eines im Verkehrsfunk gemeldeten Blitzers beinahe im Schritttempo durch das Dorf fuhren.
»Hier will man nicht begraben sein«, sagte Richard, und ich pflichtete ihm bei.
Es ist ein reizloses zweigeteiltes Straßendorf. Im südlichen Teil reihen sich links und rechts der viel befahrenen Straße alte Höfe aneinander. Ihre Tore sind meist verschlossen, die Fassaden schmucklos, und an einigen hängen verblichene Stoffbanner mit der Aufschrift: Es reicht! Umgehungsstraße jetzt!
Alte, teils abgestorbene Weiden säumen das Ufer eines ausgetrockneten Dorfteichs, die zugesperrte Kirche beginnt zu verfallen, zwischen Straßenrand und Häusern stehen neu gepflanzte Linden auf einem breiten Rasenstreifen. Es muss eine Zeit gegeben haben, als das Dorf ein belebter Marktflecken war, wo links und rechts des Fahrweges die Bauern ihre Waren verkauften. Heute lebt hier keiner mehr von Landwirtschaft. Die Felder gehören einem großen, industriell geführten Agrarbetrieb. Die Dorfbewohner öffnen morgens die Tore, steigen in ihre Autos, fahren zur Arbeit in die Stadt und kehren am späten Nachmittag mit ihren Einkäufen aus dem Supermarkt zurück. Sie schließen die Tore und verschwinden. Nachts lassen sie die Jalousien herunter, und im fahlen Licht der Straßenlaternen sieht man höchstens ein paar Katzen herumstreunen und manchmal einen Fuchs. Auch tagsüber spaziert kein Mensch über die ordentlich gepflasterten und behindertengerechten Bürgersteige, die bis ins neue Dorf führen. Dort reiht sich Fertighaus an Fertighaus, in kreischenden Farben, die Gärten mit Metallplatten, Gabionen oder Betonzäunen abgeschirmt. Kiesschotter und Schiefersplit in den Vorgärten, Rindenmulch zwischen den immergleichen trockenheitsresistenten Stauden, Trampoline auf blumenfreien Rasenflächen hinter den Häusern, wo nachts die Mähroboter fahren und den hilflosen Igeln die Beinchen abschneiden. Unter den Carports aus Aluminium stehen große Autos mit dunkel getönten Scheiben wie Panzer gegen alles Lebendige.
Nirgendwo gibt es weniger Natur als im neuen Teil des Dorfs.
Den Abschluss bildet der u-förmig angelegte Gebäudekomplex der Behindertenwohnstätte, wo morgens Fahrdienste die Bewohner abholen, um sie zur Arbeit oder zur Tagesbetreuung in die nächste Kleinstadt zu bringen.
Ringsherum nichts als flaches Land, parzelliert in große Felder mit Monokulturen – Raps und Mais –, Windräder am Horizont, hier und da ein schmaler Blühstreifen, eine gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsfläche, eine Hecke, eine alte Obstbaumallee mit sterbenden oder bereits toten Bäumen, aber kein Hügel weit und breit, nichts, was den Blick auf sich zieht und hält.
Tagsüber reißt der Autoverkehr nicht ab. Nachts lässt das Rauschen der Fahrzeuge zwar nach, doch dann beginnt das an- und abschwellende Dröhnen der startenden und landenden Frachtflugzeuge vom nahen Flughafen.
Hier lebe ich seit mehr als zwei Jahren, eine viertel Autostunde entfernt von der Kleinstadt, in der ich die ersten dreizehn Jahre meines Lebens verbracht habe, etwa vierzig Minuten weg von der Wohnung in Leipzig, die Richard noch immer unser Zuhause nennt.
Grete Adomeit traf ich im Park des Krankenhauses. Sie saß auf einer Bank, die von einer ausladenden Blutjohannisbeere mit leuchtend pinkfarbenen Blütentrauben umrahmt stand. Ich war deutlich zu früh zur Nachuntersuchung gekommen. Die Radiojodtherapie samt der fünftägigen Isolation, um meine Mitmenschen nicht zu verstrahlen, lag bereits hinter mir. Ich nahm neben der alten Frau Platz. In jener Zeit kam es öfter vor, dass ich mit Wildfremden sprach, mit Menschen, die nichts von mir wussten, die mir ohne Mitleid und Scheu in die Augen blickten, ohne Verlegenheit und Angst, etwas Falsches zu sagen.
Ihren Gehstock hatte Grete Adomeit zwischen die dicken Beine geklemmt, ihre Hände lagen auf dem Knauf. Sie trug ein grellbuntes Schürzenkleid, das noch aus DDR-Zeiten stammen musste, eine Strickjacke, an der zwei Knöpfe fehlten, und blickdichte, hautfarbene Strumpfhosen mit einer Laufmasche. Sie musste meinen Blick auf die kaputten Strümpfe bemerkt haben, denn sie schaute nun selbst auf ihre Beine.
»Taugt alles nichts mehr, ist alles fürs Wegschmeißen gemacht.«
In der halben Stunde Wartezeit bis zu meinem Termin erfuhr ich, dass die weit über achtzig Jahre alte Frau allein auf einem Hof im nördlichen Sachsen lebte, der Mann schon Jahrzehnte tot war, die Töchter beide weit weg und nicht interessiert am Hof und der Mutter. Ich hörte, dass sie Viecher hatte und einen Hund und einen unheilbaren Krebs, der sie schon bald unter die Erde bringen würde. Aus ihrer Handtasche zog sie ein Foto heraus und hielt es mir hin. Ein junger Mann und eine junge Frau mit ernsten Gesichtern vor einem großen Holztor. Aus dem ebenmäßigen, runden Gesicht der Frau blickten ausdruckslose Augen, in ihren Händen hielt sie einen Maiglöckchenstrauß. Der junge Mann neben ihr hatte nur einen Arm. Auch er schaute starr in die Kamera, ohne den Anflug eines Lächelns. Zwei Übriggebliebene, von der Not Zusammengetriebene, schoss es mir durch den Kopf.
Bevor ich sie fragen konnte, ob das ihr Hochzeitsfoto sei, sagte sie: »Mein Hof. Mein Haus.«
Alle ihre Sätze waren kurz; sie enthielten nur das notwendigste Vokabular. Vermutlich sprach sie nicht oft, und wie jede Fähigkeit, die nicht mehr angewandt wird, war Grete Adomeit das Sprechen abhandengekommen. Sie war ein verschlissener Mensch. Die trüben Augen, das ungepflegte, kaum noch vorhandene Haar, die schäbige Kleidung, die trockenen, rissigen Hände, der faulige Geruch aus ihrem Mund und der amorphe Leib erzählten von einem harten Leben und einem harten Herz. Sympathisch war sie mir keineswegs.
Von mir selbst gab ich wenig preis, unter meinem Beruf konnte sie sich nichts vorstellen, aber einer meiner Sätze ließ sie aufhorchen. Es müsse beruhigend sein, einen eigenen Hof zu haben, dessen Tor man schließen und die Welt aussperren kann, sagte ich, und sie sah mich schräg an, spielte mit ihrem Gebiss und kniff die Augen zusammen. Als ich mich verabschiedete, nannte sie mir eindringlich einen Tag und eine Zeit, zu der sie wieder hier sitzen würde. Sie wiederholte die Daten zweimal und hielt mich dabei unsanft am Arm fest.
Auf dem Weg ins Klinikgebäude spürte ich noch immer den Druck von Grete Adomeits kräftigen Fingern. Ich massierte meinen Unterarm an der Stelle und versuchte vergeblich, der Begegnung keine übermäßige Bedeutung beizumessen.
Richard gegenüber erwähnte ich Frau Adomeit mit keinem Wort. Ohnehin sprachen wir kaum miteinander. Seit klar war, dass der Krebs nicht mein Ende sein würde, radelte er nach dem Dienst in der Schule direkt ins Atelier, das er sich mit einer jungen Künstlerin teilte. Er malte wieder, obwohl er geglaubt hatte, nie wieder malen zu können. Die junge Frau arbeitete angeblich immer nachts. Wenn sie auftauche, sei er längst zu Hause, versicherte mir Richard mehrfach ungefragt. Ein paar Jahre zuvor hätte diese Konstellation ein Unruhegefühl bei mir ausgelöst, nun jedoch ließ mich der Gedanke kalt. Die Frau, die unsere Ehe gefährdete, war alt und krank und hieß Grete Adomeit.
Beim nächsten Treffen saß ich schon lange vor der verabredeten Stunde auf der Bank und wartete. Tag, Ort und Zeit stimmten, Grete Adomeit hatte die Daten wiederholt. Ich wartete lange, die Zeit war längst überschritten, ich musste zur Toilette, wagte aber nicht, mich von dem Platz wegzubewegen, aus Angst, die alte Frau zu verpassen. Endlich kam sie. Ihr schwerfälliger Gang war offenbar von Schmerzen begleitet. Bei jedem Schritt stieß sie den Stock vor sich auf den Boden und ächzte.
Dass ich gewartet hatte, schien sie als selbstverständlich hinzunehmen. Keine Entschuldigung, kein Dank kamen über ihre Lippen. Stattdessen holte sie aus einem schmutzigen, fadenscheinigen Stoffbeutel ein Fotoalbum heraus, gab es mir und wies mich an, es durchzublättern. Es war das merkwürdigste Album, das ich je gesehen hatte. Nur wenige Bilder zeigten die Familienmitglieder, auf den meisten waren Teile des Hofs zu sehen. Ein neuer Zaun, eine eingerüstete Hausfassade, der Innenhof mit einem jungen Baum und einer Bank davor, akkurat angelegte Beete. Sie benannte alles, tippte mit dem Finger darauf, wie um sicherzugehen, dass mir nichts entging. Die Töchter und den Mann überblätterte sie rasch.
»Die Mädchen wollen es nicht«, stieß sie hervor und machte eine wegwerfende Bewegung mit den Händen. Sie blickte mich prüfend an, dann fragte sie: »Haben Sie ein Auto?«
Ich bejahte, und bevor ich mich nach dem Grund dieser Frage erkundigen konnte, stand Grete Adomeit auf.
»Wo steht es?«, rief sie und lief gleich darauf erstaunlich flink neben mir her.
Am frühen Abend kehrte ich in eine leere Wohnung zurück.
Richard kam spät; ich lag im Bett und hatte die Tablette bereits genommen. Das Zolpidem flutete langsam an. Ich hatte es mit einer halben Mirtazapin kombiniert, um nicht schon nach wenigen Stunden wieder wach zu sein. Eine der Nebenwirkungen war, dass ich alles, was sich zwischen der Einnahme und dem nächsten Morgen ereignete, nahezu vollständig vergaß. Es hatte also keinen Sinn, noch mit Richard zu sprechen.
Seine vorsichtigen Schritte im Flur entfernten sich Richtung Küche. Bis er zu mir ins Bett käme, würde ich längst schlafen – regungslos, traumlos, mit in der Speiseröhre ungehindert aufsteigendem Magensaft, der mir am nächsten Tag brennende Schmerzen hinter dem Brustbein verursachen würde, weil die sedierende Tablette mein Aufwachen und Schlucken verhinderte. Irgendeinen Preis zahlt man immer, dachte ich, während ich wegdämmerte. Mein letzter Gedanke galt Grete Adomeit und der Idee, die sie mir in den Kopf gepflanzt hatte.
In den nächsten Wochen fuhr ich regelmäßig zu ihr ins Dorf, ohne Richard davon zu erzählen. Ich spürte von Anfang an, wie der Ort mich beruhigte. Die abweisenden Fassaden, die leeren Bürgersteige, die fantasielosen Vorgärten, die öde Landschaft – nichts erregte mein Gemüt, nichts weckte meinen Neid, keines der Leben hinter den Mauern und unter den scheußlich glänzenden Dachziegeln erschien mir erstrebenswert, doch was das Wichtigste war: Nichts wies auf Sonja hin.
Kein einziges Mal starrte ich hier einer jungen, schlanken Frau mit hohem, wippendem Pferdeschwanz hinterher, nie tauchte Sonjas Gesicht plötzlich aus einer Gruppe junger Leute auf, nie hörte ich ihr Lachen auf der Straße oder sah ihr Rennrad an einer Hauswand lehnen, und keiner ihrer Freunde stand plötzlich vor mir. An keinem Fleck hier ist sie je gewesen, und hinter keiner Ecke lauerten Erinnerungen und fielen mich an. Anders als in Leipzig befand ich mich hier außer Gefahr. Was Sonja betraf, befand ich mich im Niemandsland.
Grete Adomeit führte mich im Hof und Garten herum, präsentierte mir stolz ihre Schafe und Hühner und den Gemüsegarten, servierte anschließend muffig schmeckenden Pfefferminztee und zeigte mir die immer gleichen Fotos, während draußen im Hof ein zauseliger Hund von seiner Hütte aus sehnsüchtig zum Küchenfenster blickte.
In ihrer Küche war es kälter als draußen; es roch nach Alter und Krankheit, nach Zwiebeln, Bratfett und Fäulnis, und manchmal bot sie mir Kuchen an, den ich dankend ablehnte. Hatte sie genug von mir, sagte sie geradeheraus, ich solle jetzt gehen; mit Höflichkeiten hielt sie sich nicht auf.
Gesundheitlich ging es ihr jedes Mal schlechter. Gegen die Empfehlung ihres Onkologen hatte sie die weitere Behandlung der Krankheit abgelehnt. Der Gebärmutterkrebs hatte mittlerweile auf Blase und Enddarm übergegriffen und metastasierte nun in weitere Organe, in das Gewebe der Bauchhöhle und die umliegenden Lymphgefäße hinein. Sie zählte die befallenen Bereiche nacheinander auf und schien stolz darauf zu sein, sich alles gemerkt zu haben. Lediglich starke Schmerzmittel schluckte sie täglich, und über ihr nahendes Ende sprach sie ohne erkennbares Bedauern. Ihre einzige Sorge galt dem Hof und den Viechern.
Wir einigten uns, bevor sie zu schwach wurde, um weitere Dinge zu regeln. Ihren Töchtern war unser Plan recht. Verkaufen wollten sie den Hof nicht, darum kümmern wollten sie sich auch nicht. Eine Mieterin war für alle die beste Lösung.
Erst wenige Tage vor Grete Adomeits Tod sprach ich mit Richard. Bis zum Schluss hatte ich gehofft, dass irgendetwas meinen Entschluss ins Wanken bringen würde. In diesem Fall wäre es überflüssig gewesen, Richard mit meinen Überlegungen beunruhigt zu haben. Doch der Deus ex Machina blieb aus, und mein Plan ließ sich nicht länger verschweigen.
Ich hatte ihn von der Schule abgeholt und lief mit ihm im Clara-Zetkin-Park am Elsterflutbett entlang, wo die gelben Blätter der Linden auf uns herabrieselten und von der tief stehenden Herbstsonne zum Leuchten gebracht wurden. Wie goldene Taler fielen sie herunter, während ich Richard umstandslos erklärte, dass ich beabsichtige, in das Dorf zu ziehen. Nur vorübergehend, um Abstand zu gewinnen, um den ewig wachen Schmerz zu besänftigen und den Erinnerungsfallen zu entkommen.
Er blieb stehen und blickte mich an.
»Komme ich in deinen Plänen noch ir-gend-wo vor?«
»Aber ja«, sagte ich reflexhaft, »natürlich kommst du vor. Es ist nur so …«
»Es ist nur so …?«
»… dass du Teil des Problems bist.«
»Inwiefern?«
»Es geht dir besser, Richard. Dein Leben geht weiter.«
»Ich trauere auch, Linda.«
»Ja, aber auf einer anderen Ebene.«
»Und deswegen musst du weg.«
Ich nickte, Richard schüttelte den Kopf.
»Das ist doch Blödsinn!«, rief er. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es dir da draußen auf dem Dorf, allein in einem alten Haus besser geht!«
Er stellte das Fahrrad an einem Baum ab, zog sein Telefon aus der Tasche und googelte den Namen des Ortes.
»Du spinnst ja!«, rief er, »da führt die Bundesstraße durch! Da rauscht permanent der Verkehr am Haus vorbei. Und die Flugzeuge fliegen drüber. Tag und Nacht. Bist du bescheuert?«
»Es ist eine Dreißigerzone«, erwiderte ich tonlos und ignorierte sein künstliches Lachen.
»Herrlich, Linda, ganz wunderbar. Dort wirst du dich richtig wohlfühlen. Gerade du!« Er schüttelte den Kopf. »Du bist wirklich nicht ganz dicht!«
Auch die erneute Beleidigung steckte ich widerspruchslos weg.
»Ich sehe doch, wie es dir langsam besser geht«, erklärte ich, »wie du dich freust, wenn Ylvie oder Arvid vorbeikommen, wie du mit Ylvies Kindern herumalberst. Und ich gönne es dir. Aber ich ertrage es nicht! Ich kann nicht auf die Straße gehen, ohne unsere Tochter zu suchen. Ich gucke jedem blonden Mädchen auf einem Rennrad hinterher, und mein Herz bleibt jedes Mal beinahe stehen. Jeder Ort in dieser Stadt, an dem Sonja schon mal gewesen ist, ruft Bilder in mir hervor. Jede Straße, jeder Laden, jede Eisdiele, jedes Kino. Mein Puls geht hoch, ich bekomme keine Luft mehr. Ich ersticke hier, Richard!« Die letzten Worte schrie ich.
»Wenn es mir schlechter ginge, würdest du also bleiben«, konstatierte er.
»Nein … Das ist es nicht.«
Mittlerweile war die Sonne hinter den Baumkronen der gegenüberliegenden Flussseite verschwunden, der Goldregen war vorbei, und Richard sagte: »Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.« Dann stieg er auf sein Fahrrad und fuhr davon.
Von da an war es nicht mehr die lähmende Trauerstille, die unsere Wohnung erfüllte, sondern ein ratloses Schweigen.
Einmal fragte er mich: »Warum kannst du nicht mit mir trauern?«, und ich entgegnete, das sei, als würde der Favorit eines Rennens den Letzten fragen, warum er nicht einfach vorne mitlaufe. Ein andermal fand ich ihn weinend am Küchentisch, er bemerkte mich nicht und schluchzte wie ein Kind, die Arme auf den Tisch gestützt, das Gesicht in den Händen verborgen. Als er mich schließlich im Türrahmen stehen sah, blickte er mich flehend an. Ich hätte ihn fest in die Arme nehmen sollen, doch meine Kraft reichte lediglich für eine kurze Berührung an der Schulter.
Und dann kam der Tag, als ich vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte und schon im Treppenflur die Musik aus unserer Wohnung hörte. Ich erkannte den Song, er war einer der wenigen, auf den Richard sich mit Sonja an den gemeinsamen Wohnungsputztagen hatte einigen können und den sie dann beide laut mitsangen. Ich trat in den Korridor, ging weiter in die Küche und stellte die Einkäufe ab. Richard, der am Herd stand, wandte sich um. Der erschrocken-schuldbewusste Ausdruck in seinem Gesicht räumte meine letzten Zweifel aus.
In den folgenden Tagen prüfte ich meine Finanzen, sprach mit der Interimsleiterin der Kunststiftung, die mich seit meiner Krankschreibung vertrat, bot ihr meine Kündigung an, die sie etwas zu schnell und etwas zu freudig annahm, und unterschrieb den zunächst auf ein Jahr befristeten Mietvertrag für den Hof. Für dreihundertfünfzig Euro im Monat würde ich also einen Dreiseithof am Rand des Dorfs bewohnen, mit Schafen, Hühnern, einer Katze und einem hässlichen struppigen Hund, der so hieß, wie er aussah: Struppi.
Ich versprach, das Haus instand zu halten, keine unabgesprochenen Umbauten vorzunehmen und bei notwendigen Reparaturen den Töchtern Bescheid zu geben. Einige von Frau Adomeits Möbeln – jene, an denen die Töchter hingen, die sie aber dennoch nicht in ihren eigenen Wohnungen haben wollten – ließ ich in die leer stehende Scheune bringen, einige behielt ich im Haus, der andere Kram wurde weggebracht. Ein kleiner freundlicher Syrer mit dicken Tränensäcken unter den Augen kam vorbei, sah sich alles an, machte Fotos, überschlug das Volumen des Gerümpels und nannte mir nach kurzem Überlegen einen überaus fairen Preis. Er erzählte mir, dass er auch ein altes Haus gekauft habe, in Thüringen, in der Nähe von Gera, und dass seine Frau den Garten sehr gut bewirtschafte, aber der Feigenbaum, der sie an die Heimat erinnern solle, im letzten Winter eingegangen sei. Dann betonte er die Zuverlässigkeit seiner Jungs, die die Entrümpelung durchführen würden, gab zu bedenken, dass sie kaum Deutsch sprächen, und fragte, ob sich mein Mann und meine Kinder freuen würden hierherzuziehen. Als ich ihm nach kurzem Zögern antwortete, ich würde allein hier leben, ließ er seinen triefäugig-traurigen Blick eine ganze Weile auf mir ruhen.
Die Renovierung der Zimmer erledigte eine örtliche Malerfirma, die Adomeit’schen Schafe übernahm ein Nachbar, die Katze wechselte selbstständig den Besitzer und wohnte fortan ein paar Häuser weiter bei einem jungen Paar mit zwei Kindern, und dann zog ich begleitet vom Unverständnis aller Menschen, die mir noch nahestanden, in dieses Haus.
Aus unserer Wohnung nahm ich nur das Nötigste mit. Alles, was ich brauchte, passte in zwei Autos. Richard verließ das Haus an jenem Tag wie gewohnt kurz nach sieben. Bis zum Schluss hatte er nicht daran geglaubt, dass ich es wirklich tun würde. Als ich ihn zum Abschied umarmen wollte, wich er aus, schob sich an mir vorbei und sagte: »Du spinnst ja.«
Es war meine Kindheitsfreundin Esther, die mit mir den Umzug fuhr, später durch die spärlich möblierten Räume des kalten Hauses ging und sich fassungslos umsah.
»Das ist ein Tod auf Raten, Linda.«
Richard meldete sich am dritten Tag nach meinem Auszug.
»Ich verstehe dich nicht«, sagte er, »du benimmst dich wie ein Tier, das sich zum Sterben zurückzieht. Aber ich bin da, wenn du etwas brauchst. Und ich werde regelmäßig vorbeikommen, um nach dir zu sehen.«
Aus meinem alten Leben besucht mich außer Richard niemand mehr. Auch Esther nicht. An meinem Geburtstag und zu Weihnachten bekomme ich freundliche Karten von ihr, auf denen steht, ich solle mich melden. Sie sei da, egal, wie viel Zeit verginge. Auch von meiner Mutter bekomme ich regelmäßig Postkarten. Mit den Sinnsprüchen auf den Vorderseiten überbrückt sie die eigene Sprachlosigkeit. Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du heute von Neuem beginnen. (Buddha) – Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann. (Marie von Ebner-Eschenbach) – Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. (Guy de Maupassant) Aber hier, in meinem dritten Leben, sind es nicht die Menschen. Es sind die Tiere und die Pflanzen und der Wind und die Bilder der Toten an den Wänden.
3
Der Geruch von Hühnerbrühe zieht durchs ganze Haus. Richard kommt zu Besuch.
Alle zwei Wochen unterbricht er die Gleichförmigkeit meiner Tage für ein paar Stunden, bringt ausgelesene Zeitungen und Zeitschriften mit, die ich später meist ungelesen in den Ofen stecke, und irgendeine kleine Überraschung – einen guten Käse, die Neuaufnahme einiger Beethoven-Sonaten, ein Bild. Kurz vor Weihnachten kam er mit einer Tageslichtlampe, die seither in meinem Küchenfenster steht und mir die fehlende Sonne ersetzt. Er übermittelt mir Grüße von unseren Freunden und seiner Familie und fragt mich, wie lange ich noch gedenke, ihn als Brücke zur Welt zu benutzen. Ich zucke die Achseln. Er hat recht, genau das tue ich. Ich nehme die Grüße entgegen, bitte ihn, zurückzugrüßen und zu versichern, es habe nichts mit ihnen zu tun, nur mit mir, ausschließlich mit mir. Ich frage sogar nach dem Befinden der Grußsender, ohne auch nur daran zu denken, den Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Sie verstehen es nicht. Sie fühlen sich bestraft, ohne sich schuldig gemacht zu haben. Auch Richard empfindet es so. Alle zwei Wochen kommt er mit seiner geduldigen Hoffnung in dieses Haus und hinterlässt eine Spur. Schafft winzige Gemeinsamkeiten, die für einen Neuanfang nicht reichen werden.
Im Winter bleibt Richard nur kurz. Das Haus bedrückt ihn, es macht ihn unruhig, es gibt keinen Raum, in dem er sich wohlfühlt, und rausgehen mag er auch nicht. Die Wege ums Dorf sind reizlos, und über die kahlen Felder pfeift ewig der Wind. Ich verstehe ihn und bitte ihn nie darum, noch zu bleiben.
Die Tage gleichen einander so sehr, dass ich sie rückblickend nicht auseinanderhalten kann. Die Bedingung für Erinnerung scheint ein Mindestmaß an Außergewöhnlichem zu sein, doch mein Leben hier besteht aus Ritualen und Routinen, die das Zeitgefühl aufheben. Ich sehe keinen Sinn darin, Erinnerungen zu schaffen. Alles, woran ich mich erinnern will, ist vor Sonjas Tod geschehen.
Jeden Morgen ziehe ich mir meinen speckigen Lammfellmantel über den Schlafanzug, schlüpfe in ausgebeulte Jogginghosen und gefütterte Gummistiefel und stapfe über den Hof in den Garten, um die Hühner rauszulassen, sie zu füttern und das Vogelhaus neu zu befüllen. Hier draußen auf dem Land hatte ich ein buntes Vogeltreiben erwartet, aber an manchen Tagen sehe ich außer ein paar Blaumeisen, Kohlmeisen und Spatzen keinen einzigen. Amseln, Spechte und Rotkehlchen kommen hin und wieder, auch Kleiber und Grünfink habe ich schon gesehen und ein einziges Mal einen Dompfaff. In meiner Küche steht ein Vogelbestimmungsbuch, das ich bei jedem Vogel, der mir begegnet, befrage.
Nach einem starken Kaffee laufe ich mit der Hündin, der ich einen neuen Namen gegeben habe, bis in den nächstgelegenen Wald, dort bis an den kleinen Bach, der nur winters Wasser führt. Hin und zurück ein Marsch von etwa eineinhalb Stunden. Frau Adomeit ist nie mit ihr gegangen. Kaja – ehemals Struppi – war ihr x-ter Hund und lebte wie alle Hunde im Dorf ausschließlich auf dem Hof. Kajas ganze Erziehung beruhte auf der Angst vor Grete Adomeits Stock. Als nettes neues Frauchen gewann ich Kajas Zuneigung sofort, ihre Folgsamkeit jedoch musste ich mir hart erarbeiten, da ich weder einen Stock besaß noch bereit gewesen wäre, ihn einzusetzen.
Danach mache ich mir Frühstück, einen Hafer- oder Hirsebrei mit Apfelstückchen, Sonnenblumenkernen und Leinsamen. Über die Sorgfalt bei der Zubereitung wundere ich mich manchmal selbst. Ein Teil von mir will anscheinend gesund und stark bleiben.
Anschließend verrichte ich notwendige Arbeiten in Garten, Hof und Haus, koche und putze. Es ist erstaunlich, wie viel es immerfort zu tun gibt. Tausend Kleinigkeiten, die in der Summe Stunde um Stunde füllen. Nach dem Mittagessen löse ich Sudokus. Manchmal döse ich dabei ein, falle in einen traumüberladenen, kurzen Schlaf, der selten länger als eine halbe Stunde dauert. In den ersten Sekunden nach dem Erwachen ist es dann, als müsste ich alles neu lernen: wer ich war, wer ich bin, wieso ich mich hier befinde, was ich verloren habe. Die Antworten auf diese Fragen sind wie Faustschläge in die Magengrube. Buchstäblich gekrümmt schleppe ich mich in die Küche und befülle den Espressokocher, und langsam, sehr langsam richte ich mich wieder auf.
Ich stricke Schals und Mützen, die niemand braucht. Ich trenne sie wieder auf und beginne von vorn. Ich schreibe Erinnerungen an Sonja in ein Heft, bevor das Vergessen sie schluckt. Ich spreche mit Sonja, erzähle ihr alles, und alle Antworten liegen in ihrem ewigen Schweigen.
Ich lausche dem Ticken der Standuhr, dem Atmen der Hündin, dem Knarren und Ächzen des alten Hauses.
Dann beginnt die lange Zeit vom Dunkelwerden bis zum Schlafengehen. Jeder Handgriff ist mir willkommen. Holz muss nachgelegt, das Abendessen gekocht, der Abwasch per Hand gemacht, der Biomüll zum Komposthaufen gebracht, neues Brennholz geholt, die Hundehaare müssen zusammengefegt, die Hühner in den Stall gescheucht, alle Türen und Tore verschlossen, Handtücher gerollt und vor die zugigen Fenster gelegt werden. Fertig werde ich nie. Es gibt ihn nicht – den Moment, in dem ich mich umsehe und keine Arbeit mehr entdecke. Mein natürliches Habitat war eine übersichtliche, mit aller Bequemlichkeit ausgestattete, hochwertig sanierte Stadtwohnung. Hier dagegen ist es mühsam, und mühsam ist gut. Solange die Hände in Bewegung bleiben, schlagen die Gedanken keine Volten, und ich überstehe die Stunden bis zum Schlafengehen. Um 21:30 Uhr nehme ich meine Tabletten, die mich verlässlich ausschalten und für einige Stunden von jeglichem Schmerz erlösen.
Ich stelle einen leeren Topf auf den Herd, hänge ein Sieb hinein und seihe die kochende Hühnersuppe darin ab. Die Brühe ist hellbraun mit schönen Fettaugen. Der ganze Rest bleibt im Sieb zurück. Ich löse das Fleisch von den Knochen und werfe es in die Brühe, gebe Erbsen und Karotten hinzu und sehe auf die Uhr. Richard wird bald hier sein. Auf seine Pünktlichkeit ist Verlass. Ich pule Granatapfelkerne aus, knacke Nüsse, schäle und schneide gedünstete Rote Bete und einen säuerlichen Apfel und verarbeite alles zu einem Salat. »Hallo, Richard«, sage ich dabei laut. »Schön, dass du da bist, das Essen ist gleich fertig.« Und gleich noch einmal, in einer tieferen, souveränen Tonlage. »Hallo, Richard. Schön, dass du da bist. Setz dich doch, das Essen ist gleich fertig.« Ich kontrolliere mein Gesicht vor dem trüben Spiegel im Bad, er soll sich keine Sorgen machen müssen.
Seine Hände halten mich ein wenig zu fest. Ich rühre mich nicht, bis er ablässt. Seinen Mantel hängt er ordentlich auf einen Kleiderbügel an der Garderobe, den Schal legt er drum herum.
Um seinem ängstlichen Wie geht es dir? zuvorzukommen, gebe ich die Geschichte von dem Bussard zum Besten. Ich schmücke das Ganze ein wenig aus, füge eine Prise Dramatik hinzu und finde während des Erzählens Gefallen an der neuen Variante, in der der Bussard noch einmal zurückkommt und eine Attacke auf mich fliegt. Richard hört ernst zu.
»Ungewöhnlich für einen Bussard. Bist du sicher, dass es kein Falke war?«
Er nimmt die Brille ab und reibt sich die Augen. Ich finde ihn noch immer attraktiv. Sein Gesicht hat etwas Ungereimtes, Geheimnisvolles. Die Augen stehen ein wenig zu nah beieinander, das kantige Kinn und die weichen Lippen bilden einen eigenartigen Kontrast. Wenn er lächelt, bilden sich Grübchen, wenn er ernst blickt, kann er einschüchternd wirken. Doch der Eindruck täuscht. Er ist ein sanfter Mensch. Der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau sei ihr Mann, heißt es. Auf Richard trifft das nicht zu.
Nach dem Essen, von dem er sich mehrmals nachfüllt, stellt er sich vor die Bilderwand im Wohnzimmer.
»Ich verstehe nicht, warum diese Bilder noch hier sind. Und erst recht nicht, warum du sie nicht abgehängt hast. Das ist doch nicht deine Familie.«
Mein Blick fällt auf Grete Adomeits Vater, der das Zentrum der Galerie bildet. Ein Gestütwärter auf einem kleinen ostpreußischen Gut, ein stattlicher Mann mit Schnauzbart und tadelloser Kleidung. Daneben ein Bild der ganzen Familie – die Mutter einen ganzen Kopf kleiner als ihr Mann, die Kinder wie die Orgelpfeifen. Die Jungs tragen Anzüge, die Mädchen Schürzenkleider mit Rüschen, und alle stehen sie sehr gerade und schauen fest in die Kamera.
»Letztlich sind doch alle Familien gleich«, sage ich, »alle haben sie ihre Lebenden und ihre Toten, ihre Geheimnisse und ihr Leid und dieses eingefrorene kurze Fotoglück, von dem keiner mehr weiß, ob es echt war.«
»Unseres war echt«, antwortet Richard.
Er ist älter geworden. Was geschehen ist, hat Spuren hinterlassen. Wir wussten beide, dass wir nie mehr die werden würden, die wir gewesen waren, aber wer wir sein und wie wir aussehen würden, konnten wir uns nicht vorstellen. Mein Haar ergraute damals binnen drei Tagen. Als ich in den Spiegel sah, blickte mir eine fremde Person entgegen. Wie eine feindliche Übernahme kam es mir vor. Als befände ich mich noch immer im Inneren der Person, ohne je wieder aus ihr herauszukommen.
Richard blickt mich an, und ich sehe die Frage in seinen Augen. Bei seinen letzten Besuchen hat er sie nicht gestellt. Vermutlich fürchtete er sich vor meinem Schweigen. Davor hatte er sie abgewandelt, entschärft. Statt »Wann kommst du zurück?« fragte er nur: »Kommst du zurück?« Ein Ja würde bedeuten, es gäbe eine Zukunft für uns. Aber unsere Zukunft ist im Bruchteil einer Sekunde an einem schwülen Julivormittag, kurz bevor ein Gewitter ausbrach, ausgelöscht worden. Eine Ampel schaltete auf Grün, eine siebzehnjährige Fahrradfahrerin mit blondem Pferdeschwanz und lauter Musik in den Ohren trat in die Pedale ihres Rennrads, ein Lkw-Fahrer, der vergessen hatte, in den Seitenspiegel zu schauen, bog über den Radweg nach rechts ab. Die Zeit blieb stehen.
Richards Frage steht noch immer im Raum.