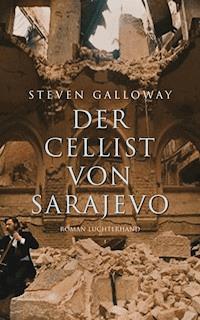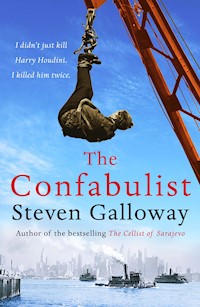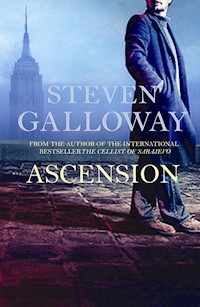Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Der Cellist
Eins
Strijela
Copyright
Für Lara
Das Sarajevo in diesem Roman ist nur ein kleiner Teil der richtigen Stadt und ihrer Menschen, wie sie sich der Autor vorgestellt hat. In erster Linie wird hier eine Geschichte erzählt.
Ihr interessiert euch vielleicht nicht für den Krieg! Aber der Krieg interessiert sich für euch!
Leo Trotzki
Der Cellist
Sie fauchte talwärts, spaltete mühelos Luft und Himmel. Ihr Ziel, durch Zeit und Geschwindigkeit näher gebracht, breitete sich aus. Einen Moment vor dem Aufschlag war zum letzten Mal alles so wie zuvor. Dann explodierte die sichtbare Welt.
Im Jahr 1945 fand ein italienischer Musikwissenschaftler in den Überresten der ausgebrannten Dresdener Musikbibliothek vier Takte vom Generalbass zu einer Sonate. Er glaubte, dass diese Noten ein Werk des venezianischen Komponisten Tomaso Albinoni aus dem 17. Jahrhundert seien, und versuchte sich in den nächsten zwölf Jahren an der Rekonstruktion eines größeren Stückes aus dem versengten Manuskriptfragment. Die dabei entstandene Komposition, bekannt als Albinonis Adagio, besitzt wenig Ähnlichkeit mit Albinonis anderen Werken und gilt bei den meisten Gelehrten als fragwürdig. Aber selbst diejenigen, die an seiner Echtheit zweifeln, können die Schönheit dieses Adagios nur schwerlich bestreiten.
Fast ein halbes Jahrhundert später ist es ebendieser Widerspruch, der dem Cellisten gefällt. Dass etwas, das in einer vom Krieg zerstörten Stadt fast vernichtet worden wäre, wiedererstehen, etwas Neues und Wertvolles werden konnte, gibt ihm Hoffnung. Eine Hoffnung, die jetzt zu dem Wenigen zählt, was den belagerten Einwohnern von Sarajevo geblieben ist. Für viele schwindet die Hoffnung mit jedem Tag.
Und so sitzt der Cellist heute am Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock und spielt wie jeden Tag in letzter Zeit, bis er seine Hoffnung wiederkehren spürt. Das Adagio spielt er selten. An vielen Tagen ist es einfach, dann kann er die belebende Kraft der Musik so direkt spüren, als tankte er ein Auto auf. Manchmal ist es nicht der Fall. Wenn diese Hoffnung nach etlichen Stunden nicht wiederkehrt, hält er inne, sammelt sich, und dann beschwören er und sein Cello Albinonis Adagio aus den Ruinen von Dresden in die von Mörsern aufgerissenen, von Heckenschützen heimgesuchten Straßen von Sarajevo. Bis die letzten Töne verklingen, hat er wieder Hoffnung gefasst, aber jedes Mal, wenn er auf das Adagio zurückgreifen muss, wird es schwerer, und er weiß, dass seine Wirkung begrenzt ist. Die Adagios, die er noch zur Verfügung hat, sind gezählt, und er will diese kostbare Währung nicht leichtfertig verplempern.
Es war nicht immer so. Unlängst noch sah es so aus, als sei ihm ein glückliches Leben beschieden. Vor fünf Jahren, als sich die ganze Familie für ein Foto anlässlich der Hochzeit seiner Schwester aufstellte, hatte ihm sein Vater den Arm um den Nacken geschlungen und ihn mit der Hand an der Schulter gepackt. Es war ein fester Griff, der für manche schmerzhaft gewesen wäre, aber nicht für den Cellisten. Die Finger auf seiner Haut verrieten ihm, dass er geliebt wurde, immer geliebt worden war und dass die Erde ein Ort war, an dem das Gute stets einen Weg finden würde. Obwohl er sich damals über all das im Klaren war, würde er nahezu alles dafür hergeben, wenn er die Zeit zurückdrehen und in diesem Augenblick anhalten könnte, und sei es auch nur, damit er sich jetzt deutlicher daran erinnern konnte. Zu gern würde er die Hand seines Vaters wieder auf seiner Schulter spüren.
Heute ist kein Tag für das Adagio, das weiß er. Seit einer halben Stunde erst sitzt er am Fenster, aber es geht ihm bereits ein bisschen besser. Draußen steht eine Menschenschlange nach Brot an. Es ist über eine Woche her, seit es auf dem Markt Brot zu kaufen gab, und er überlegt, ob er sich zu ihnen gesellen soll. Viele seiner Freunde und Nachbarn sind in der Schlange. Er entscheidet sich vorerst dagegen. Er muss noch eine Weile üben.
Sie fauchte talwärts, spaltete mühelos Luft und Himmel. Ihr Ziel, durch Zeit und Geschwindigkeit näher gebracht, breitete sich aus. Einen Moment vor dem Aufschlag war zum letzten Mal alles so wie zuvor. Dann explodierte die sichtbare Welt.
Als die Mörser die Philharmonie von Sarajevo zerstörten, kam es dem Cellisten so vor, als wäre er selbst in dem Gebäude, als würden die Ziegel und das Glas, die einst das Skelett des Bauwerks bildeten, zu Projektilen, die auf ihn einprasselten und ihn bis zur Unkenntlichkeit zerfetzten. Er war der erste Cellist des Philharmonischen Orchesters von Sarajevo. Damit kannte er sich aus. Er ließ den Geist der Musik Wirklichkeit werden. Wenn er in seinem Frack auf die Bühne trat, wurde er in ein Instrument der Befreiung verwandelt. Er schenkte den Menschen, die zuhörten, das, was er am meisten liebte. Er war so verlässlich wie der feste Griff seines Vaters.
Jetzt kümmert es ihn nicht, ob ihn jemand spielen hört oder nicht. Sein Frack hängt unberührt im Schrank. Die Geschütze auf den Bergen rings um Sarajevo haben ihn ebenso verheert wie die Philharmonie, wie das Haus seiner Familie in der Nacht, als sein Vater und seine Mutter schliefen, so wie sie letztlich alles verheeren werden.
Die Geographie der Belagerung ist einfach. Sarajevo ist ein langer, flacher Landstreifen, auf allen Seiten von Bergen umgeben. Die Männer auf den Bergen beherrschen die Anhöhe und Grbavica, eine Halbinsel im Tal, mitten in der Stadt. Sie feuern Kugeln, Mörsergranaten, Panzer- und Artilleriegeschosse in die übrige Stadt, die mit einem Panzer und kleinen Handfeuerwaffen verteidigt wird. Die Stadt wird zerstört.
Der Cellist weiß nicht, was gleich geschehen wird. Zunächst wird er den Einschlag gar nicht wahrnehmen. Lange wird er am Fenster stehen und hinausstarren. Inmitten des Gemetzels und Durcheinanders bemerkt er dann die Handtasche einer Frau, blutgetränkt und mit Glassplittern übersät. Er weiß nicht, wem sie gehört. Dann senkt er den Blick und sieht, dass er seinen Bogen fallen gelassen hat, und irgendwie kommt es ihm so vor, als bestünde ein Zusammenhang zwischen den beiden Gegenständen. Er ist sich nicht darüber im Klaren, worin der Zusammenhang besteht, aber das Gefühl, dass es einen gibt, zwingt ihn dazu, sich auszuziehen, zum Kleiderschrank zu gehen und die Plastikhülle der Reinigung von seinem Frack zu schälen.
Er wird die ganze Nacht und den nächsten Tag über am Fenster stehen. Dann, um vier Uhr nachmittags, vierundzwanzig Stunden nachdem die Mörsergranate auf seine Freunde und Nachbarn gefallen ist, während sie nach Brot anstanden, wird er sich bücken und den Bogen aufheben. Er wird sein Cello und den Hocker die schmale Treppe zur Straße hinuntertragen. Der Krieg rundum wird weitergehen, während er in dem kleinen Krater sitzt, den die Mörsergranate beim Aufschlag gerissen hat. Er wird Albinonis Adagio spielen. Zweiundzwanzig Tage lang, Tag für Tag, einen für jeden Getöteten. Er wird es zumindest versuchen. Er ist sich nicht sicher, ob er überleben wird. Er ist sich nicht sicher, ob er genügend Adagios übrig hat.
Von alldem weiß der Cellist jetzt noch nichts, während er in der Sonne am Fenster sitzt und spielt. Er hat noch nichts bemerkt. Aber sie ist bereits unterwegs. Sie faucht talwärts, spaltet mühelos Luft und Himmel. Ihr Ziel, durch Zeit und Geschwindigkeit näher gebracht, breitet sich aus. Einen Moment vor dem Einschlag ist zum letzten Mal alles so wie zuvor. Dann explodiert die sichtbare Welt.
Eins
Strijela
Strijela zwinkert. Sie wartet schon lange. Durch das Zielfernrohr ihres Gewehrs sieht sie drei Soldaten neben einer niedrigen Mauer stehen. Einer schaut auf die Stadt hinab, als erinnere er sich an etwas. Einer streckt ein Feuerzeug aus, an dem sich ein anderer eine Zigarette anzündet. Offensichtlich haben sie keine Ahnung, dass sie sie im Visier hat. Vielleicht, denkt sie, glauben sie, dass sie zu weit von der Front entfernt sind. Sie irren sich. Vielleicht meinen sie, niemand könnte eine Kugel zwischen den Gebäuden hindurchschießen, die sie von ihr trennen. Sie irren sich wieder. Sie kann jeden von ihnen töten, vielleicht sogar zwei, wann immer sie sich dazu entscheidet. Und bald wird sie sich entscheiden.
Sie ist inmitten der Trümmer eines ausgebrannten Bürohochhauses versteckt, ein paar Meter hinter einem Fenster mit Blick auf die Berge im Süden der Stadt. Für jeden Ausguck wäre es schwer, wenn nicht unmöglich, eine zierliche junge Frau mit schulterlangen schwarzen Haaren zu entdecken, die sich in den rauchenden Überresten des Alltagslebens verbirgt. Den Bauch an den Boden gedrückt, liegt sie da, die Beine teilweise mit einer alten Zeitung bedeckt. Ihre Augen, groß, blau und strahlend, sind das einzige Lebenszeichen.
Strijela glaubt, dass sie anders ist als die Heckenschützen auf den Bergen. Sie schießt nur auf Soldaten. Die anderen schießen auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Wenn sie jemanden töten, wollen sie eine Wirkung erzielen, die weit über das Auslöschen eines Menschen hinausgeht. Sie wollen die Stadt morden. Mit jedem Toten bricht ein Stück von dem Sarajevo aus Strijelas Jugend weg, ebenso wie mit jedem von Mörsergranaten zertrümmerten Haus. Diejenigen, die übrig bleiben, haben nicht nur einen Mitbürger verloren, sondern auch die Erinnerung daran, wie das Leben war, bevor die Männer auf den Bergen auf einen schossen, während man die Straße überqueren wollte.
Vor zehn Jahren, als Strijela achtzehn war, hatte sie sich das Auto ihres Vaters geliehen und war aufs Land gefahren, um Freunde zu besuchen. Es war ein strahlend schöner Tag, und der Wagen kam ihr wie lebendig vor, als wären ihre durch ihn umgesetzten Bewegungen eine Art Bestimmung, als geschähe alles genau so, wie es sein sollte. Als sie um eine Kurve bog, kam im Radio eines ihrer Lieblingsstücke, und der Sonnenschein, der zwischen den Bäumen einfiel wie durch Spitzengardinen, erinnerte sie an ihre Großmutter, und Tränen liefen ihr über die Wangen. Nicht ihrer Großmutter wegen, die damals noch unter den Lebenden weilte, sondern weil sie eine unbändige Lebenslust empfand, eine Freude, die umso stärker war, als sie wusste, dass eines Tages alles zu Ende gehen würde. Es war überwältigend, und es erschreckte sie so, dass sie am Straßenrand anhielt. Hinterher kam sie sich ein bisschen töricht vor und sprach nie darüber.
Jetzt jedoch weiß sie, dass sie nicht töricht war. Ihr wird klar, dass sie ohne einen bestimmten Grund auf den Kern dessen gestoßen ist, was das menschliche Wesen ausmacht. Es ist eine seltene Gabe, zu begreifen, dass das Leben wunderbar ist und dass es nicht ewig währt.
Wenn Strijela also den Abzug durchdrückt und dem Leben eines der Soldaten in ihrem Visier ein Ende setzt, tut sie das nicht, weil sie ihn töten will - obwohl sie das auch nicht bestreiten kann -, sondern weil die Soldaten sie und fast alle anderen in der Stadt um diese Gabe gebracht haben. Die Tatsache, dass das Leben enden wird, ist so selbstverständlich geworden, dass sie jede Bedeutung verloren hat. Aber schlimmer noch ist für Strijela die Erkenntnis, dass das, was sie weiß, und das, was sie glaubt, nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Denn obwohl sie weiß, dass ihre Tränen an diesem Tag nicht der lächerlichen Sentimentalität eines jungen Mädchens entsprangen, glaubt sie es nicht recht.
Die Soldaten, die Strijela beobachtet, haben guten Grund, sich sicher zu fühlen. Bei fast jedem anderen Schützen wären sie es auch. Sie sind einen knappen Kilometer entfernt, und das Gewehr, das sie und nahezu alle Verteidiger benutzen, hat eine zuverlässige Reichweite von achthundert Metern. Darüber hinaus ist die Chance, ein Ziel zu treffen, nur gering. Bei Strijela ist das nicht der Fall. Sie kann mit einer Kugel Sachen machen, die andere nicht fertigbringen.
Für die meisten Menschen kommt es bei Fernschüssen auf Beobachtungsgabe und mathematische Fähigkeiten an. Man ermittle Windgeschwindigkeit und -richtung sowie die Entfernung zum Ziel. Die geschätzten Maße fließen in Gleichungen ein, bei denen die Fluggeschwindigkeit der Kugel, der Zeitfaktor, die Vergrößerungsstärke des Zielfernrohrs berücksichtigt werden. Auch ein Ball wird nicht direkt auf ein Ziel geworfen, er wird in einem Bogen geworfen, der so berechnet ist, dass er sich mit dem Ziel schneidet. Strijela nimmt keine Einschätzungen vor, sie berechnet keine Formeln. Sie jagt die Kugel einfach dorthin, wo sie hin muss. Sie kann nicht verstehen, warum andere Scharfschützen damit Schwierigkeiten haben.
Von der Bergfestung Vraca aus, oberhalb des besetzten Wohngebiets Grbavica gelegen, meinen ihre Feinde die Stadt ungestraft beschießen zu können. Im Zweiten Weltkrieg war Vraca ein Ort, an dem die Nazis jene, die Widerstand leisteten, folterten und ermordeten. Die Namen der Toten sind in die Stufen gemeißelt, aber seinerzeit benutzten nur wenige Kämpfer ihren richtigen Namen. Sie nahmen einen neuen Namen an, einen Namen, der mehr über sie aussagte als jede von Trunkenbolden in einer Bar erzählte Geschichte, einen Namen, der eine Botschaft übermittelte, die sich trotz aller Versuche der Regierung nicht zu Propagandazwecken missbrauchen ließ. Es heißt, sie hätten diesen anderen Namen angenommen, damit ihre Angehörigen nicht in Gefahr gerieten, damit sie ein Doppelleben führen konnten. Doch Strijela glaubt, dass dieser andere Namen ihnen ermöglichte, Abstand zu halten zu dem, was sie tun mussten, und die Persönlichkeit, die kämpfte und tötete, eines Tages wieder abzulegen. Seit sie gelernt hat, jemanden zu hassen, weil er sie hasste, und ihn dann für das zu hassen, was er ihr antat, ist in ihr das Verlangen gewachsen, den Teil ihrer Persönlichkeit, der sich zur Wehr setzen will, der es genießt, sich zur Wehr zu setzen, von dem Teil zu trennen, der von Anfang an gar nicht kämpfen wollte. Wenn sie ihren richtigen Namen gebrauchte, wäre sie wie die Männer, die sie tötet. Es wäre ein schlimmerer Tod als das Ende ihres Lebens.
Seit sie zum ersten Mal ein Gewehr ergriffen hat, nennt sie sich Strijela - Pfeil. Manche sprechen sie weiterhin mit ihrem früheren Namen an. Sie beachtet sie nicht. Wenn sie nachhaken, erklärt sie ihnen, dass sie jetzt Strijela heißt. Keiner widerspricht. Keiner stellt das, was sie tun muss, in Frage. Jeder macht irgendetwas, um am Leben zu bleiben. Aber falls sie bedrängt werden sollte, würde sie antworten: »Ich bin Strijela, weil ich sie hasse. Die Frau, die ihr gekannt habt, hat niemanden gehasst.«
Strijela hat ihre heutigen Ziele auf Vraca ausgewählt, weil sie nicht möchte, dass sich die Männer sicher fühlen. Sie muss einen äußerst schwierigen Schuss abgeben. Obwohl sie sich im neunten Stock dieses verwüsteten Hauses verbirgt, muss sie zur Festung hin bergauf schießen und die Kugel zwischen einer Reihe von Gebäuden hindurchjagen, die zwischen ihr und dem Ziel stehen. Die Soldaten müssen an Ort und Stelle bleiben, in einem Umkreis von rund drei Metern, und der Qualm aus brennenden Gebäuden verdeckt ihr ab und zu die Sicht. Sobald sie einen Schuss abgibt, wird jeder Heckenschütze auf dem Berg im Süden Ausschau nach ihr halten. Sie werden rasch herausfinden, wo sie ist. Dann werden sie das Gebäude mit Granaten beschießen, notfalls bis auf die Grundmauern. Und dieses Haus ist vor allem deshalb ausgebrannt, weil es ein leichtes Ziel darstellt. Die Chancen, den Folgen ihrer eigenen Kugeln zu entrinnen, sind gering. Aber das ist keine ungewöhnliche Herausforderung. Sie hat schon unter verzwickteren Bedingungen geschossen und mit schnelleren Vergeltungsschlägen rechnen müssen.
Strijela weiß genau, wie lange es dauern wird, bis man sie ausfindig macht. Sie weiß genau, wohin die Heckenschützen schauen und wo die Mörsergranaten einschlagen werden. Wenn der Beschuss aufhört, wird sie weg sein, auch wenn keiner begreifen wird, wie, nicht einmal die Leute auf ihrer Seite, die Verteidiger der Stadt. Wenn sie es ihnen erklärte, würden sie es nicht verstehen. Sie würden nicht glauben, dass sie weiß, was eine Waffe macht, weil sie selbst eine Waffe ist. Dieses besondere Talent erkennen nur wenige an. Wenn sie die Wahl hätte, würde sie es auch nicht glauben. Aber sie weiß, dass es nicht von ihr abhängt. Man sucht sich nicht aus, was man glaubt. Der Glaube sucht einen aus.
Einer der drei Soldaten entfernt sich von den beiden anderen. Strijela strafft sich, wartet ab, ob die beiden salutieren. Wenn ja, wird sie schießen. Einen Moment lang ist sie unsicher, kann ihre Gesten nicht deuten. Dann tritt der Soldat aus dem schmalen Korridor, durch den die Kugel fliegen kann. In einem scheinbar bedeutungslosen Augenblick hat er sein Leben gerettet. Das Leben besteht fast gänzlich aus solchen Aktionen, wie Strijela weiß.
Sie beobachtet sie noch eine Weile, wartet auf einen Fingerzeig, der ihr vorgibt, wem die erste Kugel gelten soll. Sie will zweimal schießen, alle beide töten, aber sie ist nicht ganz sicher, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt, und wenn sie einen Soldaten auswählen muss, will sie die richtige Wahl treffen, falls es eine richtige Wahl gibt. Letzten Endes glaubt sie nicht, dass es eine Rolle spielt. Vielleicht wird einer von ihnen am Leben bleiben, aber er wird nie erfahren, wie knapp er davongekommen ist. Er wird nie erfahren, dass in ihrem Visier nur der Bruchteil eines Millimeters hin oder her darüber entscheidet, ob er in zehn Minuten noch die Sonne auf dem Gesicht spürt oder ungläubig auf seine Brust hinunterblickt, spürt, wie alles, was er war und hätte werden können, aus ihm herausströmt, und dann, in den letzten Momenten, mehr Schmerz erfährt, als er für möglich gehalten hat.
Einer der Soldaten sagt etwas und lacht. Der andere fällt ein, aber Strijela hat den Eindruck, dass er nicht so schallend lacht, seinem Gefährten vielleicht nur einen Gefallen tun will. Soll sie auf den Anstifter oder auf den Mitläufer schießen? Sie ist sich nicht sicher. In den nächsten paar Minuten beobachtet
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2008 Steven Galloway
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-02527-4
www.luchterhand-literaturverlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de