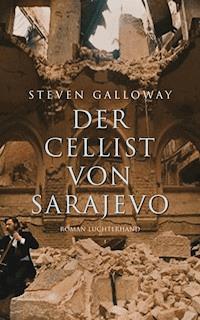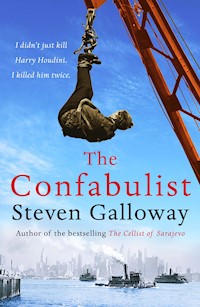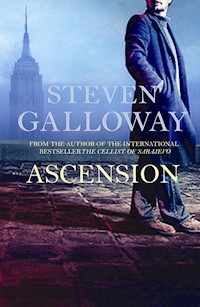9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Was ist wahr, und was ist Illusion?
Erzählern ist zuweilen nicht zu trauen. Besonders wenn sie, wie Martin Strauss, an einer seltenen neurologischen Krankheit leiden, an der sogenannten Konfabulation: Konfabulierende sind Menschen, die objektiv falsche Dinge erzählen, in der festen Überzeugung, dass sie wirklich genau so geschehen sind. Es sind Menschen, denen die Erinnerung ein ums andere Mal böse Streiche spielt. Und die, ohne es selbst zu merken, sich immer weniger darauf verlassen können, genau zu wissen, was wahr ist und was falsch …
Als Martin Strauss von seinem Arzt erfährt, dass er an fortschreitenden und unheilbaren Erinnerungsstörungen leidet, versucht er sein Leben zu rekapitulieren, noch einmal festzuhalten, wie es wirklich war. Und es ist ein wahrhaft turbulentes Leben, auf das er zurückzublicken meint – ein Leben an der Seite des großen, weltbekannten Magiers und Entfesselungskünstlers Houdini. Harry Houdini, dem Anfang des 20. Jahrhunderts der sagenhafte Aufstieg von kleinen Hinterzimmerauftritten auf die ganz großen Bühnen der Welt gelang. Der von Arthur Conan Doyle bewundert wurde, der in das Visier von Scotland Yard geriet, dem Verbindungen zu der russischen Zarenfamilie nachgesagt wurden. Martin Strauss hat Aufstieg und Fall Harry Houdinis begleitet, glaubt er zumindest. Und er hat ihn getötet – glaubt er zumindest – und musste daraufhin sein ganzes bisheriges Glück und Leben aufgeben. Doch was ist wahr an Martin Strauss‘ Erinnerungen, und was ist Illusion?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Ähnliche
Buch:
Als Martin Strauss von seinem Arzt erfährt, dass er an fortschreitenden und unheilbaren Erinnerungsstörungen leidet, versucht er, während er auf einer Bank vor dem Krankenhaus darauf wartet, abgeholt zu werden, sein Leben zu rekapitulieren, noch einmal festzuhalten, wie es wirklich war. Und es ist ein wahrhaft turbulentes Leben, auf das er zurückzublicken meint – ein Leben an der Seite des großen, weltbekannten Magiers und Entfesselungskünstlers Houdini. Harry Houdini, dem Anfang des 20. Jahrhunderts der sagenhafte Aufstieg von kleinen Hinterzimmerauftritten auf die ganz großen Bühnen der Welt gelang. Der von Arthur Conan Doyle bewundert wurde, der in das Visier von Scotland Yard geriet, dem Verbindungen zu der russischen Zarenfamilie nachgesagt wurden und den man verdächtigte, ein Doppelagent zu sein. Und der zugleich der unbestritten größte Magier seiner Zeit gewesen ist.
Martin Strauss hat Aufstieg und Fall Harry Houdinis begleitet, glaubt er zumindest. Und er hat ihn getötet – glaubt er zumindest – und musste daraufhin sein ganzes bisheriges Glück und Leben aufgeben. Doch was ist wahr an Martin Strauss’ Erinnerungen, und was ist Illusion? Auf raffinierte Weise verwebt Steven Galloway historische Fakten über einen der berühmtesten Zauberer der Welt mit einer ganz heutigen Erzählung über das Wesen von Illusion und Realität, Erinnerung und Täuschung, Wahrheit und Phantasie.
Autor:
Steven Galloway wurde 1975 in Vancouver, Kanada, geboren. Er lehrt Creative Writing an der University of British Columbia und hat bisher vier Romane publiziert. Der Cellist von Sarajevo war ein internationaler Bestseller, erschien in dreißig Ländern, kam u. a. auf die Longlist des Scotiabank Giller Prize und des IMPAC Dublin Literary Award, auf die Shortlist von Richard & Judy’s Best Read of the Year sowie des Ethel Wilson Fiction Prize. Galloway lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Vancouver, British Columbia.
Übersetzer:
Benjamin Schwarz, geb. 1937 in Schlesien, Studium der Germanistik und Kunstwissenschaft, Lehrtätigkeit an der FUB, ist der Übersetzer von u. a. Douglas Adams, Woody Allen, Dashiell Hammett, Federico Fellini, Tom Sharpe und Tom Wolfe.
Steven Galloway
DER ILLUSIONIST
Roman
Deutsch von Benjamin Schwarz
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel The Confabulist bei Alfred A. Knopf Canada, Toronto.
Copyright © der Originalausgabe 2014 Steven Galloway
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: buxdesign | München, unter Verwendung eines Motivs von shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15300-7V002www.luchterhand-literaturverlag.de
Für Diane Martin
Das Gedächtnis jedes Menschen ist seine private Literatur.
ALDOUS HUXLEY
ES GIBT EIN LEIDEN NAMENS TINNITUS, bei dem man ein Klingeln hört, das gar nicht da ist. Es ist keine Krankheit im eigentlichen Sinn, lediglich ein Anzeichen anderer Beschwerden, aber das ständige nicht existierende Geklingel hat Betroffene bekanntermaßen in den Wahnsinn und Selbstmord getrieben. Ich leide, genau genommen, nicht daran, aber ich habe ab und zu das seltsame Gefühl, dass irgendwo im Hintergrund etwas schiefläuft.
Der heutige Termin bei Dr. Korsakoff ist ein gutes Beispiel dafür. Er ist ein absonderlicher kleiner Russe, der aussieht, als habe seine Haut nie einen Strahl Sonne abgekriegt, und wenn er vom menschlichen Körper redet, beginnen meine Gedanken zu wandern. Ich verstehe nicht, wie er erwarten kann, dass ihn ein Mann meines Alters versteht. Thiamin, Neuronen, Gliose – das Ganze in diesem kehligen Akzent, na ja, es geht einfach an mir vorbei. Ich frage mich, ob das der Sinn seines Vortrags ist – mich daran zu erinnern, dass er Medizin zu Ende studiert hat und ich nicht. Mir scheint, das habe ich zugegeben, als ich vor Monaten das erste Mal in seiner Praxis erschien. Habe ich ihm erzählt, dass ich als junger Mann die Absicht hatte, Arzt zu werden? Ich kann mich nicht erinnern. Ich schenkte ihm ganz und gar keine Beachtung, das weiß ich. Aber dann sagte er unvermittelt etwas, das unmöglich zu überhören war.
»Im Grunde genommen werden Sie Ihren Verstand verlieren, Mr. Strauss.«
Ich hatte einen Philodendron angestarrt, der in einem Topf in einer ungünstigen Ecke seines Sprechzimmers stand. Der Raum war noch freudloser als das Krankenhaus insgesamt, aber der Philodendron war prachtvoll. Während seines einschläfernden Geredes beschloss ich, mir einen Plan auszudenken, wie ich den Topf stehlen könnte. Aber dann erregte dieses »Ihren Verstand verlieren« meine Aufmerksamkeit.
»Die gute Nachricht ist, dass es allmählich geschehen wird und dass Sie es wahrscheinlich nicht mal bemerken werden.« Er fasste mich fest ins Auge. Wahrscheinlich fürchtete er, ich würde in Tränen ausbrechen. Ich glaube, ein Mensch in seiner Stellung muss sich mit einer Menge unerfreulicher Reaktionen abgeben.
»Wie kann jemand, ohne es zu bemerken, seinen Verstand verlieren?«
»Sie haben ein seltenes Leiden«, sagte er geradezu begeistert, »bei dem die Schädigung, die Ihr Gehirn erlitten hat, keine kognitiven Funktionen beeinträchtigt, sondern nur die Fähigkeit Ihres Gehirns mindert, Erinnerungen zu speichern und zu verarbeiten. Als Reaktion darauf wird Ihr Gehirn sich neue Erinnerungen ausdenken.«
Ich saß wie versteinert da. Alles erschien mir lauter und langsamer. Die Neonröhren summten wie ein Bienenschwarm, und Schritte im Korridor, die sich Richtung Fahrstuhl bewegten, knallten wie Donnerschläge. Irgendwo am Ende des Ganges schrillte ein Telefon Feueralarm. Schließlich war ich in der Lage zu fragen, wie viel Zeit mir blieb.
Er zuckte die Achseln. »Monate. Vielleicht Jahre. Sie werden vielleicht einige damit einhergehende Schwierigkeiten bekommen, aber Ihr Leiden ist nicht lebensbedrohend. Sie sind ja nicht mehr jung, es ist durchaus möglich, dass Sie an etwas ganz anderem sterben, bevor dies hier ein Problem wird. Wenngleich es wirklich den Anschein hat, dass Sie abgesehen davon außerordentlich gesund sind.«
»Danke«, sagte ich, was in diesem Augenblick albern wirkte.
»Es handelt sich im Grunde um eine Verschleißerkrankung, und daran kann man im Moment nichts ändern. Vielleicht bemerken Sie nicht einmal, was da vor sich geht.«
Er redete immer weiter, aber da setzte bei mir dieses Tinnitusgefühl ein. Stellen Sie sich vor, Ihr Verstand macht ein Geräusch, kein wirkliches Geräusch, sondern etwas, was die mentale Entsprechung dafür ist. Nehmen Sie noch eine leichte Benebelung hinzu, dann haben Sie eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie mir war. Ich bemerkte, dass der Arzt aufgestanden war und hinter seinem Schreibtisch hervortrat. Anscheinend war unser Termin zu Ende, darum erhob ich mich auch, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das Gespräch nicht an einem Punkt enden lassen konnte, an dem ich dastand wie ein verdatterter Simpel.
»Ihren Philodendron finde ich wirklich sehr schön.« Ich verkniff mir die Bemerkung, dass er vorsichtig sein sollte, weil verschiedene Philodendronarten für Hunde und Katzen sehr giftig sein konnten. Ich weiß nicht, woher ich das weiß oder ob es überhaupt stimmt, und sowieso sieht man in einer Arztpraxis nicht oft Hunde und Katzen, es schien also keine nützliche Information zu sein.
Er lächelte. Es stand seinen schmalen Lippen nicht gut. »Vielen Dank. Ich finde ihn sehr beruhigend.«
Beide betrachteten wir einen Moment lang die Pflanze. Einer ihrer Wedel zitterte im leichten Luftstrom der Klimaanlage. »Ich auch.«
»Möchten Sie, dass ich von Ihnen ein Foto mit ihm mache?«
Ich hätte schon gewollt, aber sein Eifer nervte mich, und ich lehnte ab. Seine Enttäuschung verbarg er gut.
Und jetzt sitze ich draußen auf einer Bank am Haupteingang des Krankenhauses. Ich könnte direkt nach Hause gehen – es gibt niemanden, der auf mich wartet, niemanden, um dessen Gefühle ich mir Gedanken machen müsste. In meiner Einzimmerwohnung kann ich vor mich hin schmoren, so lange ich will, und später werde ich das wahrscheinlich auch tun. Gerade jetzt habe ich aber nicht die Kraft dazu, und außerdem habe ich das Gefühl, dass ich heute Nachmittag irgendwo sein sollte. Wenn mir nicht einfällt, wo, werde ich nach Hause gehen müssen und nachschauen, ob ich es in das Notizbuch geschrieben habe, das auf meinem Nachttisch liegt, aber im Moment erscheint es mir nicht besonders wichtig, und wenn, werde ich mich bald daran erinnern.
Den verschiedenen Leuten zuzusehen, die durch die zischenden Automatiktüren hinein- und hinausgehen, ist wohltuend. Sie alle haben ebenfalls Probleme, sonst wären sie nicht hier. Andere Probleme als ich, einige ernstere, einige weniger ernste, nichtsdestotrotz aber Probleme. Insbesondere ein Mann erregt meine Aufmerksamkeit. Aus irgendeinem Grund registriert der Sensor an der Tür nicht seine Anwesenheit. Er geht auf sie zu und prallt beinahe gegen die unnachgiebige Glasscheibe. Er tritt erstaunt zurück und wartet darauf, eingelassen zu werden. Als nichts geschieht, wedelt er mit den Armen über seinem Kopf herum, und als würde ihn das Krankenhaus über einen überfüllten Raum hinweg erkennen, öffnet es mit einem Schwung seine Türen, und der Mann wagt sich hindurch, wobei er zu fürchten scheint, dass sie sich jeden Augenblick wieder schließen könnten. Ich weiß, wie ihm zumute ist.
Na schön, was ist also zu tun? Ich bin anscheinend dabei, meinen Verstand zu verlieren. Aber nicht völlig. Ich werde noch meine Schuhe zubinden, Wasser kochen und lesen und sprechen können. Aber ich werde mich nicht mehr an mein Leben erinnern. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mein Leben ist ein ziemliches Kuddelmuddel gewesen. Einen Großteil habe ich damit zugebracht, einen Fehler wiedergutzumachen, den ich vor langer Zeit als junger Mann begangen habe. Es war ein dummer Fehler, und oft denke ich, dass ich mit dem Versuch, meine Schuld zu begleichen, noch mehr Mist gebaut habe. Ein andermal denke ich, ich habe das Bestmögliche getan. Wahrscheinlich werde ich nie genau wissen, was richtig ist. Aber was ist, wenn das alles verschwindet, wenn jede Erinnerung, die allein meine ist, mir für immer entgleitet? Wird mir die Last abgenommen, oder wird sie schwerer werden? Was ist denn eine Erinnerung überhaupt, wenn nicht ein Geisterbild von etwas, das schon lange verschwunden ist? Es gibt Geheimnisse, die ich bewahrt habe. Vielleicht sollten es Geheimnisse bleiben.
Nein, ich werde Alice erzählen müssen, was geschehen ist, mich rechtfertigen, klären, was unklar geblieben ist. Sie verdient es, die ganze Geschichte zu kennen. Es war ein Fehler, sie ihr all die Jahre vorzuenthalten. Aber ich werde ihr alles wahrheitsgetreu erzählen müssen, sonst wird die Sache noch viel schlimmer.
Das meiste der Geschichte kennt Alice bereits, aber in jeder Geschichte gibt es Einzelheiten, die in die eine oder andere Richtung geschoben werden können, und ich habe sie eindeutig zu meinen Gunsten verschoben. Andere Einzelheiten gibt es, die man völlig unter den Tisch fallen lassen kann, was ich ebenfalls getan habe, wenn es mir genehm war. Die einzige Möglichkeit ist, noch mal ganz von vorn zu beginnen und die Geschichte so zu erzählen, wie sie sich meiner Meinung nach zugetragen hat, und nicht so, wie ich sie haben will. Den Luxus Zeit habe ich nicht mehr. Mein Verstand wird bald zu einer Tür werden, die mir nicht mehr offensteht.
Ich habe ihr den Vater genommen. Das ist ihr schon lange klar. Ich könnte ihr alles über ihn erzählen. Die ganze Welt kennt mich als den Mann, der Harry Houdini getötet hat, den berühmtesten Menschen auf dem Planeten. Seine Geschichte ist kompliziert, wenn auch das meiste weitgehend bekannt ist. Was bis auf mich und eine andere Person, die wahrscheinlich schon lange tot ist, niemand weiß, ist, dass ich Harry Houdini nicht nur einmal, sondern zweimal getötet habe.
HOUDINI1897
JEDER SITZPLATZ IM OPERNHAUS in Garnett, Kansas, war besetzt. Nicht einmal mehr Stehplätze gab es. Die elektrischen Lichter summten und strahlten Hitze ab, und jedes Staubteilchen im Saal wirbelte umher, als wäre es am Leben. Von dort, wo er stand, in der Mitte der Bühne, konnte Houdini, mit dreiundzwanzig schon ein alter Theaterhase, die Menge atmen fühlen wie einen einzigen Organismus. Der Saal lag ihm zu Füßen.
Seine Frau Bess saß auf einem Stuhl zu seiner Rechten, durch ein Tuch verhüllt. Dies nur um der Wirkung willen – der Jenseitskontakt, den sie vorführten, erforderte keine solche Verschleierung, aber ein wenig Irreführung schadete nie. Diese Taschenspielertricks waren nichts als Effekthaschereien, und er verabscheute sie. Sie waren sinnlos, wenn damit keine Kunstfertigkeit einherging.
Drei Jahre zuvor, als seine junge Braut noch abergläubisch und unwissend war, hatte er begonnen, ihr die Tricks eines falschen Mediums beizubringen. Der Verlobte ihrer Schwester war, wie Bess glaubte, am bösen Blick gestorben. Zuerst hatte Houdini gedacht, sie mache einen Witz, aber als er merkte, wie fest sie daran glaubte, hatte er sich entschlossen, ihr zu zeigen, was für eine einfache Sache Betrug war.
Er wartete, bis Bess sich ausgeweint hatte, dann lächelte er sie an. »Du hast mir nie erzählt, wie dein Vater mit Vornamen heißt«, sagte er. Sie öffnete den Mund, aber er brachte sie zum Schweigen. »Schreib ihn auf einen Zettel und falte ihn zusammen.«
Während sie schrieb, entfernte er sich von ihr, allem Anschein nach in Gedanken versunken. Er verstand einfach nicht, wie Leute so etwas glauben konnten. Doch, er verstand es. Es hatte eine Zeit gegeben, da war sein Glaube genauso fest wie ihrer gewesen. Und vielleicht glaubte er immer noch ein bisschen daran.
Er hatte sich jahrelang ohne Erfolg in den billigen, marktschreierischen Shows der Varietés durchzubeißen versucht. Sein Bruder Dash war sein Partner gewesen, aber dann hatte Houdini Bess geheiratet, und für drei Leute war in der Show kein Platz. Die Nummer ernährte kaum zwei – ihre Bleibe war ein Beweis dafür, ein von Rauch, Ratten und Krach erfülltes Loch. In ein paar Tagen würden sie das Zimmer aufgeben und auf die Straße zurückkehren.
Er wandte sich ihr wieder zu. Sie versuchte gelassen zu erscheinen, aber er merkte, dass sie nervös war. Sie hielt ihm den zusammengefalteten Zettel hin.
»Verbrenne ihn im Ofen«, sagte er.
Sie tat wie geheißen, und er krempelte seinen linken Ärmel hoch.
»Sehr wenige Dinge in dieser Welt sind, was sie zu sein scheinen«, sagte er. »Aber das heißt nicht, dass es für sie keine Erklärung gibt. Wir sind umgeben von Dingen, die wir nicht begreifen. Das wird immer so sein. Der Verstand spielt uns Streiche, bildet Zusammenhänge, die nicht da sind. Wir müssen immer vor den Täuschungen unseres eigenen Verstandes auf der Hut bleiben. Wenn wir uns von unserem Verstand nicht täuschen lassen, können wir auch den Verrat von anderen aufdecken.«
Houdini ging zum Ofen und steckte seine Finger in die verbrannten Überreste des Zettels. Er zerrieb die Asche zwischen Daumen und Zeigefinger und strich sie sich rasch über den Unterarm. Dann streckte er ihr den Arm hin. Ihre Miene wechselte von Kummer zu Wut und dann unerwartet zu Furcht. Langsam wich sie mit ausgestreckten Händen vor ihm zurück, bis sie an der Tür war, dann rannte sie aus dem Zimmer. Auf der Haut seines Unterarms stand der Name Gebhardt.
Houdini senkte den Kopf und schloss die Augen. Bess neigte zwar zu dieser Art von Ausbrüchen, aber das hatte er nicht gewollt. Es passierte so oft; er dachte, er verhalte sich vernünftig und mitfühlend, aber nun hatte er alles nur schlimmer gemacht.
Er holte sie auf der Straße ein. Er hatte keine Ahnung, wohin sie wollte, aber als er sie endlich aufhielt, waren sie beide außer Atem.
»Der Teufel, du bist der Teufel – mein Mann wurde von ihm geholt!« Sie trat nach ihm und versuchte ihn zu beißen, als er sie in die Arme schloss.
»Ich bin’s, Bessie. Ich bin kein Teufel. Komm mit zurück, dann zeige ich dir, wie ich’s gemacht habe. Es ist nur ein Trick.«
Sie glaubte ihm nicht, dennoch ging sie mit ihm zurück. Ihre Augen huschten von links nach rechts auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Aber er merkte, dass ihr bewusst wurde, dass an Flucht nicht zu denken war, wenn er der Herr der Finsternis wäre. Wenn dich der Teufel zum Tanz bittet, dann tanze, so gut du kannst. Er spürte ihre Resignation und Angst.
Er legte seinen Arm um sie, und so gingen sie zurück, die Straße hinunter und die drei stinkenden Treppen nach oben, wobei sie im ersten Stock über einen Bewusstlosen steigen mussten. In ihrem Zimmer führte er sie zu dem Stuhl am Ofen.
»Schau her«, sagte er. Er krempelte seinen linken Ärmel hoch und zog ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit und einen Zahnstocher aus seiner Tasche. »Als du den Namen deines Vaters aufschriebst, den ich schon ein paar Tage, nachdem wir uns das erste Mal begegnet waren, erfahren hatte, habe ich Folgendes gemacht.«
Er öffnete das Fläschchen und schüttete die Flüssigkeit auf seinen Unterarm. »Salzwasser«, sagte er. Er blies kräftig darauf, und das Wasser verdunstete. Dann nahm er den Zahnstocher und kratzte eine Botschaft in seine Haut. »Man muss warten, bis die anfängliche Röte verschwindet«, sagte er. »Das dauert nur etwa eine Minute.«
Nun war auf seinem Arm nichts mehr zu sehen. »So hält es einer Überprüfung stand. Es ist wichtig zu wissen, wie stark man aufdrücken muss. Zu fest, und die Zeichen sind zu sehen. Zu sanft, und der Effekt tritt nicht ein.«
Er nahm ein wenig Asche aus dem Ofen und rieb sie über seinen Arm. »Man kann auch Klarlack, mit Terpentin verdünnt, nehmen und damit den Namen auf den Arm malen – dann bleibt die Asche nur auf dem Lack haften, aber ich finde die Wirkung nicht so stark.« Sie las, was er geschrieben hatte, und streckte ihre Hand aus.
Er legte das Salzwasserfläschchen und den Zahnstocher hinein. Sie tat, wie er sie unterwiesen hatte, wartete, bis das Wasser verdunstet war, dann kratzte sie sich mit dem Zahnstocher etwas in die Haut. Sie vermied es, ihn anzusehen. Ihm schien, es verging viel mehr Zeit als nötig, bevor sie ihre Hand in die Asche tauchte und damit über den Arm fuhr. Sie versteckte ihren Arm vor seinem Blick und sah ihn an. Auf seinem Arm stand:
Verzeih mir
Die Angst und der Zweifel wichen aus ihrem Gesicht. Ihre Schultern sanken herab, und ihr ganzer Körper schien zu erschlaffen. Sie trat auf ihn zu und streckte den Arm aus.
Das tue ich
Danach hatte sie ihren Hang zum Aberglauben verloren und war ein wertvoller Bestandteil seiner Show geworden. Mit ihrem kleinen Auftritt verließen sie die schäbigen Jahrmarktsbuden und erhielten größere Theaterengagements, aber noch immer lebten sie von der Hand in den Mund. Houdini war sich inzwischen sicher, dass er kurz vor dem Durchbruch stand. Er heuerte bei Dr. Hills California Concert Company an, hörte aber wenig später Gerüchte, dass die Truppe kurz vor der Pleite stünde. In Garnett, Kansas, bat Dr. Hill Houdini um eine Nummer, die das Haus füllen würde. Und so erklärte sich Bess zu einer weiteren Séance bereit, obwohl es bedenklich war.
Hinter dem Tuch erhob Bess ihre Stimme, hoch und wie entrückt.
»Ist hier heute Abend ein gewisser Harold Osbourne anwesend? Und auch seine Frau Mary?«
Es entstand ein Rascheln, als die Leute sich umschauten, um zu sehen, wer unter ihnen aufgerufen wurde.
Houdini trat vor. »Ist irgendjemand hier, der diese Botschaft entgegennehmen möchte?« Er tat, als spähe er durch Nebel nach einem Schiff aus.
Ein unauffällig gekleidetes Paar, ungefähr Ende zwanzig, erhob sich. Der Mann streckte seinen Arm aus, um seine Frau zu stützen, und Houdini konnte nicht sehen, ob sie ängstlich oder aufgeregt waren. »Ich bin Harold Osbourne, und das ist meine Frau«, sagte der Mann laut und deutlich.
Bess wartete, bis die Menge still geworden war. »Ich habe eine Botschaft von dem kleinen Joe.«
»Ist diese Botschaft für Sie?«, fragte Houdini und zeigte auf das Paar. Der Mann versuchte zu sprechen, aber entweder überlegte er es sich anders, oder er war nicht in der Lage dazu. Doch dann nickte er.
»Meine Damen und Herren«, sagte Houdini, »wenden Sie bitte Ihre volle Aufmerksamkeit der Bühne zu, denn die Geisterwelt hat eine Botschaft für unsere lieben Osbournes. Es ist äußerst wichtig, dass Sie jetzt den Geistern zu reden gestatten, und das sowohl um der Geister als auch um dieser guten Leute willen.«
Bess rührte sich nicht. Das Publikum flüsterte und rutschte auf den Sitzen herum. Die Spannung im Saal erinnerte Houdini daran, wie er und einer seiner Brüder einmal an den Enden eines Glücksknochens gezogen hatten, wissend, er würde brechen, aber nicht, wann. Bess blieb stumm, bis es im Theater vollkommen still war. »Der kleine Joe sagt, er ist an einem glücklichen Ort«, psalmodierte Bess. »Und er sagt: ›Weine nicht, Mama. Bald ist ein anderer da, der meinen Platz einnehmen wird.‹«
Diejenigen im Saal, die die Osbournes kannten, schnappten nach Luft, und die Frau ließ den Arm ihres Mannes los und sank nach hinten. Man tuschelte, dass das Paar vor kurzem seinen sechs Jahre alten Sohn, Joe, beerdigt habe und dass Mrs. Osbourne im zweiten Monat schwanger sei. Langsam wurden immer mehr Rufe laut wie: »Können Sie eine Botschaft von meinem Vater erhalten?« und: »Meine Frau, ist sie dort?«
Houdini ließ die Menge eine Weile gewähren, aber als die Stimmung kurz davor war, umzukippen, teilte er mit, dass das Medium erschöpft sei und sich für die Nacht zur Ruhe begeben werde. Er dankte den Zuschauern, entfernte dann mit großer Geste das Tuch und half der ermatteten Bess von ihrem Stuhl hoch. Sie blickte in den Zuschauerraum auf die Eltern des toten Jungen, das Gesicht ausdruckslos. Sie wehrte sich nicht dagegen, dass er sie von der Bühne führte, sie ging aber auch nicht von selbst. Ihr Körper reagierte steif auf die Berührung wie ein übermäßig gestärkter Kragen, bis sie von dem Paar nicht mehr gesehen werden konnte; dann fühlte er, wie sie sich entspannte. Der Vorhang fiel, und sie standen da und lauschten dem Beifall, der von verzweifelten Schreien durchsetzt war. Nach zehn Minuten gab es immer noch kein Anzeichen, dass jemand den Saal verließ. Dr. Hill, fett, weißbärtig und professoral, geleitete sie atemlos und grinsend den Gang entlang.
»Ab jetzt werden wir ständig ein volles Haus haben«, gluckste er mit wabbelndem Doppelkinn. Bess sah Houdini an, der diesen wütenden und unerbittlichen Blick kannte. Er fürchtete, sie könnte auf Dr. Hill losgehen, trat zwischen die beiden und legte seinen Arm um den Prinzipal.
»Das freut mich, Doktor. Wir haben unser Bestes gegeben.«
Am Ende des Ganges hörte Houdini ein Stimmengewirr, das sich zunächst nicht von der lärmenden Menge unterschied, aber nach und nach deutlicher wurde. Er drehte sich von Dr. Hill weg und sah den Vater des toten Jungen heranstürmen, gefolgt von ein paar Schließern, denen er grob gekommen war.
»Houdini!«, schrie der Mann. Dr. Hill befreite sich von Houdinis Arm und trat zur Seite. Mr. Osbourne war viel größer, als Houdini ihn in Erinnerung hatte. Seine massigen Hände hatte er zu Fäusten geballt. Er trat auf Houdini zu und schwang sie gegen seinen Kopf. Houdini duckte sich und glitt zur Seite. Er versetzte seinerseits dem Mann einen harten Schlag in den Magen. Mr. Osbourne sackte keuchend auf die Knie, als die Schließer und ein paar andere bei ihnen ankamen und sie umringten.
»Lasst ihn in Ruhe«, befahl Houdini. Er brauchte einen Augenblick, um sich auf das, was gleich passieren würde, vorzubereiten. Als der Mann wieder zu Atem kam, stand er auf und klopfte sich den Schmutz von den Kleidern. Sein Zorn hatte sich keineswegs gelegt, aber die Rauflust hatte er verloren.
»Warum haben Sie alle diese Dinge gesagt? Warum wollten Sie meine Frau alldem wieder aussetzen?«
»Hören Sie, Mr. Osbourne. Darf ich Sie Harry nennen?« Houdini lächelte.
Osbourne ballte die Fäuste. »Nein, das dürfen Sie nicht.«
Houdini trat einen Schritt vor und hielt ihm seine leeren Handflächen entgegen. »Das ist in Ordnung, Mr. Osbourne. Ich dachte halt, ich könnte Sie Harry nennen, weil ich auch so heiße. Aber es ist okay. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, wegen dem Namen und dem, was eben passiert ist.«
Osbourne schüttelte den Kopf. »Ich denke, Sie verstehen gar nichts.«
»Sie würden erstaunt sein. Viele Menschen, ich eingeschlossen, geraten außer Fassung, wenn Geister zu ihnen reden. Es ist eine verbreitete Reaktion.«
»Nein!«, schrie Osbourne. »Sie kapieren überhaupt nichts. Ich bin heute Abend hierhergekommen, weil meine Frau an diesen ganzen Blödsinn glaubt. Ich weiß, dass das alles Quatsch ist. Aber sie glaubt daran. Und jetzt denkt sie, dass unser Sohn Joe zu uns geredet hat.«
Aus den Augenwinkeln sah Houdini Bess. Sie wollte gerade anfangen zu reden. »Mr. Osbourne«, sagte er rasch, »was wäre, wenn ich Ihnen beweisen könnte, dass hinter den Worten meiner Frau keine üble Täuschung steckt?«
»Ich bezweifle sehr, dass Sie das können.« Osbourne wurde immer erregter. Dr. Hill und die Theaterbediensteten hatten sich zurückgezogen. Ein Haufen anderer Mitglieder der California Concert Company hatte sich am Ende des Ganges versammelt. So eine Begegnung war den Houdinis noch nie widerfahren.
»Setzen Sie sich hier neben mich«, sagte Houdini und zeigte auf eine Reihe Stühle, die vor einer Garderobe standen.
Widerstrebend nahm Osbourne Platz. Houdini setzte sich neben ihn. Bess blieb ein Stück entfernt stehen.
»Ich gebe bereitwillig zu, dass in dem, was wir tun, zum Teil Effekthascherei steckt«, sagte er. »Das Tuch zum Beispiel, das meine Frau oder mich verdeckt, je nachdem, wer mit der anderen Seite in Kontakt tritt, ist völlig unnötig. Aber die Leute zahlen für eine Show, und wir fühlen uns verpflichtet, sie ihnen zu bieten. Wollen Sie mir gestatten, für den Moment auf alle theatralische Mache zu verzichten?«
Osbournes Schultern waren starr und steif. »Ich wünschte, Sie würden auf beides verzichten, auf die theatralische Mache und auf die falschen Hoffnungen, die Sie den Leuten geben.«
Houdini lächelte, legte seine Hände auf die Knie und schloss die Augen. Er zählte bis zwanzig, dann atmete er aus, öffnete die Augen und blickte Osbourne fest an.
»Sie wurden in Tennessee geboren, kamen aber noch als Kind nach Kansas. Ihr Vater und Ihre Mutter starben vor zehn beziehungsweise zwölf Jahren. Sie hatten einen Zwillingsbruder namens Alphonse, der gestorben ist, als Sie sechs waren. Ihr Sohn Joe starb an einem Fieber, und Ihre Frau verließ danach für drei Monate nicht das Bett. Sie hat hinten an ihrem Bein eine Brandnarbe von einem Schürhaken. Sie haben einen älteren Bruder, mit dem Sie seit dem Tode Ihres Vaters nicht mehr gesprochen haben und dessen Frau im vergangenen Winter gestorben ist, und Ihre Mutter sagt, Sie sollten ihm die Uhr Ihres Vaters zurückgeben, da sie ihm als dem ältesten Sohn gehört.«
Osbourne sprang zitternd von seinem Stuhl auf. »Woher wissen Sie das alles?«
Auch Houdini stand auf und legte Osbourne eine Hand auf die Schulter. »Die Geister haben es mir erzählt. Woher sonst sollte ich es wissen?«
»Sie können wirklich mit ihnen reden?«
Der Unglaube wich aus Osbournes Gesicht. Er ließ sich auf den Stuhl sacken und legte den Kopf in die Hände. Keiner sagte etwas. Osbourne blickte zu Houdini auf, das Gesicht tränenüberströmt. »Mein Sohn. Ist er glücklich?«
Houdini zögerte einen Moment. »Sehr. Er vermisst Sie und seine Mutter, aber er ist glücklich und weiß, dass er Sie eines Tages wiedersehen wird.«
Osbourne begann wieder zu weinen, und Houdini setzte sich neben ihn und bot ihm sein Taschentuch an. Osbourne nahm es, und nach einer Weile gewann er die Fassung zurück. Er reichte Houdini die Hand. »Es tut mir leid wegen vorhin. Aber das verstehen Sie nicht. Als unser Sohn starb, war meine Frau … es war, als wäre auch sie gestorben. Und dann wurde langsam alles besser. Sie begann sich zu erholen. Wir werden wieder ein Baby bekommen. Ich wollte heute Abend nicht hierherkommen. Joe ist tot, und daran ist nichts zu ändern. Aber er ist nicht tot, nicht wirklich. Das sehe ich jetzt. Danke. Vielen Dank.«
Houdini sah, dass Bess sich umdrehte und hinausging.
Er eilte ihr hinterher und überließ es Dr. Hill, sich mit Osbourne auseinanderzusetzen. Sie zog sich in ihre gemeinsame Garderobe an der Rückseite des Gebäudes zurück. Nur wenige Nummern hatten ihren eigenen Raum – eine Verbesserung jüngster Zeit, über die Houdini sehr glücklich war. Er und Bess stritten sich sehr oft, und es störte ihn, wenn es vor den anderen geschah. Ein Zauberer sollte auf einen gewissen Zauber achten.
Er kam gleich nach Bess vor ihrer Garderobentür an, die ihm im selben Moment vor der Nase zugeknallt wurde. Das Schloss hörte er nicht hinter ihr zuschnappen – sie wusste, dass ein Schloss für ihn kein Hindernis war –, aber er kannte ihr Temperament gut genug. Das Beste würde es sein zu warten, bis sie sich etwas beruhigt hatte.
Noch traute Houdini sich nicht, das Theater zu verlassen – an allen Ausgängen würden Leute auf ihn warten, die auf eine Weissagung oder eine Gefälligkeit aus waren. Möglicherweise hatte der eine oder andere sogar vor, ihm eine Abreibung zu verpassen, wie es Harold Osbourne gern getan hätte.
Während er über die Hintertreppe zu dem Laufgang hinaufstieg, der über der Bühne entlangführte, fragte er sich, was genau er getan hatte. Wenn die Leute kamen, um einem Zauberkünstler zuzusehen, wussten sie, dass der Zauberer keine übernatürlichen Kräfte besaß und dass nichts, was sie sahen, real war. Gab er es als das aus, war es nichts weiter als Effekthascherei, und genau dafür hatten sie bezahlt. Böte er ihnen etwas Geringeres, würde er sie betrügen.
Er wählte sich auf dem Laufgang eine Querstange mit Blick auf die Bühne. Inzwischen war das Theater leer bis auf ein paar Schließer, die ausfegten. In wenigen Augenblicken würden die Bühne und die Rückseite des Hauses abgebaut und zum Bahnhof transportiert werden, von wo sie am Morgen Kansas verließen und zu einem Engagement in Cedar Rapids weiterreisten.
Der Auftritt an diesem Abend war wenig mehr als der Ertrag von ein paar cleveren Recherchen und Bestechungen. In ganz Nordamerika konnten reisende Spiritisten von anderen Mitgliedern ihres Gewerbes für ein paar Dollar Materialien erwerben, stenografierte Protokolle über lokale Individuen, die sorgfältig geführt und über ein Netzwerk von Scharlatanen weitergereicht wurden. Es war unglaublich, was in einer Schenke aufgeschnappt werden konnte, was jemand für einen Drink freiwillig preisgab und was die Leute ausplauderten, ohne es zu bemerken. Ein Gang auf den örtlichen Friedhof, ein paar Münzen in die Hand der richtigen Person – und wie durch Zauberei lagen die Geheimnisse der meisten Menschen offen da.
Im Falle Harold Osbournes zeigte ein flüchtiger Blick auf die Familiengrabstelle das frische Grab des kleinen Joe, und ein mitgehörtes Gespräch zwischen dem Arzt des Ortes und Osbournes nach wie vor gekränktem Bruder ergab den Rest. Es war nicht einmal das beste Material, das Houdini zur Verfügung stand, aber es waren die besten Informationen über die Leute, die an diesem Abend gekommen waren. Sein örtlicher Kontaktmann hatte ihn natürlich vor der Vorstellung darüber informiert, dass Osbourne da war. Als er Osbourne den Boxhieb versetzt hatte, der ihn zu Boden streckte, hatte er einen Zettel mit den entsprechenden Details aus seiner Jackentasche gezogen, sie sich eingeprägt und ihn dann verschwinden lassen. Sollte Osbourne sich zu dem Glauben entschließen, dass er übernatürliche Kräfte besäße, nun ja, dann war das nicht sein Problem.
Aber er hatte das Gefühl, ein Gefühl, das ihn öfter beschlich, dass seine Mutter damit nicht einverstanden wäre. Sie hätte diese Dinge vielleicht als unlauter angesehen. Und gewöhnlich hatte sie recht. Ihre Missbilligung schmerzte, ganz gleich, wie unausgesprochen oder eingebildet sie war.
Trotzdem hatte er keine Wahl. Sie brauchten diesen Job. Das Engagement bei Dr. Hill stellte die erste echte Chance seit Jahren dar. Von der Hand in den Mund – so war es immer gewesen, aber diese Show hier konnte zu Größerem führen. Er hatte Versprechen einzuhalten, Versprechen, denen die Armut eines Zauberkünstlers nicht gewachsen war.
Unter ihm begannen die Arbeiter die Bühne abzubauen. Er wog den Hut in seiner Hand und drehte ihn unablässig im Kreis herum, eine Gewohnheit, die er angenommen und beibehalten hatte, um seine Finger beweglich zu halten. Die meisten Zauberer, die er kannte, hielten ihre Hände fast ständig in Bewegung.
Geld hatte er nie besessen. Keiner in der Familie war vermögend. Sein Vater hatte sein ganzes Leben lang gearbeitet, war ehrlich gewesen, hatte jedermann anständig behandelt und war trotzdem arm gestorben. Rabbi Mayer Weiss kam auf der Suche nach einem besseren Leben aus Ungarn nach Amerika, war aber die meiste Zeit seiner späteren Jahre zu niedrigen Arbeiten gezwungen gewesen. Dennoch gab er den Glauben nicht auf, dass Glück und Reichtum zum Greifen nahe waren.
Als Houdini neunzehn war, hatte man ihn ans Sterbebett seines Vaters gerufen. Sein Vater sah ihn an, ohne ihn zu erkennen, sein Körper war mit seinen dreiundsechzig Jahren ausgebrannt. »Wer ist da?«, rief er.
»Ich bin’s, Ehrich.« Houdini rückte näher, damit sein Vater ihn sehen konnte.
»Mein Junge«, sagte er. »Gut, gut.« Er streckte seine Hand aus, und Houdini ergriff sie. Sie fühlte sich wie Papier an.
Seine Mutter trat hinter ihn. »Siehst du? Er ist da. Ich hab dir ja gesagt, dass er sofort nach Hause kommen würde.«
»Ich bin so schnell wie möglich gekommen«, sagte Houdini. Er hatte in einem Beiprogramm im Süden Manhattans gearbeitet und sich als Aufreißer betätigt. Da kam ein Junge zu ihm und sagte ihm, sein Vater liege im Sterben. »Geh nach Hause, Zauberer«, sagte der Junge. Er hatte sich das Geld für die Droschke nach Uptown leihen müssen und immer drei Stufen zugleich genommen, als er die fünf Treppen hinaufrannte. Vor der Tür blieb er stehen und konnte sich kaum überwinden hineinzugehen.
Drinnen warteten seine Brüder und seine Schwester. Er würde die Sache hinkriegen, und wenn nicht, dann war sie nicht hinzukriegen. Er lächelte sie an und ging in das Schlafzimmer ihrer Eltern, als wäre alles in Ordnung.
Sieben Jahre zuvor war sein älterer Halbbruder Herman an Schwindsucht gestorben. Seinem Bruder Nathan hätte die Rolle des ältesten Sohnes zufallen sollen, aber er war redescheu und schwach, und zu Nathans Erleichterung übernahm Houdini diese Rolle.
Die Augen seines Vaters waren glasig und ließen nichts von der scharfen Intelligenz erkennen, die einst in ihnen gewohnt hatte. Er starrte in einen leeren Raum zwischen Houdini und dessen Mutter.
»Ehrie«, sagte er so leise, dass Houdini ihn kaum hörte, »du musst versprechen, dass du dich um deine Mutter kümmerst.«
Houdini beugte sich vor und brachte seinen Mund dicht ans Ohr seines Vaters. »Das tue ich natürlich. Du hast mein Wort.«
Sein Vater lächelte und gab ihm ein Zeichen, ihm das Glas Wasser zu reichen, das neben seinem Bett stand. Houdini hielt ihm das Glas an die gesprungenen, fast weißen Lippen, und sein Vater trank. Seine Mutter konnte ein Schluchzen nicht unterdrücken.
Als sein Vater weiterredete, war seine Stimme kräftiger. »Hast du das gehört, Cecilia? Es wird alles gut. Ehrie wird dir die Schürze mit Gold füllen.«
Seine Mutter schüttelte den Kopf. »Das ist doch egal. Auch alles Gold der Welt kann uns nicht helfen.«
Aber sein Vater hörte nicht auf zu lächeln. Drei Stunden später starb er.
Alles, woran Houdini jetzt denken konnte, war sein Versprechen, das er immer noch nicht erfüllt hatte. Er hatte alles versucht. Er hatte Kartentricks, Zauberkunststückchen und größere Bühnenillusionen vorgeführt. Er war der wilde Mann in einem Tingeltangel gewesen, hatte Entfesselungstricks mit Handschellen gezeigt. Nichts hatte zu etwas geführt. Dr. Hills California Concert Company war fast eine richtige Wanderbühne. Sie hätte der Durchbruch für ihn sein können. Vielleicht war sie es noch.
Er blickte in das Theater unter sich. Ein Theater ohne Menschen hatte er immer als etwas Seltsames empfunden. Mit seinen leeren Sitzen, den erloschenen Lampen und der reglosen Luft erinnerte es ihn an einen Leichnam.
Sie waren für fünfzehn Wochen bei Dr. Hill engagiert und hatten erst die Hälfte der Zeit hinter sich. Zwei Monate zuvor hatten sie den Job beinahe verloren. Sie sollten in Omaha zur California Concert Company stoßen und mussten mitten in der Nacht auf einem Bahnhof umsteigen. Aber ihr Zug hatte Verspätung, ihr Anschluss war ein Expresszug, und es gab keine Zeit, sämtliche Koffer Houdinis umzuladen. Für ihn aber war die Weiterreise unter diesen Umständen undenkbar. Ein Zauberer ohne seine Tricks ist nichts.
»Ich muss darauf bestehen«, sagte er zu dem Gepäckträger. »Mein Gepäck muss eingeladen werden.«
Der schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, Sir. Der Zug fährt gleich ab.«
»Nein«, sagte Houdini, »das tut er nicht.«
Er ging zum vorderen Ende des Zuges, sprang auf die Gleise und umklammerte mit beiden Händen eine der Schienen.
Der Gepäckträger schnappte nach Luft und eilte davon. Kurz darauf kam er mit einem anderen Eisenbahner zurück, einem massigen Kerl, der ein ganzes Stück größer und mindestens dreißig Kilo schwerer als Houdini war. »Gehen Sie vom Gleis, Sir, oder ich hole Sie persönlich da runter.«
»Ich gehe erst runter, wenn mein Gepäck eingeladen ist«, sagte er, »und nein, Sie kriegen mich hier nicht weg.« Bess verschränkte die Arme und marschierte davon; Houdini nahm an, um in den Zug einzusteigen.
Der Eisenbahner drängte heran und ergriff Houdini am Arm. Er war stark, aber Houdini rührte sich nicht vom Fleck. Der Eisenbahner machte einen Schritt zurück, packte Houdini hinten an seinem Mantel und zog, trotzdem wich Houdini nicht von der Stelle. Der Mann zog sein Jackett aus und versuchte es wieder, indem er Houdinis Arme und Beine an verschiedenen Stellen umklammerte – ohne Erfolg. Der Gepäckträger versuchte es ebenfalls, zuerst auf eigene Faust, dann mit dem Eisenbahner gemeinsam. Houdini hatte eine der Schienen mit beiden Händen umfasst und die Füße gegen die andere Schiene gestemmt. Es sah aus, als mache er einen Liegestütz. Er bewegte sich jedes Mal ein wenig, wenn einer oder beide ihn wegzuziehen versuchten, ansonsten aber blieb er, wo er war. Es war ein alter Tingeltangeltrick. Sie konnten ein Dutzend Männer herbeischaffen, dennoch würden sie ihn nicht vom Gleis herunterholen. Er musste nichts weiter tun, als den Drehpunkt seines Körpers entgegen ihren Anstrengungen zu bewegen, das verhundertfachte seine Kräfte.
Schließlich kam der Schaffner heraus, um zu sehen, worum es bei der Auseinandersetzung ging. »Warum liegen Sie auf den Gleisen?«
»Ich habe eine Fahrkarte für diesen Zug, aber Ihre Leute wollen meine Koffer nicht einladen«, sagte Houdini und verlagerte sein Gewicht, um den erneuten Anstrengungen des Eisenbahners entgegenzuarbeiten.
Der Schaffner sah einen Moment lang zu, wie der Eisenbahner mit rotem Gesicht und schwitzend sich an Houdini zu schaffen machte, dann wandte er sich an den Gepäckträger und schüttelte den Kopf. »Laden Sie in Gottes Namen die verdammten Taschen des Mannes ein, damit wir endlich wegkommen.«
Während der übrigen Reise redete Bess mit ihm kein Wort, aber sie kamen zu ihrem ersten Auftritt rechtzeitig an, und am Ende des Abends war es, wie wenn nichts geschehen wäre. So war das mit ihr. Tat er etwas Gewagtes, Unüberlegtes oder möglicherweise sogar Dummes, reagierte sie darauf, indem sie ihn strafte, als hätte er versagt. Im Grunde hatte er immer zwei Kämpfe zu bestehen – einen mit seiner Aufgabe, dem Zauberkunststück oder Problem und einen hinterher mit ihr. Es ermüdete ihn.
So war es nicht immer gewesen. Als sie sich kennenlernten, war sie begeistert auf seine Vorlieben eingegangen. Unter anderem deswegen liebte er sie. Diese winzige, schöne Frau, die aussah, als könne ein leichter Wind sie zerbrechen, war in Wirklichkeit stärker als jeder zwischen Eisenbahngleise gekeilte Mann. Als sein Bruder Dash erstmals ein doppeltes Blinddate mit zwei Mädchen von den Floral Sisters, einer Gesangs- und Tanztruppe, vorschlug, hatte er sich gesträubt.
Oft erzählte er den Leuten, mit Bess sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, aber das stimmte nicht. Er hatte sie schon ein paarmal gesehen, ehe er wirklich Notiz von ihr nahm. Aber an dem Abend der Verabredung, als er mit Dash, dessen Begleiterin und Bess an einem Tisch saß, gab es einen Moment, da er sie ansah und erkannte, dass sie sein genaues Spiegelbild war. Nicht das Gegenteil, sondern die perfekte Ergänzung; ihre Stärken entsprachen allen seinen Schwächen, und er wusste, umgekehrt war es genauso. Und dann – es war damals unglaublich und ist es heute noch – sah Bess ihn an, und er erkannte, dass sie dasselbe empfand wie er. Es kam einem Moment wirklichen Zaubers so nahe, wie er ihn nie wieder erleben würde.
»Gefällt dir unsere Nummer?«, hatte Dash gefragt.
»Ja«, antwortete Bess, »sehr. Ich denke, ihr seid zu Großem ausersehen.« Sie sah Houdini an, als sie das sagte, und ihre Freundin kicherte.
Eine Woche darauf waren sie verheiratet.
Manchmal hatte er Dash gegenüber ein schlechtes Gewissen. Nicht, weil er Bess seinem Bruder vorgezogen hatte, da blieb ihm kaum eine andere Wahl. Es war die Art, wie er sich von Dash getrennt hatte, was ihm Kummer machte – er musste zugeben, dass er die Geduld verloren hatte.
Ihr Erkennungstrick damals war die Metamorphose gewesen. Es war ein gewöhnlicher Platztausch-Trick, bei dem Zuschauer aufgefordert wurden, einen großen Sack aus Samt zu inspizieren, in den Houdini dann hineinstieg. Dash band ihn zu, sicherte das obere Ende mit einem Schloss, und Houdini wurde in einen Koffer gelegt. Der Koffer befand sich im Inneren eines großen Schrankes, der an drei Seiten geschlossen und dessen vierte Seite zu den Zuschauern hin offen war. Sobald der Koffer fest verschlossen war, wandte sich Dash an das Publikum, zog einen Vorhang vor die offene Seite des Schrankes und stieg hinein, und im nächsten Moment öffnete sich der Vorhang wieder, und Houdini erschien an Dashs Stelle. Dann wurde der Koffer aufgeschlossen und der Samtsack geöffnet, um zu zeigen, dass Dash darin steckte.
Es war ein guter Trick, und oft führten sie Variationen davon vor, wobei manchmal Dash als Erster in den Sack kletterte. Als sie eines Abends vor einer großen Menschenmenge auftraten, zeigten sie die Version, bei der Dash als Erster hineinstieg. Aber Dash brachte es irgendwie fertig, sich in dem Koffer zu verheddern, und als Houdini in den Schrank trat, war er allein.
Er konnte es einfach nicht glauben. Es war ein so einfacher Platztausch. Man ist bereits aus dem Sack, ehe der Koffer verschlossen wird, und aus der vorgetäuschten Rückwand des Koffers, bevor der Vorhang auch nur zugezogen ist. Sobald der Vorhang geschlossen ist, duckt sich der Vordermann hinter den Koffer und schlängelt sich in den Sack in dessen Innerem, während vorn die Enthüllung stattfindet. Aber Dash war nicht da.
Bis zum Tage seines Todes würde Houdini die Buhrufe des Publikums hören. Selbst als er Dash befreit hatte und schließlich den Tausch vollzog, war klar, dass irgendwas schiefgelaufen war. Die Menge in einer Jahrmarktsbude liebte es, wenn ein Zauberer den Trick vermasselte. Manchmal dachte er, dass die Leute nur deswegen herkamen. Um den Zauberer scheitern zu sehen, den Wonneschauder zu durchleben, wenn jemand genauso gründlich in der Falle saß wie sie selber.
Hinterher war er so wütend, dass er Dash kaum ansehen konnte.
»Es tut mir leid«, sagte Dash. »Die Vorrichtung hat geklemmt.«
»Na schön, ist in Ordnung, Dash. Wir erklären das einfach allen Leuten. Wenn sie hören, dass das Problem darin besteht, dass du unfähig bist, werden sie es verstehen.« Er sah Dash an, der drauf und dran war, entweder eine Schlägerei zu beginnen oder zu weinen, dann stieß er ihn zur Seite und stampfte nach draußen. Sie wurden gefeuert, aber er hatte sowieso schon beschlossen, Dash durch Bess zu ersetzen. Sie war eine Frau, kleiner und gewandter, was alles die Show besser machte, und außerdem war sie seine Frau. Er war dumm gewesen, mit dem Wechsel so lange zu warten.
Die Bühne war inzwischen vollkommen abgebaut. Am besten ginge er jetzt zu Bess zurück. Er hoffte, es war genug Zeit vergangen. Wie lange ihr Zorn andauerte, konnte er nie voraussagen. Er stieg die Treppe hinunter und machte sich zu ihrer Garderobe auf den Weg. Unterwegs begegnete er mehreren anderen Artisten, aber keiner sah ihm in die Augen. Alle wussten sie, was sich zwischen ihm und Harold Osbourne zugetragen hatte. Keiner wollte damit etwas zu tun haben. So liefen die Dinge. Sie waren eine Truppe, aber im Grunde war jeder für sich. Dr. Hills California Concert Company würde es nicht ewig und wahrscheinlich auch nicht mehr lange geben. Freundschaften waren ebenso eine Illusion wie der ganze Bühnenzauber.
Als er vor ihrer Garderobe ankam, zögerte Houdini. Er und Bess hatten eine Methode, mit diesen Dingen umzugehen, die er nicht ausstehen konnte, aber notwendig fand. Er öffnete die Tür ein wenig und warf seinen Hut hinein. Dann machte er die Tür weit auf, trat aber zur Seite.
Fast im selben Moment hörte er Füße trappeln, Stoff rascheln, und dann flog sein Hut hinaus auf den Gang. Er schloss die Tür und bückte sich, um ihn aufzuheben. Na schön. Wenn sie in dieser Stimmung war, gab es selbst in diesem nichtssagenden Städtchen Besseres zu tun, als dazusitzen und seiner Frau zuzuhören, wie sie ihm all die Spielarten seines Versagens vorhielt.
Er sah auf seine Uhr. Es war kurz nach Mitternacht. Ein Spaziergang würde ihm guttun. Sein Mantel hing noch in der Garderobe, aber es war nicht kalt draußen, und wenn er seine Hutkrempe herunterzog, würde er von den wenigen Menschen, die zu dieser Stunde noch unterwegs wären, nicht erkannt werden.
Die Hintertür des Theaters ging auf ein leeres Grundstück hinaus. Er konnte seinen Atem sehen und lief forsch durch das Gelände und die Straße hinunter aus dem Ort hinaus, den Kopf gesenkt und die Hände in den Taschen.
Er hatte aus einem bestimmten Grund von den Entfesselungstricks Abstand genommen. Er bezweifelte, dass es irgendjemanden gab, der darin so gut war wie er, aber Entfesselungen waren schwierig und gefährlich. Sie beunruhigten Bess dermaßen, dass sie nicht schlafen konnte, und er hatte überlegt, dass es klug wäre, ihr nachzugeben. Außerdem konnten Entfesselungen schnell schiefgehen. Dann war das Risiko viel höher als bei Tricks wie zum Beispiel der Metamorphose.
Das letzte Mal, dass er einen Handschellentrick vorgeführt hatte, war vor sechs Wochen in Halifax gewesen. Zur Werbung für die Show am Abend war er vor Zuschauern mit Handschellen gefesselt und auf ein Pferd gebunden worden. Geplant war, das Pferd außer Sichtweite trotten zu lassen, wo Houdini sich befreien würde und dann im Triumpf zurückgeritten käme. Aber das Pferd hatte andere Vorstellungen. Sobald es losgelassen wurde, raste es in vollem Galopp in Richtung der Außenbezirke der Stadt. Houdini gelang es zwar, sich von den Stricken zu befreien, aber er konnte sich nicht gleichzeitig auf dem Pferd festhalten und die Handschellen knacken, und so blieb ihm nichts übrig, als abzuwarten, bis das Pferd sich von allein beruhigte. Erst nach einer vollen halben Stunde kam er zurück, da waren die meisten Zuschauer bis auf die Zeitungsleute bereits gegangen. Wegen der langen Zeit, die er weg gewesen war, wurde allgemein angenommen, ein anderer habe ihn befreit. Er wollte den Journalisten gerade erläutern, was wirklich passiert war, als ihm klar wurde, dass die Wahrheit noch schlimmer wäre als ihr falscher Verdacht: Er war von einem Pferd ausgetrickst worden. Da war es besser, wenn sie ihn für unfähig hielten. Sein Auftritt an dem Abend war einer seiner besten gewesen, aber das zählte nicht. Das Gefühl der Hilflosigkeit, das ihn überfiel, als er dem Pferd ausgeliefert war, war das Schlimmste, was er jemals erlebt hatte, wie eine Schlinge, die sich um seinen Hals zusammenzog.
Auf der Straße ging ein Mann an ihm vorüber, und er fürchtete, er könnte erkannt werden, aber falls es so war, zeigte der Mann es nicht. Houdini bog ab und ging in Richtung Süden weiter auf einen kleinen See zu, wo er hoffte, niemandem mehr zu begegnen.
Schon als Junge hatte er ein Geschick mit Türschlössern bewiesen, eine Begabung, die er entdeckt hatte, als seine Mutter einen Kuchen vor ihm und seinen Geschwistern in Sicherheit brachte und in einen Schrank einschloss. Er war so geschickt, dass er mit elf Jahren bei einem Schlosser namens Hanauer in Appleton, Wisconsin, in die Lehre geschickt wurde. Anfangs ließ ihn Hanauer an nichts als das simpelste Schloss heran, und dann auch nur, damit er es säuberte. Er schien nur jemanden zu brauchen, der ausfegte und auf den Laden aufpasste, wenn er weg war. Eines Tages kam der Sheriff, ein permanent kurzatmiges Babyface namens Shenk, mit dem längsten Mann, den Houdini je gesehen hatte, in die Werkstatt. Der Riese war fast zwei Meter zwanzig groß und muss mindestens hundertdreißig Kilo gewogen haben, das meiste davon Muskeln. Er war nicht rasiert, seine Haare waren zerzaust, und seine Hände steckten vor seinem Bauch in Handschellen.
»’n Tag, Sheriff. Was kann ich für Sie tun?«, fragte Hanauer, den der Mann, den Shenk im Schlepptau hatte, sichtlich nervös machte.
Shenk lehnte sich an die Wand und kratzte an seinem Daumennagel. »Sie müssen mir helfen, dem Kerl da die Handschellen abzunehmen. Der Richter sagt, er ist unschuldig, obwohl wir beide wissen, dass das nicht der Fall ist, stimmt’s, Goliath?«
Der Riese, den Blick zu Boden gerichtet, sagte nichts.
»Haben Sie wieder den Schlüssel verloren?« Hanauer trat an die Schublade, in der er die Generalschlüssel aufbewahrte.
Shenk schüttelte den Kopf. »Schlimmer. Der Schüssel ist im Schloss abgebrochen.«
Hanauer schloss die Schublade und sah sich die Handschellen genauer an. »Sie brauchen keinen Schlosser, Sheriff. Sie brauchen eine Metallsäge. Ehrich, du holst die Säge und befreist diesen Mann, während der Sheriff und ich uns ein Bier genehmigen.« Er wandte sich an Shenk. »Dafür sollte er ungefähr eine Stunde brauchen.«
Houdini trat einen Schritt zurück und prallte gegen die Werkbank. »Sie wollen mich mit ihm allein lassen?«
Shenk zuckte die Schultern. »Sicher, warum denn nicht? Offenbar hat er sich nichts zuschulden kommen lassen.«
Hanauer ließ ein leises Kichern hören und ging mit Shenk hinaus.
Houdini holte die Metallsäge aus dem hinteren Raum. Der Riese stand da, ohne sich zu rühren. Seitdem er in die Werkstatt gekommen war, hatte er sich überhaupt nicht bewegt, war nur zur Seite getreten, um Shenk und Hanauer den Weg nach draußen freizugeben.
An der Werkbank an der gegenüberliegenden Wand war ein kleiner Schraubstock befestigt, und Houdini gab dem Riesen mit einem Zeichen zu verstehen, er solle dort hinübergehen, aber der Mann reagierte nicht.
»Wir müssen die Handschellen in den Schraubstock spannen, damit ich sie durchsägen kann.«
Der Riese blickte auf ihn herunter, und Houdini bemerkte, dass er Angst hatte. »Du wirst mich verletzen.«
»Bestimmt nicht. Zumindest nicht mit Absicht. Ich werde vorsichtig sein.«
»Nein.«
Houdini legte die Säge weg. »Was soll ich denn Ihrer Meinung nach tun?«
Der Mann starrte ihn an. »Weiß nich.«
Houdini war ratlos. Wenn Hanauer zurückkam, und der Mann steckte noch immer in den Handschellen, gäbe es Ärger. Aber Houdini war kaum imstande, den Riesenkerl zu etwas zu überreden, was der nicht wollte. »Darf ich mal sehen?«
Der Riese streckte ihm die Hände entgegen. Houdini machte einen Schritt vorwärts, dann blieb er stehen. »Was sollen Sie angeblich getan haben?«
Der Riese blickte zu Boden. »Geklaut.«
»Und haben Sie?«
Der Riese sah Houdini an und lächelte. »Jo.«
Houdini erwiderte das Lächeln, vor allem, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte, aber er trat keinen Schritt näher.
»Ich tu dir nix«, sagte der Riese. »Ich will bloß diese Handschellen loswerden, damit ich weit weg komm von dieser Stadt.«
Das konnte Houdini verstehen. Er war schon zweimal weggelaufen und zweimal wieder nach Appleton zurückgekehrt, nicht weil er es wollte, sondern weil es ihm nicht gelungen war, etwas aus sich zu machen. Er trat näher und begutachtete die Handschellen.
Es handelte sich um ein ziemlich neues Paar eines Typs, der, wie er später erfahren sollte, Berliner Achter-Handschellen hieß und wie eine auf die Seite gelegte Acht aussah, die quer durchgeschnitten war. Auf der einen Seite der halbierten Acht befand sich ein Scharnier und auf der anderen Seite der Schließmechanismus. Jeder Kreis der Acht umfasste eines der Handgelenke des Riesen.
Der Schlüssel war wirklich im Schloss abgebrochen. Wenn er Glück hatte, konnte er ihn herausholen und den Generalschlüssel benutzen. Er nahm eine Spitzzange und versuchte, damit das Schlüsselstück zu greifen. Es gelang ihm, es in dem Schlüsselloch so weit herumzuschieben, dass der Zylinderkern teilweise frei lag, aber alle seine Versuche, es herauszuziehen, missglückten. Er würde das Schloss knacken müssen, aber er war sich nicht sicher, ob er das konnte. Die Handschellen selbst waren ziemlich simpel – ein gewöhnliches Zylinderschloss, wahrscheinlich mit drei Stiften. Wenn er etwas an dem abgebrochenen Schlüssel vorbeibugsieren und in den Zylinderkern schieben konnte, hätte er eine Chance.
Ein paar Handschellen hatte er zwar nie zuvor geöffnet oder auch nur aus der Nähe gesehen, aber von Schlössern dieser Art hatte er genügend viele auseinandergenommen, um zu wissen, wie sie funktionierten. Eine Reihe von Stiften, in diesem Fall drei, hinderte einen runden Zylinderkern daran, sich im Inneren eines größeren Zylinders zu bewegen. Es war, als machte er eine Faust mit einem Loch, das groß genug war, um seinen Daumen hindurchzustecken, und bohrte dann Zahnstocher zwischen den Fingern seiner Faust hindurch in den Daumen.
Damit sich der Zylinderkern drehen kann und das Schloss sich öffnet, werden aus jedem Stift an einem bestimmten Punkt zwei Teile. Wenn ein Schlüssel in das Schlüsselloch gesteckt wird, schiebt sich jeder Stift ein festgelegtes Stück nach oben, so dass genau zwischen dem Zylinderkern und dem Zylinder der Zwischenraum entsteht, der es dem Zylinderkern erlaubt, sich zu drehen und den Schließmechanismus zu entriegeln. Wenn der Zylinderkern ein wenig unter Spannung gesetzt wird wie durch einen sich drehenden Schlüssel, entsteht ein winziger Absatz, auf dem der sich nach oben schiebende Stift ruhen kann, so dass er nicht in den Zylinderkern zurückfällt. Von hier ab ist es eine relativ simple Aufgabe, jeden Stift so weit nach oben zu schieben, bis der Punkt gefunden ist, an dem er sich teilt. Drückt man alle drei Stifte nach oben, öffnet sich das Schloss. Das war die Theorie, aber Houdini wusste, was in der Theorie einfach ist, ist es nicht unbedingt in der Praxis.
Der abgebrochene Schlüssel machte die Benutzung eines konventionellen Dietrichs nahezu unmöglich, da er den freien Zugang zu dem Zylinderkern behinderte. Er holte sich ein Stück starren Draht, das er zuvor auf der hinteren Werkbank hatte liegen sehen, und hoffte, dass er es zu seinem Zweck zurechtbiegen konnte. Er brauchte eine gewisse Spannung an dem Schloss, aber der abgebrochene Schlüssel erzeugte nirgendwo eine Drehspannung in dem Zylinderkern.
Er sah den Riesen an. »Wie heißen Sie?«
»Jim Deakins.«
»Ich heiße Ehrich Weiss.«
Deakins streckte seine Arme aus, und Houdini wusste einen Moment lang nicht, was er tun sollte. Dann wurde ihm klar, dass Deakins meinte, sie sollten sich die Hand geben. Er hielt dem Riesen seine Rechte hin und war erstaunt, wie sanft sein Griff war. Er hatte eine Idee.
»Ich möchte, dass Sie Ihre Hände auseinanderziehen. Nicht sehr stark. Ich brauche nur ein bisschen Zugkraft an dem Schloss.« Er zog seine Hand zurück. Sie war warm.
Deakins beugte seine Arme und zerrte seine Hände auseinander.
»Nur leicht. Nicht so stark. Weniger.« Wenn der Zug zu heftig war, konnten sich die Stifte nicht frei in ihren Schäften bewegen.
»Entschuldigung.« Deakins entspannte sich etwas.
Houdini führte die Spitze des Drahtes an dem abgebrochenen Schlüssel vorbei in den Zylinderkern ein. Er schloss die Augen. Es half, glaubte er, wenn er sich das Innere des Schlosses bildlich vorstellte. Was er sehen konnte, war ihm sowieso nicht von Nutzen – alles Wichtige war ihm verborgen.
Er fühlte den ersten Stift. Mit einer leichten Drehung bewegte er den Draht unter den Stift und schob ihn nach oben. Zunächst spürte er kein Zeichen einer Veränderung. Er hob den Stift einen Millimeter an, dann noch einen und hörte ein leises Klicken.
»Haben Sie das gehört?«, fragte er Deakins.
»Ich hab nix gehört.«
»Halten Sie einfach Ihre Arme so wie jetzt.« Wenn Deakins locker ließ, würde der Stift wieder nach unten rutschen, und er müsste von vorn beginnen.